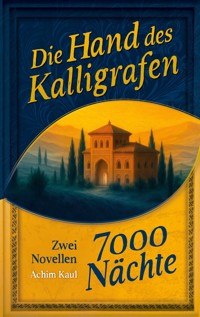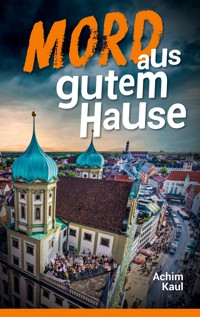3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Capri, Florenz, Paris — Ludwig Vonwegen (66) kann mangels Knete vom Reisen nur träumen. Durch eine Verwechslung ergattert er einen Job als Housesitter auf Capri. Was als Glücksfall beginnt, entwickelt sich zu einer schrägen Odyssee durch halb Europa: Von der Polizei verfolgt, in illegale Aktionen verwickelt, als Terrorist verdächtigt — Schlamassel zieht Ludwig magisch an. Renee, eine junge Amerikanerin auf Europatour »überwegs«, hält zu ihm. Paul, ein studierter Taschendieb, bietet den beiden seine klapprige Ente zur Flucht aus Florenz an. In Paris erleben die drei Ungeahntes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Achim Kaul
Überwegs
Vonwegens Begegnungen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1.Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Epilog
Impressum neobooks
Prolog
Überwegs
Vonwegens Begegnungen
Drei Freunde hatte ich in meinem Leben. Zwei von ihnen unternahmen eine Tour auf den Kilimandscharo. Sie wollten nach dem Leopardengerippe suchen, das dort nach einer von Hemingways Legenden im ewigen Eis ruht. Bei dieser Gelegenheit erforschten sie erfolgreich den Weg in die ewigen Jagdgründe. Der dritte und älteste Freund sagte bei unserem letzten Gespräch, das wir in der Nacht zum ersten August führten, Folgendes zu mir:
»Du kannst von mir aus alles schreiben, was du willst — meinen Namen lässt du raus aus der Geschichte! Du erwähnst ihn nicht! Schwöre es! Schwöre beim Heiligsten, was dir heilig ist!« Ich war schon ziemlich benebelt von dem schweren Bordeaux, den er zu unserer Wiedersehensfeier mitgebracht hatte, und nickte schwerfällig.
»Schwören ist was für Helden. Ich bin kein Held. Aber von mir aus. Ich schwöre es bei meinem Füllfederhalter. Was Heiligeres hab ich nicht.« Er schaute mir lange in die Augen, um zu ergründen, ob ich es ernst meinte. Als er damit fertig war, trank er seinen Wein aus und sagte:
»Schön. Hör gut zu. Was ich dir jetzt erzähle, hat sich eins zu eins so zugetragen.« Er stellte sein leeres Glas auf meinen guten Parkettboden und fing an zu reden. Vierzehn Stunden lang hat er mich wachgehalten mit seiner Geschichte. Und jetzt bin ich dabei, sie mit meinem Füllfederhalter aufzuschreiben. Ich halte mich an meinen Schwur und nenne seinen Namen nicht. Ich tu einfach so, als sei ich er. Nehmen wir mal an, sein Name sei: Ludwig Vonwegen.
1.Kapitel
Die haselnussbraunen Augen hinter den flaschenbodendicken Brillengläsern blickten mich groß an. Allerdings nur wegen der optischen Naturgesetze. Das war mir sofort klar, als ich die gelangweilte Stimme vernahm.
»Sie heißen?«
»Vonwegen. Ludwig Vonwegen.«
»Vonwegen …, Vonwegen …«, murmelte sie. »Warten Sie mal.« Und schon ging es wieder los. »Dann kennen Sie doch sicher den …«
»Nein.«
»Aber Sie sind doch verwandt mit …«
»Nein!«
»Waren Sie nicht der …?«
»Nein!«
»Na, dann muss ich Sie mit jemandem verwechseln.«
»Allerdings, das tun Sie wirklich. Aber Sie müssen es nicht.«
»Wie bitte?«
»Vergessen Sie’s. Krieg ich jetzt meine Papiere?« Prompt war sie beleidigt und streckte mir wortlos meine Unterlagen entgegen.
Ich kannte diese Art Gespräch, wenn man das überhaupt Gespräch nennen konnte. Es war eher ein Ballwerfen. Hin und her. Immer das gleiche Spiel. Seit einiger Zeit weigerte ich mich, den Ball aufzufangen, weigerte ich mich, freundlich zu sein.
»Aber das macht doch nichts. Ist ja verständlich. So eine Verwechslung hätte mir auch passieren können.« Nichts da! Schluss damit! Ich war 66 Jahre alt, seit gestern Rentner, seit einem Jahr Witwer und musste auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Und ich saß in der Falle, obwohl ich ein freier Mann war.
Während ich auf den Bus wartete, widmete ich mich meiner Lieblingsbeschäftigung: Ich ließ mir Namen durch den Kopf gehen. Capri, Cornwall, Paris, Rom, Amsterdam, Wien, Florenz. Sieben Namen. Sieben Destinationen. Sieben Sehnsuchtsbilder. Die Reihenfolge wechselte. Immer war es ein anderer Name, der mich besonders tief seufzen ließ. Der meinen Blick starr werden ließ, um die Bilder in meinem Kopf nicht zu verwischen, in meinem alten, grauhaarigen Kindskopf. Sobald sich ein Bild in prächtigen Farben und mit immer anderen Details vor meinem inneren Auge entfaltet hatte, krachte regelmäßig ein eiserner Rollladen herunter, mit einem Geräusch, das so grässlich war, dass mir übel wurde. Dann flatterten die wunderbaren Namen in der Dämmerung davon, wie eine kleine Schar aufgescheuchter Flamingos. In die Flucht geschlagen von einer harmlos wirkenden Zahl: eintausenddreihunderteinundzwanzig(komma) sechsundfünfzig. Diese Zahl starrte mir entgegen, schwarz eingerahmt, wie eine Todesanzeige. Aufgegeben von der Rentenrechnungsstelle. Ohne jeglichen Ausdruck eines Bedauerns. Ludwig Vonwegen, ehemals Gärtner, Buchhändler und Paketsortierer, zuletzt etliche Jahre Museumswärter, saß nach vierzigjährigem Berufsleben finanziell in der Falle.
Der Bus kam. Ich hielt dem Fahrer meinen Senioren-Ausweis hin. Der schaute ihn für mein Gefühl eine Sekunde zu lange an. Um einer Bemerkung zu entgehen, ging ich rasch nach hinten durch, ließ mich auf einen Sitz fallen und machte die Augen zu. Es war schlimmer geworden. Seit ein paar Wochen verging kaum ein Tag, an dem ich nicht mit irgendjemandem verwechselt wurde.
Bereits als Säugling entwickelte ich diese Eigenschaft, erfuhr davon aber erst viel später. Als mein Vater nach einem Schlaganfall in ein Pflegeheim kam, wo er rund um die Uhr betreut werden musste, hielt meine Mutter den Tag der Wahrheit für gekommen.
»Du bist übrigens adoptiert«, sagte sie beiläufig zu mir, während wir auf das Taxi warteten, das uns zum Bahnhof bringen sollte. Ich war damals zwanzig Jahre alt und vorübergehend sprachlos. »Aber du bist nicht das Kind, das ich wollte. Wir hatten einen anderen Jungen ausgesucht. Irgendwie wurdest du verwechselt, und als wir das nach ein paar Tagen gemerkt haben, hat dein Vater, also dein Adoptivvater sich stur gestellt. Wenn es nach mir gegangen wäre …« Sie ließ den Satz unbeendet. Seit diesem Tag habe ich nie wieder mit ihr gesprochen.
Dieser unselige Hang, verwechselt zu werden, wurde zu meinem Markenzeichen und begleitete mich mein ganzes Leben. Ich bemühte mich, dem Ganzen keine Bedeutung mehr zukommen zu lassen. Aber das war nicht einfach. Nein, es war sogar schwerer geworden und seit kurzem praktisch unmöglich. Ich konnte mir dieses Phänomen nicht erklären, dass ich ständig für jemand anderen gehalten wurde. Merkwürdigerweise für höchst unterschiedliche Personen.
»Du warst doch bei uns im Tanzkurs der schusselige Kleine.«
»Sind Sie nicht der Typ mit diesem protzigen SUV?«
»Das nächste Mal beseitigen Sie gefälligst ihre Hundescheiße.«
»Der wars, der ist hier rein, ohne Eintritt zu bezahlen.«
Ich bin sicher, es gibt außer mir niemanden, der so oft in seinem Leben sagen musste: »Ich bin es nicht! Ich war es nicht! Ich bin es nie gewesen!« Das Wort »Dementi« ist eigens für mich erfunden worden.
»Vielleicht sollte ich mich verkleiden.« Dieser Gedanke kam mir eines Morgens im Bad. Ich hatte angefangen mitzuzählen. Augenblicklich war ich bei einundzwanzig Personen angelangt, die man seit dem ersten Juli in mir entdeckt zu haben glaubte. Ich scheine ein besonderer Fall multipler Persönlichkeit zu sein. Wenn man mich schon andauernd verwechselte, konnte ich mir ja genauso gut aussuchen, für wen ich gehalten werden wollte. Eine halbe Stunde lang hockte ich auf dem heruntergeklappten Klodeckel, verschränkte die Arme und hielt meinen Kopf schräg, um besser nachdenken zu können. Außer Errol Flynn und Heinz Rühmann (wer kennt die heutzutage noch?) fiel mir niemand ein, und so spülte ich diese Idee das Klo runter.
Der Bus fuhr los und machte sofort eine Vollbremsung. Geistesgegenwärtig hielt ich mich an der mit Schaumstoff gepolsterten Stange fest, die quer über meinen Knien Sicherheit für die Fahrgäste suggerierte. Der Fahrer stieß laut ein paar Sätze auf Türkisch aus. Direkt vor seinem Bus hatte eine beleibte Dame die Straße überquert und ihm gleichzeitig mit hoch erhobenen Armen wild fuchtelnd zu verstehen gegeben, dass er anhalten sollte. Mit rotem Kopf stand sie nun vor der geschlossenen Tür und hämmerte energisch mit beiden Fäusten dagegen. Der Busfahrer drückte widerwillig auf einen Kopf, worauf die Tür mit einem Zischen aufging. Möglicherweise kam das Zischen auch von der Dame. Bevor der Busfahrer zu Wort kam, holte die erboste Matrone tief Luft.
»Zwei Minuten!«, fauchte sie und hielt dem Fahrer ihr feistes Handgelenk samt zierlicher Armbanduhr vor die von einem bleistiftdünnen, schwarzen Schnurrbart unterstrichene Nase. »Sie sind zwei Minuten zu früh losgefahren!« Der Busfahrer ignorierte das winzige Zifferblatt ihrer Uhr und griff zu einem Mittel, das er regelmäßig gegenüber meckernden Fahrgästen einsetzte: Er redete laut, langsam und auf Türkisch. Üblicherweise kürzte das jede Diskussion ab. Da er davon ausging, dass keiner dieser deutschen Wichtigtuer und Wichtigtuerinnen ihn verstand, machte er sich einen Spaß daraus, beispielsweise aufzuzählen, was er die letzten Tage alles verspeist hatte. Er war gerade beim gestrigen Mittagessen angelangt, als er eine neue Erfahrung machen durfte.
»Iki dakikim çok erken!«, schleuderte ihm die Walküre ungerührt in unverminderter Lautstärke entgegen, bevor sie sich zu den hinteren Sitzen durchkämpfte. »Çok fazla yiyorlar!«, bekam der Busfahrer außerdem zu hören. Der Triumph in ihrer Stimme war unverkennbar.
Ich konnte gerade noch erkennen, dass der Fahrer rot anlief, bevor er den Türknopf drückte und ruckartig anfuhr. Sie hatte schon den freien Platz neben mir erspäht und ließ sich, von orientalischen Fahrkünsten beschleunigt, mit einer unerwartet geschickten Drehung in letzter Sekunde darauf fallen. Sie rückte ihren Hut zurecht, schnaufte mühsam und strich die Ärmel ihres dunkelblauen Kostüms glatt. Dabei verströmte sie einen Duft, der mich an ein Rasierwasser erinnerte, das ich nicht ausstehen konnte. Fahrig untersuchte sie den Inhalt ihrer Handtasche, nahm einen beschriebenen Notizzettel heraus, warf einen nervösen Blick auf ihre Armbanduhr, musterte mich und verkündete mit brummiger Stimme:
»Ich muss um drei Uhr am Hauptbahnhof sein. Wichtige Verabredung am Gleis neunundzwanzig.« Zur Bekräftigung fuchtelte sie mit dem Zettel vor meiner Nase herum. »Da muss ich durch die ganze Halle!« Fast hätte ich mich dafür entschuldigt. Stattdessen fragte ich sie:
»War das eben Türkisch? Was haben Sie denn zu ihm gesagt?« Sie schaute mich prüfend von der Seite an.
»Sind Sie nicht…?«, begann sie.
»Nein, ganz bestimmt nicht«, fiel ich ihr ins Wort. »Aber es interessiert mich wirklich, haben Sie den Fahrer beschimpft?« Sie holte tief Luft und grunzte unverständlich. Dann gab sie ein Röcheln von sich. Ihre linke Hand, in der sie den Zettel hielt, verkrampfte sich. Sie schnappte nach Luft, krallte die Finger ihrer rechten Hand krampfhaft in meinen linken Unterarm und glotzte mich aus hervorquellenden Augen panisch an.
»Hören Sie, ich wollte nicht indiskret …«. Weiter kam ich nicht. Ihre Hand löste sich von meinem Arm. Sie ließ noch ein tiefes, abschließendes Gurgeln hören, kippte zur Seite und rutschte auf den Boden, direkt vor die Füße einer sprachlosen Schülerin der achten Klasse. Genaugenommen hatte diese zwar die Sprache verloren, war aber durchaus noch fähig, zu schreien. Und das tat sie dann auch ausgiebig.
Der Busfahrer schaute in den großen Innenspiegel, unterdrückte einen weiteren Fluch und stieg auf die Bremse. Ich war auf den freigewordenen Platz gerutscht und konnte mich gerade noch festhalten. Als der Bus stand, beugte ich mich zu der leblosen Frau hinab, deren umfangreicher Körper mich am Aufstehen hinderte. Mein Blick fiel auf ihre linke Hand, die merkwürdigerweise auf mich zeigte, als wollte sie mir den Zettel geben. Einem plötzlichen, unwiderstehlichen Impuls gehorchend zog ich das kleine rosa Papier vorsichtig zwischen den fetten, schweißfeuchten Fingern der Leblosen hervor und ließ es sogleich in der Brusttasche meines Hemdes verschwinden. Niemand hatte das bemerkt. Der Busfahrer stürmte nach hinten, um sich die Bescherung anzusehen.
»Was ist mit ihr?«, schnauzte er mich an. »Ruhe!!«, brüllte er außerdem die Schülerin an, die daraufhin das Schreien abrupt einstellte. Stattdessen begann sie, rasend schnell auf ihr Handy einzutippen. Von den anderen Fahrgästen meldete sich niemand zu Wort.
»Sie hatte einen Anfall, wahrscheinlich einen Herzinfarkt«, sagte ich. »Die Anstrengung war wohl zu groß, und die Aufregung. Und vielleicht auch ihr Gewicht.«
»Aber mir noch an den Kopf werfen, ich würde zu viel essen«, stieß der Busfahrer hervor und kniete sich nieder, um ihr den Puls zu fühlen. Dann rief er die Polizei an.
Eine halbe Stunde später stand ich am Odeons-Platz. Der Notarzt hatte den Tod der Matrone festgestellt. Zwei Polizisten unterhielten sich eingehend mit dem Busfahrer. Ich hatte keine große Lust, meinen Senf dazu zu geben und war unbemerkt getürmt. Jetzt wartete ich am Straßenrand und schaute mich ratlos um. Die Bilder gingen mir nicht aus dem Kopf. Das ganze Geschehen kam mir so unwirklich vor, als hätte ich in einem Sketch von Didi Hallervorden mitgespielt und die Pointe vergessen. Zum vierten Mal holte ich den zerknitterten rosa Zettel hervor, den ich der Frau abgenommen hatte. »Orientexpress« war darauf notiert, und darunter »15:00 Uhr«. Ich hatte keine Ahnung, was ich davon halten sollte. Sie hatte etwas von Gleis neunundzwanzig erwähnt. Ich bezweifelte, dass dort der Orientexpress haltmachte, steckte den Zettel wieder weg und schüttelte den Kopf. Liegt München überhaupt auf der Bahnstrecke zwischen Paris und Istanbul? Ich schaute auf die Uhr. Es war kurz nach drei und ohnehin zu spät. Ein Bus fuhr heran. »Hauptbahnhof« blinkte mir in rotgepunkteten Buchstaben entgegen. Da wollte ich nicht hin. Was sollte ich auch dort? Ich steckte meine Hände in die Hosentaschen und wandte mich ab. Die Bustür ging mit einem Zischen auf. Ich blieb stehen, legte die Hand auf meine Brusttasche und warf einen Blick in den Himmel, der dicht mit dicken, weißen Wolken übersät war.
Auf irgendetwas wartete ich, oder wartete irgendetwas auf mich? Erneut drang das Zischen an meine Ohren. Tief Luft holend fasste ich einen spontanen Entschluss, drehte mich um und stand nach drei, vier hastigen Schritten vor der sich gerade schließenden Bustür. Der Fahrer verdrehte die Augen und ließ mich einsteigen.
Eine Viertelstunde später stieg ich am Hauptbahnhof aus und betrat die Halle. Die große Uhr neben der Anzeige mit den Abfahrts- und Ankunftszeiten zeigte 15:23 Uhr. Ich durchquerte die Halle ohne große Eile. An Gleis neunundzwanzig war fast kein Mensch zu sehen.
»Du bist zu spät, die sind ohne dich abgefahren«, rief mir ein Obdachloser entgegen und machte es sich auf einer der unbequemen Bänke bequem. Ich nickte ergeben.
»Was für eine Schnapsidee, hierherzukommen«, dachte ich. Mir ging das Gewimmel all der Leute, die anscheinend genau wussten, wo sie hinwollten, gewaltig auf den Wecker. Ich flüchtete in ein Bahnhofsrestaurant. Dort holte ich mir an der Selbstbedienungstheke einen viel zu heißen Kaffee und ein Sandwich mit Tomaten und Gurken, das sich flach auf den Teller duckte. In einer Ecke, dicht bei den Toiletten, fand ich ein freies Plätzchen und ließ mich seufzend nieder. Nach zwei Bissen beschloss ich, das Sandwich in Ruhe zu lassen. Ich nahm einen Schluck Kaffee, verbrannte mir Zunge und Gaumen und unterdrückte mühsam einen Fluch.
Auf dem Nachbartisch lag, ordentlich zusammengefaltet, eine Wochenzeitung, die von der Person, die dort saß, achtlos an den Rand geschoben worden war.
»Entschuldigung, dürfte ich wohl einen Blick in ihre Zeitung werfen?«, fragte ich den etwa fünfzigjährigen Mann, der dort saß. Er drehte sich zu mir um und eine blitzartige Erkenntnis überfiel mich. »Sie sind der Orientexpress! Ähm, ich meine …, nein, Sie sind Hercule Poirot. Unsinn! Den gibt’s ja gar nicht, was rede ich da?« Ich räusperte mich verlegen. »Sie hatten nicht zufällig um 15:00 Uhr hier im Hauptbahnhof eine Verabredung?«, brachte ich schließlich hervor. Der Mann mit den öligen, schwarzen Haaren verzog die Lippen zu einem winzigen Lächeln.
»Ich sagte doch schon am Telefon, dass Sie mich an meinem Schnurrbart ganz leicht erkennen würden, nicht wahr. Ihre Stimme kam mir bei unserem Gespräch allerdings etwas anders vor.« Ich holte tief Luft und wusste nicht recht, was ich sagen sollte.
»Ja, das geht vielen so«, probierte ich dann als Antwort. Ich legte die rechte Hand wie zur Beschwörung auf meine Brusttasche mit dem rosa Zettel. Die pure Neugierde fuhr mir bis in die Haarspitzen. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich nichts dagegen, für jemand anderen gehalten zu werden, auch wenn dieser Jemand eine dicke tote Frau war.
»Wie dem auch sei«, sagte der Mann, stand auf und setzte sich an meinen Tisch. »Ich bin heilfroh, dass Sie noch gekommen sind. Ich war drauf und dran, die Agentur anzurufen und denen den Marsch zu blasen.« Ich nickte, ohne einen blassen Schimmer zu haben, wovon der Mann redete. »Sie sind also A.L. Sowasch.« Er sprach die Punkte mit. »Hört sich nach einem Künstlernamen an.« Ich rieb mit Daumen und Zeigefinger über meine Nase.
»Ja, das glauben viele«, sagte ich wenig originell und fragte mich gleichzeitig, wer mir da wohl gegenübersaß. Der Mann drückte mit Daumen und Zeigefinger die sorgfältig aufgezwirbelten, schwarzen Schnurrbartspitzen fest. Dann strich er mit der Hand über seine glatt anliegenden, schwarzen Haare.
»Ich liebe diese Verkleidung.« Ich schaute ihn fragend an. »Habe ich nicht erwähnt, dass ich Schauspieler bin?«. Ziemlich ratlos zuckte ich mit den Schultern. Daraufhin reichte der Mann mir die Hand. »Hans Müller. Trotzdem bin ich Schauspieler. Der Name ist so alltäglich, dass er für jemanden mit meinem Beruf schon wieder originell ist, finde ich. Deshalb verzichte ich auf einen Künstlernamen.«
»Das verstehe ich gut«, sagte ich. Mir war immer noch nicht klar, wozu dieses Treffen überhaupt gedacht war.
»Wir sind noch ein paar Wochen auf Tournee mit ›Mord im Orientexpress‹. Wie Sie richtig bemerkt haben spiele ich die Hauptrolle, den weltberühmten Hercule Poirot. Heute Abend gastieren wir in Salzburg. Der Einfachheit halber und weil es mir sehr angenehm ist, behalte ich auch tagsüber diese Gesichtsverkleidung bei. Die ganze Theatertruppe ist mir schon vorausgefahren. Oh, vielen Dank.« Die Kellnerin hatte ihm eine heiße Schokolade gebracht, das Lieblingsgetränk Hercule Poirots.
»Für mich bitte dasselbe«, sagte ich, in der Hoffnung den Geschmack des Sandwiches damit verscheuchen zu können. Langsam fragte ich mich jedoch, ob ich dem Mann nicht lieber reinen Wein einschenken sollte. Hans »Poirot« Müller nahm einen Schluck Kakao und strich anschließend mit dem Zeigefinger über seine Oberlippe.
»Ich habe also wenig Zeit, mein Zug geht in einer halben Stunde. Ist Ihnen soweit alles klar? Sind Sie mit drei Wochen einverstanden?«
»Ach, wissen Sie …«, sagte ich, ratloser denn je.
»Es können leicht auch vier oder fünf werden, aber da unten lässt es sich ja gut aushalten, nicht wahr?« Ich nickte zustimmend und überlegte fieberhaft, wie ich an nähere Informationen herankommen könnte.
»Wie sind Sie eigentlich auf diese Agentur gestoßen?« Eine clevere Frage, wie ich fand.
»Sie meinen die Someone at home? Ach, na ja, als mein Großvater mir gestern am Telefon eröffnete, dass er unbedingt zum 99. Geburtstag seines jüngeren Bruders nach Vimmerby fahren müsse, fiel mir erstmal die Kinnlade runter.«
»Das wäre mir vermutlich genauso gegangen«, pflichtete ich ihm bei. Ich hatte keine Ahnung, wo Vimmerby lag, wenn ich auch glaubte, den Namen schon mal gelesen zu haben.
»Mein Großvater ist sehr tatkräftig. Sobald er sagt, was er als Nächstes vorhat, ist er schon mittendrin. ›Du kannst ja solange auf mein Haus aufpassen. Ich verlass mich auf dich‹, waren seine letzten Worte und schon hatte er aufgelegt und mir damit wieder mal ein Ei ins Nest gelegt.« Hans »Poirot« Müller nahm einen weiteren Schluck von der heißen Schokolade und strich mit dem Zeigefinger über seinen Schnurrbart. »Ich vermute, dass er in diesem Augenblick auf der Fähre nach Schweden unterwegs ist und seine Mitreisenden mit seiner mitreißenden Lebensgeschichte unterhält.« Die Kellnerin brachte eine dampfende Tasse für mich. Allmählich dämmerte mir etwas.
2. Kapitel
Hans »Poirot« Müller legte seine sorgfältig manikürten Finger zusammen. »Natürlich kann ich im Augenblick nicht so einfach mal nach Capri gondeln.« Ich schluckte.
»Heißt das etwa …?«
»Mein Großvater hat, wie ich am Telefon schon erwähnte, ein Häuschen auf Capri. Also klemmte ich mich heute früh ans Telefon und suchte nach einer Housesitting-Agentur, die mir quasi Last-minute jemanden vermitteln kann.« Er nahm einen weiteren Schluck. Ich drehte meine Tasse hin und her und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, was nicht so einfach war, weil in meinem Kopf eine Lautsprecherstimme ständig »Capri!« rief.
Hans »Poirot« Müller griff in sein Jackett und holte eine Brieftasche hervor. »Die Agentur hat mir nur ihre Festnetznummer gegeben. Sie haben wohl kein Handy?« Ich schüttelte den Kopf. »Na, dann muss es eben so gehen.« Er schob mir ein Blatt Papier zu und tippte mit seinem Zeigefinger darauf. »Hier ist meine Nummer. Und hier hab ich Ihnen die Verbindung ausdrucken lassen. Sie können mit dem Zug um 17:23 Uhr nach Neapel fahren, nehmen dort morgen früh vom Bahnhof ein Taxi zum Hafen und fahren dann mit der Aliscafi-Fähre rüber nach Capri. Dort finden Sie am Hafen Marina Grande sicher jemanden, der Sie zur Villa meines Großvaters bringt. Der Name steht hier ganz unten.« Ich suchte nach Worten.
»Was ist es denn nun, ein Häuschen oder eine Villa?«, fiel mir als erstes ein.
»Lassen Sie sich überraschen«, sagte Hans »Poirot« Müller, holte eine Taschenuhr hervor und warf einen kurzen Blick darauf. »Jedenfalls gibt es dort ein Telefon. Sie können mich jederzeit erreichen, außer während der Vorstellungen natürlich.« Ich nickte. Ganz weit vorn in meinem Kopf kam es mir so vor, als sei alles klar, obwohl weiter hinten gar nichts klar war.
Capri! Ich hatte doch gar kein Geld für die Fahrkarten. Außerdem würde diese Agentur doch sicher irgendwann spitzkriegen, wer sich da auf Capri in Opa Müllers Villa eingenistet hatte. Vonwegen. Ich saß da und rührte in meiner heißen Schokolade, während ganz langsam ein Gedanke um meine heiße Tasse schlich: »Ich könnte doch vielleicht einfach mal so tun als ob.« Ich probierte vorsichtig einen kleinen Schluck. Die Schokolade war ausgezeichnet. Das überraschte mich und es beflügelte mich.
»Ich soll also«, begann ich noch etwas zaghaft, »auf das Haus Ihres Großvaters während der nächsten drei Wochen aufpassen. Und was …«, ich senkte meine Stimme, »ich meine, wie haben Sie sich das finanziell vorgestellt?« In diesem Moment klingelte das Telefon des Schauspielers. Hans »Poirot« Müller holte sein Handy aus der Innentasche seines Jacketts und warf einen Blick auf das Display, dann verdrehte er die Augen.
»Entschuldigen Sie, da muss ich kurz rangehen«, sagte er und drehte sich zur Seite. Ich nahm meine Schokoladentasse in beide Hände und stützte die Ellbogen auf den Tisch. »Capri, Capri, Capri!«, dachte ich und hörte bereits die Grillen in der mediterranen Sommerluft zirpen, »die Villa Iovis, der Monte Solaro, die Sesselbahn dort hinauf, Marina Grande, die drei Faraglioni, San Michele …«
»So geht das nicht!«, drang die Stimme des Schauspielers unwirsch an meine Ohren. »Ich hab dir klipp und klar gesagt, dass ich darüber nicht mit mir reden lasse. Nein. Nein, auf gar keinen Fall! Ich hab dir sechshundert Euro überwiesen und damit sind wir quitt. Ich hab jetzt eine andere. So ist das eben. Mir egal, wie du das aufgefasst hast. Ich hab dich nie im Glauben gelassen, dass … Nein! Nein, hör mir doch bitte einmal zu, ohne gleich hysterisch zu werden.« Hans »Poirot« Müller deckte sein Handy ab und warf mir ein Lächeln zu. »Dauert nicht lange«, raunte er mir zu. Ich nickte hinter meiner Tasse. »Schluss jetzt! Find’ dich mit den Tatsachen ab. Wir sind geschiedene Leute. Ja. Von mir aus. Das kannst du gerne mal versuchen. Viel Spaß dabei!« Er legte auf und platzierte das Telefon neben seiner Tasse. Ich war neugierig geworden.
»Ihre Frau?« Hans »Poirot« Müller hob abwehrend beide Hände.
»Meine Anwältin, genauer gesagt meine Ex-Anwältin. Sie sollte eigentlich dabei helfen, mir meine Ex-Frau vom Leib zu halten. Irgendwie muss sie mein Verhalten falsch interpretiert haben.«
»Ja, das soll es geben«, sagte ich mit Kennermiene. Hans »Poirot« Müller warf mir einen raschen Blick zu.
»Sie sind verheiratet?«
»Verwitwet.«
»Dann können Sie also allein nach Capri fahren, Sie Glücklicher.«
»Äh ja …«
»Ach so, ja — das Finanzielle. Sie wissen ja, als alter Hase in diesem Geschäft, wie das üblicherweise läuft.« Der »alte Hase« gefiel mir. Ich legte den Kopf schief und versuchte den dazu passenden Gesichtsausdruck hervorzuzaubern. »Sie können umsonst drei Wochen oder sogar noch länger auf der schönsten Insel im Mittelmeer wohnen. Alles was Sie dafür tun müssen ist, das Domizil meines Großvaters gegen alle Angreifer zu verteidigen, seien es nun die Mafia, die Carabinieri oder die Ameisen und zwar unter Einsatz Ihres Lebens. Zudringliche Touristen sind gefangen zu nehmen. Außerdem sollten Sie ein Auge auf die Tomaten haben. Dafür können Sie sich an allem bedienen, was Sie vorfinden. Ach ja, die Nachbarn sollen etwas merkwürdige Leute sein, hat mir mein Großvater berichtet. Er will auf keinen Fall, dass sein Refugium ihnen wochenlang schutzlos ausgeliefert ist. Ich will nicht ins Detail gehen. Sie sind ja lebenserfahren genug und finden sicher einen Weg im Umgang mit …, na ja, Sie werden es ja erleben.« Ich hatte mit zunehmendem Unbehagen den Worten des Schauspielers gelauscht.
»Wissen Sie, ich …«
»Ich weiß, ich weiß, Herr Sowasch. Mir ist wieder einmal der Gaul durchgegangen. Vergessen Sie das mit der Mafia und so weiter. Um diese Jahreszeit sind diese Leute ganz friedlich. Das mit den Ameisen, Touristen, Nachbarn und Tomaten war allerdings ernst gemeint. Und da Sie mir so kurzfristig aus einer großen Bredouille heraushelfen …« Sein Handy vibrierte auf der Tischplatte. Wieder der prüfende Blick auf das Display. »Ich bitte nochmals um Entschuldigung, aber da muss ich auch …, oh, hallo, ich hab nicht viel Zeit, mein Zug geht in — ich bin praktisch schon weg. Ja, gerade eben. Hab Schluss gemacht. Bin ja nicht blöd und lass mich von so einer einwickeln. Nein. Absolut nicht. Da besteht keine Gefahr. Du bekommst dann von meiner neuen Anwältin ein …, ja doch! Nein. Wie meinst du das? Was soll das heißen? Haben wir das nicht ausdrücklich vereinbart? Du kannst doch jetzt nicht …, aber …, hör doch mal! Nein! Nein sag ich! Mir reicht es jetzt langsam. Davon will ich nichts hören.« Er holte tief Luft. »Schluss jetzt! Versuchs doch. Kannst du gerne probieren. Viel Spaß dabei!«
Er legte auf, steckte sein Telefon weg, holte ein Seidentüchlein aus der Brusttasche seines Jacketts und tupfte seine Stirn ab. Dann räusperte er sich und leerte die restliche Schokolade in einem Zug.
»Das war jetzt Ihre …«
»Meine Ex-Frau. Was soll ich sagen? Die Frauen verstehen mich stets falsch.« Er holte wieder seine schwere Taschenuhr hervor. »Vor allem wenn es um meine Euros geht.« Er winkte der Kellnerin. »Hören Sie, Herr Sowasch, …« Ich konnte mich an diesen Namen einfach nicht gewöhnen.
»Sagen Sie doch einfach Ludwig zu mir«, unterbrach ich ihn.
»Schön, aber dann sag ich am besten gleich Luigi, schließlich fahren Sie nach Italien. Hier sind fünfhundert Euro. Die dürften für Ihre Reisespesen genügen. Das ist zwar nicht üblich, aber Sie sind mein Retter in letzter Not, mon Ami, wie Poirot sagen würde.« Nebenbei beglich er die Rechnung für uns beide.
Für mich ging das alles ein bisschen zu schnell. Im allerletzten Moment holten mich Skrupel ein. »Du musst dieses Missverständnis klären«, sagte eine Stimme hinter meinem linken Ohr. »Du musst Hans »Poirot« Müller enttäuschen und ihn in seinem Dilemma alleinlassen. Du kannst nicht nach Capri unter diesen Umständen. Das geht nicht. Du kannst nicht …, du musst …« Doch mein Gegenüber war bereits auf den Beinen. Ich gab meinem linken Ohr eine leichte Feige. Hans »Poirot« Müller reichte mir die Hand und schenkte mir sein schönstes Schnurrbartlächeln.
»Ich gebe Ihnen rechtzeitig Bescheid, falls Sie Ihren Urlaub auf Capri verlängern dürfen. Bon voyage et au revoir.« Ich stand hastig ebenfalls auf.
»Aber …«, brachte ich noch heraus, doch Hans »Poirot« Müller war schon dabei, im Laufschritt seinen Zug zu erwischen.
»Sie brauchen sich nicht zu bedanken«, rief er mir noch über die Schulter zu, dann war er zwischen all den anderen Reisenden verschwunden.
Ich ließ mich wieder auf meinen Stuhl fallen. Mein Blick fiel auf die Zeitung. Ich nahm sie an mich. »Schließlich brauche ich eine Reiselektüre«, war mein erster Gedanke. Ich starrte auf die Schlagzeilen, die es jedoch nur bis zu meinem Augapfel schafften. Der Zugang zu meinem Hirn war ihnen vorübergehend versperrt, da dort ein mittleres Chaos herrschte. Nach einigen wertvollen Minuten gewannen ein paar Schlagworte die Oberhand: 17:23 Uhr, Koffer packen, Neapel, Sparbuch, Fahrkarte, 17:23 Uhr, Siebzehnuhrdreiundzwanzig! Siebzehn …!! Ich legte eine flache Hand auf meine Stirn. Das Reisefieber hatte mich gepackt. Ich klemmte die Zeitung unter den Arm und stand mit weichen Knien auf.
Knapp eine Stunde später war ich mit meinem kleinen Koffer wieder zurück am Bahnhof. In diesen sechzig Minuten hatte ich es vermieden, weiter zu denken, als bis zur nächsten Socke. Meine Wohnung war penibel aufgeräumt, ich konnte sie jederzeit verlassen. In den Monaten nach dem Tod meiner Frau hatte ich damit begonnen, mich von den Dingen, die wir in dreißig gemeinsamen Jahren angesammelt hatten, Stück für Stück zu verabschieden. Nach und nach leerten sich Schränke, Kommoden und Regale. Nach und nach verschwanden die leeren Regale, Kommoden und Schränke. Zwei Räume waren schließlich von allem Inhalt befreit, so dass meine Schritte darin unangenehm fremd hallten. Ich hatte schon daran gedacht, in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Mein Schlafzimmer war karg wie die Lehrersuite in einer Jugendherberge aus den siebziger Jahren. Nur im Wohnzimmer leisteten die Dinge erbitterten Widerstand, was hauptsächlich daran lag, dass es sich dabei um meine Lieblingsbücher handelte. In der Eile hätte ich beinahe vergessen, Hemingways Erzählungen und den Reiseführer über Ischia, Capri und Sorrent einzupacken, sowie die Leonardo-Biografie, die schon seit Wochen ungelesen auf meinem Nachttisch lag. Das könnte für drei Wochen reichen, wenn ich meinen Lesehunger in den Griff bekäme. Ich zog alle Stecker aus den Steckdosen und drehte das Wasser ab. Dann verließ ich die Wohnung im Eilschritt.
Draußen schlug mir eine schwüle Hitze entgegen. Ich ignorierte sie. Atemlos und schweißgebadet stand ich wenig später in der Schlange am Fahrkartenschalter und vermied es, einen Blick auf die Uhr zu werfen. Morgen würde ich in Capri sein, das war es, was zählte. Während ich noch in meinem Gedächtnis nach Italienischvokabeln fahndete, traf mich der scharfe Blick der Bahnbeamtin, die das Glück hatte, mich meinem Traumziel näherzubringen.
»Schlafwagen oder Liegewagen?«, fragte sie leidenschaftslos, nachdem ich ihr Napoli als Zielort zugeraunt hatte.
»Äh ja, was ist bitte der Unterschied?«
»Im Schlafwagen schläft man, im Liegewagen liegt man«, sagte sie in gelangweiltem Ton und zog die Nase kraus, so als ob sie gleich niesen müsste. Vorbeugend sagte ich:
»Gesundheit«, so dass ihr prompt das Niesen verging. »Ich werde wahrscheinlich sowieso kein Auge zutun, also geben Sie mir einfach die billigste Fahrkarte.«
»Also einmal Stehplatz im Gang«, sagte sie ohne mit der Wimper zu zucken und begann, im Stakkato auf ihre Tastatur einzuhämmern. Verwirrt starrte ich auf ihre emsigen Finger.
»Äh, Moment, halt, halt, wie war das? Ich kann doch nicht die ganze Nacht stehen!« Sie würdigte mich keines Blickes.
»War nur ein Witz, beruhigen Sie sich. Hin und her?«
»Wie? Äh, ja, also, ich glaube erstmal nur hin, irgendwie weiß ich noch nicht sicher, wann ich zurück …«
»Sie wissen aber schon sicher, dass Sie nach Neapel in Italien wollen, oder?«
»Nach Capri, um genau zu sein. Da will ich schon seit dreißig Jahren hin«, sagte ich leise und musste an meine Frau denken, die einfach nicht nach Italien gewollt hatte.
»Nie im Leben kriegst du mich dahin«, war ihre Standardantwort gewesen. Irgendwann hatte ich nicht mehr gefragt.
»Also einmal hin und vielleicht zurück«, murmelte die Bahnbeamtin und tippte wieder in atemberaubender Geschwindigkeit.
»Darf ich wenigstens am Fenster stehen?«, versuchte ich meinerseits einen Scherz. Ich fühlte mich von ihrer trockenen Art angespornt. Wieder traf mich ein scharfer Blick aus schwarzen Augen.
»Der Scherzkeks hier bin ich. Sie haben Glück, die Toilette ist bereits ausgebucht. Sie dürfen im Trockenen sitzen.« Ein finaler Schlag auf die arg ramponierte Entertaste und schon begann der Drucker zu surren. »Cash oder Karte?«, fragte sie mich mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Äh ja, ich habs dabei. Moment.« Ich kramte mein Sparbuch hervor, in das ich die Scheine Hans »Poirot« Müllers und meine eigenen Tausendsechshundert Euro gelegt hatte, mein ganzes Vermögen.
»Cash also«, sagte sie und runzelte die Stirn. »Das macht Eintausendachthundertundvierzig Euro.« Das Blut schoss mir in den Kopf und mein Atem stockte.
»Das ist doch wohl ein Witz!«, stammelte ich. Zum ersten Mal lächelte sie.
»Na, dann werden Sie ja erleichtert sein, dass ich Sie nur um Hundertundsechzig Euro erleichtern muss. Her mit den Scheinchen, aber ein bisschen plötzlich, sonst fährt Ihr Zug ohne Sie ab. Die Italiener sind da ziemlich deutsch.«
Wenig später stand ich im schmalen Gang des Zuges. Mein Atem und mein Herzschlag beruhigten sich allmählich und meine Nase gewöhnte sich an den staubig-metallischen Reisegeruch alter Nachtzüge. Erst jetzt wagte ich es, einen Blick auf die Fahrkarte zu werfen, die mir die schwarzäugige Bahnbeamtin mit einem »Buon Viaggio« ausgehändigt hatte. München – Napoli Centrale stand darauf. In knapp dreizehn Stunden würde ich dort sein. Ich fand keinerlei Hinweise auf eine Abteilnummer oder Platznummer. Also musste ich mich selbst um mein Nachtlager kümmern. Angesichts des Gedränges, das überall im Zug herrschte, hätte ich mir normalerweise Sorgen gemacht. Im Augenblick jedoch war ich noch ganz von dem Gefühl beseelt, unterwegs nach Italien zu sein. Die Fee, die mich bis hierhergeführt hatte, würde mich auch die Nacht gut überstehen lassen. Ich ließ mir Zeit mit der Suche, zockelte mit meinem Koffer durch den ganzen Zug, während er selbst seinen Weg aus dem Gleisgewirr des Münchener Hauptbahnhofs suchte. Etwa zehn Meter vor mir wackelte ein riesiger Rucksack hin und her. Darunter waren ein paar dünne Beine in ausgefransten Jeans auszumachen, mit Füßen, die in ausgelatschten Sandalen bei jedem vierten Schritt ins Stolpern kamen. Ich hatte die Hoffnung, ganz vorne, direkt hinter der Lok einen Platz zu finden. Bis dahin würde sicher keiner der Mitreisenden laufen. Mein Plan schien aufzugehen. Immer wieder scherte eine Gestalt aus der Schlange vor mir in ein Abteil aus und der Abstand zu dem zweibeinigen Rucksack verringerte sich immer mehr. Der Zug hatte nun deutlich an Fahrt zugelegt. Ab und zu kam ich an einem geöffneten Fenster vorbei. Dann blieb ich jedes Mal stehen und streckte den Kopf hinaus. Der Rucksack vor mir tat das Gleiche. Wir schienen beide vom selben Stamm zu sein.
Schließlich waren wir im vordersten Waggon angelangt. Ich warf einen Blick zurück über die Schulter. Wir waren tatsächlich die einzigen, die noch kein Plätzchen gefunden hatten. Als ich wieder nach vorn sah, war der Rucksack auf zwei Beinen verschwunden. Das Abteil, vor dem ich stand, war voll belegt und obwohl es noch nicht einmal sechs Uhr abends war, schliefen alle fünf Insassen auf den auseinandergezogenen Sitzen, wie auf einer Liegewiese. Im nächsten Abteil wurde heftig diskutiert, gestikuliert und schnabuliert in italienischer Lautstärke und mit deutscher Gründlichkeit. »Na prima«, dachte ich, »vielleicht krieg ich was zu essen, wenn ich mich einfach dazu setze.« Den Reiseproviant hatte ich total vergessen und außer zwei Bissen von dem verunglückten Bahnhofssandwich hatte ich nichts im Magen. Ich fasste mir ein Herz und wollte gerade die Abteiltür aufschieben, als drei Abteile weiter vorn ein kahler Kopf in den Gang lugte, mir zulächelte und mit der Hand einladende Zeichen machte. Ich nahm meinen Koffer in die andere Hand und ging zögernd weiter.
»Nobody’s here, just me. Thank God! Come in!«, rief der Kahlkopf mit einer fröhlichen Mädchenstimme. Ich hatte fast nichts verstanden. Mein Englisch beschränkte sich auf »okay«, »yes« und »no«. Aber es hatte freundlich geklungen und dieser Klang lockte mich an. »Hi, I’m Renee, you can have any seat you want«, sagte die Fee und streckte mir ihre Hand entgegen, nachdem sie sie vorher rasch an ihrer Jeans abgewischt hatte. Ich zögerte einen Moment, dann nahm ich sie dankbar und schüttelte sie mit einem kräftigen Händedruck. Es war so als hätten wir damit eine Abmachung besiegelt. Mein Blick begegnete zwei klaren grünen Augen die mich aus einem Gesicht anstrahlten, das mich an jemanden erinnerte. Es war ungewöhnlich schön, aber diese Ähnlichkeit? Mit wem nur? Natürlich, sie sah aus wie Romy Schneider in dieser Talkshow damals, als sie eine Art schwarzen Turban trug, der ihr Haar vollständig verbarg und ihr Gesicht umso schöner zur Geltung brachte. Dieses Gesicht hatte ich nun vor meinen Augen. Ich hatte ein wenig das Gefühl, angekommen zu sein, auch wenn meine Reise gerade erst begonnen hatte.
»Hallo. Ich heiße Ludwig und kann kein Englisch«, brachte ich mit einem Schulterzucken hervor. Sie hob beide Hände.
»Das macht wenig. Main duitsch is börfekt«, war ihre Antwort. Ihr gewaltiger Rucksack lag schräg in der Ecke am Fenster. »Ist es ok wenn ich sage Lou zu you? Ludwig sounds wie ein Oldtimer, you know?« Ich lächelte etwas gequält und nickte. Dann schaute ich mich im Abteil um.
Draußen an der Tür steckte zwar ein »Reserviert-ab-München-Schild«, doch wie es aussah, hatten die Leute es sich anders überlegt, oder waren krank geworden, oder hatten einen Unfall gehabt, oder waren durch einen Stau aufgehalten worden, oder hatten ganz einfach keine Lust mehr gehabt, nach Neapel zu fahren, weil sie sich gerade in einem mordsmäßigen Streit über eine Lappalie verheddert hatten. Ich hätte mir noch fünfzig weitere Gründe denken können. Meine Fantasie ging in solchen Dingen oft mit mir durch.
Meine letzten zwanzig Arbeitsjahre hatte ich als Museumswärter in den Münchner Pinakotheken verbracht. Den lieben langen Tag war ich durch die Säle geschlurft und hatte die Besucher beobachtet, ohne dass ich selbst wahrgenommen wurde. Irgendwann hatte ich begonnen, der alten Dame, die jeden Montag mit einem Schirm lange vor dem Caspar David Friedrich verweilte, einen Lebenslauf zu weben, in dem vier Ehemänner vorkamen; dem bärtigen jungen Mann mit der dicken Brille, der seit fünf Monaten versuchte, den Caravaggio zu kopieren, eine Karriere als Staubsaugervertreter zu auszumalen; dem Paar, das eines Abends in Rodins Ecke knutschte, einen heftigen Streit wegen ihrer Schwangerschaft anzudichten und für den grauhaarigen Herrn im Gehrock, der den van Dyck jedes Mal betrachtete, als sehe er ihn zum ersten Mal, ein Testament zu formulieren, in dem kein einziger seiner Angehörigen vorkam. Diese gedanklichen Exkursionen halfen mir durch die langen Nachmittage in trüben und trockenen Räumen, in denen man leise raunte, ehrfürchtig murmelte oder einfach nur sprachlos staunte, während das alte, ehrwürdige Parkett sich bisweilen betreten räusperte.
Renees Stimme riss mich aus meinen Gedanken.
»Want something to eat? Oh, sorry Lou, willst du futtern?« Sie hielt mir eine überdimensionierte Brezel und einen Früchteriegel hin, die sie aus den Tiefen ihres Rucksacks hervorgezaubert hatte.
»Ok, danke, das ist sehr …, ich hab wirklich Hunger, aber ich will nicht, dass …«
»Don’t worry, ich kaufe immer zwei von alles. Das ist very good gegen Verhungern.« Ich stellte meinen Koffer auf den Sitzplatz am Gang, nahm Brezel und Riegel entgegen und ließ mich auf dem mittleren Sitz nieder. Während der nächsten Minuten kauten wir einvernehmlich und verfolgten die vorbeiziehende Landschaft. Ab und zu riskierte ich einen verstohlenen Blick auf meine Fee, wie ich sie insgeheim nannte. Ich hatte noch nie ein kahlköpfiges Mädchen gesehen, und ich bewunderte sie für die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Glatze zeigte. Meine Blicke waren ihr nicht entgangen.
»I don’t like caps, weil die sind so, wie sagt man, hasslich«, sagte sie.
»Hässlich«, half ich.
»Exactly. Außerdem the sun is good for main Kopf, you know. It makes me think positive. Ah, wait a minute: Es denkt besser ohne Helm, ohne Hut.« Ich nickte. Ich konnte sie gut verstehen. Als wir mit dem Essen fertig waren, kramte sie aus ihrem Rucksack zwei kleine Bierflaschen hervor und stellte sie auf den Klapptisch am Fenster. Dann verschwand sie erneut in ihrem geräumigen Reisegepäck. Ich hörte ihre Stimme gedämpft eine Reihe englischer Worte murmeln. Dem Klang nach waren es keine Vokabeln, die ich an der Volkshochschule hätte lernen können. Ich warf einen Blick auf die Flaschen und verspürte plötzlich einen brennenden Durst. Ich griff in meine Hosentasche.
»Shit, my opener is weg. Lou, hast du vielleicht …«, sagte sie und tauchte enttäuscht aus ihrem Rucksack auf. Ein langanhaltendes Zischen unterbrach sie.
»Ist ein bisschen warm, das Bier, scheint mir«, sagte ich und hielt ihr eine geöffnete Flasche hin.
»Oh, thanks. Thank God. German guys, ah, deutsche Männer haben always ein Taschenmesser«, sagte sie mit einem Seufzer und nahm ihre Flasche. Ich öffnete vorsichtig meine Flasche, steckte mein Schweizermesser wieder ein und prostete ihr zu, bevor ich einen langen Zug tat. Das Bier war zwar nicht kalt, das hätte mir mein Magen ohnehin übelgenommen, aber es hatte genau den richtigen Geschmack. Renee ließ einen scheuen Rülpser hören und lehnte sich entspannt gegen ihren Rucksack.
»Sie kennen schwierige Wörter. Taschenmesser und so«, versuchte ich sachte etwas Konversation.
»Yeah, und Schließfachgebuhr und Sussigkeitenautomat und gelegtes Brotchen. Ich kriege jeden Tag ein neues Wort in my head«, sagte sie und tippte an ihre Stirn. »Das macht ihn wieder ok.« Ich nickte und schaute aus dem Fenster. Wir fuhren gerade besonders langsam durch einen kleinen Provinzbahnhof, kurz vor der Grenze. Als der Zug wieder beschleunigte, hatte ich beschlossen, dasselbe zu tun wie Renee. In meinem Kopf, da war ich sicher, war genug Platz für täglich ein neues englisches Wort. »By the way, Lou, you can say du zu me, zu mir, zu mich.«
»Mir ist schon richtig«, sagte ich.
»In Schweden ganze Welt sagt du. Nur zu the king plus sein family sagt man Sie.«
»Du warst in Schweden?«
»Vor sechs Wochen, nein sieben. Aber nicht für lange Zeit.«
»Wie lang bist du denn schon unterwegs?« Sie nahm einen letzten Schluck aus ihrer Flasche und stellte sie dann auf den Boden.
»Mein ganzes Leben«, sagte sie und schaute mich an. Ich nickte und wollte vorerst nicht mehr erfahren.
»Meinst du …, also ich würde gern jeden Tag …, ich kann nämlich nicht englisch reden, und so ein Wort am Tag …, kannst du mir vielleicht ein paar Worte aufschreiben, für meine Reise?« Sie zog die Augenbrauen nach oben.
»Ich kann dich jeden Tag ein neues Wort sagen, solange wir sind together überwegs.«
»Unterwegs.«
»That’s what I mean. Ausgemacht?« Sie streckte mir ihre kleine Hand hin und ich nahm sie.
»Abgemacht. Du hast ein schönes Armband. Sind das Holzperlen?« Sie lächelte und nickte.
Später, als es bereits dunkel war, brannte nur die kleine Notlampe über der Eingangstür. Draußen rauschte die Nacht vorbei. Drinnen lagen wir auf den zusammengeschobenen Sitzbänken und ließen die Zeit in unsere Köpfe, die vergangene und die zukünftige. Kurz bevor ich einschlief hörte ich Renees vom nahen Schlaf schon gefärbte Stimme.
»Lou, du erinnerst mir an my grandpa, Großvater, you know.«
»Nicht schon wieder«, dachte ich. Sie gähnte herzhaft, dann war für eine Minute nur das regelmäßige Rattern des Zuges zu hören. »But du bist trotzdem somehow ganz schön anders«, kam es leise von ihrer Seite. Ich drehte mich auf die andere Seite, dankbar für alles, was mir an diesem Tag begegnet war, besonders aber für diesen einen Satz.
3. Kapitel
Am nächsten Morgen um kurz nach sieben weckte mich ein schrilles Kreischen. Ich bekam die Augen nicht gleich auf und tastete nach meinem Wecker. Der stand jedoch über tausend Kilometer entfernt auf meinem Nachttisch in München und klingelte sich die Seele aus dem Leib. Die Tür zum Abteil wurde mit einem Ruck aufgerissen.
»Dieci minuti a Napoli Centrale«, sagte eine raue, tiefe Stimme. Es klang wie ein Befehl. Renee war mit einem Schlag wach.
»Scusi, signor, do you have, ah, avete un coffee? I want to buy two espresso per favore, please.« Der Schaffner, der bereits dabei war, das verschlafene Nachbarabteil in die Wirklichkeit zu zerren, streckte noch einmal seinen Kopf in unser Abteil. Ich lag auf dem Rücken lag und rieb mir den Schlaf aus den Augen. Dabei bemerkte ich erschrocken, dass der Schaffner eine Schaffnerin war.
»Cosa vuoi?«, kam es drohend, während sie ihren Kopf mit einer langen schwarzen Mähne zurückwarf und mit den Augen funkelte. Renee blieb unbeeindruckt.
»Per favore un coffee, due coffee, please, we need espresso«, sprudelte sie hervor und faltete theatralisch die Hände wie zum Gebet. Die Schaffnerin ließ ein verächtliches Schnauben hören und nickte dann mit dem Kopf herrisch in Richtung des Nachbarwaggons. Renee schlüpfte blitzschnell aus ihrem Schlafsack, machte einen großen Schritt über mich hinweg, sprang an der Schaffnerin vorbei in den Gang und machte sich in Jeans und T-Shirt auf ihre knallgelben Socken.
Ich hatte mich gerade erst ein wenig aufgerappelt, die Liegesitze zurück in ihre aufrechte Position geschoben und stand mit schmerzendem Rücken etwas wacklig auf den Beinen am Abteilfenster, als Renee mit zwei kleinen weißen Bechern schon wieder in der Tür erschien.
»I love this coffee. Here Lou, taste it, probieren, du wirst vergeistert sein.«
»Begeistert.«
»Yeah, that’s what I mean.«
»Coffee?«, fragte ich. »Das ist mein Wort für heute.«
»Allright. Coffee means Kaffee. That’s easy, isn’t it?« Ich lächelte etwas verknittert, zuckte mit den Schultern und nahm meinen Becher entgegen.
»Du bekommst noch Geld«, sagte ich und trank meinen ersten heißen schwarzen Schluck.
»Don’t worry. Du zahlst das Nächste, was wir brauchen. Here, if you want.« Sie zog ein Zuckertütchen aus ihrer Hosentasche und hielt es vor meine Nase.
»No, thank you.«
»Yeah, du machst große Schritte, great.« Ich hielt mich mit einer Hand am Fenstergriff fest. Die Rückenschmerzen waren wie fortgeblasen.
Der Zug rollte gemächlich an einem großen Stationsschild vorbei — Napoli Centrale.
»Gestern um die Zeit lag ich noch in meinem Bett in der Maxvorstadt und der Weg zum Bäcker kam mir viel zu weit vor«, dachte ich, »und wo bin ich jetzt?« Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Renee stand neben mir und sah schweigend aus dem Fenster. Ohne es auszusprechen, bewunderten wir uns gegenseitig für unseren Wagemut, am frühen Morgen in Neapel auszusteigen. Mir jedenfalls kam es wagemutig vor. Ich blickte Renee verstohlen von der Seite an. Bisher wusste ich so gut wie nichts von dem Mädchen. Aber etwas flüsterte mir ins Ohr, dass an ihrer Seite alles in Italien leichter sein würde. Sie hatte entschieden mehr Übung im Unterwegssein und im Lösen der vielen kleinen Probleme, die, davon war ich überzeugt, an jeder Ecke auf mich lauerten. Renee knüllte ihren Kaffeebecher zusammen, beförderte ihn zielsicher in den winzigen Mülleimer und klatschte voller Energie in die Hände.
»Let’s go, Lou. Andiamo. Wir gehen Napoli besuchen. Die haben fantastic Pizza hier, sagen die Leute.«
»Die wurde hier erfunden.« Ich war überrascht, dass mir dies so plötzlich eingefallen war. Ich hatte es in einem Reiseführer gelesen, zu einer Zeit, als Neapel für mich so unerreichbar war, wie der Mond oder Moskau. Der Zug bremste ruckartig und brachte mich ins Stolpern, als ich mich nach meinem Koffer streckte, den ich abends zuvor im Gepäcknetz verstaut hatte. Renee konnte sich gerade noch am Fenstergriff festhalten.
»Die mögen uns hier, I’m sure«, sagte sie und schlüpfte im Sitzen in die Träger ihres Rucksacks, an dem sie zuvor mit ein paar Handgriffen ihren Schlafsack befestigt hatte. Dann verschränkte sie die Arme und stand mit einem Ruck auf.
Auf dem Gang draußen drängelten sich bereits die übrigen Fahrgäste. Ich erkannte die fünf Schlafmützen vom Abend zuvor. Sie redeten in buntem Italienisch durcheinander, hielten sich an den Händen und versperrten
mir damit den Weg. Eine schnell wachsende Unruhe strich über meinen Scheitel und packte mich am Genick. Sie trieb mich hinaus auf den überfüllten Gang. Ich zwängte mich mit meinem Koffer zwischen die Italiener, so dass sie ihre Hände loslassen mussten. Für einen Moment verschlug es ihnen die Sprache, dann bemerkten sie meine grauweißen, kurzgeschorenen Haare, nahmen mir meine Drängelei nicht übel und setzten ihre lebenswichtige Unterhaltung umso lauter fort. Ich drehte mich nach Renee um, konnte sie aber nicht entdecken. Draußen hallte eine kalte, unverständliche Lautsprecherstimme. Das schrille, metallische Kreischen der Bremsen übertönte sie. Der Zug kam endgültig zum Stehen.
Alle Fahrgäste auf dem Gang holen gleichzeitig tief Luft. Ich starre durch die schmutzigen Scheiben nach draußen. Die Strahlen der Morgensonne finden ihren Weg durch die staubige Bahnhofshallenatmosphäre, vorbei an altgedienten Tauben, über alle Bahnsteige hinweg bis hin zu unserem Zug, bis zu unseren vom Schlaf befreiten Gesichtern und beruhigen meinen Puls mit ihrem warmen Glanz.
»Lou, I follow you, don’t worry«, höre ich Renee von hinten rufen. In Trippelschritten meinem Vordermann auf den Fersen, den Koffer an meinen Bauch gepresst, nähere ich mich quälend langsam der Tür. Gleichzeitig werde ich von den Fahrgästen, die dicht hinter mir unaufhörlich diskutieren sanft aber ebenso unaufhörlich geschoben, bis ich endlich, aufatmend und einen unbeholfenen Hopser wagend, mit beiden Füßen gleichzeitig auf italienischem Boden lande.
Kurz darauf steht Renee mit ihrem Ungeheuer von Rucksack neben mir.
»Und jetzt?«, frage ich und blicke mich ratlos um.
»Well, was schlägst du zu, Lou?«
»Vor. Was schlägst du vor, heißt es.«
»Yeah, that’s what I mean.« Ich schaue sie unsicher an mit einem flauen Gefühl im Magen. Sie deutet mit beiden Zeigefingern auf mich. »Du willst nach Capri, right?« Ich nicke. Der bittere Geschmack des Kaffees liegt noch auf meiner Zunge. Ich brauche dringend was zu essen.
»Für eine Pizza ist es wohl zu früh?« Sie lacht.
»Not in my opinion. Come on. Wir schauen nach, was hat Napoli Gutes für uns.«
»Gut und anschließend suchen wir nach dem Hafen, wo die Fähren ablegen.«
»Allright. Die haben ein funny name hier, Alishuffle, something like that.«
»Aliscafi.«
»Okay, I follow you, ich folge du, Lou.«
»Dir. Es heißt dir. Ich folge dir.«
»That’s what I mean.«
Später an diesem Vormittag lege ich beide Hände auf die Reling der Fähre. Sie wird gleich ablegen und mich nach Capri bringen. Nach Capri! Seit mehr als dreißig Jahren hatte ich mir diesen Moment vorgestellt. Ich schließe die Augen, während eine scheue Euphorie an meinen Beinen hochkrabbelt. Gedämpfte Stimmen umschwirren mich. Es hört sich nach Holländisch an, auch nach Französisch, dazwischen ein paar harte japanische Silben. Ich verstehe zum Glück kein Wort. Das macht es mir leicht, mich zu konzentrieren und die letzten zwei Stunden Revue passieren zu lassen:
Das Frühstück im Stehen gleich vor dem Bahnhof, bestehend aus Pizza Margherita, zwei Cornetti und zwei doppelten Espressi. Ich war auf den Geschmack gekommen und von den Reisespesen Hans »Poirot« Müllers war noch jede Menge übrig. Mir kam dessen prächtiger Schnurrbart in den Sinn. Wie wohl die Vorstellung in Salzburg gelaufen war? Ich sah ihn vor mir, wie er mitreißend scharfsinnig in seinem Schlussmonolog die Lösung des Rätsels im Orient Express herbeiführt. Wie er genüsslich seinen schwarzen Bart zwirbelt. Wie er nonchalant in die Innentasche seines tadellos gebügelten Jacketts greift, sein Handy herausholt, das er, verflixt nochmal, vergessen hat, auszuschalten, und das sich in perfektem Timing stilecht mit den Tönen von Big Ben meldet.
»Bon, hier spricht Poirot. Nein. Nein, du verstehst mich ganz genau, ich bin Hercule Poirot. Hans Müller, wer soll das sein? Da liegt wohl eine Verwechslung vor.« Und auf diese Weise, elegant improvisierend, den Anruf seiner Ex-Frau oder Ex-Anwältin oder Ex-Freundin mitten auf der Bühne überspielt, von spontanem Applaus begleitet.
In einer engen Seitenstraße trafen wir auf der Suche nach einem Taxi auf ein Taxi, das auf den ersten Blick nicht nach einem Taxi aussah. Genauer gesagt trafen wir es unvermutet mitten auf der Straße, als wir uns reflexartig mit beiden Händen auf der Kühlerhaube eines alten Fiat Cinquecento abstützen mussten. Unsere Kniescheiben blieben verschont, da der Fahrer des Fiats wegen akuter geistiger Abwesenheit vergessen hatte, das Gaspedal artentypisch durchzutreten. Die beiderseitige Schrecksekunde dauerte angemessene fünf Sekunden. Sodann knallte der Fahrer ein magnetisches Taxischild auf das Dach seines motorisierten Kokons. Anschließend entpuppte er sich und überschüttete uns mit einer Wortkaskade, aus der ich »scusi«, »Madonna mia« und »mannaggia«heraushörte. Nach einigem Hin und Her fand ich zusammen mit meinem Koffer auf dem Rücksitz Platz, indem ich mich schräg hineinfallen ließ und anschließend die Knie anzog. Renee konnte sich auf den mit Asche gesprenkelten Beifahrersitz quetschen. Ihr Rucksack fand auf dem Dach des Fiats ein luftiges Plätzchen, wo ihn Gianpaolo, so hieß der Taxifahrer, energisch mit ein paar Möbeltragegurten festzurrte. Zum Schluss implantierte Gianpaolo sich selbst in sein unter dem ungewohnten Gesamtgewicht ächzendes Gefährt, startete und fragte schnaufend:
»Dove?« Renee, die die Suche nach einem Taxameter aufgegeben hatte fragte kurz und bündig zurück:
»Quanto?«, worauf Gianpaolo zu einem längeren Monolog ansetzte, der mit einem kurzen Überblick der Geschichte Italiens begann, seine eigene Familiengeschichte einschloss, die schulischen Leistungen seines Sohnes beiläufig streifte, die Frechheiten seiner beiden Töchter ausführlich behandelte, die Untreue seiner Frau mit einem Achselzucken abtat, die Untreue seiner Freundin mit einer geballten Faust beleuchtete, sowie die Lage der italienischen Wirtschaft, speziell seines eigenen Taxiunternehmens in von Abgaswolken verdüstertem Licht darstellte. Sein Plädoyer unterstrich er gestenreich, während er einhändig lenkte, blinkte, schaltete und den einen oder anderen gesalzenen Fluch einstreute. Wir waren bereits zehn Minuten unterwegs, als es mir gelang, das Wort »Aliscafi« in das stete Wortgeplätscher zu werfen.
»Ah! Capri! Ich wusste. Allora Signore, dahin wir fahren schon ganze Zeit.«
»But how did you know, ah scusi, wie sagst du in Italy?«, mischte Renee sich ein.
»All want Capri, Madonna, alle von euch Deutschen …«
»Sono americana …«
»Si si, certamente auch tutto l’inglese e gli americani, sie alle wollen Capri …« Mir schwirrte der Kopf und ich beschloss, den Rest der Fahrt zu schweigen, und zwar auf Deutsch. Renee dagegen versuchte hartnäckig im Interesse einer soliden Finanzplanung die Kosten unserer Stadtrundfahrt von Gianpaolo zu erfahren, der bei diesem Thema wahlweise nickte oder den Kopf schüttelte, bevor er es ebenso hartnäckig wechselte. Nach einer halbstündigen Fahrt, während der ich mehr Englisch und Italienisch hören durfte, als zuvor in meinem ganzen Leben, bremste Gianpaolo mit einem zufriedenen »ecco la« und rutschte elegant in einen gerade freigewordenen Parkplatz. Dreißig Euro waren nach meinem Ermessen ganz in Ordnung, aber Renee wollte Gianpaolo nicht mehr als Zwanzig Euro geben. Wie auf Kommando erbleichte er und griff sich schweratmend ans Herz. Darauf griff Renee stöhnend an ihr Knie und zeigte ihm ihre aufgerissene Jeans. Als sie dann noch einen »Dottore« und die »Policia« erwähnte, war der Kampf gewonnen.
Ich stehe weit vorn an der Reling der Fähre mit noch immer geschlossenen Augen und atme tief durch. Die Stimmen neben mir sind verstummt. Wir waren so zeitig angekommen, dass die Ersteigerung der Karten nach Capri und das Entern der Fähre im Vergleich zu der Taxifahrt enttäuschend nüchtern, ja langweilig vonstattengingen. Was ich aber insgeheim genoss. Denn ich bin immer noch damit beschäftigt, mein inneres Navigationssystem neu zu zentrieren und das geht nur in aller Stille und ohne störende Einflüsse von außen. Renee, der das viel schneller gelingt, versteht sehr gut, warum ich dort allein und sprachlos an der Reling stehen will und lässt mich in Ruhe. Sie versucht in der Zwischenzeit auf der anderen Deckseite der Fähre nach Hause zu telefonieren. Ich bekomme davon nichts mit. Das leichte Schwanken der Fähre, die sich rasch vom Festland entfernt, wirkt beruhigend. Auch der tiefblaue Himmel, von vereinzelten weißen Wolken getüpfelt, die gemächlich dahintreiben, flößt mir Gelassenheit ein. Die frische Brise des Golfs von Neapel tut meiner Nase wohl. Sie vergisst den penetranten metallischen Geruch, der so typisch ist für alte Zugwaggons. Sie vergisst das durchdringende Zigarrenaroma aus Gianpaolos winzigem Taxi. Mein Blick geht über die Dächer von Neapel, wandert weiter, die Silhouette des Vesuvs entlang und hinauf, fällt dann zurück aufs Meer.
Ich denke an meine Frau und beinahe taucht ein schlechtes Gewissen aus den friedlich schäumenden Bugwellen auf. Sie wusste nichts von Italien, aber sie wollte auch nichts davon wissen und jetzt war sie tot. Seit einem Jahr. Ein schlechtes Gewissen ist daher so angebracht wie Zucker auf einer Pizza Margarita. Der Gedanke gefällt mir. Isola Capri. »Jetzt bin ich da«, denke ich und klopfe wie zur Bestätigung paar Mal auf die Reling. »Jetzt bin ich da«.
Renee kam von der anderen Seite herüber.
»Hast du jemanden erreicht?«, fragte ich und deutete auf das Smartphone in ihrer Hand. Sie nickte.
»My uncle. Er hat mich nach Europa verschickt.«
»Geschickt.«
»Yeah. Oh my God, Duitsch ist ein geflickte, äh nein, wait a moment — ein geflixte Sprache.«
»Verflixt. Es heißt verflixte Sprache und das ist wirklich ein schweres Wort.«
»Egal for mich. Anyway. Ich hab ihn geweckt, mein Onkel. Er lebt in Seattle. Ich ruf ihn immer an, wenn ich an ihn denken darf.«