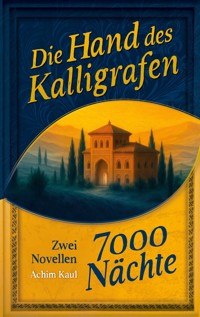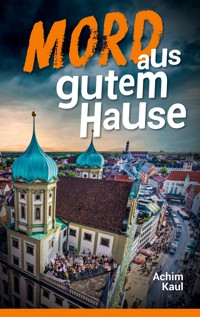Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was sucht ein Typ am Pol der Unerreichbarkeit? Gibt es Giraffen in New York? Was geschah in Lesleys Haus? Wen hat Rabenstein auf dem Gewissen? Was dürfen die Bewohner von Gold Point niemals tun? Verschläft Leander ein Jahrhundertbeben? Warum blieb Leas Flaschenpost ungelesen? Wer hörte den tödlichen Ruf der Tiefe? Wohin verschwand Elisa? Neun Storys, die einen noch lange verfolgen werden. Sie sind leicht zu lesen, aber die darin beschriebenen Bilder, Figuren und Ereignisse gehen nicht mehr aus dem Kopf. Es sind Lagerfeuergeschichten, die das Kino im Kopf auf Hochtouren bringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Was sucht ein Typ am Pol der Unerreichbarkeit? Gibt es Giraffen in New York? Was geschah in Lesleys Haus? Wen hat Rabenstein auf dem Gewissen? Was dürfen die Bewohner von Gold Point niemals tun? Verschläft Leander ein Jahrhundertbeben? Warum blieb Leas Flaschenpost ungelesen? Wer hörte den tödlichen Ruf der Tiefe? Wohin verschwand Elisa?
Neun Storys, die einen noch lange verfolgen werden.
Achim Kaul ist ein erfolgreicher Autor aus Friedberg. Seit 2019 veröffentlichte er vier Kriminalromane mit dem beliebten Ermittlerduo Zweifel und Zick.
2022 erhielt Kaul in München den SpaceNet Award für eine seiner Kurzgeschichten.
Im selben Jahr erschien »Überwegs«, der Roman einer ungewöhnlichen Odyssee quer durch Europa.
»Du sollst nicht langweilen« ist die aktuelle Sammlung seiner fesselnden Storys.
Diese Geschichten kauerten im Morgengrauen vor mir auf einem nebligen Hügel, fuhren in einer Vollmondnacht auf meinem Floß den Fluss hinab, standen neben mir an einer Graffitiwand, verbargen sich hinter einem Schwarzweißfoto, starrten mich aus einem Spiegel an, verfolgten mich im Unterholz, trieben mich mitten in der Nacht aus dem Bett, gingen im Gewitterregen unter meinem Arm spazieren und standen mit mir an einem verlassenen Bahnsteig. Die Figuren erschienen, einer Fata Morgana gleich, in der unerforschten Savanne meiner Fantasie und es war schwierig genug, sich ihnen unbemerkt zu nähern. Doch schließlich folgten sie alle meiner Feder.
Inhalt
27 Wörter
Rabenstein
Noahs Gleichung
Leander schläft Leander
Giraffen kann man nicht reiten
Die Sache mit Leslie James
Vom Verschwinden
Du sollst nicht langweilen
Ein sattes Blau
Siebenundzwanzig Wörter
Am ersten Tag konnte ich sie nicht ausstehen. Zu jener Zeit konnte ich niemanden ausstehen. Allein schon ihre unverschämte Art, in unsere Klasse zu stolzieren: lange kupferrote Haare, dünne Arme und Beine, aber kein bisschen verlegen oder unsicher. Mit ihren großen grünen Augen musterte sie seelenruhig einen nach dem anderen. Einige der Jungs kicherten, die Mädchen rümpften ihre Nasen. Vielleicht war es auch umgekehrt. Ich war vierzehn Jahre alt und wollte mit keinem von denen etwas zu tun haben.
Sie ging zur hintersten Reihe und ließ ihre schäbige Schultasche lässig auf einen leeren Tisch fallen. Raubach, unser Klassenlehrer, stellte sie vor. Ich behielt nur den Vornamen: Lea. Sie war mir egal. Zumindest versuchte ich, mir das einzureden.
Nach der Stunde packte ich meine Sachen und verließ die Klasse. Das Geschwätz der anderen interessierte mich nicht. Sie ödeten mich an und diese Lea hatte gerade noch gefehlt.
Mein Heimweg mit dem Rad führte durch ein Stück Wald und an unserem See entlang. Hier konnte ich sicher sein, keinem Menschen zu begegnen. Nahe bei einem Steg, der weit in den See hinausführte, ließ ich mein Rad liegen. Die Holzbohlen waren morsch, einige fehlten, das Betreten war, logisch, streng verboten. Ich ging bis zum äußersten Ende, logisch. Dort setzte ich mich auf das vom nächtlichen Gewitter noch feuchte Holz. Der See lag glatt in der warmen Nachmittagssonne, umrundet von einer grünen Stille.
Meine Füße baumelten über dem trüben Wasser. Hier konnte ich den Teufel in mir beruhigen. Nach einer Weile legte ich mich flach auf den Rücken. Was zuhause auf mich wartete war mir klar. Das hier war entschieden besser. Ich blinzelte in den Himmel und schnalzte zufrieden mit der Zunge. Ein leises Schnalzen, fast wie ein Echo, ließ mich auffahren.
Am Ufer stand Lea, mit beiden Händen an ihrem Lenker. Ich hatte sie nicht kommen hören. Sie warf einen Blick über den See und ließ ihr Rad ins Gras fallen. Dann betrat sie den Steg und kam auf mich zu. Ich war sprachlos vor Überraschung und Ärger. Und verwirrt war ich außerdem.
Sie warf ihre roten Haare mit einem Schwung über die Schulter und kniff ihre Augen zusammen.
»Du kennst meinen Namen, aber ich weiß deinen nicht«, sagte sie leise. Ich zog die Knie hoch und verschränkte die Arme darauf.
»Musst du den wissen?« Sie schüttelte den Kopf.
»Nee, ich nenn’ dich einfach Junge.« Ich verdrehte die Augen.
»Hör zu, Mädchen, ich …«
»Ich bin Lea.« Stur schüttelte ich den Kopf.
»Pass auf, Mädchen …« Sie hob beide Hände.
»Ich weiß, was du sagen willst. Das hier ist dein Ort. Niemand soll dich stören. Du willst deine Ruhe haben, möglichst weit weg von den anderen. Und nach Hause willst du auch nicht.« Ich starrte sie an. Ihre grünen Augen leuchteten. Sie zuckte mit den Schultern. »Ich geh schon.«
Sie drehte sich um. Ihre rote Mähne funkelte in der Sonne, als sie über den Steg zurück zum Ufer ging. Sie nahm ihr Rad und fuhr davon. Bald war sie zwischen den Bäumen verschwunden.
Meine Gedanken kreisten um ihre Worte. Es war, als hätte sie aus meinem Tagebuch laut vorgelesen. Am nächsten Tag in der Schule ging ich ihr aus dem Weg. Tat sie das Gleiche? Jedenfalls wechselten wir weder Worte noch Blicke.
Nach der Schule fuhr ich zu meinem Steg am See, legte mein Rad ins Gras und setzte mich auf die sommerwarmen Holzbohlen. Während ich das gegenüberliegende Ufer beobachtete, wartete ich darauf, dass sie kam. Und fürchtete es gleichzeitig.
Einerseits fühlte ich, dass sie jemand war, mit dem es sich zu reden lohnte. Aber ich hasste andererseits Veränderung. Mit mir selbst kam ich am besten klar. Da brauchte ich keine Abwehrstrategien, musste nicht argumentieren und auf der Hut sein. Vor allem konnte ich meinen eigenen Gedanken nachhängen und musste keine fremden ertragen. Ich war ein eigenbrötlerischer Freak, zu jung, um mich zu rasieren, aber alt genug, um zu wissen, was für mich gut war.
Sie näherte sich geräuschlos. Erst als die Holzbohlen leicht vibrierten, spürte ich ihre Anwesenheit. Sie setzte sich wortlos neben mich.
Wir blickten über den See und auf unsere nackten Füße, die eine Handbreit über der Wasseroberfläche schwebten. Wir saßen schweigend nebeneinander, die Minuten flossen an uns vorbei und ich hatte das Gefühl, mich noch nie so gut mit jemandem verstanden zu haben.
Als es dämmerte, stand sie auf. Sie berührte mit ihrer Hand leicht meine Schulter — ein wagemutiger Schmetterling. Dann zog sie ihre Schuhe an und ging den Steg zurück. Ich sah ihr nach. Sie drehte sich zu mir um und fuhr mit beiden Händen durch ihr Haar.
»Morgen können wir reden«, sagte sie und hob ihr Rad aus dem Gras.
»Vielleicht«, sagte ich leise, als sie verschwunden war.
In den folgenden Wochen hatten wir die Nachmittage und den See für uns allein. Und wir redeten. Und wir lachten. Und wir fanden so viele Gemeinsamkeiten, dass es uns fast unheimlich war. Am Wochenende eroberten fremde Leute den See und wir versteckten uns im Wald. Wir wussten bald so viel voneinander, dass es uns am besten gefiel, miteinander zu schweigen. Das war eine von Leas großen Gaben: genau zu wissen, wann die Stille für uns am schönsten war.
Dieser Sommer machte uns unzertrennlich. Wir waren wie die beiden Hälften einer Ellipse.
Eines Nachmittags streunten wir durch das Unterholz und Lea fand zwischen den Wurzeln einer Buche eine leere Flasche ohne Etikett. Sie zog den Korken mit einiger Mühe heraus, roch daran und gab ihn mir. Er hatte nur noch ein schwaches Aroma.
»Was meinst du?«, fragte sie. Ich zuckte mit den Schultern.
»Keine Ahnung, die muss schon lange hier liegen.« Sie besah die Flasche von allen Seiten. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Ich weiß, was wir machen«, sagte sie und rannte damit los.
Außer Atem erreichten wir den See und ließen uns ins Gras fallen.
Sie kramte einen Notizblock aus ihrem Rucksack. Einen Bleistift hatte sie immer hinter ihrem Ohr stecken. Die anderen zogen sie schon deswegen auf, doch Lea kümmerte das nicht. Sie lächelte über die Boshaftigkeiten hinweg und funkelte nur mit den Augen. »Wir schreiben«, sagte sie.
»Was?«, fragte ich.
»Einen Brief. An uns. Wie wir sein werden.« Ich sah sie verständnislos an, doch sie hatte den Stift schon in der Hand und den Block auf den Knien. »Während ich schreibe, kannst du dir was überlegen«, sagte sie und der Stift glitt flink über das linierte Papier.
»Wie wir sein werden?«, fragte ich verwirrt und warf einen Kieselstein ins Wasser. Sie nickte, ohne mit dem Schreiben aufzuhören. »Du schreibst mir also gerade einen Brief?« Sie sah mich mit ihren tiefgrünen Augen an. Diesen Blick werde ich nie vergessen.
»Ich stell mir vor, wie du sein wirst in zehn oder zwanzig oder dreißig Jahren, was du bis dahin erlebt hast, welche Träume du dir erfüllt hast und welche nicht.«
»Und was dann?«
»Ganz einfach, du tust dasselbe für mich.« Ich blies die Backen auf und schaute ratlos in die Gegend. Doch während ich ihrem emsigen Bleistift bei seinem Weg über das Papier zuhörte, erschienen wie aus dem Nichts meine Sätze zwischen den Kiefern, tauchten aus dem schilfgrünen See auf, schlängelten sich durch das Gras.
»Beeil dich«, sagte ich aus Angst, meine Geistesblitze könnten spurlos verlöschen.
»Jetzt du«, sagte sie und riss das Blatt ab. Ich nahm ihr den Bleistift aus der Hand und brauchte kaum länger als sie, während der Schatten ihres Kopfes auf meine Schreibhand fiel. Es war, als würde jemand, der hinter meinem linken Ohr saß, mir die Worte diktieren. Nach wenigen Minuten gab ich Lea den Bleistift zurück und sie riss auch mein Blatt aus dem Block heraus. Sie legte unsere Briefe so zusammen, dass die Schriften aufeinander lagen.
»Roll sie eng zusammen«, sagte sie und löste den Schnürsenkel aus ihrem rechten Schuh.
»Willst du nicht lesen was ich geschrieben habe?«, fragte ich.
»Das tun wir in zehn Jahren, nicht eher«, sagte sie und knotete den Schnürsenkel um die beiden Blätter, die ich zu einer dünnen Röhre gerollt hatte. Dann schob sie sie vorsichtig in die Flasche. Ich half ihr mit dem Korken. Dabei kam ich ihr sehr nahe und der Duft ihrer roten Haare betäubte mich.
»Zehn Jahre? Glaubst du wirklich, dass wir so lange zusammenbleiben?«, fragte ich und musste schlucken.
»Ich glaub es nicht, ich weiß es«, sagte sie und strahlte mich an. Die Erinnerung an ihr leuchtendes Gesicht begleitet mich bis heute.
»Aber wenn wir die Flasche in den See werfen, werden wir sie nie wieder finden«, sagte ich.
»Wir verstecken sie dort, wo wir sie gefunden haben«, erwiderte sie und rannte damit los.
»Eine Flaschenpost im Wald«, keuchte ich neben ihr. »Find ich ziemlich schräg.«
»Passt doch zu uns«, rief sie und lief noch schneller. Wir fanden den Baum, gruben ein Loch für die Flasche und deckten sie mit Zweigen zu.
»Haben wir jetzt unsere Träume begraben?«, fragte ich übertrieben dramatisch.
»Blödmann«, sagte sie und grinste. Meine Neugierde war zu groß.
»Was hast du geschrieben?«, wollte ich wissen. Sie sah mich lange an, dann zwickte sie mich in den Arm und sagte:
»Siebenundzwanzig Wörter.«
Ich erwiderte ihren Blick. Er sagte mir alles. Wie von selbst breiteten meine Arme sich aus.
Sie legte den Kopf schief und lächelte, dann fiel sie mir um den Hals. Es war die erste Umarmung meines Lebens.
Einen Tag später überfuhr ein LKW Lea. Sie war auf der Stelle tot.
Ich weinte nicht, ich schrie nicht, ich rannte los, rannte wie durch einen Tunnel, rannte mir die Seele aus dem Leib, erreichte den Wald, suchte mit wirren, verschleierten Augen die Buche, lehnte mich erschöpft an einen feuchten Stamm, rutschte zu Boden, spürte die Regenschauer nicht, saß da, an den Baum gelehnt und hatte endlich die Kraft, Leas Namen zu schreien. Ich rutschte zur Seite, sank auf meinen Rücken, der Regen prasselte auf mein Gesicht. Ich schrie »Lea!«, rief nach Lea, murmelte ihren Namen, konnte ihn, heiser geworden, nur noch flüstern.
Irgendwann kroch ich auf Händen und Knien. Nach ein paar Metern fand ich unsere vergrabene Zukunft.
Das geschah vor mehr als zweiundfünfzig Jahren.
Jeden Tag denke ich daran.
Jeden Tag nehme ich die Flasche in die Hand.
Jeden Tag betrachte ich unsere beiden innig zusammengerollten Briefe.
Ich habe die Flasche nie geöffnet.
Rabenstein
Mein Vater war neunundachtzig Jahre alt, als er mich eines Morgens mit den Worten begrüßte:
»Ich habe mich erschossen. Du musst bei mir bleiben.« Er klang so ruhig, als spräche er über das Menü dieses letzten Sonntags im September.
Eine Viertelstunde zuvor hatte mich die Leiterin seines Seniorenstifts in heller Aufregung angerufen. Während ich versuchte, ihrem wirren Wortschwall zu folgen, schweifte mein Blick weit hinaus über die im weichen Morgenlicht liegende Flussebene jenseits der Stadt und blieb alarmiert an dem ockergelben Türmchen der Barockkapelle hängen, die in der Ferne auf einem Hügel, wie von Spitzweg gemalt, einfach da war.
Ich legte mitten im nächsten Satz der aufgelösten Frau auf, griff nach meinem Tweed-Jackett, suchte die Autoschlüssel. Sie lagen auf der fünften Stufe der Wendeltreppe; der Geruch nach Bohnerwachs im Flur; mein starres Gesicht im Spiegel; die schwere Holztür, die hinter mir zufiel — nie werde ich diese Nichtigkeiten vergessen. Ich raste mit dem Wagen quer durch die Stadt, als gäbe es keine anderen Autos, und Motorräder und Straßenbahnen.
Die Leiterin stand hektisch winkend an der Pforte. Ich rannte an ihr vorbei die Treppen hoch in den zweiten Stock und riss die Tür zum Apartment meines Vaters auf. Ein junger Arzt stand neben seinem Bett, drehte sich erschrocken zu mir um und kam eilig auf mich zu.
»Sie können jetzt nicht …« Ich schob ihn wortlos beiseite und war mit wenigen Schritten bei meinem sterbenden Vater. Er winkte schwach mit einer Hand.
»Sie können gehen, die Sache ist erledigt«, stieß er hervor und nickte dem Arzt zu. Der hob hilflos die Schultern und verließ erleichtert, wie es schien, den Raum. Die alte Armeepistole nahm er mit.
Mein Vater richtete sich ächzend auf, sah mich an und sein Blick war so klar wie nie. »Ich habe mich erschossen. Du musst bei mir bleiben.«
Seine Pyjamajacke war offen. Erst jetzt entdeckte ich den weißen Verband in seiner Herzgegend.
Vor fünf Jahren hatte er hier sein letztes Zuhause gefunden. Das heißt, ich hatte es für ihn gefunden. Weil ich es nicht mehr aushielt. Weil ich ihn nicht mehr aushielt. Seine Depression war im Laufe von drei Jahren nach meiner Rückkehr unaufhörlich und unerbittlich wie Efeu an uns emporgekrochen. Sie griff auf mich über. Sein Atmen vergiftete meine Luft, sein Seufzen umklammerte meine Brust, seine Blicke verdunkelten meine Welt. Seine Schritte drängten mich an den Rand einer tiefen Schlucht.
Er war der letzte Vater unserer Familie und ich der letzte Sohn. Niemand sonst war übrig von der Familie Rabenstein.
Ich musste etwas tun, um zu überleben und so fand ich »das beste Refugium für das besondere Alter«, wie mir die Leiterin des Hauses bei unserem ersten Gespräch versicherte. Ich brachte ihn dorthin. Scheinbar war es ihm gleichgültig.
Als er aus dem Haus war, stand ich am Fenster meines Studierzimmers, blickte über die Stadt hinaus in die Ferne und atmete auf.
Seit jenem Tag entfernte sich mein Vater immer weiter von mir, Lichtjahr um Lichtjahr, einem uralten Kometen gleich, dessen unabsehbare Umlaufbahn sich in weiten Sternennebeln verlor.
Ich besuchte ihn jeden Tag, einer Abmachung folgend, die ich mit mir selbst getroffen hatte. Nicht wegen eines schlechten Gewissens, das gewiss nicht. Mir ging es um eine Wiedergutmachung. Wenngleich ich diese Vokabel nicht ausstehen kann. Sie klingt so, als hätte ich etwas schlecht gemacht. Was nicht zutrifft.
Schön, ich gebe es zu, wir hatten, als ich noch jung war, verschiedene Meinungen und jeder hielt seine für unumstößlich. Es gab in jener Zeit heftige Auseinandersetzungen, doch wenn Atmung und Puls sich beruhigt hatten tranken wir unseren Kaffee aus und gingen uns für eine Weile aus dem Weg.
Eines Tages, es war bevor ich für lange Zeit aus seinem Leben verschwand, redete mein Vater über die finsterste Zeit seines Lebens.
Er stand am Fenster und sah in den Garten hinaus. Ich saß in seinem roten Sessel und las die Tageszeitung.
»Was damals geschah, als die braunen Teufel ausschwärmten, das kann jederzeit wieder geschehen.« Sein Satz kam aus heiterem Himmel.
»Du übertreibst«, widersprach ich. »Die Leute sind heutzutage viel besser informiert und sie kennen die Geschichte. Wir haben immerhin seit Jahrzehnten Frieden in Europa.«
»Du vergisst den Balkan und du plapperst nach, was all die schlauen Köpfe von sich geben. Glaub mir, es braucht nur eine handfeste Krise, mit der man den Menschen Angst einflößen kann. Und es braucht einen Sündenbock. Eine ganze Herde von Sündenböcken. Die Vorurteile, der Hass und die Dummheit auf diesem Planeten reichen für das ganze Universum.« Ich faltete die Zeitung zusammen und ließ sie auf den Boden fallen.
»Dein Problem ist, dass du nur noch auf das Negative fixiert bist.«
»Ich weiß jedenfalls, wovon ich rede. Ich habe alles selbst erlebt. Diese Stimmung. Die Hetze. Dieses Volk von Denunzianten.« Er spuckte das Wort förmlich aus.