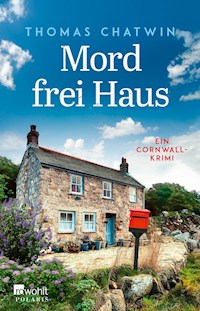
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Daphne Penrose ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet als Daphne und Francis den Sonnenaufgang auf der wilden Landzunge Land`s End genießen, klingelt ihr Handy. Der Anruf kommt von Daphnes Kusine Annabelle. Vor ihrer Tür liegt ein Toter, eingewickelt in rotes Geschenkpapier und mit einer hübschen Grußkarte versehen. Der Ermordete ist Annabelles grantiger Nachbar. Als Chief Inspector Vincent am Tatort Daphne antrifft, ist seine Laune sofort im Keller. Außerdem mutmaßt er, dass Annabelle selbst die Mörderin ist. Nur dem energischen Eingreifen von Daphne ist es zu verdanken, dass ihre Kusine nicht festgenommen wird. Während Daphne auf eigene Faust zu ermitteln beginnt, denkt sich der Täter bereits ein neues Mordgeschenk für Annabelle aus. Und es soll nicht das letzte bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Thomas Chatwin
Mord frei Haus
Ein Cornwall-Krimi
Über dieses Buch
Postbotin Daphne ermittelt!
Ausgerechnet als Daphne zusammen mit ihrem Mann Francis den Sonnenaufgang auf der wilden Landzunge Land’s End genießen will, stört ein Anruf die Ruhe. Daphnes Kusine Annabelle ist außer sich. Vor ihrer Tür liegt ein Toter, eingewickelt in Geschenkpapier. Der Ermordete ist Annabelles grantiger Nachbar. Als Chief Inspector Vincent am Tatort Daphne antrifft, ist seine Laune sofort im Keller. Außerdem mutmaßt er, dass Annabelle selbst die Mörderin ist. Nur dem energischen Eingreifen von Daphne ist es zu verdanken, dass ihre Kusine nicht festgenommen wird. Während Daphne auf eigene Faust zu ermitteln beginnt, denkt sich der Täter bereits ein neues Geschenk aus. Und es soll nicht das letzte bleiben.
Vita
Thomas Chatwin, geboren 1949, ist promovierter Literaturwissenschaftler und ein profunder England-Kenner. Er liebt Cornwall und verbringt jede freie Minute dort. Seiner langjährigen Freundschaft mit der englischen Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher und vielen gemeinsamen Reisen verdankt er ungewöhnlich detailreiche Einblicke in Cornwalls Alltag.
Prolog
Über Cornwalls Möwen ist schon viel geschrieben worden. Ihre wilde Entschlossenheit ist legendär. Auch Daphne Penrose hatte früh lernen müssen, sich vor ihnen in Acht zu nehmen. Wer zum Hafen an der Bucht hinuntergeht, entdeckt sie überall, die schnellen weißgrauen Silhouetten am Himmel, die sich in Gruppen auf die einfahrenden Boote stürzen und ungeduldig nach Fisch oder Brotkrumen schreien. Bekommen sie ihren Willen nicht, greifen sie zu anderen Mitteln. Selbst Hafenmeister Bellamys treuherziger Basset, der auf dem Bootssteg gerne die täglichen Pasteten in seinem Napf verteidigte, hätte ein Lied über die kämpferischen Möwenschnäbel jaulen können, wenn die letzte Begegnung nicht so schlecht für ihn ausgegangen wäre.
Die schrillen Möwenrufe von den Dächern gehörten meist zu den ersten Tönen, die Foweys Neugeborene wahrnahmen, und auf dem Friedhof neben dem River Fowey wurde niemand ohne das Jammern der Mantelmöwen zu Grabe getragen. Auch Stürme konnten die Vögel zuverlässig vorhersagen. Von ihrer Großmutter hatte Daphne gelernt, die unterschiedlich starken Möwenschwärme mit dem bevorstehenden Wetter in Verbindung zu bringen. Bereits vier oder fünf Tage vor einem Sturm zogen die Vögel ins Inland, um Schutz zu suchen. Flogen sie auffällig im Kreis, kalibrierten sie ihre natürlichen Barometer neu. Kamen sie in kleinen Gruppen zurück, war der Luftdruck wieder gestiegen und schönes Wetter stand bevor.
Früher hatte es geheißen, dass nur Gott und die Möwen wussten, was in Fowey vor sich ging. Stimmt nicht, widersprachen Daphnes Freundinnen augenzwinkernd, wenn im Pub die Rede darauf kam. Wirklich alles weiß nur eine – Daphne Penrose.
Auch wenn es nur ein Witz war, fanden doch alle, dass es cool sein müsste, als Postbotin so viel über die Leute in Fowey zu wissen. Daphne hörte es sich an und amüsierte sich darüber. Jeder sah nur, wie sie jeden Tag gut gelaunt mit dem Fahrrad durch die engen Gassen des Küstenortes fuhr, die braunen Haare zu einem praktischen Pferdeschwanz zurückgebunden und vor der Lenkstange den Korb der Royal Mail. Da sie gut zuhören konnte, legte man ihr an manchen Haustüren die Lebensgeschichten wie reife Früchte vor die Füße, ob sie wollte oder nicht. Einiges war zum Lachen, anderes eher schwere Kost. Hin und wieder gab Daphne auch einen fröhlichen Rat, so wie Pferde jemanden sanft anstupsen.
Was keiner sah, war ihre stille, kleine Last des Mitwissertums. Ihre erwachsene Tochter und Francis nannten es liebevoll-spöttisch Daphnes Betriebsgeheimnis, eigentlich traf es das ja auch. Im Prinzip konnte Daphne gut damit leben, es gehörte zum Job. Ein bisschen fühlte es sich an, als wenn man unfreiwillig die Einzige war, die für sich behalten sollte, wer unter Fußpilz litt oder schmutzige Unterwäsche trug.
So war es bis in den August, nach einem ungewöhnlich stürmischen Sommer. Dann kam das Wochenende, an dem die Möwen mit dem Wetterwechsel zurückkehrten und ganz Fowey durch ihr Verhalten beunruhigten. Waren sie früher nur frech gewesen, schienen sie jetzt unerklärlich aggressiv zu sein. In drei Fällen durchbrachen sie sogar Fensterscheiben und flogen in die Häuser, als weigerten sie sich, menschlichen Hindernissen auszuweichen. Einige griffen im Sturzflug Pferde an. Jeder musste unweigerlich an Mrs. du Maurier und ihre Erzählung Die Vögel denken, die der Schriftstellerin eingefallen war, nachdem sie nahe Fowey eine weiße Wolke von Möwen hinter einem pflügenden Traktor entdeckt hatte.
Bis zur letzten Augustwoche hatten sich die Vorfälle mit aggressiven Möwen fast verdoppelt. Plötzlich traute man ihnen alles zu. Als am letzten Augustsonntag die Leiche von George Huxton gefunden wurde, machte sogar für einige Stunden das Gerücht die Runde, die Möwen hätten ihn zerhackt. Aber das stimmte nicht, die Wahrheit war noch schlimmer. Das Verbrechen an George Huxton entpuppte sich als Anfang einer schrecklichen Mordserie, wie Cornwall sie so noch nie erlebt hatte.
Das alles passierte an dem Sonntag, den Daphne bis zum Rest ihres Lebens in schmerzhafter Erinnerung behalten sollte. Der Tag, an dem sie zum ersten Mal begriff, wie wenig sie im Grunde über die Menschen in Fowey wusste.
1
An einem wundervollen Morgen entdeckte ich von meinem Aussichtspunkt eine Schule langsam dahinziehender Haie, die das Wasser nach Plankton durchsiebten, unbeholfen und anmutig zugleich.
Mary Wesley
Normalerweise lief es sonntags in ihrer Ehe so: Daphne schlief ein bisschen länger, weil sie keine Post austragen musste, Francis bereitete währenddessen ein schönes Frühstück vor. Seine Rühreier waren ohnehin fluffiger als ihre. Bei schönem Wetter frühstückten sie im Garten. Spätestens beim Toast begannen, sie Pläne für den Rest des Tages zu schmieden. Sie machten eine Küstenwanderung, segelten oder befestigten eine Hängematte zwischen ihren beiden größten Cornwall-Palmen. Meistens lag Daphne darin und schaukelte, unter sich im Gras unterhaltsame Lesevorräte wie die über Die Todesermittlung in der Kriminalistik oder Englands brutalste Morde. Im Liegestuhl daneben machte Francis ein kleines Schläfchen.
Jeder von ihnen besaß sein eigenes Talent abzuschalten.
Doch an diesem Sonntag war alles anders.
Francis zuliebe war Daphne nachts um vier Uhr aufgestanden, mit Haaren wie ein zerstrubbeltes Dünenkaninchen. Er hatte eine Überraschung angekündigt.
Es war noch dunkel, als er mit ihr nach Land’s End fuhr, dem westlichsten Zipfel Englands. Während der Autofahrt sah Daphne vom Beifahrersitz aus, dass sein Gesicht in leiser Vorfreude strahlte. Seine dunkelblonden Haare mit den ersten grauen Fäden waren durch die Eile nicht weniger zerstrubbelt als ihre. Erst als er eine alte CD aus dem Fach in der Autotür fischte und sie einlegte, begann sie zu begreifen, warum sie hier im Auto saß. Es war rührend. Er spielte Ronan Keatings Schmusesong When You Say Nothing At All, die Schnulze, bei der sie vor achtundzwanzig Jahren während einer Strandparty bei Land’s End zum ersten Mal getanzt hatten. Daphne war wegen mehrerer hässlicher Pickel am Kinn nicht gerade gut drauf gewesen, ihm war ein verletzter Arm abgespreizt und eingegipst worden. Beide hatten sie in dem Gefühl getanzt, wegen ihrer Unvollkommenheit wenigstens an diesem Abend füreinander geschaffen zu sein.
Daphne beugte sich zum Lenkrad hinüber und gab Francis einen Kuss auf die Wange. «Wie süß, dass du daran gedacht hast! Wieso eigentlich? Wir haben den Tag sonst nie gefeiert.»
«Ich hatte eine kleine Gedankenstütze», sagte er stolz, während er auf die Schnellstraße nach Penzance einbog. «Brian Readfields schöner Oldtimer ist an diesem Tag zum ersten Mal zugelassen worden.»
Sie wollte schon Protest anmelden, als ihr strafmindernd einfiel, dass sie selbst nur deshalb an ihre silberne Hochzeit gedacht hatte, weil ihre Kosmetikerin ihr kurz vorher für fünfundzwanzig Jahre Treue gedankt hatte.
Das Wichtigste war, dass Francis den Tag nicht vergessen hatte. Er machte es spannend.
Erst als sie im ersten Dämmerlicht bei Land’s End parkten, rückte er damit heraus, was Daphne hier erwartete. Sie musste zugeben, dass es etwas Großes war. Sein Geschenk war romantisch – ein Sonnenaufgangspicknick an den Klippen. Er hatte alles gut geplant. Während sich über dem Plateau der Himmel erhellte, als würde man langsam einen Dimmer aufdrehen, zauberte er voller Stolz einen Picknickkorb und die blaue Familiendecke aus dem Kofferraum. Der Korb stammte von Colonel Waring, Daphnes englischem Großvater. In ihm hatte bereits die Wildschweinpastete gelegen, die König George VI. dem Colonel nach einer Jagd in Sandringham geschenkt hatte. Später wurde das leere Pastetenglas in der Familie behandelt, als wäre es der Hosenbandorden.
«Ich ahne, wo du hinwillst», rief Daphne freudig. Sie hätte gewettet, dass Francis sie nach Seal Head führte, wie der Platz unter Kennern hieß, die Bucht mit den meisten Seehunden. Kaum hatte man dort zweimal in sein mitgebrachtes Sandwich gebissen, streckte unten im Meer schon die nächste Robbe den Kopf aus dem Wasser.
«Jedenfalls werden wir gleich ziemlich allein sein», versprach Francis. «Den Platz kennt kaum einer.»
Gut gelaunt schnappten sie ihre Sachen, verließen den Parkplatz und das Gelände des Besucherkomplexes mit dem angeschlossenen Hotel und folgten dem sandigen Pfad zu den zerklüfteten Klippen. Dort bog Francis nach links ab. Natürlich wollte er nach Seal Head.
Gerade als sie den Klippenrand erreicht hatten, dreißig Meter über der Brandung, stieg die Morgenröte aus dem Meer. Es war ein erhabener Augenblick.
«Wir sind keine Minute zu früh», sagte Francis. «Schnell, die Decke!»
Eilig breiteten sie die Decke aus und ließen sich darauf nieder. Eng aneinandergelehnt, die Knie umschlungen, warteten sie auf das Spektakel.
Es war noch eindrucksvoller, als Daphne es in Erinnerung hatte. Sie hörten, wie unten die Wellen rauschten. Während am Horizont in rötlichen Streifen die Sonne aufging und Land’s End in unwirkliches Licht getaucht wurde, drehte sich plötzlich der Wind, als hätte er einen neuen Befehl erhalten. Jetzt bogen sich die Gräser neben ihnen in eine andere Richtung. Plötzlich roch die Luft nach einer Mischung aus Seetang, Muscheln und den Hagebutten auf der Heide hinter den Klippen. Das Meer begann, silbrig zu glitzern. Für ein paar Sekunden glaubte Daphne, im Meeressilber die Flossen stöbernder Haie zu sehen. Aus den Nischen im Gestein lösten sich Sturmvögel, um zu den kahlen Felsen der kleinen Insel Carn Bras hinüberzufliegen.
Seit ihrem achten Lebensjahr hatte Daphne den Sonnenaufgang bei Land’s End nicht mehr erlebt. Für Sekunden sah sie sich wieder in ihrem geblümten Kinderkleid im Wind auf den Klippen stehen, gut festgehalten von ihrer Mutter. Mum hatte sich ihr seidenes Kopftuch umgebunden, ein Weihnachtsgeschenk von Mrs. du Maurier …
Damals war man fast immer allein hier oben gewesen.
Jetzt nicht mehr.
Männerstimmen in den Klippen unter ihnen, ein Poltern von Steinen, dazwischen das ohrenbetäubende Aufklatschen einer Riesenwelle an die Felswand. Jemand versuchte, Möwenschreie zu imitieren, leider eher krähend und ungeschickt.
«Touristen», flüsterte Francis und legte einen Zeigefinger auf die Lippen.
Daphne ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie beugte sich etwas vor und lauschte. Zu sehen war noch niemand, aber eine der Stimmen tönte besonders markant.
«Klingt nach Eddie Fernbroke.»
«Oh Gott», sagte Francis entsetzt. «Es ist ja Basstölpel-Woche!»
In seiner Vorfreude hat er es vergessen. Jedes Jahr im August zählten Vogelfreunde die jungen Basstölpel in den Klippen von Land’s End. Die gannets wurden groß wie Gänse und verbrachten die meiste Zeit ihres Lebens segelnd über dem Meer.
Eddie krabbelte auf allen vieren nach oben. Sein rotbackiges Gesicht strahlte. Wie immer auf seinen Exkursionen waren der Rucksack, die Tweedjacke und seine Hose in graugrünen Tarnfarben gehalten. Wind und Wetter hatten seinen Teint braun gegerbt. Daphne mochte ihn, nur seine Vogelmanie war manchmal anstrengend.
«Einen fröhlichen Basstölpel-Morgen!», rief Eddie gut gelaunt.
Daphne und Francis winkten ihm vom Sitzen aus freundlich zu. «Hallo, Eddie!»
In der Hand trug er ein zerfleddertes leeres Nest, an den Schuhen klebte jede Menge Vogelkot. Er schien kein bisschen überrascht zu sein, dass hier jemand schon morgens um sechs auf der Decke saß. Um seinen Hals hingen Kamera und Fernglas, im Gürtel steckte ein zusammengeklapptes Stativ. Da ihm die Mostkelterei in Par gehörte, beulten Äpfel seine rechte Tasche aus.
«Wart ihr gestern auch erfolgreich?», wollte er wissen.
«Wir starten gerade erst», sagte Daphne diplomatisch.
«Hör zu, Eddie», begann Francis vorsichtig. «Daphne und ich hatten uns dieses Plätzchen gerade …»
«Warte, ich muss euch was erzählen», sagte Eddie, während er sich gemütlich neben Francis auf der blauen Decke niederließ. «Es gibt eine Sensation!»
Daphne und Francis nahmen es mit Humor. Eddie war kein normaler birdwatcher, ein Vogelbeobachter, wie sie am Wochenende zu Hunderten mit baumelnden Ferngläsern Cornwall durchstreiften. Eddie Fernbroke war die fanatische Ausgabe davon – ein birdspotter. Und er redete gerne darüber. Mit detektivischem Ehrgeiz war er bis nach Schottland gefahren, um den einzigen Alpenbirkenzeisig zwischen Glasgow und Inverness zu fotografieren, und er hatte fluchtartig die Taufe seiner jüngsten Tochter verlassen, weil jemand in Wald von Helford einen Trauerschnäpper gesichtet hatte.
«Ich wette, ihr werdet nicht draufkommen, wen ich gestern vor der Linse hatte», sagte er genüsslich, während er sich Daphnes kleines Sitzkissen unten den Hintern schob.
«Irgendwelche Nester?», versuchte Daphne zu raten. «Bodenbrüter?»
«Kalt», sagte Eddie. «Ganz kalt. Ich sage nur: gelbbraunes Köpfchen und graues Nackenband.»
«Wir passen», antwortete Francis, damit die Sache nicht zu lange dauerte. Gegen einen Vogel-Paparazzo hatte man keine Chance.
«Einen Kernbeißer!» Eddie blickte sie triumphierend an. «Ein Kernbeißer auf Land’s End! Wie ist das denn?»
«Wahrscheinlich hatte er nur sein Navi vergessen», spottete Francis, um Eddie aufzuziehen.
Sie lachten. Es war das laute, herzliche Lachen der kornischen Männer, wenn sie auf jemanden trafen, den sie schätzten.
Daphne schaute irritiert zum Himmel. Obwohl der Wind nur eine mäßige Brise war, bekam sie wie aus dem Nichts eine Gänsehaut. Es war seltsam. Der kalte Hauch kühlte sie innerhalb von Sekunden aus – vielleicht lag es daran, dass sie noch nichts gefrühstückt hatte. Da Eddie keinerlei Anstalten machte, wieder zu verschwinden, beschloss sie, schnell zum Auto zu laufen und ihre Strickjacke zu holen. Vermutlich würde es nachher auf ein Picknick zu dritt hinauslaufen.
Der Autoschlüssel lag neben den Pasteten im Picknickkorb. Sie nahm ihn heraus, ohne dass die Männer es mitbekamen. Dann ging sie auf dem Trampelpfad zum Parkplatz zurück. Unter keinen Umständen wollte sie krank werden. Seit vergangener Woche waren zwei ihrer Kollegen bei der Royal Mail ausgefallen, sodass sie und Bridget Collins die Post für Fowey vorerst allein austragen mussten.
Das Auto stand in der Nähe des Besucherzentrums. Hastig schloss Daphne den Wagen auf, setzte sich auf den Beifahrersitz und griff nach ihrer dicken Strickjacke auf der Rückbank. Für einen Moment spürte sie die Verlockung, hier gemütlich sitzen zu bleiben und auf Francis zu warten, aber es wäre unfair gewesen. Er war ihretwegen hierhergefahren. Als sie im Innenspiegel ihre zerwehten braunen Haare betrachtete, stellte sie zum ersten Mal seit ihrem fünfzigsten Geburtstag fest, dass die Poren auf ihrer Stirn nicht mehr so fein waren wie früher. Aber vielleicht kam das auch nur vom Frieren, tröstete sie sich.
Um die Rückkehr in den Wind noch etwas hinauszuzögern, zog sie die Jacke im Sitzen an. Sie war gerade dabei, die Knöpfe zu schließen, als in der rechten Tasche ihr Handy klingelte. Sie erkannte die Nummer ihrer Cousine Annabelle Carlyon. Sie war drei Jahre jünger als Daphne und arbeitete als Gartendesignerin.
«Hallo, Annabelle! Hast du Schlafstörungen?»
Normalerweise gab Annabelle sofort eine passende Bemerkung zurück, doch diesmal klang ihre Stimme aufgeregt. «Daphne – ich brauche dich! Er ist tot! Er liegt vor meiner Haustür und ist tot!»
«Wer?» Daphne war irritiert. Erst dachte sie an Annabelles zauseligen Kanarienvogel, aber den hatte ja im Juni eine Katze verspeist. Über einen neuen Lover sprach Annabelle sicher auch nicht, von ihm hätte sie längst erzählt.
«George Huxton. Jemand hat ihn vor meine Tür gelegt. Er ist in Papier eingewickelt.»
«In Papier?», fragte Daphne ungläubig.
«Ja, in rotes Geschenkpapier. Wie das, mit dem du zu Weihnachten die Vase für mich verpackt hast.»
«Hast du was getrunken?»
«Nein! Glaub mir, er liegt da. Nur seine Füße und sein Kopf mit den blutigen Haaren schauen raus.» Ihre Stimme wurde panisch. «Oh Gott, jetzt kreisen schon die Möwen über ihm! Bitte lass mich nicht im Stich!»
Es klang so flehentlich, dass Daphne keinen Zweifel mehr an Annabelles Beschreibung hatte. George Huxton war ihr unmittelbarer Nachbar, unverheiratet, Mitte fünfzig, das größte Ekel in der Straße. Seit zwei Jahren hatte er ihr und anderen in der Nachbarschaft nichts als Ärger gemacht.
«Hast du die Polizei gerufen?»
«Ja. Sie werden gleich hier sein. Das Mädchen am Telefon hat mich allen Ernstes gefragt, ob ich heute Geburtstag habe. Sie dachte, es sei ein Scherz.»
«Ganz ruhig, Annabelle. Wie hast du es …» Sie korrigierte sich, um nicht pietätlos zu klingen. «… ihn … bemerkt?»
«Als ich die Haustür aufgemacht habe, um die Zeitung reinzuholen. Ich wäre fast über ihn gestolpert.» Daphne hörte, wie ihre Cousine heftig an eine Fensterscheibe klopfte, wahrscheinlich um die Vögel zu verscheuchen. «Weg mit euch!»
«Annabelle? Das klingt nach Mord. Du darfst auf keinen Fall was anfassen. Hörst du?»
«Das weiß ich selbst», stöhnte Annabelle. «Dachtest du, ich will Huxton auspacken?»
«Ich versuche, so schnell wie möglich bei dir zu sein», versprach Daphne. «Wir sind seit Sonnenaufgang bei Land’s End. Ich fahre sofort los.»
«Gut. Was soll ich so lange tun?»
«Mach dir einen Tee.» Daphne fiel nichts Besseres ein. Auf keinen Fall durfte Annabelle jetzt das Haus verlassen. «Und schau nicht mehr aus dem Fenster. Versprichst du mir das?»
«Ich verspreche es.»
«Dann bis gleich.»
Daphne sprang aus dem Auto und rannte quer über die Heide zu ihrem Picknickplatz zurück. Francis war gerade dabei, die Flasche Cider aus dem Korb zu ziehen, um sie zu öffnen, während Eddie ein großes Stück Cheddar-Käse aus seinem Rucksack gezaubert hatte. Zwei fröhliche Jungs auf Klassenausflug.
Daphne blieb nichts anderes übrig, als ihnen die Stimmung zu verderben. Hastig erklärte sie die Situation. Francis war ebenso schockiert wie sie. Er mochte Annabelle sehr und bewunderte, wie sie sich allein und ohne fremde Hilfe als erfolgreiche Gartendesignerin etabliert hatte. Außerdem erinnerte sie ihn an seine verstorbene Schwester.
«Wie geht sie damit um?», fragte er besorgt.
Eddie war so taktvoll, seinen leckeren Cheddar auf die Decke zurückzulegen und schweigend zuzuhören.
«Noch behält sie die Nerven, aber du weißt ja – mit den Vernehmungen wird sich das ändern», antwortete Daphne. Sie sprach aus eigener Erfahrung mit der Polizei.
«Dann lass uns zusammenpacken.»
Entschlossen zog Francis den Picknickkorb zu sich heran, doch Daphne hielt ihn davon ab. «Nein, warte. Lass mich allein fahren.»
Wie sie ihre Cousine kannte, würde Annabelle sich in Gegenwart von Francis unnötig gezwungen sehen, eine Fassade aufzubauen. Mit Daphne war sie aufgewachsen, bei ihr konnte sie loslassen. Auch ein anderer Gedanke war Daphne unangenehm. Obwohl Francis wusste, dass sie mit Anfang zwanzig ein kurzes Verhältnis mit Detective Chief Inspector Vincent gehabt hatte, der damals noch ein junger Constable gewesen war («Nur sieben Tage, Francis, aber die größte Zeitverschwendung meines Lebens!!!») und obwohl Francis damit völlig entspannt umging, sah sie es nicht gern, wenn die beiden öfter als notwendig aufeinanderstießen.
Außerdem hatte Francis um zehn Uhr einen wichtigen Termin bei Lady Wickelton, den er unter keinen Umständen verpassen durfte. Die alte Dame plante, dem Hafenamt ihre Villa zur Einrichtung eines Schiffsmuseums zu vermachen. Ihr Gesprächspartner sollte Francis sein. Als zuständiger Flussmeister für den River Fowey schien er ihr am ehrlichsten die Bedürnisse des Hafens zu vertreten.
Schließlich gab Francis nach, und Eddie Fernbroke bot an, ihn später nach Fowey mitzunehmen.
Erleichtert lief Daphne zurück zum Parkplatz, gedanklich schon bei Annabelle. Die nächsten Stunden würden für ihre Cousine schwer werden. Sobald der polizeiliche Marathon aus Fragen und Beweissicherungen begonnen hatte, wurden aus Menschen Tatverdächtige und aus Dingen des Alltags Indizien.
Die Strecke nach Fowey raste sie mit überhöhtem Tempo zurück. Einmal überfuhr sie ein Stoppschild, in zwei Kurven hatte sie Mühe, den Wagen in der Spur zu halten. In Kinofilmen konnten alle auf zwei Rädern fahren, nur bei ihr funktionierte es nicht, stellte sie selbstironisch fest. Währenddessen wählte ihr Telefon die private Telefonnummer von Chief Inspector Vincent. Obwohl er und sie bei jeder Begegnung zuverlässig aneinandergerieten, hatte er ihr kürzlich seine alberne private Visitenkarte mit den zwei gekreuzten Jagdhörnern aufgedrängt.
Es sprang nur die Mailbox an, begleitet von James Vincents snobistischem Hinweis, man habe ihn leider verpasst. Daphne vermutete, dass er gerade irgendwo bis zu den Knien im Moor stand, um Enten zu schießen, wie meistens am Sonntagmorgen. Aber wenigstens konnte er dann auch nicht Annabelles Leiche auswickeln, dachte sie boshaft.
Als sie in Fowey ankam und in Annabelles Straße einbog, entdeckte sie schon von weitem die beiden Polizeiwagen. Sie wirkten wie Störenfriede in der verschlafenen Sonntagsruhe des Küstenortes. Foweys Häuser erstreckten sich über einen Hang am River Fowey, vom Hafen bis hinauf zum Kamm mit den malerischen Zedern. Während Daphne und Francis weiter oben wohnten, lag Annabelles Haus und das ihres Nachbarn George Huxton in einer ruhigen Wohnstraße unten am Fluss, nur durch einen breiten Wiesenstreifen vom Ufer getrennt.
Vor Annabelles Haus sperrten zwei junge Polizisten das Areal mit Bändern ab. Einer war Mark Ripley, mit dem Daphnes Tochter in den Kindergarten gegangen war. Von Dr. Fouls, dem Polizeiarzt, und von Chief Inspector Vincent war weit und breit nichts zu sehen. Daphne hatte es nicht anders erwartet. Sich in Cornwall am Wochenende ermorden zu lassen, war eine schlechte Idee.
Als sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte und ausstieg, grüßte Constable Ripley mit ernstem Gesicht zu ihr hinüber. Er wusste, dass Daphne und Annabelle Cousinen waren. Beklommen überquerte Daphne die Straße und ging die drei Stufen zum Eingangsbereich des Hauses hinauf. Annabelle hatte das einst unansehnliche Gebäude mit weiß lackiertem Holz verkleiden lassen. Sie nannte es ihr Küstenhaus. Die Fenstersimse, die Läden und die Haustür hatten die gleiche grüne Farbe wie der Sockel des Pendeen Lighthouse, des weißen Leuchtturms bei Land’s End. Entlang der Hauswand hatte Annabelle in Steintrögen Zauberglöckchen und Begonien gepflanzt. Rechts befand sich der Eingang zum Garten. Den Bereich davor, die Stelle mit dem Toten, hatte die Polizei diskret mit zwei transportablen Paravents umstellt.
Mark Ripley sprach Daphne höflich an, als sie auf ihn zukam.
«Gut, dass Sie da sind, Mrs. Penrose», sagte er. «Miss Carlyon ist ziemlich fertig. Bitte gehen Sie ganz am Rand entlang durch den Garten auf die Terrasse, die Spurensicherung müsste gleich hier sein. Und ziehen Sie das hier an.» Er drückte ihr ein paar blaue Wegwerf-Überzieher für die Schuhe in die Hand. Auch er selbst trug welche.
«Natürlich, Mark.» Sie stülpte das dünne Material über ihre Wanderschuhe. So etwas gab es nur in Fowey. In der Anonymität einer Großstadt hätte kein Polizist jemanden vor der Spurensicherung hineingelassen. Mutig geworden, zeigte sie auf den Paravent.
«Meinen Sie, ich darf vorher kurz …»
Er nickte und schob die vordere Abtrennung ein Stück zur Seite. Es war nicht das erste Mal, dass sie einen Toten zu Gesicht bekam. Sie war auf einiges gefasst.
Doch was sie jetzt zu sehen bekam, war so skurril, dass sie vor Schreck starr stehen blieb.
Die Leiche von George Huxton lag nur ein paar Schritte von der Haustür entfernt. Wie eine Mumie war sie vom Hals bis zu den Knöcheln in glänzendes rotes Geschenkpapier gewickelt. Nur Huxtons Kopf mit den blutverschmierten Haaren und die hellbraunen Slippers an den Füßen waren zu sehen.
Als würde das Geschenkpapier noch nicht genug aussagen, hatte der Mörder sein Opfer wie ein wertvolles Präsent mit breitem goldfarbenem Geschenkband eingeschnürt. Über dem Bauch war es elegant zu einer gigantischen Doppelschleife gebunden. Unter der Schleife klemmte eine beigefarbene Karte, wie man sie gerne mit einem Gruß zu Geburtstagen verschenkte. Die Buchhandlung in Fowey führte solche Karten seit Jahren. Mit einem roten Herzen versehen, trug sie die Aufschrift Für Dich.
Darunter stand mit lilafarbener Tinte, in perfekter kalligraphischer Schrift:
Liebe Annabelle,
ich schenk Dir einen Toten.
Jetzt wird Dir niemand mehr das Leben schwermachen.
Zu Daphnes besonderem Entsetzen klebte in der rechten oberen Ecke der Karte der kleine Aufkleber der Royal Mail mit der königlichen Krone, als hätte der Mörder für sein Paket Porto bezahlt.
Nur weil sie sich traute, ein zweites Mal zum Kopf des Toten zu schauen, bemerkte sie den hellen Streifen an seinem faltigen Hals, ein dünnes Stück weißen Kunststoff. Sie erkannte sofort, worum es sich handelte. Es war ein mit großer Brutalität zugezogener Kabelbinder, dessen freies Ende unter dem Kragen des Hemdes klemmte.
Schockiert blickte Daphne von den starren Augen des Toten auf.
Hinter der Fensterscheibe der Küche entdeckte sie das verheulte Gesicht von Annabelle.
2
Es gibt Dinge, die unsagbar sind.
Darum haben wir Kunst.
Leonora Carrington
Um kurz vor zehn war Francis wieder in Fowey.
Während der Autofahrt hatte Eddie Fernbroke so lange über das Verhalten von Nachtigallen in der Mauser doziert, dass Francis am Ende nur noch widerstandslos nicken konnte. In Wirklichkeit dachte er ununterbrochen an Daphne und Annabelle. Aber Eddie war eben ein Freak. Selbst als er einmal in Falmouth dem Prinzen von Wales vorgestellt worden war, hatte er plötzlich das Foto eines Säbelschnäblers aus der Tasche gezogen und es dem verblüfften Royal in die Hand gedrückt.
Als sie am Schaufenster des Tourismusbüros vorbeifuhren, entdeckte Francis die neuen Plakate der Gemeinde. Darauf wurde mit witzigen Wortspielen erklärt, dass man den Ortsnamen Fowey kurz und prägnant wie Foy aussprach. Am Aquarium vorbei ging es schließlich hinauf zu Lady Wickeltons viktorianischer Villa. Kaum waren sie dort angekommen, schien Eddie noch einmal beweisen zu wollen, dass er sich auch für die Sorgen von Francis interessierte. Doch es wurde eher ein kritischer Kommentar.
«Noch mal wegen George Huxton …», begann er. «Ich wollte es nicht vor Daphne sagen, aber er war ein ziemlicher Widerling. Sorry, das ist nun mal die Wahrheit.»
«Du kanntest ihn?», fragte Francis überrascht. Er selbst hatte mit George Huxton zweimal im Hafen zu tun gehabt, was anstrengend genug gewesen war. Huxton hatte beantragt, dass auf dem jährlichen Hafenfest keine lärmenden Bands mehr auftreten sollten, weil er die Musik bis zu seinem Haus hören konnte.
«Was heißt schon kennen?», fragte Eddie zurück. «Keiner kannte ihn. Er war ein Einzelgänger und Streithammel. Wollte krankhaft alle kontrollieren. Ich hab ihm mal sein Luftgewehr abgenommen, weil er auf Kaninchen geschossen hat.»
«Wo war das?»
«Hinter seinem Garten.» Seine Stimme wurde gedämpfter, als säße hinter ihnen jemand im Auto, der mithören konnte. «Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, fragt Sally Inch, sie kannte ihn sehr gut. Aber das weiß sonst keiner. Ich hab’s von meiner Schwester.»
«Danke», antwortete Francis, während er die Beifahrertür öffnete und seine Füße aus der Enge des Wagens nach draußen schob. Für sich selbst speicherte er die interessante Frage ab, wie es sein konnte, dass sich Sally als angesehene Möwenforscherin mit einem Mann wie George Huxton abgegeben hatte.
Eddie hupte zweimal und fuhr los, die Gasse zum Herrenhaus der Treffrys hinauf, hinter dem sein Bungalow stand.
Nachdenklich öffnete Francis das Holztor in der Granitmauer. Es war der Hintereingang, den nur Freunde von Lady Wickelton benutzen durften. Auf den obersten Mauersteinen wuchsen Moos und Gräser. Vom Tor führte ein Plattenweg bis zur Rückseite der Villa. Bis man dort war, wanderte man durch Lady Wickeltons berühmten Garten. Berühmt deshalb, weil sie die Blütenpracht jeden Sommer für vier Wochen der Öffentlichkeit vorstellte und damit Geld für junge Künstler sammelte.
Wickelton House war ein Gebäude aus viktorianischer Zeit, zweistöckig, aus hellbraunem Backstein. Sämtliche Fenster der Villa waren mit weißen Steinen umrahmt, die ihr etwas sehr Vornehmes gaben. Vor der Terrasse hatte der Architekt das Haus im Erdgeschoss mit einem halbrunden Erker versehen, darüber lag, mit einem ebenso großen Erker, Dorothy Wickeltons Atelier. Sie arbeitete als Illustratorin.
Francis war lange nicht mehr hier gewesen. Es hatte sich viel verändert. Die Dahlien, Rosen und Hortensien in den Beeten waren verblüht und danach nicht mehr geschnitten worden. Mitten auf den Platten stand eine Schubkarre mit verrottetem Unkraut, dem Schimmel nach musste sie schon länger hier vergessen worden sein. Am schlimmsten sah der Bereich entlang der Gartenmauer aus, an der sonst gigantisch großes Gemüse wuchs. Francis musste daran denken, wie Dorothy Wickelton dieses Phänomen einmal das wahre Geheimnis der blühenden Gärten Cornwalls genannt hatte, den sonnenerwärmten walled garden.
Auf dem Weg zwischen Mauer und Haus stach hinter Chrysanthemen die dunkelrot gestrichene Hütte hervor, in der während der Sommermonate Mrs. Hackett wohnte, Lady Wickeltons Betreuerin. Eigentlich stand ihr in der Villa ein komfortables Zimmer zur Verfügung, doch die eigenwillige Mrs. Hackett hatte darauf bestanden, bis zum Herbst in der Hütte zu schlafen. Vermutlich wollte sie nachts nicht von Lady Wickelton mit Extrawünschen belästigt werden.
Vorsichtig klopfte Francis an die Glastür zur Küche. Sie war nur angelehnt, wie meistens. «Lady Wickelton?»
Niemand antwortete.
«Lady Wickelton? Darf ich reinkommen?»
Er öffnete die Tür, schob die flatternde Gardine beiseite und trat in die Küche. Sie war bewusst unauffällig eingerichtet, mit grauen Hängeschränken und einem schlichten Holztisch in der Mitte. Francis musste daran denken, wie Daphne ihn hier vor zwanzig Jahren bei den Wickeltons eingeführt und ihm dabei leise erklärt hatte, dass die Hausherrin sich nur von wenigen Menschen duzen ließ. Es war einfach ihr Stil. Daphne gehörte zu den Privilegierten, weil Dorothy sie schon als Kind gekannt hatte. Dorothys verstorbener Mann, der Anwalt Sir Harold Wickelton, hatte die Villa vor über vier Jahrzehnten durch Vermittlung von Mrs. du Maurier erworben. In den ersten Jahren waren die Wickeltons noch regelmäßig zwischen London und Fowey gependelt. Erst kurz vor Harolds Tod vor fast zehn Jahren hatten sie sich ganz hier niedergelassen.
Lady Wickelton war eine Berühmtheit. Ihre Anfänge als Illustratorin gehörten der Graphik. Dann hatte sie ihr erstes eigenes Kinderbuch geschrieben und es auch selbst illustriert. Es hieß Lily Loveday und wurde ein Welterfolg. Die Geschichte des kleinen Mädchens, das von allen im Stich gelassen worden war und ganz allein im New Forest das Vertrauen der Tiere gewinnen musste, rührte jeden an. Fast zwei Dutzend Kinderbücher folgten. Mit Anfang siebzig erlitt Lady Wickelton einen Herzinfarkt, gab ein letztes Interview und hörte freiwillig auf, ein Zirkuspferd für die Medien zu sein. Jetzt, mit fast achtzig, war sie nur noch eine Legende.
Francis öffnete die Schiebetür zum Wohnzimmer. Erleichtert stellte er fest, dass hier noch alles unverändert war. Dorothy Wickelton hatte den Raum mit der hohen Decke überwältigend kreativ eingerichtet, mit farbigen italienischen Möbeln, selbst entworfenen Stühlen aus Nussholz, modernen französischen Leuchten und einer frechen Sitzecke im Zebradesign. Niemals hätte man vermutet, dass hier eine achtzigjährige Frau lebte. Die Wand gegenüber dem Fenster war hellblau gestrichen. Überall hingen Zeichnungen, Skizzen und Gemälde, teils von Lady Wickelton selbst, teils von Künstlern aus ihrem Freundeskreis. Es war ein so phantasiereiches stilistisches Durcheinander, dass man nie wusste, was man zuerst bewundern sollte.
Ihr blauer Ohrensessel hatte seinen Platz in der Mitte des Erkers, mit dem Blick in den Garten. Auf der umlaufenden Fensterbank zu Füßen der Fensterflügel stapelten sich Bücher, vor allem Bildbände und Biographien. Der Sessel stand halb schräg mit der Rückseite zu Francis.
«Lady Wickelton?»
Das Parkett unter seinen Füßen knarrte. Von der Seite konnte er ihre welken Füße in den weißen Seidenpantoffeln und den eleganten roten Kimono über den Knien sehen, ihr Lieblingsgewand. Da er vermutete, dass sie schlief, näherte er sich dem Sessel auf Zehenspitzen. Erst als er neben ihr stand, stellte er fest, dass sie Kopfhörer trug und Musik hörte. Die Augen hielt sie geschlossen. Er glaubte, Töne von Rachmaninow zu erkennen. Ihre immer noch markanten Gesichtszüge und das weiße Haar gaben ihr etwas Vornehmes. Früher war es eine schwarze, hochgesteckte Frisur gewesen, mit der man sie oft in Zeitschriften gesehen hatte, gefeiert als Großbritanniens berühmteste Buchillustratorin.
Francis berührte sanft ihren Handrücken, um sich bemerkbar zu machen.
Langsam öffnete Lady Wickelton die Augen, ihre berühmten großen dunklen Augen, die der Hofporträtist Lord Snowdon einmal so magisch fotografiert hatte. Lächelnd beugte Francis sich über sie.
«Guten Morgen, Lady Wickelton.»
Sie brauchte einen Moment, um wieder zu sich zu kommen. Ihre Stimme klang schwach. «Wo ist Mrs. Hackett?», fragte sie murmelnd. Noch schien sie Francis nicht zu erkennen. «Sie hat vergessen, mir die Tabletten zu geben …»
«Mrs. Hackett wird sicher gleich da sein», beruhigte er sie. «Ist alles in Ordnung mit Ihnen?»
Sie stutzte etwas, als würde der Motor in ihrem Alter etwas länger brauchen, bis er vollständig ansprang. Ihre verschlafenen Augen waren immer noch nicht ganz geöffnet.
«Wer sind Sie?»
«Francis.»
«Kenne ich nicht.»
«Ich soll Sie von Daphne grüßen.»
Der Name war wie ein Zauberwort. Mit einem Ruck stemmte Lady Wickelton sich in ihren Pantoffeln ab und setzte sich aufrecht hin. «Francis Penrose?»
«Ja …»
«Ist Daphne auch hier?»
«Nein», sagte er bedauernd. Er wusste, wie sehr sie an Daphne hing. «Aber sie wird morgen bei Ihnen klingeln, wenn sie die Post austrägt.»
Die Haut auf Dorothy Wickeltons schmalen Künstlerhänden war dünn und durchsichtig geworden. Francis erschrak, wie durcheinander sie heute war, so hatte er sie noch nie erlebt. Laut Daphne kam sie meistens selbst zur Haustür, um die Post in Empfang zu nehmen, auch wenn sie einen Gehstock benötigte.
Die Anwesenheit von Francis schien sie noch immer zu erstaunen. «Was machen Sie hier, Francis?»
«Sie haben mich doch eingeladen.»
«Ich? An meinem Musikvormittag?» Sie schüttelte den Kopf. «Nein, ganz bestimmt nicht.»
Francis versuchte, ihrem Gedächtnis sanft auf die Sprünge zu helfen. «Sie hatten mir gestern eine Nachricht geschickt. Ich solle um zehn Uhr hier sein.» Geduldig zog er ihren Brief aus der Jacke und zeigte ihn ihr. «Sehen Sie?»
«Darf ich mal?» Lady Wickelton beugte sich vor, um lesen zu können. Ihre Augen schienen noch gut zu funktionieren. Etwas an dem Brief empfand sie offenbar als befremdlich. «Ja, das ist meine Tinte», sagte sie zögernd. «Aber wann habe ich das geschrieben …?» Sie brach ab und ließ ihren Kopf gegen die Rückenlehne des Sessels sinken. «Es ist grässlich, Francis! Ich vergesse neuerdings so viel. Vor allem, wenn Mrs. Hackett mir nicht pünktlich die Tabletten gibt.»
«Wo steckt denn Mrs. Hackett?»
«Sie wird wieder mal verschlafen haben», sagte Lady Wickelton unwillig. «Heute Morgen musste ich mich ganz allein die verdammte Treppe runterquälen.»
«Wenn ich irgendwas für Sie tun soll, Lady Wickelton – sagen Sie es mir.»
«Danke.» Die alte Dame musterte ihn. Francis konnte sehen, wie sie sich dabei straffte. Ihr eiserner Willen war berühmt. «Aber Sie sind ja wegen etwas anderem hier. Wegen des neuen Museums, nehme ich an.»
Immerhin war ihr das wieder eingefallen. Dankbar nahm Francis das Stichwort auf. «Sie müssen diesen Vertrag nicht abschließen, Lady Wickelton. Nur wenn Sie sich wirklich gut dabei fühlen. Das ist auch Captain Steeds Meinung.»
«Wer soll mein Haus denn sonst bekommen?», fragte Dorothy müde. «Kinder habe ich nicht, Harold lebt nicht mehr und meine Buchrechte erhält eine Stiftung. Also – warum soll die Villa nicht an die Hafengesellschaft gehen? Eigentlich habe ich es ja längst entschieden.»
Es war ein Thema, das schon seit zwei Jahren in der Luft lag. Dorothy Wickelton selbst hatte es aufgebracht, als im Stadtrat über ein Schifffahrtsmuseum für Fowey diskutiert worden war. Wie sooft mangelte es dafür an Geld und an einem geeigneten Standort. Foweys natürlicher Hafen war bereits seit dem 13. Jahrhundert berühmt. Nicht nur, dass er früher Cornwalls wichtigster Umschlagsplatz für Fisch, Zinn und Wolle gewesen war. In ihm hatten sich auch Piraten versteckt, er hatte Kaperern Schutz geboten und an seinen Docks Englands Kriegsschiffe beherbergt. Es gab viel darüber zu erzählen.
«Wie haben Sie sich die Regelung denn vorgestellt?», fragte Francis. «Captain Steed erwähnte eine Schenkung noch zu Ihren Lebzeiten.»
Lady Wickelton nickte. «Ja. Mein Anwalt hat Vorschläge dazu ausgearbeitet. Ich möchte, dass der Hafen das Museum einrichten kann, sobald ich mich vom Acker gemacht habe.»
Sie liebte drastische Formulierungen. Francis verzog gequält das Gesicht, versuchte aber mitzuspielen. «Noch ist Ihr Acker hier», sagte er. «Und Sie sollten ihn möglichst lange genießen. Das wünscht sich jeder in Fowey.»
«Kann schon sein», antwortete sie. «Aber es macht keinen Spaß mehr.»
Er versuchte, sie bei ihrer Ehre zu packen. «Lassen Sie deshalb den Garten verwildern? Er sieht aus wie die vertrockneten Felder in Ihrem Kinderbuch Der faule Farmer Finn.» Er nahm ihre schmal gewordene Hand. «Was ist los, Lady Wickelton?»
«Es geht eben nicht mehr.» Sie klang nicht, als ob sie wirklich etwas dagegen unternehmen wollte. «Meine Kräfte lassen nach. Würde Ihnen das Spaß machen?»
«Haben Sie Schmerzen?»
«Nur wenn ich mich ärgere», sagte sie trotzig. Als würde sie ihren Ärger ausschließlich mit ihrer Betreuerin in Verbindung bringen, blickte sie zornig in Richtung Küche. «Wo bleibt denn Mrs. Hackett? Sie macht mich noch wahnsinnig.»
«Soll ich mal nach ihr schauen?»
«Bitte, tun Sie das. Danach binden wir sie in der Küche fest, damit sie uns einen frühen Lunch zubereitet.»
Francis war erleichtert. Wenigstens ansatzweise hatte ebenjene Lady Wickelton durchgeklungen, wie er sie von früher gekannt hatte.
Er ging in den Garten, folgte einem mit Gras überwucherten Kiespfad und landete hinter dem Chrysanthemenbeet vor der roten Hütte. Wie er wusste, bestand sie nur aus einem Raum und einem winzigen Bad mit altertümlicher Toilette. Die Wickeltons hatten die Hütte vor Jahrzehnten als Spielhaus für Nachbarskinder errichten lassen, weil sie keinen eigenen Nachwuchs bekommen hatten. Auch Daphne hatte als Schülerin hier übernachten dürfen. Morgens war Lady Wickelton immer mit Bergen von Schokoladen-Sandwiches, Kuchen und Obst erschienen, um den Kindern eine Freude zu bereiten.
Das Schindeldach der Hütte hatte mit den Jahren einen grünen Schimmer angesetzt. Rund um das weiße Fenster blätterte die rote Farbe der Außenwand ab, am Boden wucherte Unkraut. Es war Francis ein Rätsel, wie jemand, der in der Villa ein schönes Zimmer haben konnte, freiwillig hier wohnen wollte. Nachdenklich ging er an der zugezogenen Gardine vorbei um die Hütte herum. Die schmale Eingangstür zeigte windgeschützt zur Mauer.
Francis klopfte. Angeekelt bemerkte er, dass am Türgriff getrocknete Marmelade klebte. Die Sauberste schien Mrs. Hackett nicht zu sein.
«Mrs. Hackett? Schlafen Sie noch? Ich bin’s, Francis Penrose.»
Als er ein zweites Mal klopfte, stellte er fest, dass die Tür nicht fest im Schloss saß und er sie leicht aufdrücken konnte.
«Mrs. Hackett?»
Es dauerte ein paar Sekunden, bis er sich an das Dämmerlicht im Inneren gewöhnt hatte. Er sah ein zerwühltes Bett, Wäschestücke über dem Stuhl, einen Teller mit halb gegessenen Spaghetti auf dem Tisch und eine Tüte voller Tafelsilber daneben. Dann entdeckte er Mrs. Hackett. Sie lag blutbespritzt auf einem Sessel hinter der Tür, mit dem Gesicht zur Seite. Ihre Beine waren auf den Boden gerutscht, nur der Oberkörper und ihre klammernden Hände hatten sich nicht von dem Sessel lösen wollen. Durch das hochgerutschte gelbe Nachthemd waren ihre dicken weißen Oberschenkel zu sehen. Auf den Kelim unter dem Sessel war Blut getropft, bereits geronnen und schwarz.
Entsetzt folgte Francis der Spur des Blutes. Das Rinnsal war aus Mrs. Hacketts angegrauten Haaren gekommen. Wenn Francis nicht schon öfter Tote gesehen hätte, wäre ihm jetzt übel geworden. Die offene Wunde an Mrs. Hacketts Fontanelle war groß wie ein Handteller. Jemand musste mit brutaler Gewalt zugeschlagen haben. Die Erklärung für die Wunde lag vor dem Sessel auf dem Kelim – ein blutbefleckter silberner Kerzenleuchter mit kantiger Unterseite.
Dass Mrs. Hackett noch lebte, war nicht sehr wahrscheinlich. Ihre Augen waren starr, sie atmete nicht mehr. Als er sich wieder aufrichtete, musste er ungewollt auf ein Foto von ihr starren. Es hing hinter dem Sessel an der Wand. Mrs. Hackett trug darauf eine blaue Wanderjacke und blickte mit verkniffenem Gesicht in die Kamera. Glücklich sah sie nicht aus.
Um bloß nichts zu berühren, zog Francis sich bis zur Tür zurück und holte dort sein Handy aus der Tasche. Ihm fielen Annabelle und Daphne ein, die gerade Ähnliches durchmachten. Er hoffte inständig, dass die Polizeistation in St. Austell sonntags genügend Polizisten in Bereitschaft hatte, um sofort hierherzukommen.
Was war nur los in Fowey?
Erst beim Wählen merkte er, dass seine Finger voller Blut waren. Entsetzt erinnerte er sich an den Türgriff mit der getrockneten Marmelade.
3
Jeder Augenblick geschieht zweifach: innen und außen, und es sind zwei unterschiedliche Geschichten.
Zadie Smith
Sonntagsstille war es nicht gerade, die vor Annabelles Haus herrschte. Die ganze Straße war in Bewegung. Wie Ameisen liefen Polizisten hin und her. Überall standen diskutierende Nachbarn, dazwischen ein Reporter, der sie interviewte. Vom Hafen kamen neugierige Touristen, dem verheißungsvollen Klang der Polizeisirenen folgend.
Daphne war überrascht, wie wenig Huxtons Tod bedauert wurde. Eigentlich gar nicht.
Nachdem Detective Chief Inspector Vincent und sein Rechtsmediziner am Tatort eingetroffen waren, durchkämmte jetzt die Spurensicherung sämtliche Grundstücke in der Straße. Die Nachbarn nahmen es gelassen hin. Da es in der vergangenen Nacht keine Auffälligkeiten gegeben hatte und niemand etwas wusste, betrachteten sie DCI Vincents Ermittlungen eher wie Dreharbeiten für einen Film. Daphne musste an den Spruch denken, dass das kornische Naturell in jeder Krise entspannt blieb. So war es auch. Harriet Swindell und ihr Mann sagten sogar ein wichtiges Golfturnier ab, um länger miterleben zu können, wie James Vincents Männer akribisch jedes Beet und jeden Busch untersuchten und selbst kleinste Papierschnipsel aufhoben.
Annabelle tat allen leid. In ihrer burschikosen, empathischen Art war sie überall beliebt. Bedauerlicherweise hatten die versammelten Nachbarn sie seit dem Auftauchen von DCI Vincent nicht mehr zu Gesicht bekommen. Allein Mrs. Brimble hatte für einen Moment das große Glück gehabt, sie weinend durch den Garten gehen zu sehen.
Daphne durfte anfangs nur kurz mit ihrer Cousine reden, im Hausflur. Neben ihnen wartete ein Polizist.
«Bitte setz dich so lange auf die Terrasse», bat Annabelle. «Sie fangen jetzt mit der Vernehmung an. Ich weiß ja nicht, wie lange so was dauert …»
Daphne wusste es, behielt es aber klugerweise für sich. «Bleib geduldig», riet sie stattdessen. «Du hast ein gutes Gewissen. Sag nichts, was du nicht sagen musst. Jedes Wort zu viel kann bei James schnell zu Missverständnissen führen.»
Annabelle nickte dankbar. Sie war blass. «Gut. Auch dass du gleich gekommen bist …» Sie versicherte Daphne, dass sie mit dem Mord absolut nichts zu tun hatte. Sogar ein Rest Humor war ihr geblieben. George Huxton in seiner streitbaren Form sei ihr immer noch lieber gewesen als sein verstörender Anblick im roten Geschenkpapier.
Der Polizist neben ihr räusperte sich. «Der Chief Inspector wartet, Ma’am. In Ihrem Arbeitszimmer.»
Von der Terrasse aus konnte Daphne durch ein Fenster beobachten, wie ihre Cousine von DCI Vincent in die Zange genommen wurde. Er saß mit grimmiger Miene da, sie voller Anspannung. Der Kragen ihres kanadischen Karohemdes unter den lockigen schwarzen Haaren war halb aufgestellt. Annabelle hatte es vermutlich gar nicht bemerkt, aber es wirkte wunderbar kämpferisch.
Um zehn Uhr machte James Vincent eine kurze Vernehmungspause. Mit zugeknöpftem Sakko trat er auf die Terrasse, um Daphne guten Tag zu sagen. Noch bevor sie ihn entdeckt hatte, konnte sie sein Rasierwasser riechen. Ein Duft von herbem Snobismus, den ihm seit Jahrzehnten Fortnum & Mason in London direkt ins Haus lieferte.
«Hallo, James», sagte sie geistesgegenwärtig, als er vor ihr stand. «Alle Enten erledigt? Heute ist doch Sonntag.»
Er ging darüber hinweg. «Guten Morgen. Ich dachte mir schon, dass du hier bist.» Seine Stimme klang vorwurfsvoll. Er deutete auf die blauen Überzieher an ihren Füßen. «Wer hat dich überhaupt reingelassen?»
«Annabelle.»
«Sie hätte lieber einen guten Anwalt anrufen sollen.»
«Sei nicht albern, James», erwiderte Daphne. «Ich bin die Einzige aus der Familie, die Annabelle noch hat. Wie kann ich sie da im Stich lassen?»
«Hat sie keinen Mann?»
«Nein.» Fast hätte Daphne hinzugefügt, dass Annabelles letzter fester Partner, ein Meteorologe aus London, sich als ebenso egoistisch entpuppt hatte wie James selbst vor über dreißig Jahren. Aber sie ließ es. Stattdessen sagte sie mit ruhiger Stimme: «Bitte frag mich, falls du etwas über Annabelle wissen willst. Wir sind als Kinder viel zusammen gewesen und treffen uns auch heute noch oft. Sie ist ein integrer, warmherziger Mensch.»
«Ich werde es mir merken.» Er wollte wieder zurück ins Haus gehen, blieb dann aber noch einmal stehen. Unter dem Revers des dunkelgrünen Tweed-Sakkos steckte ein weißes Tuch, die sandfarbene Hose war sauber gebügelt. Sein längliches Gesicht, die leicht angehobenen Augenbrauen und die zurückgekämmten Haare ließen ihn aussehen wie jemanden, der sich das Treiben der Welt lieber von einem Landsitz aus ansehen würde. Und doch wirkte alles an ihm zu gewollt. Daphnes adliger Freund Sir Trevor Tyndale – aus wirklich royalem Stall – hatte James Vincent einmal so beschrieben:





























