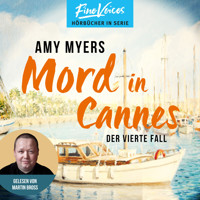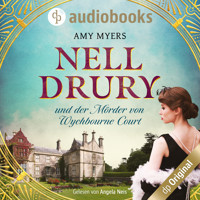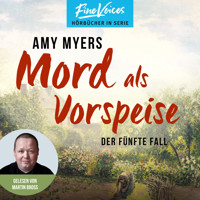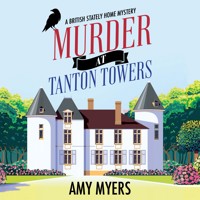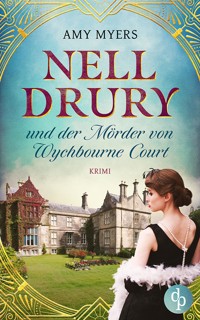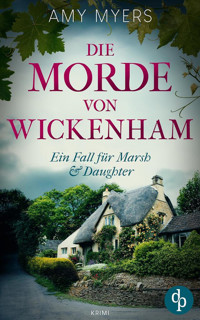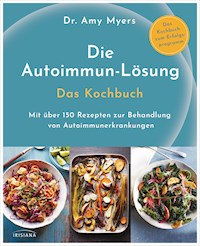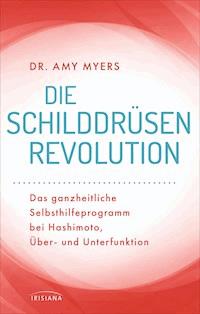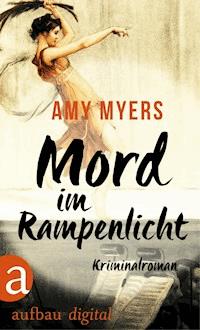8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Didier & Rose ermitteln
- Sprache: Deutsch
Es ist eine prunkvolle Hochzeit im altenglischen Stil. Gefeiert wird sie auf dem Landsitz des Bräutigams, Lord Arthur Montfoy. So hat es sich die Braut, Gertrude Pennyfather, eine reiche Erbin aus Amerika, gewünscht. Sogar der König ist gekommen, und für das Hochzeitsmahl zeichnet Meisterkoch Auguste Didier verantwortlich. Gertrude sieht sich schon als Herrin des prächtigen Anwesens in Kent, träumt von allerlei Reformen und einem Sitz im Londoner Unterhaus. Was sie nicht ahnt: Arthur Monfoy hat den Landsitz bereits vor drei Jahren verkauft. Und noch weniger war vorgesehen, dass man ihn in seiner Hochzeitsnacht an den Maibaum gefesselt und mit einem Pfeil im Herzen finden würde ... Ein neuer Fall für den charmanten Chefkoch und Detektiv Auguste Didier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Amy Myers
Amy Myers wurde 1938 in Kent geboren. Sie studierte an der Reading University englische Literatur, arbeitete als Verlagslektorin und war bis 1988 Direktorin eines Londoner Verlages. Seit 1989 ist sie freischaffende Schriftstellerin. Sie ist mit einem Amerikaner verheiratet und wohnt in Kent. Amy Myers schreibt auch unter dem Namen Harriet Hudson und Laura Daniels.
In ihren ersten Ehejahren arbeitete ihr Mann in Paris, und sie pendelte zwischen London und der französischen Hauptstadt hin und her. Neben vielen anderen Dingen mußte sie nun lernen, sich auf französischen Märkten und den Speisekarten französischer Restaurants zurechtzufinden. Dabei kam ihr die Idee, einen französischen Meisterkoch zum Helden eines klassischen englischen Krimis zu machen: Auguste Didier war geboren. Alle Kriminalromane von Amy Myers erscheinen im Aufbau Taschenbuch Verlag.
Irmhild und Otto Brandstädter, Jahrgang 1933 bzw. 1927, haben Anglistik an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert, waren im Sprachunterricht bzw. im Verlagswesen und kulturpolitischen Bereich tätig. Sie übertrugen Werke von Sean O’Casey, Jack London, John Hersey, Masuji Ibuse, Louisa May Alcott, Charles M. Doughty, John Keane, Joseph Caldwell sowie Historio-Krimis von Amy Myers, Ingrid Parker und Peter Tremayne ins Deutsche.
Informationen zum Buch
Es ist eine prunkvolle Hochzeit im altenglischen Stil. Gefeiert wird sie auf dem Landsitz des Bräutigams, Lord Arthur Montfoy. So hat es sich die Braut, Gertrude Pennyfather, eine reiche Erbin aus Amerika, gewünscht. Sogar der König ist gekommen, und für das Hochzeitsmahl zeichnet Meisterkoch Auguste Didier verantwortlich. Gertrude sieht sich schon als Herrin des prächtigen Anwesens in Kent, träumt von allerlei Reformen und einem Sitz im Londoner Unterhaus. Was sie nicht ahnt: Arthur Monfoy hat den Landsitz bereits vor drei Jahren verkauft. Und noch weniger war vorgesehen, dass man ihn in seiner Hochzeitsnacht an den Maibaum gefesselt und mit einem Pfeil im Herzen finden würde.
Ein neuer Fall für den charmanten Chefkoch und Detektiv Auguste Didier.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Amy Myers
Mord in der Hochzeitsnacht
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Irmhild und Otto Brandstädter
Inhaltsübersicht
Über Amy Myers
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorbemerkung der Verfasserin
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Epilog
Impressum
Vorbemerkung der Verfasserin
Presseberichten zufolge reiste Seine Majestät König Edward VII. am Samstag, dem 29. April 1905, zu einem Privatbesuch nach Paris, und nach seiner Rückkehr tat er befremdlicherweise sein Mißfallen darüber kund, daß die Presse ihn während seines Aufenthaltes auf Schritt und Tritt belagert habe. Dieser Roman enthüllt die Gründe für das Ungehaltensein des Monarchen. Jedoch mußten in meiner Darstellung ein paar geringfügige Abänderungen im offiziellen Programm Seiner Majestät für den Folgemonat vorgenommen werden.
Seine verewigte Majestät ersuche ich, mir dafür Verzeihung zu gewähren. Ferner möchte ich dankbar anmerken, daß ich in Adrian Turners Schuld stehe, der mir einen der wesentlichen Handlungsstränge dieses Romans lieferte. Auch meiner Agentin Dorothy Lumley von der Dorian Literary Agency, die wie üblich mit kundiger Hand unser Schifflein lenkte, gebührt Dank.
Prolog
»Nieder mit den Montfoys; es lebe der Drachen.«
»Red nicht so’n Zeug, Aggie, wir haben noch ’ne Menge zu erledigen.«
Bert Wickman drängte seine eigenen unguten Ahnungen zurück und setzte sich als Vorsitzender des Komitees zur Erhaltung des Wirtshauses »Zum Weißen Drachen« in Positur. Hier ging es um seine ureigenen Interessen, denn er war der Wirt. Allerdings war er völlig Aggies Meinung, soweit es die Montfoys betraf; denen hatte fast ganz Frimhurst gehört, und das schon seit den Zeiten Wilhelms des Eroberers. Auch sein Wirtshaus, dessen Schild im Wappen der Montfoys seinen Ursprung hatte, war Teil ihres Besitzes. Vor drei Jahren hatte sich der derzeitige Lord Montfoy in das frühere Wittumspalais zurückgezogen und Schloß Farthing Court mit dem gesamten Grundbesitz verkauft, weil er am Rande des Bankrotts stand. Zu jedermanns Überraschung hatte sich Mr. Thomas Entwhistle, der meist durch Abwesenheit glänzte, als ein durchaus gnädiger Gutsherr erwiesen, doch von Zeit zu Zeit fiel der lange dunkle Schatten der Montfoys mit aller Wucht auf das Anwesen. Und nun war es wieder einmal soweit.
Aggie Potter war die Rolle der alten Gevatterin und weisen Frau auf den Leib geschrieben, und sie gefiel sich darin. Mürrisch schaute sie in ihr Glas Porter.
»Hütet euch vor den Flammen in der Walpurgisnacht«, murmelte sie. Neben ihr knisterte ein anheimelndes Feuer im Kamin des Schankraums und wärmte ihr die Füße, die in Wollstrümpfen und ausgetretenen brüchigen Schuhen steckten. Den derben Rock hatte sie etwas hochgezogen, »um die Wohltat zu genießen ...«
Frimhurst bereitete sich vor, die Wiedergeburt der Erde zu feiern, wie es das schon seit vierzehnhundert Jahren tat. Einstmals hieß das Fest Beltain, und Freudenfeuer wurden entzündet; heutzutage aber sprach man nur vom ersten Mai oder vom Maifest, und die Aufmerksamkeit, die man ihm schenkte, war eher schwach, abgesehen von dem fünf Meter hohen Maibaum, der vor der Dorfschule aufgerichtet wurde. Mit Girlanden geschmückte Kinder sprangen drum herum und gaben sich alle Mühe, sich gegenseitig mit Ketten aus Papierblumen und bunten Bändern zu erdrosseln.
In unserem Jahr 1905 jedoch hatte eine Krise die Lage dramatisch verändert. Der in Kent lebende Schriftsteller Charles Igglesden hätte bei seinen Streifzügen – wäre er je durch Frimhurst gezogen – festgehalten, daß das Dorf, das über die Jahrhunderte am Flusse Crane in der Hügellandschaft des Weald gewachsen war, vom Hopfen- und Obstanbau lebte. Seine halbfeudale Abhängigkeit von der Gutsherrschaft Farthing war dem Ort geblieben, aber er schien in den paar Jahren, seit Mr. Entwhistle hier der Herr war und seit die Montfoys ihr gerechtes Geschick ereilt hatte (wie die Dorfhonoratioren sich ausdrückten), behaglich vor sich hin gelebt zu haben. Anheimelnde rote Ziegelhäuser mit Biberschwanzdächern standen friedlich neben mittelalterlichen Fachwerkbauten. Und die Kirche aus grauem Stein am Dorfanger, genau gegenüber dem »Weißen Drachen«, strahlte Ruhe und Eintracht auf ihre Gemeinde aus. Doch all das war jetzt bedroht. Das Herzstück des Dorfes, wenn nicht seine Seele, stand auf dem Spiel – das Wirtshaus.
Das Komitee der sieben drängte sich an einem Abend früh im März um den Kamin: Bert und Bessie Wickman, Alf Spade (so hieß der Maurer), seine Frau Adelaide, Harry Thatcher, der junge Briefträger, der die jüngere Generation vertrat, und, stellvertretend für die Dorfgreise, die beiden Alten, Aggie Potter und Jacob Meadows.
»Tanz mit Glöckchen«, schnaubte Bert und marschierte an die Theke, um hemmungslos seine Tageseinnahme auszugeben.
»Maibäume«, spottete seine Frau empört und war sich durchaus bewußt, daß die Zeiten, als sie die Maikönigin spielte, längst dahin waren.
»Wir kommen da nicht drum herum!« Bert blickte in seinem Verein in die Runde. »Und wir müssen die Sache richtig organisieren. Wenn schon, dann sollen die eine ordentliche Vorstellung kriegen.« Er grinste. »Amerikaner«, fügte er verächtlich hinzu und spuckte auf den Fußboden. »Denen werden wir zeigen, was Altengland so drauf hat! Baron Entwhistle weiß, wovon er redet, der haut uns die Rübe runter, wenn wir nicht mitspielen. Und wie soll’s im Dorf weitergehen ohne den ›Weißen Drachen‹?«
Es floß noch eine ganze Menge Bier, während man erörterte, wie diese Katastrophe abzuwenden sei, und einige Stunden später hatte man erste Pläne geschmiedet, denen alle zustimmten.
Nur Mrs. Aggie Potter hatte ihre Bedenken und murmelte in ihren Schlaftrunk: »Mit den Elfen ist nicht zu spaßen und mit den Kobolden auch nicht.«
Aber keiner ihrer Mitverschworenen achtete darauf. Für sie waren Elfen lediglich umherschwebende harmlose Geschöpfe aus Bilderbüchern, und die Warnungen ihrer Großmütter vor den dunkleren Mächten hatten sie längst vergessen.
1. Kapitel
Nichts weiter als eine Hochzeit!
Auguste Didier, Meisterkoch (sofern man ihm erlaubte zu kochen), war auf das Schlimmste gefaßt, als Seine Majestät König Edward VII. geruht hatte, ihn für heute morgen zu sich zu bestellen. Unterwegs hatte er gegrübelt, was er wohl verbrochen haben könnte, ganz so, wie er als Junge immer überlegte, ob er etwas ausgefressen hatte, wenn er zu der kleinen Schule von Mont Chavalier in seiner Heimatstadt Cannes lief. Erleichtert hüpfte er jetzt nahezu auf dem Rückweg vom Palast in seine Wohngegend am Bird Cage Walk. Ihn hatte eine gute Nachricht erreicht.
»Ah, Did – Auguste, guten Morgen.« Seiner Majestät war gerade noch rechtzeitig eingefallen, daß Auguste immerhin zur Familie gehörte, wenn auch in zweiter Linie. »Was halten Sie davon, den ersten Mai in Kent zu verbringen?«
Nichts Gutes ahnend, richtete sich Auguste aus seiner tiefen Verbeugung auf. Oder wollte Seine Majestät den Cousin zu einem Ausflug in seinem Daimler einladen? Er schöpfte Hoffnung. Für Bertie zu kochen war freilich kein Pappenstiel. Augustes Heirat mit Tatjana hatte Probleme mit sich gebracht. Am schwerwiegendsten hatte ihn getroffen, daß man einem Mann wie ihm, der bei Escoffier in die Lehre gegangen war, untersagte zu kochen, es sei denn privat oder für Seine Majestät.
»Es geht um eine Hochzeit, und ich möchte, daß Sie kochen«, erläuterte der König.
»Doch nicht etwa für Eure Majestät?« Seine Hoffnungen schnellten empor.
»Natürlich für mich.« Ein leicht gereizter Unterton schwang in des Königs Stimme mit. »Und für ein paar tausend andere Leute, wie ich Horace Pennyfather kenne.«
»Pennyfather?« Der Name klang ihm nicht fremd. Auguste war dem amerikanischen Soft-Drinks-Millionär vor einigen Jahren begegnet, und er hatte ihm gefallen. Das war ein liebenswürdiger Herr, wenn auch finster entschlossen, seine alkoholfreien Pennyfather-Getränke jedem auf der ganzen Welt in die Kehle zu zwingen.
»Ein umgänglicher, achtenswerter Mann. Seine Tochter wird einen meiner Freunde heiraten, Lord Montfoy.«
Auguste dachte angestrengt nach. Auch der Name sagte ihm etwas.
»Die Hochzeit wird am ersten Mai gefeiert.«
»Wo soll sie stattfinden, Euer Majestät?«
Verwundert sah ihn der König an, dann fiel ihm ein, daß der Kerl Ausländer war, und schon stand ihm seine übliche Höflichkeit zu Gebote. »Auf Farthing Court in Kent. Die Montfoys leben dort bereits seit der Normannischen Eroberung von 1066. Ach ja«, beendete er abrupt die historischen Erläuterungen. »Da gibt es noch ein Problem, im Grunde genommen zwei.«
Er hätte es von vornherein wissen sollen. Wo Bertie seine Hand im Spiele hatte, gab es stets Probleme.
»Und beide sind streng geheim«, bedeutete Seine Majestät dem angeheirateten Vetter mit warnendem Blick, als wären halbfranzösische Meisterköche dafür berüchtigt, rein private Enthüllungen des Monarchen in Londoner Gesellschaftskreisen zu verbreiten. »Farthing Court ist nicht mehr im Besitz von Arthur Montfoy. Er ist ins Wittumspalais gezogen.«
»Wie schade, Farthing Court war doch einer Ihrer Lieblingsorte für Wochenendparties in kleinem Kreise.« Der Name Montfoy – in Augustes Kopf begann es zu arbeiten.
Der König runzelte die Stirn, bekundete seinen Unmut ob der unangebrachten Bemerkung. »Konnte es sich nicht leisten, den Familiensitz länger zu halten. Hat ihn an Thomas Entwhistle verkauft, einen prachtvollen Menschen.« Der Name sagte Auguste nichts. »Lebt die meiste Zeit im Ausland. Hat sich als sehr hilfreich erwiesen, hatte nichts dagegen, daß Arthur zur Hochzeit noch einmal ins Haupthaus zieht.«
»Ich verstehe.« Auguste entspannte sich. Nichts Aufregendes also.
»Und jetzt kommt der springende Punkt. Entwhistle wird Brautführer sein. Für die Braut, ihre Familie und alle Gäste gilt, daß Lord Montfoy selbstverständlich Besitzer von Farthing Court ist – und er wohnt auch dort. Ist das klar?«
»Hm – ja.« Das war immer noch die einfachste Antwort, wenngleich sofort quälende Fragen in ihm aufstiegen. Aber Tatjana hatte ihn oft genug beschworen: »Mach Bertie bloß keinen Ärger.«
»Gut. Und da ist noch etwas. Ich werde dort sein, eigentlich aber auch nicht.«
»Je m’excuse?«
Seine Majestät blickte indigniert. »Ich werde in Kürze zu Staatsbesuchen in verschiedene Mittelmeerländer reisen. Algier und so weiter. Ich werde einige Wochen unterwegs sein, am Tag vor der Hochzeit aber auf Farthing Court eintreffen. Die Presse wird im Glauben gehalten, daß ich auf einer Privatreise in Paris bin; daselbst werde ich aber erst am Mittwoch sein, zwei Tage nach der Hochzeit also, wenn es offiziell verlautbart wird. Klar?«
Schade, daß man Königen nie die Frage »Warum?« stellen konnte. Wenn Bertie auf den Spaß verzichtete, die Folies-Bergère zu besuchen und danach sehr intim bei Voisin zu soupieren, dann versprach diese Hochzeit ein aufsehenerregendes Ereignis zu werden.
Auguste machte seinen Bückling und empfahl sich, seine Neugier allerdings blieb unbefriedigt. Doch im Vergleich zu den Schwierigkeiten, die man sonst mit Bertie zu gewärtigen hatte, waren diese Probleme geradezu lachhaft. So meinte er jedenfalls.
Die Umstände hätten kaum glücklicher sein können. Tatjana würde Anfang Mai in Paris sein, um sich mit ihren russischen Verwandten zu treffen; und er könnte sich mit der himmlischen Aufgabe, für eine Hochzeit zu kochen, die Zeit vertreiben (und dabei den beharrlichen Mahnungen seines Verlegers entgehen, der händeringend auf das Manuskript von »Dinieren mit Didier« wartete, an dem freilich noch letzte Ausfeilungen vorzunehmen waren). Vorzugeben, daß Farthing Court immer noch Lord Montfoy gehörte, würde gewiß ein wenig peinlich sein, denn es bereitete ihm Gewissensbisse, Horace Pennyfather derart täuschen zu müssen. Doch Auguste ermahnte sich, daß er nur der Koch sei. Und schon durchzuckte ihn ein schrecklicher Gedanke. Würde man von den Gästen erwarten, Pilgrim’s Cherry Shrub zu trinken, Pennyfathers berühmten alkoholfreien Kirschpunsch? Was ihn betraf, so würde er so einem Gebräu die Bezeichnung drink nicht zubilligen. Aber nein, Pennyfather war ihm als ein Gentleman mit Feingefühl in Erinnerung.
Man geleitete ihn zu einer Suite im Hotel Ritz. Horace Pennyfather erhob sich, um seinen Gast zu begrüßen. Abgesehen von dem grau werdenden Haar, schien er wenig verändert seit ihrer ersten Begegnung damals. Er war ein Mann von kräftiger, untersetzter Statur. Mit dem sorgsam gezwirbelten Schnurrbart wirkte sein Gesicht immer noch angenehm, und der etwas verlorene Blick verbarg seine Schläue recht gut. Auguste bereitete im Geiste schon das üppige Bankett vor, das er zu gestalten gedachte. Vor seinem inneren Auge schwebten bereits Steinbutt mit Trüffeln in Champagnersauce, caneton aux olives, pêches aiglon und weitere unendliche Wunder seiner Küchenwelt.
Horace Pennyfather begrüßte ihn warmherzig, doch während sie über ihre frühere Begegnung sprachen, gewann Auguste den Eindruck, daß er nicht mehr ganz der Mann von damals war. Er schien nervös und nicht der in sich ruhende Gentleman zu sein, an den sich Auguste erinnerte. »Bevor meine Tochter kommt«, brachte er fast stotternd hervor, »sollte ich Ihnen vielleicht zeigen, wie sie sich das Menü denkt.«
Wie sie sich das Menü denkt ... Das klang geradezu unheilvoll.
Horace holte aus dem Schreibtisch ein längliches Blatt Papier hervor, das mit schwarzen Schriftzügen einer energischen, gestochenen Handschrift bedeckt war, und überreichte es ihm. Daß er es schweigend tat war kein Wunder. Auguste konnte sich vage erinnern, von solchen Speisen schon in Büchern gelesen zu haben, doch im Leben eines selbstbewußten Meisterkochs hatten die nichts zu suchen.
»Succotash?« fragte er finster.
»Das aßen die Siedler aus der Frühzeit«, murmelte Horace. »Ein Gemisch aus Mais und Limabohnen. Sehr schmackhaft.«
»Hominy grits?« Auguste stellte sich vor, wie Seine Majestät von einem Gericht mit dieser Bezeichnung kostete.
»Maisbrei aus den Südstaaten.«
»Shoofly Pie?«
»Syrup-Blätterteiggebäck – Pennsylvania.«
»Jambalaya?«
»Reis mit Sellerie und Garnelen – New Orleans.«
Auguste ließ die Aufstellung sinken. »Tut mir leid, Mr. Pennyfather, auf diesem Plan ist nur ein einziges Gericht, das ich mir zutraue, und das ist Thomas Jeffersons Vanille-Eis. Vielleicht sollten Sie einen anderen Koch ...«
»Nein, nein, nur Sie und niemand anders kommt in Frage«, beschwor ihn Horace. »Gertrude ist ausgesprochen patriotisch. Sie ißt sogar Hühnerklein zum Frühstück, weil sich auch Präsident Andrew Jackson damit begnügte.
Angesichts eines höchst gegenwärtigen britischen Königs und Kaisers und nicht eines längst verblichenen amerikanischen Präsidenten steckte Auguste in einem wahren Dilemma: Seiner Majestät den Gehorsam aufzukündigen war Hochverrat, doch nachdem er ein solches Mahl bereitet hatte, konnte jeder ehrenhafte Koch nur noch Selbstmord begehen. So beschloß er bei sich, eher sein Leben zu opfern als seine Selbstachtung.
»Non«, erwiderte er und mühte sich, das Wort so höflich wie möglich klingen zu lassen. »Je regrette que cela n’est pas possible.«
»So etwas wie pas possible gibt es nicht, Mr. Didier.«
Auguste sprang auf, als er die kühle Frauenstimme vernahm. Die Dame, die soeben durch die Tür geschwebt kam, konnte nur Gertrude Pennyfather sein. Sogleich wurde ihm klar, warum ihr Vater derart nervös war. Diese Dame hatte festgefügtere Ansichten als Horace selbst. Sie war eine hochgewachsene junge Frau, so groß wie er, vermutete Auguste, etwa ein Meter zweiundsiebzig. Ihre Gesichtszüge lenkten sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Sie waren hübsch, wenn auch nicht ausgesprochen schön, die großen grauen Augen blickten eindringlich, verrieten aber einen Schimmer von Humor. Das ovale Gesicht insgesamt wirkte jedoch unerbittlich streng.
»Sie haben recht, Madame.« Auguste verbeugte sich, als er vorgestellt wurde. »Allgemein gesehen gibt es nichts Unmögliches, im Einzelfall jedoch kommt das durchaus vor. Selbst wenn man es dabei mit einer so reizenden Braut, wie Sie es sind, zu tun hat.«
»Wie denn das?« Sie schien eher interessiert zu sein als verärgert.
Auguste zögerte kurz und entschloß sich zu einer aufrichtigen Antwort. »Es gibt da zwei Gründe, Madame. Der erste ist meine Integrität als Koch, und der zweite ist Seine Majestät König Edward VII., Ihr Ehrengast, dessen Geschmack ich sehr wohl kenne.«
»Ihre Integrität, Mr. Didier, geht mich nichts an. Ich gebe aber zu, daß ich mir hinsichtlich Seiner Majestäts Geschmack da weniger sicher bin.«
»Gertrude, Liebes«, warf Horace zaghaft ein – so zaghaft, daß Auguste sich wunderte, wie dieser Mann vom Laufburschen je hatte zum Millionär aufsteigen können – »ich meine, du solltest auf Mr. Didier hören.«
»Ich höre auf jeden, der mir etwas Vernünftiges mitzuteilen hat, Vater«, erklärte Gertrude gleichmütig, »und ziehe es dann in Erwägung.«
»Gertrude bewundert Ihre Mrs. Pankhurst«, bemerkte Horace, wobei er Augustes Nationalität geflissentlich ignorierte.
Dem fiel das nicht einmal auf, denn er lebte schon so lange in England, daß er Mrs. Pankhurst fast als seine Landsmännin betrachtete. Jedenfalls brachte Tatjana die Frauenrechtlerin und ihre Suffragetten so oft am Frühstückstisch zur Sprache, daß er mitunter glaubte, Mrs. Pankhurst sei die Nachbarin vom Grundstück nebenan.
»Der Gaumen Seiner Majestät schätzt sowohl die auserlesenste wie die einfachste Küche«, erklärte er. »Ein gut angerichtetes Hammelkotelett ist ihm genauso lieb wie die exquisitesten Schöpfungen, die die französische Küche zaubern kann.«
Getreu ihrer Devise, erwog Gertrude diese Darlegung ernsthaft. »Bitte behalten Sie Platz, Mr. Didier.« Entschlossen ging sie zum Schreibtisch, drehte das Blatt mit ihrer abgelehnten Speisenfolge um und begann auf der Rückseite zu schreiben. Keine zehn Minuten vergingen, da erhob sie sich und überreichte Auguste die Frucht ihrer Bemühungen. Angsterfüllt las er:
»Salmagundi. Hindle Wakes. Whim-wham. Lancashire Hot Pot. Dressed mock turtle. Pickled Kent pippins. Tansy fritters. Spotted Dick. Green codling pudding ...« Erneut ließ er die Liste sinken, suchte nach taktvollen Worten, um zu erklären, daß er dem Monarchen nicht mit einem alten, mit Backpflaumen gefüllten Suppenhuhn kommen konnte, das lediglich mit Zitronensoße getarnt war – jedenfalls nicht, wenn er mit Tatjana verheiratet bleiben wollte und wenn das Oberhaus nicht einberufen werden sollte, um die sofortige Auflösung der Ehe wegen geistiger Zerrüttung zu verfügen.
Gertrude blickte ihn erwartungsvoll an. »Nun?« fragte sie. »Einfache, herkömmliche englische Gerichte. Was wollen Sie mehr?«
Horace wand sich. »Ich denke mal, ich sollte Ihnen dazu was erklären, Mr. Didier. Meine Tochter beschäftigt sich schon lange mit unserem großartigen Erbe, und sie hat jetzt vor, sich Ihrer englischen Folklore zuzuwenden.«
»Ich habe vor, einen Sitz im englischen Parlament zu erlangen, Mr. Didier. Und zwar mit der unmißverständlichen Botschaft: Bewahrt euer kulturelles Erbe!«
Selbst wenn es Mr. Balfour, der konservative Premierminister, irgendwie schaffte, das Parlament und die britische Öffentlichkeit plötzlich zum Frauenwahlrecht zu bekehren, dachte Auguste, so dürfte sich die Ehe mit einem Angehörigen des Hochadels als beträchtliches Hindernis für eine Mitgliedschaft im Unterhaus erweisen. Laut sagte er jedoch nur: »Sie würden, dessen bin ich ganz sicher, eine große Stütze für Mr. Balfours Partei sein.«
»O nein. Ich beabsichtige, in Mr. Keir Hardies neue Labourpartei einzutreten. Papa ist wie ich der Meinung, daß ihr die Zukunft gehört. Ich möchte mich für die Rechte der geknechteten Arbeiter einsetzen. Mit Arthur habe ich bereits über meine Reformpläne für seine Verwaltung des Guts gesprochen.«
Auguste machte schon den Mund auf, besann sich aber und schloß ihn wieder. Er war froh, gleich am Tage nach der Hochzeit nach London zurückkehren zu können, denn auf Farthing Court würde es vermutlich bald recht stürmisch zugehen. Seine Aufgabe bestand allein darin, im Interesse der Entente cordiale zwischen England und Frankreich des Königs Gaumen zu befriedigen. Diplomatie war angesagt.
»Es gibt eine bemerkenswerte französische Redensart, Madame, le chef propose ... Die Gäste müssen einer solchen Empfehlung des Küchenmeisters nicht unbedingt folgen, aber wer ein echter Kenner der cuisine ist, weiß, daß er gut beraten ist, wenn er es tut.«
»Und wieso?«
»Der Küchenmeister hat sein ganzes Können hineingelegt, außerdem sind die Zutaten meist frischer.«
Gertrudes Augen leuchteten, und er hätte schwören können, daß sie drauf und dran war zu lächeln. Doch sie tat es nicht. »Das zweite dürfte sich aus dem ersten ergeben. Bitteschön, Mr. Didier, empfehlen Sie.«
»Für den eigentlichen Hochzeitsschmaus ein herkömmliches, traditionelles englisches Dinner in zwei Gängen ...«
»In den Staaten würde davon nicht mal ein Floh satt werden«, brauste Horace auf. »Sie müssen nämlich wissen, Mr. Didier, daß bei uns ...«
»Jeder Gang«, fuhr Auguste rasch fort, »würde aus etwa zwanzig plats bestehen, die gleichzeitig serviert werden, so daß die Gäste selber wählen können, was ihnen behagt. Ich empfehle eine Mischung aus den von Ihnen vorgeschlagenen köstlichen traditionellen englischen Gerichten und französischer Cuisine, wie zum Beispiel Entenbraten mit Gurken und faisan au façon Didier ... Obst, Käse, Süßspeisen und scharf Gewürztes würden natürlich dazugehören.«
Er hielt ein, eingedenk dessen, daß es um Kopf und Kragen ging, falls er sie nicht umstimmen konnte.
»Gut«, erklärte Gertrude prompt.
Horace Pennyfather war sichtlich erleichtert, er strahlte geradezu. Die verstorbene Mrs. Pennyfather muß wie ihre Tochter gewesen sein, dachte Auguste, denn Horace schien es gewohnt, bei seinem Weibervolk die zweite Geige zu spielen.
»Aber ich lege Wert darauf, daß der Tischschmuck durchweg in Gold gehalten ist, nichts Grünes kommt auf den Tisch.«
»Verzeihen Sie?«
»Grün ist die Farbe der Elfen und daher den Menschen schädlich.«
Auguste starrte sie an. Man lebte inzwischen im zwanzigsten Jahrhundert. Meinte sie das im Ernst?
»Aber la salade ... und die Petersilie. Und ...«
Gertrude überlegte kurz. »Die Speisen natürlich ausgenommen.« Dann lächelte sie tatsächlich. »Ich bin nicht verrückt, Mr. Didier. Lord Montfoy hat mir eine echt englische Hochzeit nach altem Brauch versprochen, so wie sie die Bräute auf dem Dorf feiern. Er hat mir erzählt, daß in Frimhurst die alten englischen Sitten und Gebräuche und der alte Aberglaube lebendig sind. Ich werde darauf achten, daß sie nicht in Vergessenheit geraten. Ich habe vor, ein großes Volkskundewerk zu schreiben, so eins wie ›Der goldene Zweig‹.«
Auguste wußte sehr wohl, daß Mr. Frazers exzellentes Werk auf zwölf Bände angelegt war und daß der gute Mann schon fünfzehn Jahre daran arbeitete. (Wenn doch sein eigener Verleger auch so weitsichtig wäre!) Für die Arbeiter auf dem Landsitz konnten sich Gertrudes Pläne nur verheerend auswirken.
»Beabsichtigen Sie, ständig auf Farthing Court zu leben?« Auguste konnte sich nicht verkneifen, beiläufig diese Frage zu stellen.
Sie wurde wieder ernst. »Nein, Arthur zieht es in die Stadt, und ich muß schließlich auch in der Nähe vom Parlament und vom Britischen Museum sein. Außerdem werde ich natürlich viel im Lande umherreisen und für Mrs. Pankhursts Ideen werben.«
»Ja, natürlich.«
»Arthur hat mir geschildert«, fuhr Gertrud fort, »daß ein Maibaum aufgestellt und daß man Freudenfeuer entzünden wird, um ein Fest zu feiern, das noch aus vorchristlichen Zeiten stammt. Und die Dorfmädchen treffen sich im Morgengrauen des ersten Mai zum Tautreten. Deshalb haben wir die Hochzeit auf den ersten Mai gelegt; die Dorfbewohner werden den ersten Mai wie immer im Park des Herrenhauses feiern, und wir begehen den Tag mit ihnen zusammen.
Auguste enthielt sich jeder Äußerung. Gertrude und Seine Majestät König Edward VII. schienen von zwei verschiedenen Hochzeiten zu reden. Ein Wort zu Horace Pennyfather unter vier Augen wäre wohl angebracht, um des Königs Gemüt zu schonen. Er hatte Seine Majestät nie um einen Maibaum springen sehen und war überzeugt, daß so etwas auch nie geschehen würde. Man mußte vermeiden, daß es zu einer Katastrophe kam. Er würde mit Egbert, Hauptinspektor Egbert Rose von Scotland Yard, über seine Befürchtungen sprechen. Da Seine Majestät zu dem Zeitpunkt angeblich in Paris war, hatte die Sache durchaus einen politischen Aspekt. War der Schutz Seiner Majestät auch genau genommen die Angelegenheit des Sonderdezernats, so ging doch jede Bedrohung seiner Person den gesamten Apparat von Scotland Yard an.
Bedrohung? Befürchtungen? Merkwürdig, wie schnell die freudige Erregung, ein Hochzeitsbankett anrichten zu dürfen, in etwas ganz anderes umschlagen konnte. Er war schon am Einschlafen, da kam ihm eine alte englische Volksweisheit in den Sinn, die er öfter während seiner Jahre auf Stockbery Towers gehört hatte. Galt der Mai nicht als Unglücksmonat für Hochzeiten?
Die Spannung im »Weißen Drachen« stieg. Am Montagabend, es war der 24. April, eine Woche vor der Hochzeit also, fand die letzte Sitzung des Komitees zur Erhaltung des Wirtshauses »Zum Weißen Drachen« statt.
»Fehlt noch was?«
»Noch ’n Halber von Ihrem Besten, Mr. Wickman.«
»Bier hab ich zwar nicht gemeint.« Bert schenkte ihm trotzdem ein – Jacob war schon senil, aber als Aushängeschild nützlich, mit dem langen weißen Bart und seinen endlosen Geschichten von damals, als die Eisenbahn gebaut wurde. Dann stellte sich Bert neben die aus dem Schankraum geholte Tafel, bereit, Vorschläge zu notieren. »Also dann«, sagte er sarkastisch. »Jeder hat jetzt, was er braucht, und damit kommen wir zum weniger interessanten Teil des Abends.«
Adelaide Spade und Bessie nahmen keine Notiz von ihm, denn sie erörterten gerade flüsternd die umstrittene Frage, ob die Maikönigin noch Jungfer sei. Adelaide vertrat die Ansicht, daß Mary Smith, das flatterhafte Ding, ihre Unschuld schon längst an den jungen Harry verloren hatte (der keine zwei Meter von ihnen entfernt saß), und sah bereits das Schlimmste kommen. Bessie, die Liebe zwischen jungen Leuten immer neidisch machte, bekräftigte das Gesagte mit heuchlerischem Kopfnicken. Im stillen verglich sie Marys Geschick mit ihrem – war sie doch Lord Montfoys verflossene Liebschaft.
Bert schlug auf den Tisch. »Ruhe!« brüllte er. »Jeder gibt seinen Bericht, einer nach dem anderen. Und alle Probleme, die vorhersehbaren und die unvorhersehbaren, müssen jetzt und hier zur Sprache gebracht werden. Bessie, du fängst an. Du hattest die traditionellen Volksbräuche übernommen. Geht da alles in Ordnung?«
Bessie gab sich einen Ruck. Es hatte keinen Zweck, sich auszumalen, was sie Arthur Montfoy am liebsten antun würde, selbst wenn es, egal was, in jedem Fall sicherstellen würde, daß keine jungen Montfoys nachwachsen könnten. Verwunden hatte sie die Sache noch längst nicht. Wo sie all die Jahre hindurch für ihn dagewesen war. »Tschüs Bessie«, hatte es einfach geheißen, ich heirate jetzt ’n Yankee-Mädel. Das war gewiß bloß so’n spacker Kleiderständer, und dabei hatte er das Privileg genossen, sich an Bessie Wickman zu erfreuen, deren reife dunkle Schönheit ihm stets zu Willen gewesen war. Oder wenigstens hatte sie ihn das immer glauben lassen. Sie setzte eine besorgte Miene auf. »Mit der Schar, die sich früh im Tau tummeln soll, habe ich noch Probleme. Am Abend vorher wird’s beim Tanzen und bei den Spielen spät werden, und da hat keins von den Mädchen Lust, in aller Herrgottsfrühe aufzustehen und Tau zu treten. Und Jack, der den Hans im Grünen spielen soll, will auch nicht recht ran. Er will sich nicht das Blätterzeug umhängen lassen.«
»Kannst ihm sagen«, knurrte Alfred Spade und meinte seinen Lehrling, »ich hau ihn windelweich, wenn er nicht mitmacht.«
»Das mit dem Tautreten und sich mit Tau waschen dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen«, stellte Bert finster fest. »Sag den Mädels, wer nicht in den Tau geht, darf nicht ins Gefolge der Maikönigin. Das ist ein uralter Brauch.«
»Wer hat denn das behauptet?« kreischte Aggie. Alte Bräuche waren nun einmal ihre Wiese.
»Ich behaupte das. Ist mir gerade eingefallen. Kein Tautreten, kein Maientanz. So einfach ist das. Alfred, wie kommst du mit all dem überlieferten Kram zu Rande?«
Alf, ein Mann von grobknochiger Statur, der langsam sprach und nicht gerade sehr gesellig war, erstattete Bericht. »Ein Priesterversteck seitlich im Kamin eingebaut, wie bestellt. Das Paneel abgenommen und den Anfang von ’nem scheinbar eingefallenen Geheimgang gemauert, die Verkleidung ’n bißchen sperrig wieder eingesetzt. Den Steinkreis aus den ollen Felsbrocken hab ich auf dem Fünf-Morgen-Acker ausgelegt.« (Bauer Beard hat sich gewaltig aufgeregt, weil er da gerade Rüben säen wollte, hätte er noch erwähnen können.)
Das Scheppern der Bierkrüge belohnte seine Bemühungen. »Und die künstlichen Strohdächer werden Klasse.« Alf klang richtig zufrieden. »Bis Freitag hab ich alle drauf.«
»Gut gemacht, Alf. Adelaide?« Adelaide, die stets ängstlich darauf bedacht war, mit allen im Dorf gleichzuziehen, hatte die verhältnismäßig sichere Abteilung Tanzen und Singen übernommen, wozu auch die Kostümierung gehörte.
»Ich find keinen, der am Sonntag um Mitternacht den Auftritt auf’m Schloß übernimmt.« Hilfesuchend blickte sie zu ihrem Anführer.
»Ich mach das«, ächzte Jacob Meadows.
Vor Zeiten hatte Jacob eine bemerkenswerte Tenorstimme gehabt, aber das war lange her. »Kannst du gar nicht, alter Mümmelgreis«, wimmelte ihn Harry ab und lachte, »ist doch viel zu spät für dich, da liegst du längst im Bett. Ich übernehm das.«
»Geht nicht. Du hast Dienst am Maibaum«, erinnerte ihn Bessie. Sie hielt sich was drauf zugute, daß sie ein mütterliches Auge auf den jungen Harry hatte, obwohl mütterlich, wie sie sich eingestand, nicht alle Gefühle einschloß, die sie für ihn hegte.
»Was ist denn mit dem Pfarrer? Der kann doch singen.«
»Wir können den Pfarrer nicht um Mitternacht Lieder über Liebeslust singen lassen. Wie würde der aussehen am nächsten Tag in der Kirche?« gab Alf zu bedenken.
Bert holte tief Atem. »Na, dann mach ich’s eben.«
»Du? In Trikot und Wams?« Bessie wollte sich ausschütten vor Lachen.
Bert blickte sie finster an. »Harry?« Er ging schnell zum nächsten Punkt über. »Wie steht’s mit der Gruppe Maibaum und Dorfsport? (Das hieß Sport außer Kricket, denn das hatte er sich vorbehalten.) Harry war die leichteste Aufgabe zugefallen, für Schlagballspiele und Tauziehen fanden sich immer ein paar Mannschaften, auch fürs Maibaumaufstellen und -schmücken gab es willige Helfer. Die Girlanden sollten von Adelaides Gruppe gewunden werden.
»Aggie und Jacob?« fragte Bert als nächste. »Habt ihr die alten Aberglauben und Bräuche parat? Braucht ihr noch Vorschläge für ein paar neue?«
»Nicht nötig, wir haben uns schon alles zurechtgelegt«, prahlte Aggie.
»Was denn zum Beispiel?« wollte Bessie wissen.
»Müssen wir jetzt nicht verraten. Wart’s nur ab.«
»Was wird bloß unser Pfarrer zu dem ganzen Theater sagen?« fragte Adelaide plötzlich, der neue Bedenken kamen.
»Der wird schweigen«, entgegnete Bert herablassend. »Baron Entwhistle hat ihm neue Kirchenglocken versprochen, wenn er den Mund hält. Ihr wollt bestimmt noch wissen, was ich auf meiner Strecke getan habe. Wegen Geistern und Kricket. Den Geist von unserem berühmten Kricketspieler Mighty Mynn werde ich spielen, ich brauche bloß noch zwei, drei Schmuggler.«
»Wozu brauchst du Schmuggler?« erkundigte sich Aggie.
»Nur als Geister, Aggie, keine echten. Wir wollen die Schlacht von Frimhurst nachspielen, deshalb.«
»Hat doch nie eine gegeben«, protestierte Jacob, der sich für das Wissen um die graue Vorzeit zuständig fühlte.
»Dann erfinden wir sie eben«, erwiderte Bert kurz angebunden.
Aggie krächzte. »Du bist mir einer, Bert Wickman. Hast du schon die Elfen beschwichtigt? Das möchte ich gern wissen. Du kennst doch die Sage von den Elfen und Feen, von wo der Name Farthing Court herkommt. Farnfeen – daher Farthing – verstehst du? Ich hoffe, die haben ein Alles-sehendes-Auge draußen am Haus – einen Stein mit ’m Loch drin. Übrigens, du brauchst so einen auch hier, Bert. Hält die bösen Geister vom Bier weg.«
»Brauch ich nicht. Ich hab Wichtigeres zu tun, als mir den Kopf um deine Feen zu zerbrechen.«
»Nichts ist wichtiger, als die Elfen und Feen auf seine Seite zu kriegen«, sagte Aggie herausfordernd. »Wirst das schon noch merken.«
Der Dienstagmorgen sah Auguste auf der Station Cranbrook, wo er das Aus- und Umladen der vielen kostbaren Körbe und Transportkisten überwachte. Behutsam wurden sie in dem Lastwagen verstaut, der sie nach Farthing Court bringen sollte. Auguste kletterte auf den Sitz neben dem Fahrer. Von dort genoß er den Blick über die Hügellandschaft der Grafschaft Kent, die sich in frischem Grün vor ihm ausbreitete. Außer Landschaft war allerdings nicht viel zu sehen. Vom Dorf Cranbrook machten sie zunächst nur das Wirtshaus und ein paar verstreute Gehöfte aus, als sie auf der Straße von Hawkhurst nach Cranbrook dahinrumpelten.
Der heutige Tag, so hatte er entschieden, sollte für die Erkundung der Gefilde genutzt werden: Er würde den Gemüsegarten und die Küchenräume inspizieren, würde sich mit dem Personal verständigen und das Arrangement der Tische festlegen. Das war eine Aufgabe, die er liebte, und die ihm um so verlockender erschien, seit Vetter Berties Gebot ihn daran hinderte, sich ihr zu widmen, von ein paar seltenen Gelegenheiten abgesehen. Schließlich erreichten sie mit ihrem Lastwagen Cranbrook, das sich als ein geschäftiges, quirliges Dorf entpuppte, es war fast eine Kleinstadt, verglichen mit Frimhurst. Letzteres lag drei, vier Kilometer entfernt und war nur auf so schmalen Wegen zu erreichen, daß der Fahrer auf die Zufahrt zu einem Feld ausweichen mußte, um die entgegenkommende Kutsche vorbeizulassen. In ungemein höflicher Manier zog er den Hut vor dem Kutscher.
»Schönen guten Tag, Sir«, rief er.
Auguste war geradezu beeindruckt. Bislang waren ihm Arbeitsleute aus Kent ihrer Sprache und ihrem Benehmen nach als weit erdgebundener in Erinnerung.
Frimhurst, durch das sie dann fuhren, um nach Farthing Court zu gelangen, schien ein friedvoll vor sich hin dösendes Dorf zu sein. Weit und breit war kein Motorwagen zu sehen, nicht zu vergleichen mit den vom Verkehr verstopften Straßen Londons. Aus den Hecken lugten die ersten Glöckchen-Blausterne. Osterglocken hielten sich noch tapfer inmitten von Tulpen. Waldungen, die an die Landstraße grenzten, hatten einen schwachen Blauschimmer zwischen den kahlen Bäumen. Wenn er an Kent dachte, hatte er immer die Fülle der Blausterne vor Augen. Ihm gefielen die Schindeldächer der Bauernhäuser und der behäbig aussehende »Weiße Drachen«. Die Wirtschaft machte einen so gemütlichen Eindruck, daß er den Fahrer anhalten ließ und hineinging, um ein Glas zu trinken. Er hatte öfter die Erfahrung gemacht, daß man vom Wirtshaus auf das ganze Dorf schließen konnte, denn zwischen beiden erwuchs eine Ähnlichkeit wie zwischen lange verheirateten Eheleuten.
Doch der »Weiße Drachen« erfüllte seine Erwartungen keineswegs. Sowie er die Gaststube betrat, hörten alle auf zu reden, und er war peinlich berührt. Zwar wußte er, daß Fremdländische – und damit meinen die Leute in Kent jeden, der neu ins Dorf kommt – ein Gespräch sofort verstummen lassen, aber hier spürte er, daß er die Dörfler bei einer wichtigen Diskussion unterbrochen hatte und nicht bloß bei alltäglicher Unterhaltung. Er bestellte einen Whisky mit Zitrone, was ihm die Wirtin rundweg abschlug; statt dessen drängte sie ihm ein süßliches Getränk auf, das als Met bezeichnet wurde. Sie lehnte sich mit ihrer drallen Figur weit, ja fast bedrohlich über die Theke und beäugte ihn unverhohlen. Ob das Zeug giftig ist, fragte er sich besorgt. Merkwürdig genug schmeckte es jedenfalls. Er trank es nicht aus und ging.
Farthing Court war ein weitläufiges Bauwerk aus anheimelndem, gelblichem Sandstein. Der Fassade nach stammte es aus dem sechzehnten Jahrhundert, aber die ganze Anlage ließ auf eine noch ältere Vergangenheit schließen. Auguste hatte herausgefunden, daß Seine Majestät sich hier so wohl fühlte, daß seine reichlich häufigen Besuche Lord Montfoy gezwungen hatten, das Anwesen vor drei Jahren zu verkaufen. Die aufwendige Bewirtung des hohen Gastes hatte ihn fast in den Bankrott getrieben. Auguste konnte nur hoffen, daß Mr. Entwhistle ausreichende Rücklagen hatte, um das Haus weiterhin in so großem Stil zu führen. In den drei Jahren dürfte er schon einen Vorgeschmack auf die Prüfungen bekommen haben, die Bertie ihm auferlegte. Im Augenblick war er noch abwesend, und das war Auguste nur recht, denn so konnte er sich in Haus und Küche ziemlich ungestört umsehen.
Wie auch immer seine Mission im Dienstbotenbereich aussah, sein Status als angeheirateter Cousin des Königs erforderte es seiner Meinung nach, das Haus durch den Eingang für Herrschaften zu betreten. Und so zog er den altmodischen Klingelzug am Portal. Ein ungemein langer, spindeldürrer Butler öffnete eilfertig die Tür und kniff kurz die Augen zusammen, als ob der Anblick eines Franzosen vor seiner Tür für seine englische Gelassenheit zuviel sei.
»Guten Morgen, Sir. Sie sind der Chefkoch, vermute ich.«
Dann umfing ihn die Dienstbarkeit eines gepflegten Butlers, wie er sie schon lange nicht mehr erlebt hatte. Selbst die Handbewegung, mit der er den Lastwagen mit der kostbaren Fracht in den Dschungel der rückwärtigen Gebäude wies, war majestätisch. Höchstpersönlich geleitete er den soeben eingetroffenen Erforscher von Neuland durch Räumlichkeiten des Hauses, die normalerweise denen verschlossen bleiben, die durch den Haupteingang eintreten.
Auguste schaute sich mit großem Interesse um, während er im Kielwasser des Butlers durch das Schloß schritt. Farthing Court hatte offensichtlich schon das Hochzeitsgewand angelegt. Von jeder Wand und aus jeder Nische starrten ihm Porträts der Montfoys, Wappenschilder oder Banner und Teile von Ritterrüstungen entgegen. Alles, was an Mr. Entwhistles Ahnenreihe erinnern konnte, hatte man mit Sorgfalt entfernt. Auguste überfiel plötzlich die Angst, daß die Küche ebenso mittelalterlich sein könnte wie dieser Plunder.
»Ah, Mrs. Honey. Darf ich Mr. Pennyfathers Chefkoch vorstellen? Mrs. Honey ist unsere Haushälterin.«
Die rundliche, mütterliche Dame war aus einem Seitengang erschienen, als sie das Dienstbotenrevier betraten. Am Gürtel ihres dunklen, seidig glänzenden Kleids klirrte ein Schlüsselbund. Fast erwartete Auguste, daß sie auch eine Muskatnußbüchse an der Seite trug, wie er es in den ersten Jahren seines Englandaufenthalts wiederholt erlebt hatte. Das Gewürz galt als so kostbar, daß die Haushälterin es aufs schärfste zu bewachen hatte. Er verneigte sich. »Ich heiße Auguste Didier, Madame.«
Mrs. Honeys rundes Gesicht errötete wie ein provençalischer Pfirsich. Sie war eine Haushälterin wie aus dem Bilderbuch. »Danke sehr, Mr. Tudor«, sagte sie, strahlte den hageren Riesen an, und wandte sich dann dem Neuankömmling zu: »Seien Sie willkommen auf Farthing Court, Monsieur Didier.«
Wie konnte es anders sein, ein so vollendeter englischer Butler mußte einfach Tudor heißen, sagte sich Auguste, leicht benommen von soviel Perfektion. Nun mußte nur noch die Küche in Augenschein genommen werden – und der dort waltende Koch. Als sie schließlich den Ort seiner Befürchtungen erreichten, stellte er zu seiner immensen Erleichterung fest, daß Mr. Entwhistle, falls nicht schon die Montfoys vor ihm, eine gute Hand für modernste Ausstattung hatte. Offene Feuer und Bratspießböcke gab es nicht mehr. Befriedigt schweifte sein Blick über Teigkneter, Fleischwölfe, Schneidemaschinen, Eisschränke, Bratröhren und den großen Küchenherd.
Er war einigermaßen erstaunt und fühlte sich geschmeichelt, daß das gesamte Küchenpersonal von der niedrigsten Spülmagd bis zum (nach seiner Mütze zu urteilen) stellvertretenden Chefkoch sofort aufsprang, als er hereinkam, und ihn mit schnellem Knicks oder leichter Verbeugung würdigte. Die üben schon für die Ankunft Seiner Majestät, bedeutete er seinem Ego, doch das begehrte auf, ließ sich nicht einfach dukken. Noch nie hatte er eine so einladende Küche besucht, geschweige denn in ihr gearbeitet. Normalerweise ist die Stimmung in einer Küche wie Milch, die kurz vor dem Überkochen ist. Doch wo blieb der oberste Küchenchef? Denn mit dem gut auszukommen verlangte das allermeiste Fingerspitzengefühl.
Da wirbelte auch schon eine Gestalt, die ein Bund Spargel wie ein Bukett vor sich hielt, durch die Gartentür. Hut und Schürze verkündeten den Beruf, aber die roten Haarsträhnen, die unter der Kochmütze hervorstanden, und seine drahtige Dürre erinnerten eher an einen abgenutzten Pfeifenreiniger. Er war nicht so großgewachsen wie Tudor, aber ebenso schlank. Konnte dieser junge Mensch mit dem Sommersprossengesicht und den bohrenden braunen Augen wirklich der Chefkoch eines so großen Hauses wie Farthing Court sein? Das schien tatsächlich so, denn er verbeugte sich tief und verkündete: »Ethelred Perkins steht Ihnen zu Diensten, Sir«, und gleich darauf herrschte er den Pastetenbäcker an, daß Auguste zusammenzuckte. »Doch nicht so, Percy! Liebkosen mußt du den Teig, nicht schlagen.«
»Tut mir leid, Mr. Perkins«, murmelte der untere Dienstgrad beschämt.
Das ist außergewöhnlich, dachte Auguste, denn die meisten Pastetenbäcker, die ihm begegnet waren, verhielten sich gegenüber den Feinheiten ihres Gewerbes ziemlich gleichgültig. Er brachte seine üblichen Entschuldigungen vor, daß es ihm widerstrebe, in das Reich eines Kollegen einzudringen, aber Mr. Perkins wies das ungeduldig von sich.
»Das versteht sich doch von selbst«, entgegnete er fast verwundert. »Seine Majestät wird uns mit seiner Gegenwart beehren, wir werden Mr. Pennyfather zu Gast haben, und ich hoffe, eine Menge von seinem Küchenmeister zu lernen.«
Sonderbar war das und wurde immer sonderbarer. Er hatte stets die Erfahrung gemacht, daß die angestammten Köche nichts lieber taten, als dem Eindringling Knüppel zwischen die Beine zu werfen, wenn nicht gar die Suppe zu versalzen. Eine so offenherzig bekundete Bereitschaft zur Zusammenarbeit war selten. Dennoch nahm er sich vor, sich in der Küche von Farthing Court mit Vorsicht zu bewegen. Einer kann lächeln und immer lächeln, wie Hamlet feststellte, und doch ein Schurke sein. Ethelred Perkins könnte sich noch als so einer entpuppen.
In einem Appartement am Place Vendôme in Paris bereitete sich der Schloßherr von Farthing Court auf seine Rückkehr nach England vor. Er war sicher, daß es dort höchst vergnüglich und amüsant werden würde. Es war verabredet, daß er in Calais mit König Edward zusammentraf, wo dieser auf der Rückreise von seinen Staatsbesuchen in den Mittelmeerländern Station zu machen gedachte. Ein weiteres Mal würde Seine Majestät sein Gast sein, und bei dieser Gelegenheit, so hoffte er, könnten sich seine hochfliegenden Erwartungen erfüllen. Dieser Besuch war nicht ohne Pikanterie. Arthur Montfoy und Gertrude Pennyfather wollten heiraten, und er war bereit, deshalb zeitweilig auf seine Rolle als Schloßherr zu Arthurs Gunsten zu verzichten. Sein Freund Arthur, ein liebenswürdiger, aber nicht gerade superintelligenter Gentleman, schien eine Tatsache zu übersehen. Es war ein glänzender Schachzug, eine reiche amerikanische Erbin zu heiraten, die wie ihre Familie unter dem Eindruck stand, daß die Montfoys im Vollbesitz ihrer irdischen Güter waren. Aber auf jeden Hochzeitstag folgt ein neuer Morgen, und die Erbin würde früher oder später entdecken, daß ihre Besitzungen in Kent lediglich aus einem kleinen Wittumspalais und einem Garten von dreißig mal acht Metern bestand. Doch damit hatte er nichts zu schaffen. Er hatte sein Teil bereits getan. Das Dorf war in jeder Hinsicht eingestimmt. Und Horace Pennyfather brachte sogar seinen eigenen Küchenchef mit. Normalerweise bestand Seine Majestät darauf, daß Köche aus dem Palast entsandt wurden, um neben dem üblichen Personal aus dem Schloßhaushalt für ihn zu kochen. Horace Pennyfather mußte im Ansehen des Königs ziemlich hoch stehen, daß der seiner Wahl traute. Thomas Entwhistle war das nur recht, er konnte sich heraushalten und die Ereignisse ihren Lauf nehmen lassen, was sie dank seiner Planungen auch tun würden.
Früh am Morgen des 29. April, einem Samstag, fuhr Arthur Montfoy von London zu seiner Hochzeit, auf die er sich schon sehr freute. Bald würden sich all seine Probleme lösen, die herrliche Gertrude würde die seinige sein, und in absehbarer Zeit könnten sie vielleicht sogar Farthing Court zurückkaufen. Thomas hatte so etwas angedeutet, obwohl er nicht ganz überzeugt schien, daß Arthur dazu in der Lage sein würde. Wie dem auch sei, Thomas hatte alles hervorragend organisiert; er würde es genießen, wieder in dem alten Haus zu sein, und könnte Gertrude ihren Herzenswunsch erfüllen: eine englische Hochzeit nach altem Brauch. Ganz idyllisch würde das werden.
Eigentlich hatte er die Fahrt mit Gertrude machen wollen, aber ihrer Meinung nach schickte es sich nicht für die Braut, zuviel mit dem Bräutigam zusammenzusein. Widerstrebend hatte er sich bereit gefunden, eine Frau mitzunehmen, mit der sich Gertrude in Paris angefreundet hatte. Seine Stimmung besserte sich rasch, als er im Palmengarten des Hotels Carlton die Comtesse Eleonore de Balleville vorfand, die ihn erwartete. Eine tolle Frau war das, mit schwarzem Haar und dunklen Augen, auch wenn sie jenseits der Dreißig schien. Die Taille ihres eng anliegenden dunkelblauen Straßenkleids verhieß eine göttliche Figur. Soviel er verstand, war ihr Gatte recht häufig in diplomatischer Mission unterwegs, nur, ob die Diplomatie seiner Karriere oder der ehelichen Bequemlichkeit diente, blieb unklar. Eleonore gefiel ihm augenblicklich. Gertrude war gewiß wundervoll, aber sie verwandte wenig Zeit darauf, ihm zu beteuern, was für ein fabelhafter Mann er sei. Die Comtesse hingegen tat das bereitweilligst, als sie durch die Landschaft tuckerten.
»Artur« – die belegte Stimme der Gräfin ließ seinen französisch ausgesprochenen Namen so melodisch klingen, wie er ihn noch nie gehört hatte – »Gertrude hat mir erzählt, daß Ihr Dorf das Maifest immer in Ihrem Park feiert. Wie großmütig! Es läßt auf eine feste Bindung zwischen Schloß und Dorf schließen. Die Bauern müssen Ihnen sehr zugetan sein, was ja kein Wunder ist.«
»Da ist was dran.« Arthur Montfoy hatte die ganze Angelegenheit Thomas überlassen und demzufolge keine Ahnung, was tatsächlich zur Feier vorbereitet wurde. Er hoffte nur, daß man der Gräfin ihre Schönheit zugute halten und ihr die allzu wörtliche Übersetzung der paysans ihrer Heimat nicht übelnehmen würde, falls sie das Wort in Hörweite von Alf Spade zum Beispiel sagte, denn der, wie andere auch, sah sich nicht als Bauer, sondern eher als Landwirt oder Farmer.
»In Frankreich schenkt man sich Maiglöckchen zum ersten Mai.«
»Ein hübscher Brauch«, kommentierte Arthur eifrig. Das schien viel billiger zu sein als der Aufwand, den Thomas betrieb.
»Gertrude hat mir eine Liste mit Regeln gegeben, an die man sich zu halten hat, wenn Seine Majestät unter den Gästen weilt«, plapperte Eleonore munter weiter. »Mein Gepäck ist gestern abgeholt worden. Nur vier Kleiderkoffer und zwanzig kleinere Pakete, abgesehen von den Hutschachteln natürlich. Ich bin nun mal auf Reisen, und da konnte ich nicht mehr mitnehmen. Wenn auch nur ein Koffer nicht ankommt, werde ich eine der Regeln brechen und zweimal im selben Kleid erscheinen müssen. Oder«, sie hielt inne und wandte sich Arthur zu, »sollte man lieber en chemise oder völlig nackt erscheinen, was meinen Sie?«
Arthur wurde puterrot, denn das beschwor Vorstellungen herauf, die es nicht leicht machten, den Napier durch die Kurven zu lenken. Fast wünschte er sich, daß ihm bis zur Hochzeit ein bißchen mehr Zeit blieb; was Seine Majestät bevorzugen würde – privat jedenfalls, da war er sich ganz sicher. Zum Glück erwartete Eleonore keine Antwort, unbekümmert fuhr sie fort: »Ich habe natürlich auch Trauerkleidung eingepackt und bin ...«
»Trauerkleidung?« Ihm glitt fast das Lenkrad aus der Hand.
»Gertrude hat mir erzählt, das sei ganz wichtig in Gegenwart des Königs, es könnte ja die Nachricht eintreffen, daß einer seiner Verwandten einem Attentat zum Opfer gefallen sei.«
Arthur überlegte krampfhaft, ob sein Kammerdiener wohl daran gedacht hatte, zusammen mit dem Hochzeitsanzug auch Bekleidung für Trauerfälle in die Garderobenschränke auf Farthing Court zu hängen. Doch sein solider englischer gesunder Menschenverstand kam ihm zu Hilfe. Es ging um eine Hochzeit, nicht um eine Trauerfeier.
Die Familie Montfoy, ob nun verflucht oder nicht, wurde nicht allein von Arthur repräsentiert. Seine ältere Schwester Belinda, mit zweiunddreißig Jahren immer noch unverheiratet, weil sie es nicht anders wollte, widmete sich emsig den Hieroglyphen und der Ägyptologie am Londoner University College und mühte sich, auf der akademischen Laufbahn voranzukommen. Für die Hochzeit hatte sie sich nur widerstrebend von ihren Forschungen losgerissen und war nun, begleitet von »Jung-Gerald«, mit der Eisenbahn nach Farthing Court unterwegs. Seit seiner Kindheit sah die Familie etwas gönnerhaft auf Gerald Montfoy herab. Er hatte im zarten Alter von fünf Jahren aus einem der hochherrschaftlichen Häuser Englands ein kostbares silbernes Weihrauchgefäß entwendet. Sein Hang, den Familiennamen zu entehren, hatte sich seither nicht gewandelt. Man hatte ihn so früh wie möglich nach Südafrika expediert, wo er sich dadurch auszeichnete, daß er als einziger englischer Gentleman dort kein Vermögen machte. Erst vor drei Wochen war er bettelarm nach England zurückgekehrt. Er war achtundzwanzig, also etwa so alt wie Arthur, sah stattlicher aus als dieser, nur besaß er weit weniger Geld, als sein Vetter je gehabt hatte. Er hatte beschlossen, hinfort alle Vergnügungen des Lebens zu genießen und Monate hindurch London zu seinem Tummelplatz zu machen. Ein Reigen von Jagdgesellschaften und Aufenthalte in Cannes könnten den Rest seiner Zeit ausfüllen. Heute früh war er, ganz gegen sein Naturell, in dumpfes Brüten verfallen, obwohl Belinda sich alle Mühe gab, ihn für das Osireion in Abydos zu interessieren.
»Ein ansehnliches Weib, die Gertrude«, knirschte er schließlich durch die Zähne, als sie auf der Station Paddock Wood auf den Zug nach Cranbrook warteten. »Gesund und robust.«
Belinda sah ihn an und bemerkte sarkastisch: »Ich glaub schon, Gerald, daß du mit etlichen kleinen Montfoys rechnen mußt, die zwischen dir und dem Adelstitel herumwuseln.
Er zwang sich zu einem Grinsen. »Und dem Geld, das daran hängt, vergiß das nicht, liebe Belinda.«
»Das vergesse ich durchaus nicht. Möglicherweise ist dir noch nicht aufgefallen, Gerald, daß ich mir meinen Lebensunterhalt selbst verdiene.«
»Wie könnte man so etwas übersehen, Belinda.« Gerald Montfoy betrachtete seine Cousine. Das zu einem Dutt zurückgesteckte Haar hätte noch strenger gewirkt, wäre es nicht einigen Strähnen ihrer Naturlocken gelungen, sich dem Zwang zu entwinden. Dazu ein graues Tweed-Kostüm und ein grauer Hut. Offenbar würde es ihm obliegen, etwas Heiterkeit in die Gertrude zu Ehren veranstalteten Festivitäten zu bringen, schließlich würde sie nun zur Familie gehören. Arthur hatte wirklich Schwein. Er besaß alles: den Titel, die Gutsländereien, das Geld, und nun angelte er sich noch eine amerikanische Erbin. Dabei hatte der eine Erbin gar nicht nötig, eher brauchte er, Gerald, eine. Er grübelte, ob sich da was machen ließe. Schließlich war Arthur eine Niete und Gertrude ein attraktives Weib.
Die Mehrzahl der Gäste, die zur Pennyfather-Montfoy-Hochzeit anreisten, saß im selben Zug wie Gerald und Belinda. Unter den Passagieren war auch Jeanne Planchet, die mit den übrigen Dienern dritter Klasse fuhr. Sie würden auf die Kremser klettern und nicht in die Kutschen, die in Cranbrook bereitstanden, um die Gäste auf der letzten Wegstrecke zu befördern. Jeanne war nämlich nur die Zofe von Mademoiselle Pennyfather. Sie hatte sich in Paris um diese Stellung beworben, doch schon jetzt vermißte sie ihre Heimatstadt. Man hatte ihr erzählt, daß die Landschaft in England lieblich sei, aber bislang war sie keineswegs von ihr beeindruckt. Es war wie in London, das Ganze hatte keinen Stil. Nichts als eine durcheinandergewürfelte Ansammlung von Bäumen, Häusern, Waldstücken und Bächen. Es fehlte die großartige Weite der Ebenen und Ströme Frankreichs oder der Boulevards von Paris. Hier war nichts planvoll angelegt, es war nur zufällig da. In Amerika mußte das ganz anders sein, und da wäre sie viel lieber hingefahren. Sie hatte gehört, daß Washington und New York in der Tat Stil hätten. Ihrem Traum stand nur ein Umstand entgegen. Mademoiselle Pennyfather war drauf und dran, diesen englischen Lord zu heiraten, und sie wollte allen Ernstes hier leben – für immer und ewig. Ihre Jugend und Schönheit würde sie an diese barbarische Wüstenei verschwenden. Jeanne starrte auf die bläulich schimmernden Wälder, und es tat ihr leid, daß sie Paris mit seinen Brücken, den Clochards und allem, was sonst noch dazu gehörte, verlassen hatte. Trotz aller Probleme, die es dort gab und derentwegen sie erst vor kurzem von dort geflohen war, bedauerte sie ihren Entschluß.
»Mein lieber Mr. Waites, welch glücklicher Zufall, Sie hier zu treffen. Steigen Sie doch bitte zu mir mit ein.«
»Gern, Euer Gnaden.« Richard Waites, aufsteigender Diplomat im Außenministerium, der sich auf europäische Angelegenheiten spezialisierte, verbeugte sich tief vor Louisa, Herzogin von Wessex. Er hegte eine zurückhaltende Sympathie, ja Bewunderung für sie. Ein verblassender Stern am Firmament des königlichen Liebeslebens zu sein, war eine Rolle, um die einen keiner beneidete. Doch Mrs. Keppel überstrahlte alles, und so leuchteten die anderen Sterne weniger hell, selbst der der Schillernden Herzogin, wie man sie nannte. Offenbar war ihr Schillern dem Herzog zuviel geworden, denn er war vor einigen Jahren auf einer Expedition durch die Sahara verstorben. Wie mochte sie es zuwege gebracht haben, auf der Einladungsliste zu stehen? Er nahm an, daß Seine Majestät sein ihm zustehendes Veto nicht auf die Gästeliste zu einer Hochzeit ausdehnen konnte.