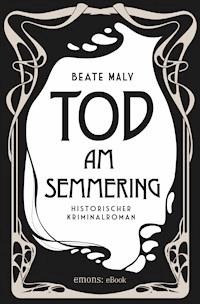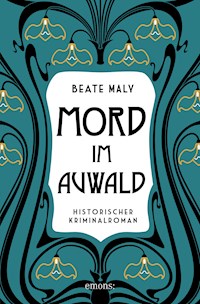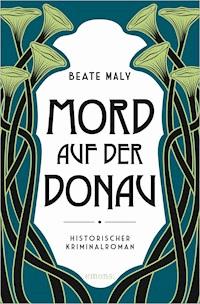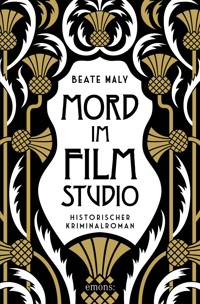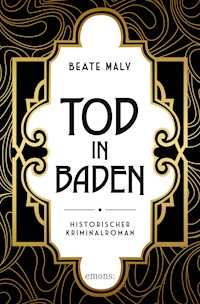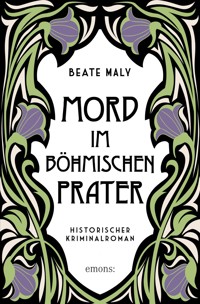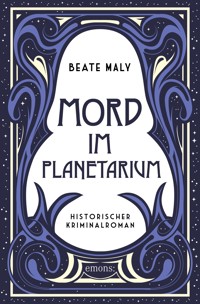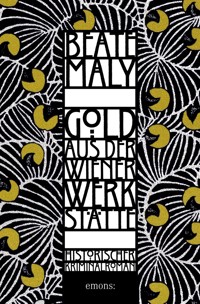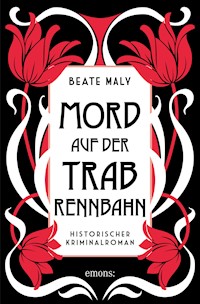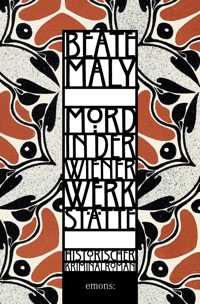
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historischer Kriminalroman
- Sprache: Deutsch
Beate Maly in Bestform: kundig, atmosphärisch, hochspannend! Wien, 1906: Die junge Fälscherin Lili wird bei einem Diebstahl erwischt. Um einer Strafe zu entgehen, verspricht sie Kommissar Max von Krause, sich eine ordentliche Arbeit zu suchen. Durch Zufall ergattert sie eine Aushilfsstelle in der legendären Wiener Werkstätte und ist begeistert vom Ideenreichtum der dort arbeitenden Frauen. Doch die kreative Idylle trügt: Eines Morgens findet Lili eine der Künstlerinnen erschlagen auf. Ihr Sinn für Gerechtigkeit ist geweckt, und während der fesche von Krause gleich mehrere Fälle zu lösen hat, nimmt Lili die Ermittlungen selbst in die Hand... Band 1 der Reihe »Liliane Feiglas und Max von Krause«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Wikimedia Commons/public domain, Koloman Moser
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Christine Derrer
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-159-1
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Die Straßen Wiens sind mit Kultur gepflastert. Die Straßen anderer Städte mit Asphalt.
1
Wien, 1906 – Kohlmarkt, Café Milani
Die Gasbeleuchtung im Separee hinter dem Billardzimmer flackerte unruhig. Die Luft war stickig. Jeder der Anwesenden rauchte und verschwand in einer dicken Wolke aus stinkendem Qualm. Das kleine Kämmerchen verfügte über kein Fenster, das man hätte öffnen können. Die rote Tapetentür mit dem floralen Muster in Gold hatte längst ihre Strahlkraft verloren. Aber Einrichtung oder Bilder interessierten die Männer am Tisch ohnehin nicht. Sie hätten genauso gut im Hinterzimmer einer Spelunke am Spittelberg sitzen können und nicht in einem der vornehmen Kaffeehäuser der Stadt, die den Einflussreichen und Wohlsituierten, den Männern, die das Sagen in der Stadt hatten, vorbehalten waren.
»Gehen alle mit?« Der General mit den drei großen Orden an der Brust sah fragend in die Runde.
Der Einsatz wurde erneut erhöht. Die Münzen in der Mitte des Tischs glänzten verheißungsvoll. Wie viel hatte er heute schon verspielt? Er hatte längst den Überblick verloren und sich wiederholt Geld ausgeborgt. Irgendwann musste die Pechsträhne abreißen. Unmöglich, dass es den ganzen Abend so weiterging. Das war rein rechnerisch gesehen unrealistisch. Irgendwann endete jedes Schlamassel und verwandelte sich in Glück. Er musste bloß noch ein bisserl Geduld haben, dann würde das Blatt sich zu seinen Gunsten wenden.
Klirrend wurden weitere Münzen in die Mitte geworfen. Er fasste in die ausgebeulte Tasche seines feinen Sakkos. Wie konnte sie schon wieder leer sein? Hilfesuchend drehte er sich zu seinem Sitznachbarn.
»Brauchst du noch etwas?« Der Leutnant der Kavallerie hatte deutlich mehr Glück gehabt. Die Geldstöße vor ihm wuchsen von Runde zu Runde. Bald würde er nicht mehr darüber hinweg auf den Tisch schauen können.
Er nickte bloß.
Mit großzügiger Geste schob der Leutnant ein paar Münzen zu ihm. »Ich will das Geld morgen wiedersehen.«
»Selbstverständlich.« Er lachte nervös und kehlig. »Du kriegst es heute noch, sobald ich gewinne.«
Der Blick des Leutnants wurde mitleidig. »Ich muss auf einen Schuldschein bestehen.«
»Du hast doch schon einen.«
»Dann setz eine neue Summe ein.« Der Militär holte das zusammengefaltete Papier aus seiner Uniform und legte es gemeinsam mit einem Stift vor ihn auf den Tisch. »Ein Versprechen ist gut, eine Unterschrift besser.« Er grinste breit und legte einen Vorderzahn frei, dem ein Teil fehlte. Es verlieh ihm eine brutale Entschlossenheit.
Widerwillig besserte er die Summe auf dem Schuldschein aus und besiegelte ihn mit seiner Unterschrift. Dann nahm er die Münzen entgegen. Er schwitzte. Es war unnatürlich heiß in dem winzigen Raum. »Ein neues Blatt«, forderte er ungeduldig.
Er spürte es ganz deutlich. Jetzt würde er gewinnen. Und um diese Wende auch gebührend zu feiern, brauchte er noch etwas zu trinken. Sein Glas war leer und seine Kehle völlig ausgetrocknet von der schlechten Luft. Schon etwas benommen fasste er nach dem schweren Bleikristallglas, hob es an. Sofort eilte der Kellner, der die ganze Zeit im Hintergrund gestanden hatte, zu ihm. Der Bursche wartete nur darauf, die Wünsche der Gäste zu erfüllen. Bereitwillig schenkte er das Glas mit goldflüssigem Whisky auf. Sollte er jetzt nicht gewinnen, würde er auch dafür Geld ausborgen müssen.
Er schwenkte das Glas. Der rauchige Geruch erstklassigen schottischen Whiskys stieg in seine Nase. Das Getränk weckte Erinnerungen in ihm. Für einen Moment schloss er die Augen. Ja, jetzt würde er gewinnen. Er wusste es. Das Glück würde ihm hold sein. Dann nahm er einen großen Schluck, stellte das Glas schwungvoll vor sich ab und wartete auf die neuen Karten. Voller Zuversicht nahm er sie auf. Seine Fingerspitzen kribbelten, er fühlte sich lebendig. Der Abend hatte erst begonnen, und das Spiel kam nun so richtig in die Gänge. Eines war gewiss: Er würde erst aufstehen, wenn die Pechsträhne ihn verlassen hatte.
2
Naschmarkt
Die Marktstände waren frisch poliert und glänzten in der Sonne. Vor einem Jahr waren die fix gemauerten Gebäude mit den hübschen grünen Dächern in drei ordentlichen Reihen über dem unterirdisch fließenden Wienfluss aufgebaut worden. Der Markt war der modernste der Stadt. Hier gab es alles, was das kulinarische Herz begehrte. Köstlichkeiten aus fünfzehn Kronländern wurden angeboten: eingelegte Paprikaschoten und Gurken vom Balkan, Knoblauchzehen aus Transsilvanien, Rosenöl aus Sofia, Salami aus der Puszta und frische, knusprige Topfengolatschen aus Böhmen, Zitronen und Orangen aus Triest, würziger Käse aus Bozen und luftgetrockneter Hirschspeck aus Vorarlberg. Wein aus dem Süden und Schnaps aus dem Osten des Reichs.
Liliane Feigls Magen knurrte beim Anblick der glänzenden Äpfel, der duftenden Pfirsiche und des goldbraunen Brots. Wann hatte sie das letzte Mal eine ordentliche Mahlzeit zu sich genommen? Es musste Tage her sein. Wieder einmal war die Haushaltskassa leer. Lilis Vater hatte einen Teil des Geldes, das ihnen zur Verfügung stand, versoffen, den Rest am Kartentisch verspielt. Zum Glück war Lili fingerfertig. Als einziges Kind eines Kleinganoven, das ohne Mutter aufgewachsen war, waren Geschicklichkeit und Gerissenheit für sie überlebensnotwendig gewesen. Mit vorgespieltem Interesse musterte sie einen Apfel, nahm ihn in die Hand und betrachtete ihn von allen Seiten, während sie mit der anderen einen weniger leuchtenden in der Tasche ihrer nicht mehr ganz sauberen Schürze verschwinden ließ. Wichtig war, sich nichts anmerken zu lassen. Auch wenn die Marktfrau sie wegscheuchte, galt es, ruhig zu bleiben und mit gelassenen Schritten zum nächsten Stand zu gehen, um dort mit dem gleichen Trick ein Stück Wurst zu stibitzen. Je dichter das Treiben am Markt wurde, umso einfacher war es, satt zu werden. Lili zwängte sich an Dienstmädchen in dunklen Uniformen und mit weißen Hauben vorbei, näherte sich flink Hausfrauen mit langen Mänteln und ausladenden Hüten, um aus offenen Einkaufskörben ein paar Weintrauben und ein Stück Käse mitgehen zu lassen.
Vor einem Stand mit feiner Schokolade und Bonbons hielt sie an. Eigentlich hatte sie bereits genug in ihrer Tasche. Aber so ein Stück Schokolade oder ein Fruchtbonbon waren einfach zu verlockend. Sie hatte erst zweimal in ihrem Leben richtige Süßigkeiten gegessen. Einmal als Kind. Da hatte eine Standlerin ihr eine Handvoll leuchtend roter Kirschbonbons geschenkt. Sie waren das Köstlichste gewesen, was Lili jemals gelutscht hatte. Und das zweite Mal als junge Frau, da hatte sie einen Schokoladenriegel gestohlen. Auch er war ausgesprochen gut gewesen. Immer noch träumte sie von dem mollig süßen Geschmack, der sich langsam in ihrem Mund ausgebreitet und ein Gefühl höchster Glückseligkeit in ihr ausgelöst hatte.
Die Köstlichkeiten in den hohen Körben waren ganz besonders. Sie waren in so hübsches Papier gewickelt, dass Lili sich fragte, warum man sie nicht im Museum ausstellte. Es gab kleine Pralinen in Kästchen, die so kostbar aussahen, dass man Schmuck darin hätte aufbewahren können, wenn man welchen besessen hätte. Lilis einziger Schatz war ein alter Hornkamm ihrer Mutter. Wie war es möglich, dass es Menschen gab, die etwas so Wunderschönes als schnöde Verpackung verwendeten? Sie fasste nach einem Bonbon in rosarotem Papier, auf das phantasievolle Blumen und Weinranken gedruckt waren. Sofort ertönte eine keifende Stimme.
»Finger weg!«
Die Marktfrau war ein paar Jahre älter als Lili, Anfang dreißig. Lili wusste nicht, wie alt sie selbst wirklich war. Ihr Vater konnte sich nicht mehr genau erinnern. Der Alkohol hatte sein Gehirn aufgeweicht. Getauft worden war Lili nie. Geld für eine Geburtsurkunde hatte Franz Feigl nie gehabt. Das gefälschte Dokument, das er für sie angefertigt hatte, war vor Jahren abhandengekommen. Lili hatte beschlossen, sich selbst einen Geburtstag zu geben. Sie mochte den Frühling, also hatte sie sich für den 24. April entschieden. Ein schönes Datum, wie sie meinte. Und die Urkunde hatte sie allein ausgestellt. Lili hatte das Talent ihres Vaters geerbt. Er war ein Meister darin, aber seit ein paar Jahren hatte Lili ihn übertroffen. Ihre Stempelmarken sahen den echten zum Verwechseln ähnlich.
Widerwillig legte sie das rosarote Bonbon weg, nur um sich ein hellgelbes zu grapschen. Es hatte ein ähnliches Muster. Mit mehr Blumen und weniger Weinreben. Es gefiel Lili noch besser. Sie selbst würde das Muster mit Vergissmeinnicht ergänzen, die waren klein und unscheinbar und leuchteten trotzdem in sattem Himmelblau.
»He, hast du nicht gehört? Du sollst es zurücklegen.«
»Schon gut.« Lili gab das Bonbon auf den vollen Korb.
Die Marktfrau besaß mindestens hundert davon. Es würde ihr überhaupt nicht auffallen, wenn eines fehlte. Mittlerweile wollte Lili gar nicht die Süßigkeit, sondern die wunderschöne Verpackung. Sie würde ihr als Vorlage und Inspiration dienen. Bestimmt konnte sie ebenso schöne Muster zeichnen.
Sie blickte an sich hinunter. Wenn ihr Kleid nicht so schäbig aussehen würde und ihre Frisur ein bisschen ordentlicher wäre, hätte die Marktfrau niemals erkannt, dass sie die Süßigkeiten nicht bezahlen konnte. Lili war weder auf den Mund gefallen, noch war sie dumm, auch wenn sie bloß vier Jahre die Schule besucht hatte. Sie war des Lesens und Schreibens kundig und konnte rechnen. Was brauchte man mehr zum Leben? Sie blieb hartnäckig stehen und betrachtete die anderen Bonbons. Alle waren in kostbares Papier gewickelt. Die Marktfrau behielt sie mit giftigen Blicken im Auge. Sie hatte kein Verständnis für Lilis Wünsche. Da half es auch nicht, dass Lili sie gewinnend anlächelte. Die Frau blieb griesgrämig.
Lili verfluchte ihr löchriges Kleid, das viel zu locker an ihrem mageren Körper herunterhing. Ihr Gesicht war schmal, und ihre Lippen waren voll. Lili wusste, dass sie wunderschöne veilchenblaue Augen hatte, die je nach Wetterlage den Farbton änderten. Und ihr goldblondes Haar glänzte, wenn es mal gewaschen war, was heute aber nicht der Fall war, da das Brunnenwasser im Hof eiskalt war und sie wegen einer Haarwäsche nicht drei volle Kübel in den vierten Stock hatte schleppen wollen.
Während sie über ihr Äußeres nachdachte, trat eine Kundin mit einem Dienstmädchen und einer Gesellschafterin an den Stand. Der Kleidung nach zu urteilen, handelte es sich um eine sehr wohlhabende Dame aus gehobeneren Kreisen. Ihre breite Taille war mit einem Korsett eng geschnürt. Ihr Gesäß durch eine ausladende Turnüre verdeckt. Lili fragte sich stets, wie vornehme Damen mit so einem Gestell aus Fischbein am Hinterteil sitzen konnten. Ob sie ständig standen? Die Hände der Kundin steckten in Handschuhen, auf ihrem Kopf saß ein Hut, der mit mehreren bunten Federn geschmückt war.
Die Marktfrau erkannte in der Dame eine potenzielle Kundin, die möglicherweise viel Geld bei ihr ausgeben würde. Voll gespielter Liebenswürdigkeit widmete sie sich ihr.
»Grüß Gott, gnä’ Frau. Darf ich Ihnen eine Kostprobe unserer handgedrehten Bonbons anbieten? Die Köstlichkeiten sind in Papier aus der Wiener Werkstätte verpackt.« Sie hielt ihrer Kundin ein silbernes Tablett entgegen, auf dem mehrere Süßigkeiten zur Auswahl lagen.
Das darf nicht wahr sein, dachte Lili verärgert. Die feine Dame und ihre Gesellschafterin bekamen die Bonbons geschenkt. Sogar das Dienstmädchen durfte zugreifen. Und sie wurde weggescheucht wie ein lästiges Insekt. Sie nutzte die Unaufmerksamkeit der Verkäuferin und griff blitzschnell nach einem hellblau eingepackten Bonbon. Kaum dass sie es in ihrer Schürze verschwinden lassen wollte, legten sich kräftige Finger um ihr Handgelenk. Ein Polizist stand neben ihr. Wie hatte sie nur so achtlos sein können? Der Wunsch, so ein schönes Bonbon zu besitzen, hatte sie unvorsichtig werden lassen.
»Diebsgesindel!«, sagte er finster.
Der Helm mit dem glänzenden Spitz war ihm zu groß. Er rutschte ihm in die verschwitzte rote Stirn. Lili wand sich wie ein Wurm, leider ließ er sie trotzdem nicht los. Im Gegenteil, seine fleischigen Finger bohrten sich tief in ihren Unterarm.
»Ich wollte das Bonbon bezahlen«, verteidigte sie sich.
»Ach ja? Dann bitte sehr. Ich warte.« Die Enden seines Bartes waren zu Schnecken gedreht, die zitterten, während er sprach.
Lili fasste mit der freien Hand in ihre Rocktasche. Sie spürte den Apfel, ein Stück Brot, das Ende einer Wurst. Natürlich war keine Münze da. Sie hatte gehofft, dass er jetzt ihren Arm loslassen würde und sie weglaufen könnte oder die feine Dame sich ihrer erbarmen würde und die Rechnung für sie beglich. Aber weder das eine noch das andere trat ein. Der Polizist hielt sie gnadenlos fest.
Sie legte das Bonbon wieder in den Korb. »Ich hab doch keine Münze dabei«, sagte sie entschuldigend. »Ich gebe es zurück. Das Bonbon ist wieder im Korb. Kann ich jetzt gehen?«
Er fasste nach ihrer Schürze und zog die Köstlichkeiten heraus. »Ich beobachte dich schon den ganzen Nachmittag«, sagte er. »Du kommst jetzt mit auf die Wache. Fürs Erste ist es mit dem Stehlen vorbei.«
»Eine Diebin!«, quietschte die feine Dame entsetzt.
Sie klang, als wäre Lili eine hässliche, fette Ratte. Nur das Dienstmädchen, das bestimmt kein einfaches Leben führte, betrachtete Lili mit einem Hauch von Mitleid. Der Gesellschafterin schien sie egal zu sein. Ihr Mund war voller Schokolade. Gierig griff sie nach dem nächsten Stück. Die wunderschöne Verpackung zerknüllte sie nachlässig und warf das Papier achtlos auf den Boden. Lili wollte das kleine Kunstwerk aufheben und fein säuberlich glatt streichen. Aber sie konnte sich keinen Zentimeter bewegen.
Die Marktfrau keifte: »Faules Diebespack. Gesindel. Eingesperrt gehörst du.«
»Ein Jammer, dass der Pranger abgeschafft wurde. Für stehlende Schmarotzer wie die da wäre er gerade recht«, legte die Dame nach.
Lili spuckte der Frau vor die Füße. Sie hatte es satt, beschimpft zu werden. Keine von ihnen hatte eine Vorstellung davon, was es hieß, in der Gosse aufzuwachsen. Mit hocherhobenem Kopf und durchgestreckten Schultern ließ sie sich von dem Polizisten abführen. Was blieb ihr auch anderes übrig? Seine Finger schnürten das Blut an ihrem Handgelenk ab. Morgen würde ihr Unterarm blau sein.
3
Elisabethpromenade, Polizeipräsidium
»Am Spittelberg haben wir letzte Nacht zwei illegale Hübschlerinnen festgenommen, in der Leopoldstadt einen Trickbetrüger und am Naschmarkt eine Diebin. Womit wollen Sie anfangen?«
Polizeidiener Carel Novak reichte Max von Krause eine Liste mit Namen. Eigentlich hatte Max seit drei Stunden Dienstschluss, aber ans Nach-Hause-Gehen war nicht zu denken, da zwei seiner Kollegen krank waren und sein Vorgesetzter, Oberkommissar Peter Sobotka, darauf bestand, dass alle Festgenommenen noch am selben Tag verhört wurden. Auf die Idee, dass Sobotka selbst eines der Verhöre übernehmen könnte, kam der Mann nicht.
Max seufzte laut, fuhr sich mit beiden Händen durchs rabenschwarze Haar, das seit Wochen dringend einen Schnitt benötigte, und tippte willkürlich auf einen der Namen auf der Liste. »Schick die Diebin herein und bring mir bitte noch eine Tasse Kaffee.«
Carel nickte.
Er war ein zuverlässiger Bursche mit dem Blick und Haar eines Straßenköters. Längst hätte er sich eine Beförderung verdient. Aber solange Oberkommissar Peter Sobotka dafür zuständig war, würde das niemals geschehen, denn Carel Novak hatte keinen Schulabschluss, und Sobotka machte sich einen Spaß daraus, dem jungen Mann, Carel war an die zwanzig, diesen Makel spüren zu lassen. Bei Max verhielt es sich anders. Er war dem Oberkommissar an Ausbildung und Herkunft weit überlegen. Nur zu gern hätte Sobotka den Adelstitel seines Untergebenen übernommen. Dass er Oberkommissar war und nicht Max, war allein der Tatsache geschuldet, dass Sobotkas Schwiegervater der Schwager des Polizeipräsidenten war.
Max las den Namen der Diebin: »Liliane Feigl, Geburtsdatum: 24. April 1881«. Eine junge Frau, nur fünf Jahre jünger als er selbst. Der Name Feigl kam ihm bekannt vor. Er konnte sich aber nicht mehr erinnern, in welchem Zusammenhang er ihn schon einmal gehört hatte. Es waren zu viele Gauner, mit denen er sich Tag für Tag herumschlagen musste. Der Vorname Liliane gefiel ihm.
Carel brachte eine Tasse dünnen Kaffee, der nach nichts schmeckte, und einen Teller mit trockenen Butterkeksen. Die Verpflegung der kaiserlichen Polizeiagenten.
Noch bevor Max nach einem Keks greifen konnte, ging die Tür zu seinem winzigen Büro auf, und eine ungewöhnlich attraktive Frau trat ein. Selbst ihr mürrischer Gesichtsausdruck konnte daran nichts ändern. Einige ihrer blonden Strähnen hatten sich aus ihrer Frisur, einem einfachen Knoten am Hinterkopf, gelöst. Ihre Augen hatten einen ungewöhnlichen Farbton. Sie waren veilchenblau. Ihre schäbige Kleidung passte nicht zu ihrem fein geschnittenen Gesicht. Störrisch wie ein kleines Kind verschränkte sie die Arme vor der schmalen Brust.
»Ich hab nix Böses getan.«
Max brauchte einen Moment, um seine Gedanken wieder zu ordnen. Er schaute auf die Unterlagen auf dem Schreibtisch. »Hier lese ich etwas anderes. Sie haben mehrere Lebensmittel gestohlen.«
»Ich hätt das bunt eingewickelte Bonbon bezahlt!«
»Sie hatten kein Geld dabei.«
»Deshalb hab ich es zurückgegeben.«
Max lehnte sich nach hinten und verschränkte ebenfalls die Arme. Eigentlich waren ihm Verhöre wie dieses zuwider. Aber heute fand er Gefallen daran, was wohl der Person geschuldet war, die vor ihm stand.
»Der Kollege behauptet, Sie hätten auch einen Apfel, Brot, Wurst und ein Stück Käse gestohlen.«
Liliane Feigl löste die Arme und stützte sich frech auf seiner Tischplatte ab. »Ich hatte Hunger.«
»Wie wäre es mit ehrlicher Arbeit?«
»Das habe ich versucht. Ich war zwei Wochen lang Dienstmädchen in einem feinen Haushalt auf der Ringstraße.« Sie lachte bitter. »In der Dienstbeschreibung stand nicht, dass es auch zu meinen Aufgaben gehört, die Bedürfnisse des jungen und des alten Herrn des Hauses zu befriedigen. Ich bin davongelaufen, bevor ich schwanger werden konnte.«
Max presste die Lippen zusammen und schluckte. Liliane Feigl hatte eben eine bittere Wahrheit ausgesprochen. Nur zu gut wusste er um die katastrophalen Arbeitsbedingungen von Dienstmädchen. Sie dienten den jungen Männern als »erotische Versuchsobjekte« und den älteren als »Ersatz für die Ehefrau«, damit die nicht etwas tun musste, was ihr zuwider war. Max vermutete, dass sein verstorbener Vater auf diese Weise unzählige Kinder in die Welt gesetzt hatte. Halbgeschwister, die Max alle nicht kannte. Vielleicht liefen sie jetzt ebenso abgerissen durch die Stadt und stahlen Äpfel am Markt, um zu überleben. Der Gedanke schmerzte ihn.
»Es gibt auch andere Arten, sein Geld zu verdienen«, sagte er düster. »Man muss nicht als Dienstmädchen anfangen.«
»Ach ja? Sie scheinen ein Experte zu sein.«
Die Frau war unglaublich frech. Jetzt stemmte sie die Hände in die schmalen Hüften und richtete sich auf. Ihre Dreistigkeit imponierte Max.
»Wissen Sie, wie viele Frauen ihren Körper verkaufen müssen? Ich kenne eine Menge, die in Fabriken arbeiten und trotzdem im horizontalen Gewerbe tätig sind, um zu überleben.«
Max widersprach nicht. Er kannte das Elend auf den Straßen der Stadt. Trotzdem konnte er es nicht durchgehen lassen, dass eine Frau am Markt Lebensmittel stahl.
Er beugte sich ebenfalls nach vorn. Ihre Gesichter waren einander ungebührend nahe. »Jetzt hören Sie mir gut zu, Liliane Feigl.« Er mochte es, ihren Namen auszusprechen. »Ich drücke beide Augen zu. Weil unsere Gefängnisse ohnehin voll sind und ich nicht eine weitere Person darin wissen will.« Blitzte Überraschung in ihren Augen auf? Ganz bestimmt war da Erleichterung. »Aber ich will Sie hier nie wieder sehen. Haben Sie mich verstanden?«
»Sie nehmen mich nicht fest?«
»Nein, ich lasse Sie laufen. Ohne Vermerk, ohne Eintrag in Ihrer Akte. Einfach so. Aber …« Er betonte das Wort. Um ihm noch mehr Wichtigkeit zu verleihen, erhob er oberlehrerhaft den Zeigefinger. »… ich will, dass Sie sich Arbeit suchen. Irgendetwas Ehrliches. Kein Diebstahl mehr.«
Sie sah ihn mit großen veilchenblauen Augen an.
»Und auch keine illegale Prostitution.«
Jetzt verfinsterte sich der hübsche Farbton und wurde zu einem Dunkelblau, das an eine Gewitterstimmung erinnerte. »So was würd ich nie machen.«
Er glaubte ihr. »Gut«, sagte er. »Dann sind wir uns einig. Sie gehen jetzt, und ich sehe Sie hier nie wieder. Keine weiteren Diebstähle oder sonstigen Gesetzesübertretungen.« Er schaute auf. Langsam wurde ihre Augenfarbe wieder heller. »Kann ich Ihren Namen von der Liste streichen?«
Sie stand auf und nickte. Ihr Blick fiel auf die trockenen Butterkekse neben seinem dünnen Kaffee.
»Greifen Sie zu«, sagte er. »Aber ich warne Sie, sie stauben einem aus den Ohren.«
»Hauptsache, sie machen satt.« Sie steckte gleich vier davon ein und verließ ohne weiteres Wort das Büro.
4
Neustiftgasse
Die vier trockenen Kekse hatten Lilis Hunger erst so richtig befeuert. Ihr Magen knurrte lauter denn je. Warum hatte sie das Brot und die Wurst nicht gleich gegessen? Was einmal im Bauch war, konnte einem niemand mehr wegnehmen. Eine alte Regel, die ihr Vater ihr mit fünf beigebracht hatte.
Ehrliche Arbeit, pah. Wie stellte der Herr Kommissar mit dem Adelstitel im Namen sich das vor? Selbst wenn Lili in einer der Fabriken Arbeit annahm, in denen ausschließlich Frauen tätig waren – Männer waren dort nur als Vorarbeiter angestellt –, würde das niemals zum Überleben reichen. Er sollte ihr mal vorhüpfen, wie man als Frau aus den untersten Schichten ehrlich überleben konnte.
Ein Kohlewagen ratterte laut an ihr vorbei. Der Mann am Kutschbock pfiff ihr anzüglich zu. »He, Süße, wie wär’s mit uns zwei?«
»Schleich dich!«
Er lachte zur Antwort.
Verärgert stapfte Lili weiter. Sie hatte weder genug Münzen für eine Fahrt mit der Pferdestraßenbahn noch für einen Fiaker. Alle Wege in der Stadt legte sie zu Fuß zurück. Was den feinen Damen der Stadt verwehrt war, nämlich ein Spaziergang ohne Begleitung, war für Frauen wie Lili eine Selbstverständlichkeit. Sie bewohnte eines der nasskalten Löcher am Magdalenengrund. Im Volksmund wurde er auch Ratzengrund genannt. Es war eines der heruntergekommensten Viertel Wiens. Hier hausten nur die, die sich nichts anderes leisten konnten.
Der Weg von der Elisabethpromenade ins Elendsviertel führte über den Ring, vorbei an den schönen neuen Museen, hinauf in die Neustiftgasse. Hier reihte sich ein Prachtbau an den nächsten. Wie es sich wohl anfühlte, in einem der neu errichteten Wohnhäuser zu leben? Mit Gasbeleuchtung, Kachelofen und Fließwasser am Gang? Wenn Lili Wasser benötigte, musste sie über die enge, wackelige Holztreppe hinunter in den Hof, wo sich ein alter Ziehbrunnen befand. An manchen Tagen verzichtete sie auf die Katzenwäsche.
Völlig in ihre verträumten Gedanken versunken, in denen sie sich ausmalte, saubere Kleider zu tragen und süßes Backwerk zu verspeisen, sah sie die Frau zu spät, die vor ihr aus einem der Hauseingänge stolperte. Sie stieß mit ihr zusammen, worauf die Frau sie wüst beschimpfte.
»Hast du keine Augen im Kopf?« Wütend erhob sie die Faust und hielt sie Lili drohend entgegen. Zwei ihrer Zähne fehlten, der Rest waren schwarze Stummel. Das Haar war ungepflegt und strähnig. Ihre Kleidung sah ungewaschen aus.
»Verschwinde, Thea, und lass dich hier nie wieder blicken!«
Die Frau, die nun sprach, war aus völlig anderem Holz geschnitzt. Ihre Aussprache war gewählt. Ihre Gesichtszüge fein. Das helle Haar ordentlich zurückgebunden. Sie trug ein hochgeschlossenes Kleid. Eine lange Schürze war darüber gebunden, um den dunklen, feinen Stoff zu schützen. Die Schürze wies bunte Farbspritzer auf. In einer Hand hielt sie einen Druckmodel. Lilis scharfer, geschulter Blick erkannte das Blumenmuster. Sie hatte es heute schon einmal bewundert.
»Keine zehn Pferde würden mich hier noch einmal herbringen!« Die Frau auf der Straße spuckte aus, zog den löchrigen Umhang enger um ihre kantigen Schultern und stapfte schimpfend davon.
Lili sah ihr verdattert nach.
Die Frau im Türrahmen hob entschuldigend die Schultern. »Das war unsere Putzfrau.« Sie verzog leidend den Mund. »Sie haben nicht zufällig Lust, die freie Stelle zu übernehmen?« Ihre Worte waren nicht ernst gemeint, denn schon wandte sie sich um.
Aber Lili reagierte schnell. »Ich bin auf der Suche nach Arbeit.«
Die Frau drehte sich am Absatz um. »Es war bloß ein Scherz.«
»Ich meine es ernst«, beeilte sich Lili. »Bedrucken Sie mit dem Model das hübsche Papier für die Bonbons, die am Naschmarkt verkauft werden?«
Die Überraschung auf dem Gesicht der Frau war nicht zu übersehen. »Sie haben das Muster erkannt?«
»Es ist ein außergewöhnlich schönes Muster. Es prägt sich ins Gedächtnis ein.«
»Wirklich?« Die Frau hob den Model, so als müsse sie sich von Lilis Worten selbst überzeugen. »Ich habe es entworfen.«
»Es ist sehr, sehr schön«, wiederholte Lili. Sie sah eine winzig kleine Chance auf eine Anstellung wachsen. Als Putzfrau in einer Werkstätte einer Frau müsste sie sich wohl kaum den erotischen Wünschen eines Hausherrn beugen. »Das Muster ist etwas ganz Besonderes«, wiederholte Lili. »Und ich suche Arbeit. Ich bin ordentlich und scheue mich nicht vor harter, körperlich anstrengender Tätigkeit. Ich kann einen Boden fegen, aufwaschen und mit der Drahtbürste schrubben. Fenster putzen.« Mehr fiel ihr im Moment gar nicht ein. Was galt es sonst noch sauber zu halten?
»Sie müssten eine Werkstatt säubern.« Mit einem Mal betrachtete die Frau sie mit wachsendem Interesse. Ihre Augenbrauen rutschten zusammen. Sie waren dunkel und bildeten einen interessanten Kontrast zu ihrem blonden Haar. Ihre braunen Augen musterten Lilis zerschlissenes Kleid. Beschämt hielt Lili eine Hand über das Loch im Rock.
»Das kann ich«, log Lili. Sie hatte die winzige Wohnung, in der sie lebte, noch nie ordentlich geputzt. Wozu auch? Es lohnte sich nicht, das Zimmer am Ratzengrund sauber zu halten. Ihr Vater würde es mit seinen Farben und Pinseln ohnehin sofort wieder einsauen. Mit ihrer nächsten Bemerkung sagte sie die Wahrheit. »Ich kenne mich mit Farben, Lösungs- und Bindemittel aus.«
»Tatsächlich?« Nun war die Neugier der Frau endgültig geweckt. »Thea konnte einen Fleck von Aquarellfarbe nicht von Öl unterscheiden. Sie hat alles nur noch schlimmer gemacht und gleich drei meiner Drucke zerstört.«
Lili nickte eifrig. »Ich weiß, dass man Pinsel niemals ins Wasser stellen darf. Ölfarbe muss man mit Terpentin entfernen. Druckmodel sind immer gleich zu säubern, da die Farbe das Holz sonst ruiniert.«
Die Frau kniff die Augen zusammen. »Woher wissen Sie das alles?«
»Mein Vater ist Künstler.« Der Satz war nicht vollständig gelogen. Franz Feigl war wirklich ein Künstler. Dass er seinen Lebensunterhalt mit dem Fälschen von Dokumenten verdiente, musste man ja nicht dazusagen.
»Ein Künstler?«, fragte die Frau misstrauisch.
»Einer, der nicht von seiner Kunst leben kann.« Auch das stimmte bis zu einem gewissen Grad. Franz Feigl versoff seine Einnahmen, also konnte er nicht davon leben.
Die Frau winkte Lili ins Haus. »Kommen Sie rein«, sagte sie. »Vielleicht sind Sie ja wirklich genau die Person, die wir brauchen.«
Lili konnte ihr Glück nicht fassen. Wenn das der anmutige Herr Kommissar mit den dunklen Augen erfahren würde, dass sie schon am Heimweg eine »ordentliche Arbeit« gefunden hatte, wäre er stolz auf sie. Seltsam, dass sie an ihn dachte. Lili hob ihre Röcke, stieg über die zwei Stufen und betrat das Haus. Sie folgte der Frau durch einen kurzen Gang. Am Ende gelangten sie in einen großen hellen Raum. Der Geruch nach Lösungsmittel, Gips, Holz und Papier schlug ihr entgegen. Lili sog ihn tief in ihre Lungen. Die Mischung war besser als jedes Parfum. Sie verband sie mit glücklichen Stunden mit ihrem Vater. Stunden, in denen er nicht betrunken gewesen war und ihr als Kind die Grundbegriffe der Farbenlehre beigebracht hatte.
»Willkommen in der Wiener Werkstätte«, sagte die Frau. »Mein Name ist Helene. Helene Gabler.«
»Ich bin Liliane Feigl, aber sagen Sie Lili zu mir.«
»Was für ein hübscher Name, eigentlich ist er viel zu schade, um ihn abzukürzen. Servus, Liliane.« Sie reichte ihr die Hand. Helenes Händedruck war ungewöhnlich kräftig für eine Frau.
Mit offenem Mund sah sich Lili um. Der Raum war von natürlichem Licht durchflutet. Erst beim zweiten Blick erkannte sie den Grund dafür. Die Decke war fast vollständig aus Glas wie in einem riesigen Gewächshaus. Eine hölzerne Treppe führte zu einer Art Galerie, wo sich Arbeitsnischen befanden. Dort arbeiteten zwei Frauen an Schreibtischen. Sie blickten nur kurz von ihrer Arbeit auf, widmeten sich dann aber wieder ihrem Tun.
In der Halle standen Tische und Staffeleien. Die Tische waren zu einer langen Reihe zusammengeschoben. Eine Frau bearbeitete eine Stoffbahn und bedruckte sie mit einem großen Holzmodel. Sie arbeitete voller Konzentration und ließ sich auch durch Lili und Helene nicht aus dem Konzept bringen. In einer Ecke saß eine Frau an einer Töpferscheibe. Mit dem Fuß bediente sie ein Pedal, das die Scheibe rasch zum Drehen brachte. Mit den Händen drückte sie einen grauen Klumpen genau ins Zentrum der Scheibe. Kurz darauf zog sie mit geschickten Fingern eine dünnwandige Vase in die Höhe. Was so leicht aussah, bedurfte jahrelanger Übung. Daneben modellierte eine andere Frau einen Kopf aus Keramik. Lili wähnte sich im Paradies. Hier waren Frauen, die ihrer Leidenschaft nachgehen durften: Sie kreierten Kunstwerke.
»Arbeiten hier nur Frauen?«, fragte sie ehrfürchtig.
»Nein, es gibt viel mehr Männer als Frauen. Aber in diesem Raum überwiegt der Frauenanteil. Wir haben alle die Kunstgewerbeschule besucht. Wir sind Kunstgewerblerinnen.« Helene lachte.
Es klang fröhlich und war ansteckend. Gern hätte Lili mit eingestimmt, wenn sie nicht so nervös gewesen wäre. Ihre Hände waren plötzlich feucht. Noch nie hatte sie sich etwas so gewünscht, wie hier zu arbeiten, und sei es bloß als Putzfrau.
»Eigentlich war es nie vorgesehen, dass so viele Frauen in der von Männern gegründeten Werkstätte arbeiten«, erklärte Helene. »Aber wir sind eben die besseren Dekorateurinnen.«
Die Frau, die eben noch gedruckt hatte, hob nun den Kopf. Eine Strähne fiel ihr in die helle, verschwitzte Stirn. Sie schob sie mit dem Handrücken zurück. »Vielleicht sind wir die besseren Künstlerinnen. Aber das müssen die Männer erst akzeptieren lernen.«
Helene lachte erneut. »Na, ja es wird wohl noch dauern, bis sie uns auch an die Architektur und das Möbeldesign lassen. Im Moment geben wir uns mit Stoffmustern, Postkarten und Keramiken zufrieden.« Sie machte eine Pause. »Es sind kleine Schritte, die wir gehen.«
Lili fand, dass es Riesenschritte waren. Noch nie war sie an einem Ort gewesen, an dem Frauen so frei arbeiten durften und sich nicht den Vorgaben von Männern beugen mussten. Hatte die Keramikerin gar eine Hose an? Das war völlig undenkbar. Oder etwa doch nicht? Sie hatte beim Arbeiten eine Zigarette im rechten Mundwinkel. Ihr Haar war unordentlich zusammengebunden. Auf der Straße wäre sie auf der Stelle von der Sittenpolizei festgenommen und in eines der überfüllten Gefängnisse geworfen worden. Hier schien sich niemand daran zu stören.
An der Rückseite des Raums hingen Stoffmuster, Drucke und Ansichtskarten an der Wand. Lili sah entzückende Karten, die spielende Kinder, Frauen in eleganter Kleidung und Szenen in der kaiserlichen Menagerie zeigten. Eine Serie mit Frauen in schmal geschnittenen Kleidern ohne Reifunterröcke mit Hunden an Leinen und extravaganten Hüten am Kopf stach ihr besonders ins Auge. Die Figuren wirkten auf dem verschwommenen, gepunkteten Hintergrund besonders plastisch, dabei zierte kein einziger Faltenwurf die Kleidung. Es war die Art des Drucks, die die Plastizität vorgaukelte. So als würden die Figuren den Betrachtern entgegentreten. Lili war fasziniert.
»Wollen Sie bei uns putzen?«
Hatte Helene die Frage eben wirklich gestellt? Oder hatte Lili sie sich nur gewünscht? Lili zwickte sich in den Unterarm, um sicherzugehen, dass sie nicht träumte. Helene sah sie abwartend an. Also war es kein Traum. Lili nickte. »Oh ja.« Sie verschwieg, dass sie gern auch malen und zeichnen und entwerfen würde. Aber dazu fehlte ihr die Ausbildung. Sie gab sich mit dem Putzen zufrieden.
»Wir zahlen Ihnen den Lohn wöchentlich aus.« Die Summe, die Helene nannte, ließ Lilis Kopf hochschnellen. Bestimmt hatte sie sich verhört. Aber Helene wiederholte die Summe.
»So viel Geld?«, fragte Lili erstaunt.
Helene verzog den Mund. »Wir wollen nicht, dass unsere Putzfrau abends dem ältesten Gewerbe nachgehen muss, um zu überleben. Wir sind Frauen. Wir sitzen schließlich alle im selben Boot.«
Lili konnte es nicht fassen. Sie zwickte sich ein zweites Mal in den Unterarm, diesmal fester. Kein Traum.
»Wann können Sie anfangen?«
»Jetzt gleich?«
Helene lachte erneut. Lili mochte dieses Lachen. Es würde sie heute im Schlaf begleiten.
»Das gefällt mir.« Sie winkte Lili weiter. »Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Garderobe und die kleine Küche.«
»Es gibt eine Küche?«
»Ja, natürlich. Wir müssen ja irgendetwas essen. Mit leerem Bauch lässt es sich nicht kreativ denken. Da hört man doch nur das Brummen des Magens. Ich glaube, es gibt noch Reste vom Reisfleisch. Jeden Tag bringt eine andere von uns das Mittagessen mit. Haben Sie Hunger?«
Beschämt fasste Lili auf ihre Körpermitte. Ein lautes Brummen war zu hören.
»Ich werte das als ein Ja.« Helene hakte sich bei Lili unter. So als wäre sie ihr ebenbürtig. Sah sie denn nicht, dass Lili vom Ratzengrund stammte? Oder war es ihr gleich? »Keine falsche Zurückhaltung«, sagte sie. »Bei uns verhungert niemand. Vielleicht sind auch noch zwei Semmeln übrig. Sie können unmöglich hungrig den Boden schrubben. Ich will nicht schuld daran sein, wenn Sie wegen eines Schwächeanfalls umkippen.«
Jetzt war Lili sicher: Das war der Glückstag ihres Lebens. Besäße sie einen Kalender, würde sie diesen Tag rot anstreichen. Und der »von und zu«-Kommissar würde Augen machen, wüsste er, wie schnell sie eine ordentliche Arbeit gefunden hatte.
5
Magdalenengrund, Ratzengrund
Es war spät geworden, als Lili endlich nach Hause kam. Kathi hatte ihr gezeigt, worin ihre Arbeit bestehen würde. Neben dem Auffegen und Aufwischen des Bodens sollte Lili mithelfen beim Pinselauswaschen, beim Säubern der Druckmodel und beim Aufräumen der Tische. Arbeiten, die Lili nicht fremd waren. Sie erledigte sie jeden Abend, nachdem ihr Vater sich am wackeligen Küchentisch ausgebreitet hatte. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie für die Tätigkeiten in der Werkstätte bezahlt wurde und dabei noch ein warmes Essen im Bauch hatte. Lili wollte ihre neue Anstellung auf jeden Fall behalten. Deshalb hatte sie sich bemüht, alles richtig zu machen und sich keinen Fehler zu leisten. Ihren Wunsch, hier und dort die Hand anzulegen, so wie sie es zu Hause bei ihrem Vater tun würde, hatte sie geflissentlich unterdrückt. Mit Sicherheit würde es nicht gut ankommen, wenn die Putzfrau sich dazu erdreistete, Verbesserungsvorschläge zu machen. Ideen hätte sie genug. Die Farbkomposition bei dem Stoffdruck war eine Spur zu grell. Die Proportionen der Keramik stimmten nicht. Es waren bloß Kleinigkeiten, aber Lili fand, dass eine Veränderung die Kunstwerke noch besser zur Geltung bringen könnte.
Lilis Auge fürs Schöne war von klein auf geschult worden. Man konnte Franz Feigl viel vorwerfen. Dass er ein Spieler und Alkoholiker war, dass er die Bildung seiner kleinen Tochter vernachlässigt hatte und sie schon sehr früh dazu gezwungen gewesen war, bei seinen Gaunereien mitzuhelfen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Er hatte als Vater so ziemlich alles falsch gemacht, aber in zwei Punkten war er verlässlich: Er liebte Lili von ganzem Herzen, und er hatte ihr beigebracht, wie man Pinsel sachgemäß reinigte und mit ihnen umging. Schon im zarten Alter von vier hatte Lili Unterschriften fälschen können, mit zehn war sie in der Lage gewesen, Stempelmarken zu kopieren, und mit zwölf wusste sie, wie man nackte Körper auf die Leinwand zauberte. Ein Privileg, das Frauen eigentlich verwehrt war. Sie durften zwar auf der Kunstgewerbeschule lernen, aber die Tore zum Kunststudium blieben ihnen nach wie vor verschlossen. Lili hatte einfach mitgemalt, wenn ihr Vater eine Prostituierte über Nacht bei sich gehabt und am nächsten Morgen ihren Körper mit raschen Aquarellstrichen auf Papier festgehalten hatte. Das hastige Kunstwerk war der Lohn gewesen, und die Frauen waren damit stets zufrieden gewesen. Lili hatte einen Blick fürs Besondere entwickelt, das hatte ihr ihr Vater mehrmals versichert und gemeint, dass es ihr gelänge, das Wesen der Menschen einzufangen, mit ihren Stärken und ihren Schwächen, während er selbst nur das malen konnte, was er vor sich sah. Lilis Gemälde erzählten eine Geschichte, meinte er. Sie glaubte ihm. Wie ihr das genau gelang, wusste sie nicht. Sie versuchte, die Striche aufs Wesentliche zu reduzieren, und vielleicht hielt sie auf diese Weise die Essenz des Lebens fest.
Müde vom langen Tag durchquerte sie den dunklen Innenhof. Der Vollmond wies ihr den Weg. Straßenlaternen standen am Ratzengrund nur auf den befestigten Straßen, und davon gab es im Viertel wenige. In den meisten Gassen versank man bei jedem Regen knöcheltief im Schlamm. Die Häuser waren dicht an dicht gebaut. Die meisten waren windschief oder nach vorn geneigt. Auf einige der Gebäude waren zusätzliche Stockwerke gesetzt worden. Man hatte sie ohne Genehmigung errichtet. Die Beamten der Stadt verirrten sich nur selten in diesen Teil Wiens. Die Menschen, die hier hausten, waren sich selbst überlassen. Die Höhenunterschiede zwischen den windschiefen Häusern wurden mit engen Treppen ausgeglichen. Die Hauswände waren mit Plakaten vollgeklebt. Manchmal hatte Lili den Eindruck, dass man sie nicht entfernte aus Angst, die Gemäuer würden ohne den Kleister und das bunte Papier zusammenfallen wie einfache Türme aus Spielkarten. In den Hinterhöfen der Häuser stapelten sich Müll und Gerümpel. Niemand trennte sich endgültig davon, und nicht selten fanden alte Holzkarren, Drahtgestelle oder löchrige Töpfe doch noch einen neuen Besitzer, der noch ärmer dran war als der alte.
Im Hof stank es nach totem Tier. Irgendwo lag wieder eine verwesende Katze oder ein Hund. Lili hielt sich die Hand vor den Mund und betrat das Stiegenhaus. Hier roch es nicht besser. Eine Welle des Geruchs von ranzigem Speck und billiger Kohlsuppe mischte sich mit dem von Kümmel. Lilis Magen war zur Abwechslung einmal voll. Das Reisfleisch hatte himmlisch geschmeckt. Schnell stieg sie die schmale Holztreppe hoch in den vierten Stock. Das Holz knarrte unter ihren Schritten. Im zweiten Stock weinten die zwei Kinder von Grete. Wahrscheinlich waren sie wieder einmal allein zu Hause, während Grete anschaffen ging.
Lili lief weiter. Sie war zu müde, um nach den beiden zu schauen. Vielleicht würde sie es später tun. Vor der niedrigen Tür blieb sie kurz stehen. Sie lauschte. Hatte ihr Vater Besuch? Es wäre nicht das erste Mal, dass sie ihn mit einer Frau erwischte oder einer seiner Trinkkumpane in Ermangelung einer anderen Unterkunft die ganze Nacht dablieb. Heute war es still. Ein gutes Zeichen. Lili öffnete die Tür und trat ein. Die winzige Wohnung bestand aus zwei kleinen Zimmerchen. Das eine war nicht mehr als ein Schrank. Es war mit einem löchrigen Vorhang vom Rest abgeteilt. Darin befand sich ein altes Bett, das Lili allein gehörte. Es war mehr, als so manch andere Frau in der Stadt ihr Eigen nennen konnte. Lili war ihrem Vater dankbar dafür, dass sie es nicht mit Bettgängern teilen musste.
Das kleine rechteckige Fenster vor dem Bett ihres Vaters stand offen. Franz Feigl saß davor und rauchte seine Pfeife. Neben dem Alkohol der einzige Luxus, den er sich seit Jahren gönnte. Als Lili eintrat, hob er den Kopf. Seine Augen waren glasig. Er hatte getrunken. Aber nicht so viel wie an anderen Tagen.
»Meine Güte. Hab ich mir Sorgen gemacht. Wo warst du so lang?« Lilis Vater war in den letzten Jahren gealtert. Sein Haar war eisgrau, sein sonnengebräuntes Gesicht von tiefen Falten zerfurcht. Sein Körper war immer noch schlank. Er nahm die Pfeife aus dem Mund. »Ich dachte schon, dass ich dich von der Polizei abholen muss.«
»Da war ich auch«, gestand Lili.
»Ach du Schande. Was ist diesmal passiert?«
»Warum ›diesmal‹?«, fragte Lili. Es war Jahre her, dass ihr Vater sie von der Wache hatte abholen müssen. Für gewöhnlich war er es, der mit den Staatsdienern Probleme hatte.
Franz Feigl zuckte bloß mit den Schultern.