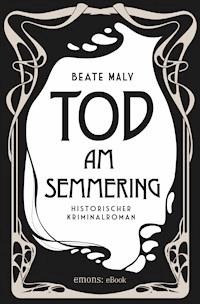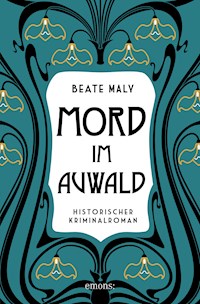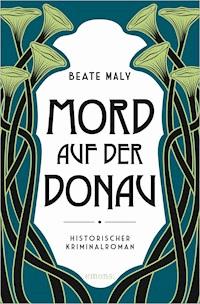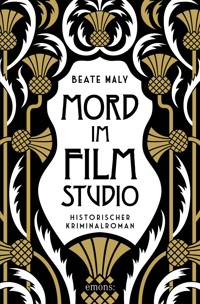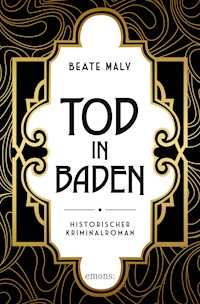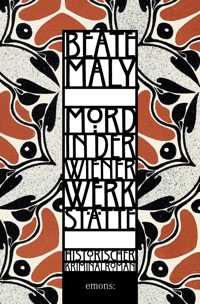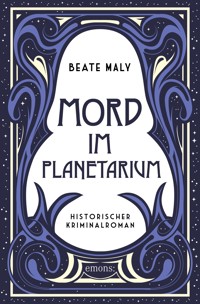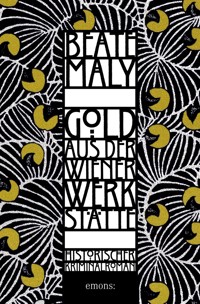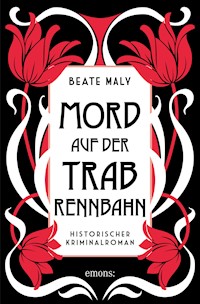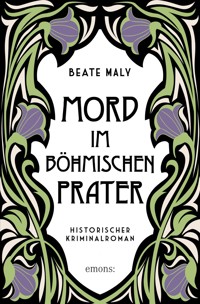
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historischer Kriminalroman
- Sprache: Deutsch
Eine atmosphärische Zeitreise in das Wien der 20er Jahre – herrlich charmanter Lesegenuss mit Wohlfühlgarantie. Wien, 1925. Bei schönstem Herbstwetter genießen Anton und Ernestine das bunte Treiben im Böhmischen Prater. Während Anton vor lauter Powidltascherl im Mehlspeishimmel schwelgt, widmet sich Ernestine der Polka. Doch die beschwingte Stimmung kippt, als Cockerspaniel-Dame Minna einen menschlichen Knochen unter dem Musikpavillon ausgräbt. Ernestine wittert ein Verbrechen – und stößt inmitten von Schaustellern und Besuchern auf gut gehütete Geheimnisse und raffinierte Intrigen. Band 9 der Reihe »Ernestine Kirsch und Anton Böck«. Alle Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Beate Maly wurde 1970 in Wien geboren, wo sie bis heute lebt. Zum Schreiben kam sie vor rund zwanzig Jahren. Sie widmet sich dem historischen Roman und dem historischen Kriminalroman. 2019 und 2023 war sie für den Leo-Perutz-Preis nominiert, 2021 gewann sie den Silbernen Homer.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von shutterstock.com/Lunetskaya
Lektorat: Uta Rupprecht
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-195-9
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Niemals sind wir ungeschützter gegen das Leiden, als wenn wir lieben, niemals hilfloser unglücklich, als wenn wir das geliebte Objekt oder seine Liebe verloren haben.
PROLOG
Isonzo, Juni 1917
Am Nachmittag hatte man erneut Verletzte ins Feldlazarett hinter dem Verteidigungswall gebracht. Soldaten mit verstümmelten Körpern. Männer, für die nichts mehr so sein würde wie zuvor, sollten sie überleben.
Die Unversehrten hatten ihre Kameraden aus den Erdgräben gezogen, manche mehr tot als lebendig. Einige waren fast noch Kinder, doch sie hatten die Gesichter von Greisen. Auf notdürftig zusammengebastelten Bahren, Mänteln, die zu Tragevorrichtungen zusammengeknüpft waren, hatte man sie hinter die Front geschleppt.
Das Leid war auf beiden Seiten schier grenzenlos und der Tod allgegenwärtig. Längst hatte man vergessen, weshalb gekämpft wurde. Die Jubelschreie, mit denen man 1914 in den Krieg gezogen war, waren schon nach wenigen Wochen verstummt und einem ängstlichen Entsetzen gewichen. Was machte es für einen Sinn, die dreckverschmierten Männer auf der gegnerischen Seite abzuschießen? Auch sie waren Ehemänner und Väter, Söhne und Brüder, deren Tod zu Hause Leid verursachte. Inzwischen hatten alle nur noch einen Wunsch: dass die Verantwortlichen den Wahnsinn, der Europa wie ein Flächenbrand erfasst hatte, endlich beendeten. Ganz egal, wie der Krieg ausgehen mochte, der Frieden wäre besser als das Massensterben an der Front und der nagende Hunger in den Dörfern und Städten im Hinterland.
Im Lazarett versuchte man, die zerfetzten Körper der Soldaten wieder zusammenzuflicken. Schmerz- und Desinfektionsmittel waren schon vor Wochen ausgegangen, Nachschub war keiner in Sicht. Man behalf sich mit Alkohol und Seife, die mittlerweile ebenfalls knapp wurden. Gestern hatte Dr. Brenner einem jungen Soldaten, er war noch keine zwanzig, ohne Narkose das Bein abgenommen. Die Schreie des Burschen waren bis ins feindliche Lager zu hören gewesen. Heute Morgen war der Mann seinen Verletzungen erlegen. Ein weiterer Brief würde nach Wien gehen: »Der Soldat Martin Huber fiel tapfer im Kampf für Kaiser und Vaterland.«
Wie viele dieser Nachrichten waren in den letzten Wochen auf der klapprigen Schreibmaschine getippt und mit der Feldpost verschickt worden? Sie hatte längst aufgehört, die Namen zu zählen, die täglich ans Kriegsministerium gemeldet wurden.
Müde hob sie den Kopf, wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß aus der Stirn und schob die feuchten Haarsträhnen zurück unter die Haube der grauen Schwesterntracht. Wann hatte sie das letzte Mal mehrere Stunden am Stück geschlafen? Es musste Tage her sein. Stets wurde ihre Hilfe gebraucht, bei den Operationen ebenso wie beim Versorgen der Verletzten. In den Feldbetten lagen Männer, die einen Arm, ein Bein oder gleich zwei Extremitäten verloren hatten. Offene Schusswunden, Knochenbrüche, Verbrennungen. Es gab nichts an Entstellungen, das sie in den letzten Wochen nicht gesehen hatte. Der Krieg war eine Bestie, die in ihrer schier unersättlichen Gier einen Mann nach dem andern fraß.
Erschöpft richtete sie sich auf, legte beide Hände in den Rücken und streckte ihn. Mit einem leisen Knacken löste sich eine Verspannung. Dann ließ sie den Blick über die Verletzten schweifen. Die einfachen Betten standen so dicht nebeneinander, dass man gerade noch dazwischen durchgehen konnte. Jeder freie Platz wurde genutzt, und trotzdem lagen seit gestern drei der Verletzten im Freien. Solange es nicht regnete, war es dort vielleicht sogar angenehmer. Im Zelt war die Luft zum Schneiden stickig, es stank nach Urin, Schweiß, Blut und Eiter. Seit Tagen warteten alle auf einen Gewitterregen, der sie für ein paar Stunden von der unerträglich schwülen Junihitze erlöste. Fette schwarze Fliegen umkreisten die Gaslampen, die an Metallstäben von der Decke baumelten. Nicht ein winziger Luftzug sorgte für Abkühlung. Sogar das Atmen fiel schwer.
Sie hörte das ständige leise Wimmern, Jammern und Schluchzen der Männer längst nicht mehr, sie war daran gewöhnt. Auch das laute Aufschreien, wenn Alpträume die Männer quälten, schreckte sie nicht mehr auf. Nun machte sie sich daran, mit einem frisch gefüllten Wasserkrug von einem Bett zum anderen zu gehen. Die wenigsten Männer konnten selbstständig trinken. Der Arzt hatte sie wiederholt gewarnt: »Achten Sie darauf, dass die Verletzten bei der enormen Hitze ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Sie dehydrieren sonst.«
Eigentlich wäre das die Aufgabe der jungen Aushilfsschwester Maria gewesen. Aber das Mädchen war überfordert. Heute Morgen hatte sie eine Stunde lang hinter dem Zelt gehockt und geweint. Sie war nicht ansprechbar gewesen, hatte nur noch gezittert und gejammert, sie wolle nach Hause.
Ihre Verzweiflung war nur allzu verständlich. Niemand hatte das Mädchen auf das Ausmaß des Leidens vorbereitet. Wer sich freiwillig für einen Fronteinsatz meldete, wusste, dass er Schreckliches sehen würde. Aber wie grenzenlos das Grauen war, überwältigte oft sogar die Hartgesottenen unter den Helfern.
Langsam schritt sie die Reihen der Verletzten ab. Immer wieder blieb sie stehen, rückte eine Augenbinde zurecht, wischte eine schweißige Stirn ab, half beim Trinken, deckte einen fiebernden Körper zu.
Als sie ans Zeltende gelangte, fasste eine Hand nach ihrer Schürze und hielt sie zurück. Erstaunt drehte sie sich um. Der Mann lag seit einer Woche hier. Er war zu schwach für einen Weitertransport. Der Arzt hatte ihm nicht mehr als zwei Tage gegeben, jetzt waren es bereits sieben, die er noch am Leben geblieben war. Er schien sich mit Verbissenheit daran festzuklammern. Der Soldat hatte einen Arm, ein Bein und beide Augen verloren. Die Wunden nässten und hatten sich entzündet. Auch jetzt waren wieder rotgelbe Flecken dort, wo einst seine Augen gewesen waren. Sie würde den Verband erneut wechseln müssen. Der Anblick, der sich darunter bot, war auch für Menschen, die an schwere Verletzungen gewöhnt waren, kaum zu ertragen.
»Schwester!« Seine Stimme klang leise, schwach. Kaum mehr als ein Hauch. Trotzdem lag eine Entschlossenheit darin, die sie erstaunte. Sie trat näher und ging in die Hocke, damit ihn das Sprechen nicht so anstrengte.
»Ich kann Sie hören«, versicherte sie ihm und ergriff seine Hand. Sie glühte. Sein Fieber war gestiegen. Wenn es nicht gelang, es zu senken, würde er diese Nacht nicht überleben.
»Ich brauche Ihre Hilfe.«
»Was kann ich für Sie tun? Sind Sie durstig?«
»Nein.«
»Soll ich Ihren Verband wechseln? Brauchen Sie die Leibschüssel?«
»Nein. Ich will, dass Sie …« Seine Stimme brach ab.
»Ja?«
Er setzte erneut an.
»Ich will, dass Sie einen Brief für mich schreiben.«
Er war nicht der Erste, der sie um diesen Gefallen bat. Männer, die im Sterben lagen, hatten oft den Wunsch, noch ein paar Worte an ihre Liebsten zu richten. Ein letztes »Ich liebe dich«. Nicht selten schmückte sie die Worte aus und ergänzte sie, um den Hinterbliebenen etwas Trost zu spenden und ihnen Mut fürs Weiterleben zu schenken.
»Was soll ich schreiben?«, fragte sie. Meist waren es bloß ein paar Sätze, die sie sich merkte und am Abend zu Papier brachte.
»Es ist eine lange Geschichte.« Der Druck, den seine Finger auf ihre Hand ausübten, war erstaunlich fest. Sie konnte sich vorstellen, wie kräftig der Mann einst gewesen war.
»Wie lang?« Sie überlegte. Es gab noch so vieles, was sie erledigen musste, bevor sie sich dem Schreiben eines Briefes widmen konnte. Es galt, Verbände zu waschen, die Lebensmittelvorräte zu kontrollieren, frisches Wasser zu holen.
»Sehr lang«, gab er zu.
Ihr Blick glitt über die engen Bettenreihen. Im Moment war es ungewöhnlich friedlich. Viele der Verletzten schliefen oder dösten vor sich hin. Doch das würde nicht lange anhalten. Schon am Abend wurden neue Soldaten erwartet. Keiner gab sich der Illusion hin, dass bei der nächsten Schlacht niemand verletzt werden würde. Sie hatte keine Ahnung, wo sie die frisch Verwundeten dann unterbringen sollte.
Nachdenklich strich sie dem Mann über die Wange. Sie war ebenso heiß wie seine Hand, und ihre Entscheidung fiel. Das Waschen der Verbände musste warten. Sie konnte einem Sterbenden seinen letzten Wunsch unmöglich verwehren.
»Einen Moment«, sagte sie. »Ich hole Papier und Stift.«
»Danke.« Die Erleichterung in seiner Stimme gab ihr recht. Sie tat das einzig Richtige.
EINS
Wien, Herbst 1925
»Gott sei Dank scheint endlich wieder die Sonne!« Die pensionierte Lateinlehrerin Ernestine Kirsch trat in den Garten und atmete tief durch. Die Luft fühlte sich sauber an. Der Regen der letzten Tage hatte den Ruß und Staub von den Fassaden gewaschen und Wien in eine strahlende Stadt verwandelt. Satt gelb und leuchtend rot glänzten die Blätter der Weinreben an der Hausmauer im warmen Licht und versprachen einen goldenen Herbsttag.
»Ich hatte schon befürchtet, das Nieselwetter hält bis Allerheiligen an. Es reicht, wenn der Nebel im November einsetzt. Der Winter dauert danach noch lang genug. Können wir im Freien frühstücken?« Anton streckte den Kopf zur Terrassentür heraus. Er und Ernestine bewohnten seit einem Jahr das kleine, frisch renovierte Kutscherhäuschen im Garten seiner ehemaligen Apotheke in Mariahilf. Seit Antons Pensionierung leitete seine Tochter Heide das Geschäft.
Allerdings würde Anton in naher Zukunft wieder einspringen müssen, denn Heide erwartete nach Weihnachten ihr zweites Kind. Kurz nachdem sie den Kommissar Erich Felsberg geheiratet hatte, war sie schwanger geworden. Ab Jänner würde Anton nicht nur beim Drehen der Hustenpastillen unterstützen, sondern für einige Zeit hinter den Verkaufstresen zurückkehren. Er sah dem mit gemischten Gefühlen entgegen, hatte er sich doch an seinen geruhsamen Alltag mit Ernestine gewöhnt. Auch wenn die unternehmungslustige Pensionistin ihn immer wieder zu Aktivitäten überredete, auf die er sich allein niemals einlassen würde, verlief sein Leben doch in deutlich ruhigeren Bahnen als noch vor ein paar Jahren.
»Ja, es ist warm genug. Ich hole die Pölster für die Gartensessel«, bot Ernestine an und verschwand im Schuppen zwischen Kutscherhäuschen und Apotheke.
Kurz darauf saßen die beiden bei Kaffee und Butter-Honig-Semmeln im Garten und streckten die Gesichter der wärmenden Sonne entgegen. Zufrieden langte Anton nach der Morgenausgabe der Wiener Zeitung, überflog die Überschriften und runzelte dann sorgenvoll die Stirn.
»Es gefällt mir nicht, dass die Sozialisten sich paramilitärisch formieren«, brummte er. »Wer braucht denn einen Schutzbund?«
»Es ist die logische Antwort auf die Heimwehren der Christlichsozialen«, meinte Ernestine. »Wäre es dir lieber, man würde diesen bewaffneten Einheiten nichts entgegensetzen?« Während sich auf dem Land schon kurz nach dem größten aller Kriege die christlichsozialen Ortswehren paramilitärisch aufgerüstet hatten, zogen die Sozialisten in den Städten erst jetzt mit Verspätung nach.
»Ich würde ein Österreich vorziehen, in dem weder das rechte noch das linke Lager Waffen besitzt«, sagte Anton. »Wer Gewehre hat, wird sie früher oder später auch einsetzen. Und was haben wir dann? Österreicher, die auf Österreicher schießen. Bei der Vorstellung gefriert mir das Blut in den Adern.«
Ernestine schüttelte den Kopf. »Ach, Anton, du siehst die Lage zu düster. Warum sollte das passieren? Der große Hunger liegt hinter uns. Wir sehen einer rosigen Zukunft entgegen. Sonnige Zeiten, in denen die Menschen friedlich zusammenleben. Wir haben alle unsere Lehren aus dem schrecklichen Krieg gezogen und werden verhindern, dass es erneut zur Katastrophe kommt. Niemand will seine Brüder, Ehemänner und Söhne am Schlachtfeld verlieren.«
Anton schien nicht überzeugt. »Unsere Demokratie ist ein sehr zartes Pflänzchen. Schnell kann es von Militärstiefeln wieder zertrampelt werden. Schau nach Italien. Dort hat Mussolini das Parlament ausgehebelt. Die Faschisten regieren. Stell dir vor, das wäre in Österreich der Fall. Mit einem Schlag wäre es mit den Errungenschaften des roten Wiens vorbei. Kein sozialer Wohnbau, keine Bildungsreform und kein Gesundheitswesen mehr.«
Ernestine langte über den Tisch und nahm Anton entschlossen die Zeitung aus der Hand. »Wenn die Artikel dermaßen finstere Gedanken in dir erzeugen, solltest du die Zeitung nicht mehr lesen«, befand sie streng. Ihre Stimme hatte den belehrenden Unterton der Lateinlehrerin angenommen, die sie jahrzehntelang gewesen war. »Ich besorge dir unterhaltsame Literatur aus der Bibliothek. Ab jetzt kriegst du nur noch Texte von Kabarettisten. Letztens habe ich Liedtexte von Fritz Grünbaum und Karl Farkas gelesen. Die sind genau richtig für dich.«
»Seit wann verschließt du die Augen vor dem, was rund um dich geschieht?«, fragte Anton.
»Ich sehe sehr wohl hin«, verteidigte sich Ernestine. »Deshalb finde ich es ja so wichtig, dass auch die Sozialisten sich bewaffnen. Solange es ein Gleichgewicht der Kräfte gibt, ist der Frieden gesichert. Sobald eine Gruppe stärker wird, droht Gefahr.«
»Ich sehe das anders«, widersprach Anton.
»Ich weiß!« Ernestine faltete die Zeitung zusammen und legte sie auf die andere Seite des Tisches. Anton hätte aufstehen müssen, um sie zu holen, was er aber tunlichst vermied. Denn er saß gerade ausgesprochen bequem.
»Lass uns über etwas Erfreulicheres reden«, schlug Ernestine vor. »Zum Beispiel über das bevorstehende Wochenende. Das Wetter soll stabil bleiben. Es stehen uns wunderschöne Herbsttage bevor, die wir unbedingt nutzen sollten, bevor es wieder nass und kalt wird und dann für Monate so bleibt.«
Anton ahnte, dass Ernestines Vorstellung davon, wie man warme Herbsttage verbringen sollte, nicht ganz seinen Wünschen entsprach.
»Wir könnten gemütlich im Garten lesen und hin und wieder eine kleine Runde mit Minna spazieren gehen«, schlug er vor. Als die Cockerspaniel-Dame ihren Namen hörte, hob sie die Schlappohren und sah erwartungsvoll zu Anton. »Und nach dem Spaziergang belohnen wir uns mit einer ordentlichen Mehlspeise«, fügte er hinzu. »Minna kriegt ein Würstel.« Die Hündin stupste ihm dankbar mit der Pfote gegen das Schienbein.
»Aber Anton, wir werden doch nicht faul im Garten sitzen, wenn wir stattdessen zu böhmischer Blasmusik tanzen können!« Genau wie Anton befürchtet hatte, deckten sich seine Pläne nicht mit denen von Ernestine.
»Wenn wir was?«, fragte er irritiert. Hoffentlich hatte er sich eben verhört. Tanzen gehörte nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen, und Blasmusik war die Form Musik, die er mit Abstand am schlimmsten fand. Die Kombination aus beidem betrachtete er als mittlere Katastrophe.
»Am Wochenende findet im Böhmischen Prater ein Herbstfest statt«, fuhr Ernestine unbeirrt fort. »Ich habe Rosa davon erzählt. Sie würde sehr gerne hingehen.«
Rosa war Antons Enkeltochter. Er liebte das Mädchen über alles und konnte ihr kaum einen Wunsch abschlagen. Das war auch der Grund, warum eine wuschelige Hundedame zu seinen Füßen lag und darauf wartete, dass ein Stück Buttersemmel für sie abfiel. Anton reichte Minna einen Bissen und wurde mit einem Schwanzwedeln belohnt.
»Rosa freut sich schon riesig auf den Besuch«, erklärte Ernestine. »Das alte Ringelspiel dort wurde repariert und geht wieder in Betrieb. Jedes Kind darf einmal gratis damit fahren.«
»Rosa ist doch kein Kleinkind mehr!«, entgegnete Anton in der Hoffnung, der Blasmusik doch noch zu entkommen. Seit ein paar Wochen besuchte seine Enkeltochter die dritte Klasse der von Lili Roubiczek geführten Schule in Wien, in der nach den Methoden der italienischen Ärztin Maria Montessori unterrichtet wurde. Und im Sommer hatte Rosa ganze zwei Bände von Karl May vollständig durchgelesen. Sie war definitiv zu alt fürs Ringelspiel.
Aber Ernestine war anderer Meinung. Sie blieb hartnäckig.
»Unsinn, Anton. Du weißt, dass man für eine Fahrt mit dem Ringelspiel niemals zu alt ist. Wenn ich darf, setze ich mich auch auf eins der weiß lackierten Pferde. Mal sehen, ob ich den Karussellbetreiber überreden kann.«
Anton bezweifelte, dass Ernestine auf das frisch renovierte Ringelspiel durfte. Sie war von rundlicher Statur, woran das gemütliche Leben mit ihm und die Kuchen, die er regelmäßig buk, nicht ganz unbeteiligt waren. Er behielt seine Überlegungen aber für sich. Anton mochte Ernestine genau so, wie sie war.
»Außerdem gibt es echte Ponys, auf denen die Kinder reiten können«, fuhr sie fort. »Und die beliebten Hutschenschleuderer, genau wie im Wurstelprater.«
Anton hatte immer noch die Blaskapelle und den Tanzpavillon vor Augen. Beides bereitete ihm Kopfzerbrechen.
»Wenn dich das alles nicht überzeugen kann, dann denk an Langosch, die feinen Powidltascherl und das einmalige böhmische Bier.«
Jeder, der Anton besser kannte, wusste von seiner größten Schwäche, dem guten Essen. Nichts liebte er mehr als Mehlspeisen. Die Aussicht auf böhmische Powidltascherl, Germknödel und Palatschinken ließ die Blasmusik mit einem Mal nicht mehr ganz so unangenehm erscheinen. Vielleicht würde sich ein Besuch im Böhmischen Prater doch lohnen. Es war Jahre her, dass er das letzte Mal in dem Arbeitervergnügungsviertel am Laaer Berg gewesen war.
»Wir können Minna mitnehmen«, schlug Ernestine vor. »Es wird gewiss ein gemütlicher Nachmittag.«
Anton überlegte. Heide sah in letzter Zeit oft sehr müde aus, die fortschreitende Schwangerschaft setzte ihr zu. Ein Sonntag in der Hängematte würde ihr sicher guttun. Heides Mann Erich hatte dieses Wochenende Dienst, er musste sich um Verbrechen kümmern. Und da Ernestine Rosa den Ausflug bereits versprochen hatte, blieb Anton ohnehin nichts anderes übrig, als mitzukommen.
In Gedanken konnte er die gerösteten Butterbrösel der Powidltascherl bereits riechen und schmeckte den Vanillezucker auf seiner Zunge. Obwohl er vom Frühstück noch satt war, lief ihm das Wasser im Mund zusammen.
»Du hast mich überredet«, erklärte er großmütig.
»Um drei fahren wir los. Heide weiß bereits Bescheid.«
»Wie kann das sein? Ich habe doch eben erst zugestimmt«, meinte Anton verdattert.
Ernestine lächelte nachsichtig. »Ich wusste, dass du den Powidltascherln nicht widerstehen kannst.«
»Bin ich so leicht zu durchschauen?«
»Ja!« Ernestine stand auf, trat zu ihm und drückte ihm einen zärtlichen Kuss auf die hohe Stirn. »Aber keine Sorge«, meinte sie, »das macht dich nur noch liebenswerter.«
ZWEI
Schon von Weitem waren die Klänge der Blaskapelle zu hören, sie spielte einen strammen Marsch. Die Musik mischte sich mit dem lauten Lachen der Besucher, den Rufen der Schausteller, die ihre Dienste anboten, und dem Geräusch eines knarrenden Leierkastens. Der Werkelmann, ein kleiner Mann in einem schäbigen alten Frack, stand am Eingang zum Vergnügungspark und begrüßte die Gäste mit einer beschwingten Melodie, die so fröhlich klang, dass man ihm die verstimmten Töne der Drehorgel verzieh. Mit seinem Hut sammelte er Münzen ein und bedankte sich mit überschwänglichen Verbeugungen.
Von allen Seiten strömten die Menschen auf das Gelände. Es roch nach heißem Öl und gebackenem Langosch, nach Zuckerwerk und Zimt. Eine Luftballonverkäuferin bot ihre Ware an, sie hielt Rosa einen knallroten Ballon entgegen. Zu gerne hätte das Mädchen ihn genommen, aber Anton meinte: »Lass uns warten, bis wir nach Hause gehen. Sonst verlieren wir den Ballon am Ende noch.« Er erinnerte sich an einen Besuch im Wurstelprater, wo Rosas Ballon in den Himmel gesegelt war und für bitterliche Tränen gesorgt hatte.
Auch Rosa schien den Vorfall nicht vergessen zu haben, sie war mit dem Vorschlag einverstanden. »Heben Sie den roten Ballon für mich auf?«, fragte sie die Verkäuferin.
»Gerne!«
Dann lief das Mädchen zielstrebig auf das Karussell zu. Es bildete das Herzstück des Parks. Weiß lackierte Pferde bewegten sich im Takt auf- und abwärts, während sie auf der runden Plattform im Kreis herumfuhren. Auf jedem der Pferde saß ein Kind. Die Warteschlange derer, die ebenfalls auf einem der Pferde um und um reiten wollten, reichte bis zum Gasthaus nahe dem Ringelspiel.
»Willst du dich wirklich anstellen? Oder sollen wir zuerst zu den Hutschenschleuderern gehen?« Anton betrachtete stirnrunzelnd die lange Reihe der wartenden Kinder. Es dauerte bestimmt eine Stunde, bis die Letzten endlich an die Reihe kamen.
»Lieber reite ich auf einem echten Pony«, meinte Rosa. Das Mädchen war über den Sommer wieder ein gutes Stück gewachsen, ihr neues Kleid reichte ihr nur noch knapp über die Knie. Heide würde den Saum noch einmal herauslassen müssen.
»Eine gute Entscheidung«, pflichtete Ernestine ihr bei. Gemeinsam gingen sie vorbei am Gastgarten des Wirtshauses, einer einfachen Holzhütte, wo über dem Eingang »Böhmisches Biergartl« in gelben Lettern auf einem dunkelgrünen Schild stand. Darunter konnte man in kleineren Buchstaben lesen: »Inhaber Carel Prohaska«. Davor waren unter großen Kastanienbäumen Tische mit rot-weiß karierten Tischtüchern gedeckt. Sie waren alle besetzt. Anton fürchtete, dass es auch hier zu langen Wartezeiten kommen würde.
Da entdeckte er im hintersten Winkel des Gartens doch noch einen freien Tisch. »Seht nur«, rief er entzückt. »Dahinten sind freie Plätze!«
»Anton, wir sind eben erst gekommen. Du wirst doch nicht jetzt schon eine Pause einlegen wollen.« Ernestine fasste ihn am Ellbogen, um ihn weiterzuziehen, aber Anton blieb hartnäckig stehen.
»Warum nicht?«, fragte er. »Der Weg auf den Laaer Berg war lang. Wir waren über eine Stunde unterwegs. Höchste Zeit für ein kühles Bier und einen Langosch. Oder Kaffee und Powidltascherl.« Er überlegte. »Oder beides.«
»Opa, ich will doch reiten!«, bettelte Rosa.
Ihre Worte gingen in der Musik unter, denn die Blaskapelle hatte jetzt im hölzernen Pavillon neben dem Biergartl Aufstellung bezogen. Kaum dass sie die Polka anstimmte, sprangen auch schon die ersten Tanzhungrigen auf und marschierten auf die Wiese, die als Tanzfläche diente. Beschwingt drehten sie sich im Takt der Musik.
»Ich werde mit Rosa zu den Ponys gehen«, bot Ernestine an. »Halte du uns in der Zwischenzeit den Tisch dort drüben besetzt. Wir kommen später nach.« Sie zwinkerte Anton zu. »Und wenn du dich ordentlich gestärkt hast, wagen wir eine Polka auf dem Rasen.«
»Da werden ein Langosch und ein Bier nicht ausreichen«, meinte Anton.
»Dann bestell dir zwei«, lachte Ernestine. Sie nahm Rosa an der Hand, und die beiden liefen zum kleinen Wäldchen, wo in einer Koppel drei Ponys geduldig eine Runde nach der anderen drehten.
Anton und Minna eilten unterdessen in die Ecke, bevor jemand anderer den freien Platz entdeckte. Sie hatten Glück. Erleichtert setzte sich Anton und ließ den Blick über den Gastgarten schweifen. Im Schatten der Kastanie hielt man es gut aus. Die Musik war nicht ganz so laut, und der Geruch von heißem Öl war deutlich dezenter als direkt neben der Küche des Gasthauses.
Ein Mann mit einer dunklen Schürze über einem dicken Bauch kam auf ihn zu.
»Was darf’s denn sein?« Er wirkte gehetzt. Seine Stirn glänzte vom Schweiß. In einer Hand hielt er ein Serviertablett, in der anderen einen Block. Ein Bleistift klemmte hinter seinem Ohr. »Emil, du Fetzenschädl, des Bier ghört auf’n Nebentisch!«
Erschrocken zuckte Anton zusammen. Die Worte des dicken Wirtes waren nicht an ihn gerichtet, er schrie über die Köpfe seiner Gäste hinweg einen Jungen an, der höchst konzentriert ein Tablett mit mehreren Krügen Bier vor sich herbalancierte. Dabei strengte er sich so an, dass seine Zunge, die eine Spur zu breit für seinen Mund schien, ein Stück weit herausragte. Vor Schreck biss er sich darauf und geriet ins Straucheln. Zum Glück reagierte ein Gast neben ihm blitzschnell, fasste nach dem Tablett und verhinderte so, dass die Krüge ins Rutschen gerieten und die Flüssigkeit sich auf seine weibliche Begleitung ergoss. Die Frau schrie dennoch auf. Die Menschen rundum lachten, als sie bemerkten, dass nichts Schlimmeres passiert war.
Der junge Kellner errötete beschämt. Er war älter, als Anton ihn zuerst eingeschätzt hatte, und seine Augen standen ungewöhnlich schräg in seinem runden Gesicht. Schließlich stimmte er verlegen in das Lachen mit ein. Er schien es gewohnt, Gespött der Besucher zu sein.
»Der Bursche ist zu nix zu gebrauchen«, schimpfte der Wirt. »Wenn der no einmal was zerbricht, schmeiß i ihn raus. Ganz wurscht, was die anderen dazu sagen. Solln sie sich doch mit ihm rumgfretten. Wie komm i dazu, dass i den Schwachkopf am Hals hab?«
Dann schaute er in die andere Richtung und stellte das Tablett am Boden ab. »Des dearf ned wahr sein! Is Dummheit denn ansteckend?« Erneut erhob er die Stimme. Diesmal war seine Schimpftirade an einen Burschen am anderen Ende des Gastgartens gerichtet. »Mihaelo! Ham s’ dir ins Hirn gschissen?«
Anton war entsetzt ob der derben Worte.
Der Wirt fluchte weiter. »Du sollst des Bier zum Hutschenschleuderer bringen! Der Milan wartet scho seit aner Stund drauf. Der sitzt am Trockenen. Gemma, gemma.«
Der angesprochene Junge – er war wirklich noch ein Kind und wohl keine zehn Jahre alt – zog den Kopf ein. Er war bloß ein Strich in der Landschaft; es war erstaunlich, dass er in seinem Alter ein so großes, schweres Tablett mit sechs vollen Bierkrügen schleppen konnte. Mit gesenktem Blick wuselte der Bub aus dem Gastgarten und lief hinüber zu den Schaukeln.
»I bin gstraft!« Der Wirt seufzte leidend. Er fasste nach seinem Tablett und widmete sich Anton. »Was ham Sie gsagt, dass Sie haben wollen?«
»Ich habe noch keine Bestellung aufgegeben«, sagte Anton.
»Na dann. Worauf warten S’? I hab mei Zeit ned gstohlen.« Er zog den Stift hinter dem Ohr hervor und tippte damit ungeduldig auf den Block. Der Mann war auch den Gästen gegenüber unfreundlich. Wäre der Sitzplatz nicht so perfekt gewesen, wäre Anton aufgestanden und gegangen.
»Eine Portion große Powidltascherl und ein Glas kalte Milch.«
Der Wirt nickte, notierte den Wunsch und eilte davon. Anton rief ihn noch einmal zurück. »Und eine Schüssel Wasser für meinen Hund, bitte!«
»Flohschleudern werdn bei uns ned bedient«, erwiderte der Wirt grimmig und ging einfach weiter.
Fassungslos ob dieses Benehmens starrte Anton dem unhöflichen Mann hinterher.
»Denken Sie sich nichts dabei«, hörte er eine freundliche Frauenstimme. »Der Carel Prohaska fährt allen Menschen mit dem Hinterteil ins Gesicht. Es liegt in seinem Naturell.«
Anton wandte den Kopf. Am Nebentisch saßen zwei Frauen, sie sahen gut situiert aus. Die jüngere der beiden hatte ihn angesprochen. Die deutlich ältere Frau neben ihr hatte graues Haar, das sie zu einem eleganten Knoten gebunden trug. Ihr Kleid mochte vor dem Krieg noch modern gewesen sein, jetzt wirkte es aus der Zeit gefallen. Doch sie besaß klassische Gesichtszüge, selbst die Falten konnten nicht verbergen, dass sie einmal eine ausgesprochene Schönheit gewesen war. Daneben wirkte die jüngere Frau unscheinbar. Sie war eine jener Personen, von denen man hinterher nicht mehr sagen konnte, wie sie ausgesehen hatten. Auch dann nicht, wenn man sich eine Weile freundlich mit ihnen unterhalten hatte.
»Beim Brunnen neben dem Garteneingang stehen Schüsseln«, fügte sie hinzu. »Dort können Sie Wasser für Ihren Hund holen.«
Anton blickte zum Eingang, konnte aber weder Brunnen noch Schüsseln entdecken. Zu viele Menschen drängten sich dort.
»Ich hole Ihnen Wasser«, erbot sich die Fremde hilfsbereit und stand auf. Ihre Kleidung war so unauffällig wie ihr Gesicht. Das Einzige, was an der Frau auffiel, war die Kette, die sie um den Hals trug. Daran hing ein außergewöhnliches Medaillon in der Form eines Schmetterlings, unzählige Edelsteine zierten die Flügel. Die Steinchen funkelten im herbstlichen Sonnenlicht.
Schon wenige Augenblicke später kehrte sie mit einer Schüssel voll Wasser zurück und stellte sie vor Minna auf den Boden. Dankbar stürzte die Hündin sich darauf. Die Frau streichelte der Cockerspaniel-Dame über den Kopf. »Du bist aber eine Süße!«
»Das war sehr nett von Ihnen«, sagte Anton. »Vielen Dank.«
»Gerne.« Die Frau richtete sich auf und setzte sich wieder.
Ihre ältere Begleiterin schien überhaupt nicht mitbekommen zu haben, dass sie einen Moment lang allein gewesen war. Langsam wandte sie sich Anton zu und sah ihn aus leeren Augen an.
»Grüß Gott«, sagte er höflich. »Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Anton Böck. Ich bin Apotheker im Ruhestand.«
»Sehr erfreut«, sagte die Jüngere. »Ich heiße Annezka Henkel. Und das ist Fräulein Hermine Bitterkopf, die Tante meines verstorbenen Mannes.«
Anton schüttelte zuerst Frau Henkel, dann dem alten Fräulein die Hand. Als er die Finger der Dame berührte, schien Leben in sie zu kommen. Mit einem Ruck streckte sie die Schultern durch und blickte sich um. »Warum sind heut so viel Leut bei den Ziegelböhm? Gibt’s was umsonst?«
Sie sprach mit dem nasalen Akzent einer Frau aus dem gehobenen Großbürgertum.
»Tante Mimi, es ist Herbstfest im Böhmischen Prater«, erklärte Annezka Henkel.
»Herbstfest? Die Böhm können vom Feiern ned genug kriegen. Das war schon immer so. Lauter arbeitsscheues Gsindel. Man hätt ihnen den Prater niemals erlauben dürfen. Die sollen arbeiten. Deshalb sind s’ schließlich nach Wien kommen. Nicht zum Feiern.«
Entschuldigend hob Frau Henkel die Hände. Die Worte der Tante waren ihr sichtlich unangenehm. »Tante Mimi, man kann nicht alle Menschen in einen Topf werfen. Die meisten Arbeiter sind fleißig. Ohne sie müsste die Ziegelfabrik zusperren.«
Jetzt klingelte es bei Anton. Die größte Ziegelfabrik am Laaer Berg befand sich im Besitz der Familie Henkel. Viele Häuser in Wien waren aus den Ziegeln gebaut, die ein eingeprägtes H trugen, als Zeichen dafür, dass sie aus der Fabrik der Henkels stammten. Der Betrieb war bis weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Als Österreich noch eine Monarchie gewesen war, hatte die Familie Henkel ihre Ziegel mit der Bahn in alle Teile des Vielvölkerstaates transportiert. Davon hatte Anton in der Zeitung gelesen.
In dem Moment kehrten Ernestine und Rosa vom Ponyreiten zurück.
»Opa, es war einfach großartig!«, rief Rosa begeistert. »Können wir im Garten ein Pony halten?«
Sie setzte sich zu ihm und faltete bittend die Hände.
»Nein, das können wir nicht«, sagte er bestimmt. Ein Hund reichte ihm. Die Vorstellung, auch noch ein Pony zu versorgen, jagte ihm Angst ein.
»Schade!«, meinte Rosa. Doch sie schien mit einer Absage gerechnet zu haben und bohrte nicht weiter nach.
Ernestine setzte sich neben Anton. »Du hast noch gar nicht bestellt?«, fragte sie überrascht.
»Doch, aber es dauert alles ein bisserl länger. Der Wirt ist mit dem heutigen Ansturm sichtlich überfordert.«
»Wer sind die Frau und das Kind?« Fräulein Bitterkopf richtete ihre Frage an Anton. »Gehören die etwa zu Ihnen?«
»Tante Mimi, die Frage ist unhöflich«, sagte Frau Henkel. Sie wandte sich an Ernestine. »Bitte entschuldigen Sie, meine Tante ist manchmal verwirrt.«
»Gar nicht«, widersprach die alte Frau. »Ich bin völlig klar im Kopf. Ich kann mich an alles erinnern, was in meinem Leben wichtig war. Hier gibt’s die besten Powidltascherl der Stadt. Die Jana Benesch macht sie. Ewig schade, dass mein Schwager sie nie überreden konnte, bei uns zu kochen. Dabei hat er ihr so ein gutes Gehalt geboten. Aber manchen Menschen ist nicht zu helfen. Die erkennen eine gute Gelegenheit nicht und bleiben ihr ganzes Leben lang unglücklich.«
Ernestine zog fragend die Augenbrauen hoch, und Anton machte sich daran, die Damen alle miteinander bekannt zu machen.
»Sehr erfreut!« Sie reichten einander die Hände.
Rosa bückte sich und sah unter den Tisch. »Wo ist eigentlich die Minna?«
»Sie muss hier sein«, meinte Anton. »Eben noch hat sie getrunken. Frau Henkel war so freundlich und hat eine Schüssel Wasser für sie gebracht.« Auch er schaute unter den Tisch. Aber von Minna fehlte jede Spur. Sie musste weggelaufen sein, als Ernestine und Rosa zurückgekommen waren.
»Sie kann nicht weit weg sein«, meinte Anton, stand auf und drehte sich suchend nach allen Seiten.
»Dort!«, rief Rosa. »Sie ist bei der Musikkapelle.«
Tatsächlich war Minna neben dem windschiefen Holzpavillon. Hatte die Hundedame etwa ihre Liebe zur Polka entdeckt? Anton kniff die Augen zusammen, um besser zu sehen.
Minna buddelte unterhalb der wackeligen Konstruktion, offenbar hatte sie dort etwas Spannendes entdeckt. Vielleicht eine Maus, einen Maulwurf oder eine Ratte.
»Besser, ich hole sie«, brummte er. »Am Ende beschwert sich der unhöfliche Wirt und jagt uns davon, ohne uns die Powidltascherl zu bringen.« Noch bevor er zum Pavillon gehen konnte, kehrte Minna zu ihm zurück. Stolz hielt das Tier eine Trophäe im Maul.
»Minna, zeig her. Was hast du gefunden?« Rosa sprang auf und ging vor Minna in die Hocke, doch der Cockerspaniel wollte den Fund nicht hergeben. Die Hündin drehte sich um und lief ein paar Meter weiter.
»Sieht aus wie ein Knochen«, meinte Ernestine.
»Ein sehr großer, langer Knochen«, sagte Anton. »Minna, komm her.« Er winkte die Hundedame zu sich.
Nur widerwillig folgte Minna. Langsam trottete sie auf Anton zu und ließ ihren Schatz vor Antons Füßen auf den Boden plumpsen. Sie setzte sich und blickte ihr Herrchen schwanzwedelnd an. Offenbar wartete sie auf Lob, schließlich hatte sie ihm eben ihren Fund übergeben. Doch Antons Aufmerksamkeit war auf den Gegenstand vor ihm gerichtet.
»Der Knochen sieht eigenartig aus«, meinte Ernestine und schaute ebenfalls auf den Boden. »Er erinnert mich an meine Zeit als Lehrerin. Das Skelett im Biologiesaal hatte einen Oberschenkel –« Weiter kam sie nicht.
»Ach du meine Güte!« Anton stöhnte laut auf.
»Was ist los?«, wollte Frau Henkel wissen. Ihre Tante war die Erste, die den Verdacht, den alle hegten, aussprach: »Das ist der Oberschenkelknochen eines Menschen. Das sieht ein Blinder.«
In der Aufregung, die folgte, lief Ernestine zum Musikpavillon. Sie suchte nach dem Loch, das Minna gebuddelt hatte. Es war nicht schwer zu finden, ein kleiner dunkler Erdhaufen zeigte die Stelle an. Die Cockerspaniel-Dame hatte ganze Arbeit geleistet. Unter der Holzkonstruktion lagen noch weitere Knochen und daneben Reste von Stoff. Sie waren voller Erde, weshalb die ursprüngliche Farbe nicht mehr erkennbar war. Ernestine entdeckte daran Knöpfe aus Perlmutt.
»Was ist denn da?« Eine ausgenommen dicke Frau hockte sich neugierig neben sie. Sie roch nach einer Mischung aus Weihrauch, Moschus und altem Schweiß. Der Geruch stach unangenehm in der Nase.
»Ein Fund, den die Polizei sich ansehen muss«, sagte Ernestine. Sie drehte sich zu der Frau um. Die Proportionen ihres Gesichts passten nicht zu denen des Körpers, ihre Arme und Beine waren viel zu kurz für den Brustkorb. Die Fremde war kleinwüchsig. Ernestine hatte sie zuvor neben einem bunten Zelt sitzen sehen. »Frau Natalia, die Warsagerin!«, hatte auf einer Schiefertafel gestanden, die Ernestine wegen des Rechtschreibfehlers ins Auge gestochen war.
»Das muss die Mizzi sein«, raunte die Wahrsagerin. Ihr struppiges grellblond gefärbtes Haar war mit einem bunten Tuch hochgebunden. Die Frisur erinnerte an einen schiefen Turm, vielleicht wollte die Frau auf diese Weise größer erscheinen.
»Ist denn jemand abgängig?«, fragte Ernestine.
»Mizzi Novotny«, sagte die kleine Frau. »Ich habe immer gewusst, dass sie noch hier ist. Ihre verwunschene Seele spukt nachts durch den Böhmischen Prater und sorgt dafür, dass so mancher von uns nicht schlafen kann. Vielleicht kann die Tote jetzt endlich Frieden finden.« Sie bekreuzigte sich drei Mal, spuckte über ihre rechte Schulter und murmelte einen Spruch, der lateinisch klingen sollte, in Wahrheit aber unsinniger Firlefanz war. Als ehemalige Lateinlehrerin erkannte Ernestine das sofort.
»Wer war denn diese Mizzi Novotny?«, wollte Ernestine wissen. Sie konnte nicht anders, die Neugier lag ihr im Blut wie anderen die Leidenschaft für Musik oder Kunst.
»Das hübscheste Mädel, das jemals im Böhmischen Prater gelebt hat«, sagte die Wahrsagerin. Sie verzog die stark geschminkten Lippen. Auf ihrer faltigen rechten Wange klebte ein Schönheitspflaster in der Form eines Herzens. Ernestine hatte es zuerst für einen Schmutzfleck gehalten.
»Und gleichzeitig war die Mizzi auch die arroganteste, kälteste und berechnendste Person, der ich jemals begegnet bin. Ein zickiges Gfrast«, ergänzte die Frau. Ernestine zuckte zusammen. Die abfällige Bemerkung passte überhaupt nicht zu den netten Worten davor.
»Alle zur Seiten!« Die Stimme gehörte dem Wirt, der sich durch eine Gruppe Schaulustiger drängte. »Alle, Sie da auch. Weg hier!« Er zeigte erst auf Ernestine, dann auf die Kleinwüchsige. »Natalia, schleich di, du alte Hex.«
»Ich gehe, wenn ich das will, und ned, wenn du es mir sagst«, widersprach die Wahrsagerin. »Da liegt die tote Mizzi Novotny. Jemand muss die Polizei rufen.«
»I brauch kane Kiwara«, sagte der Wirt. »Des is bloß a totes Viech. Des kommt weg, und fertig is die Gschicht.«
»Viecher tragen keine Kleider«, widersprach die Wahrsagerin.
Der Wirt blieb davon unbeeindruckt. Er drehte sich nach allen Seiten, stemmte die Hände in die Hüften und erhob die Stimme. »Da gibt’s nix zum Sehen. Setzen S’ sich alle wieder hin. Die Musi spielt glei wieder weiter. Es wird getanzt, gegessen und getrunken. Heut is Herbstfest im Böhmischen Prater.«
Auch die Musikanten waren aufgestanden und reckten die Köpfe nach dem, was sich unter der Holzkonstruktion befand. Keiner machte Anstalten, weiter aufzuspielen.
»Musik! Gemma!«, forderte Carel Prohaska ungeduldig. Doch die Männer weigerten sich.
»Ich spiel ganz sicher ned auf ana Leich!«, rief einer empört.
Aufgeregtes Stimmengewirr erhob sich. Jeder wollte einen Blick auf die Knochen erhaschen.
»A Leich? Hier im Prater?«
Die Menschen drängten näher, und der Wirt verlor die Kontrolle über seine Gäste. Immer näher kamen die Schaulustigen. Es war Ernestine, die schließlich lenkend eingriff. Sie kletterte zu den Musikern aufs Podest und erhob die Stimme.
»Bitte Ruhe!«, forderte sie. »Die Musik muss leider eine kurze Pause einlegen. Bis weitergespielt werden kann, wird der Bereich rund um den Holzpavillon abgesperrt. In der Zwischenzeit können Sie sich an allen anderen Vergnügungen im Prater erfreuen. Die Köstlichkeiten aus Herrn Prohaskas Küche schmecken auch ohne musikalische Begleitung hervorragend.« Ihre Stimme klang so bestimmt, dass niemand auch nur ansatzweise dagegen protestierte. Das Gemurmel, das sich erhob, klang wie Zustimmung.
Ernestine legte noch etwas nach. »Es besteht keinerlei Grund zur Sorge«, versicherte sie. »Die zuständige Behörde ist bereits informiert.«
Sie sprach nicht von der Polizei, was nur für weitere Verunsicherung gesorgt hätte. Langsam legte sich die Aufregung.
»Es ist nur a totes Viech.«
Die Menschen kehrten zurück zu ihren Plätzen und setzten sich. Erst als die meisten der Gäste bei den Tischen waren, kletterte Ernestine wieder vom Pavillon.
Carel Prohaska starrte sie mit offen stehendem Mund an. Es dauerte, bis er seine Sprache wiederfand. »Wie ham S’ des grad gmacht?«
»Was?«, fragte sie.
»Na, dass die Leut Ihnen zughört ham? Die san alle wieder auf ihre Plätz gangen.« Er war sichtlich beeindruckt.
»Natürliche Autorität.«
Ihre Erklärung schien seine Frage nicht befriedigend zu beantworten. Er starrte sie immer noch verdattert an.
Ernestine klatschte in die Hände. »So, und jetzt holen Sie die Polizei.«
»I brauch kane Kiwara …« Weiter kam er nicht.
Ernestine hob mahnend den Zeigefinger und hielt ihn ihm vor die Nase. »Sie holen jetzt die Polizei. Und zwar flott.«
Ohne weitere Widerrede trottete der Wirt davon.
»Na bitte. Geht ja«, sagte Ernestine zufrieden.
Frau Natalia, die immer noch neben ihr stand, musterte sie von der Seite. »Sie waren früher Lehrerin, stimmt’s?«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich bin Wahrsagerin«, sagte die kleinwüchsige Frau. Dann zuckte sie mit den Schultern. »Aber um das zu erkennen, braucht man keine hellseherischen Fähigkeiten. Man sieht es Ihnen einfach an.«
Ernestine überlegte, ob das nun ein Kompliment oder eine Beleidigung war.
DREI
»Ich habe mir schon Sorgen gemacht«, beschwerte sich Heide. Antons Tochter hatte in den letzten Wochen an Gewicht zugelegt, trotz ihres weiten Kleides mit der versetzten Taille war ihre Schwangerschaft nicht mehr zu verbergen. Unter dem hellblauen Stoff wölbte sich ein kleines Bäuchlein.
»Wir konnten ja nicht ahnen, dass Minna die Reste einer Leiche ausgräbt«, sagte Ernestine. Heide warf einen alarmierten Blick zu ihrer Tochter. Aber Rosa hatte längst mitbekommen, weshalb sie so lange im Böhmischen Prater geblieben und erst abends nach Hause zurückgekehrt waren.
»Unsere Minna ist einfach die schlaueste Hündin von ganz Wien«, erklärte das Mädchen stolz. Sie strich der Cockerspaniel-Dame über den Kopf, die sowohl das Lob als auch die Streicheleinheiten bereitwillig entgegennahm. »Fritzi wird staunen, wenn ich ihm am Montag von Minnas Fund erzähle.« Fritzi war Rosas bester Freund. Er wohnte im Nachbarhaus. Die beiden gingen in dieselbe Klasse und verbrachten auch außerhalb der Schule beinahe ihre gesamte Freizeit zusammen.
»Ich denke, es wäre besser, du redest noch nicht so viel darüber«, meinte Erich Felsberg. Er und Heide hatten im Frühjahr geheiratet. Die beiden ergänzten einander perfekt. Seit Heide und Erich ein Paar waren, war der traurige Ausdruck aus Heides Gesicht verschwunden, der sie seit dem Tod ihres ersten Ehemanns jahrelang begleitet hatte. Und Erich, der unter den Folgen des Krieges sehr gelitten hatte, wurde seit der Hochzeit nur noch selten von bösen Erinnerungen an die Schlachtfelder heimgesucht.
Allerdings hatte er nicht nur Heide geheiratet, sondern eine ganze Familie, mitsamt der Freundin seines Schwiegervaters. Zufälligerweise war Ernestine seine ehemalige Lateinlehrerin, womit sich der Kreis schloss.
»Warum darf ich in der Schule nichts erzählen?«, wollte Rosa wissen. Es war ihr an der Nasenspitze anzusehen, dass sie die wundervoll aufregende Geschichte zumindest mit ihrem besten Freund teilen wollte.
»Solange nicht feststeht, um wen es sich bei der Leiche handelt, wäre es fein, wenn nicht zu viel Lärm darum gemacht wird. Möglicherweise geht es dabei um ein Gewaltverbrechen, das aufgeklärt werden muss.«
»Selbstverständlich war es ein Verbrechen«, sagte Ernestine voller Überzeugung. »Welche Leiche vergräbt sich selbst?«
»Noch wissen wir nicht, wie der oder die Tote in den Böhmischen Prater kam«, widersprach Erich. »Es kann genauso gut ein Unfall gewesen sein. Jemand ist gestolpert, hatte einen Herzinfarkt oder kam durch einen anderen ungeklärten Umstand ums Leben.«
»Und hat sich dann selbst eingebuddelt?« Ernestine wiederholte ihre Theorie.
»Auch darüber wissen wir noch zu wenig«, beharrte Erich. »Bei umfangreichen Erdarbeiten kann es schon mal passieren, dass etwas übersehen wird, vielleicht sogar eine Leiche. Es ist zugegeben unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.«
Heide ging in die Küche und holte die Gulaschsuppe, die sie fürs Abendessen warm gehalten hatte. Nach dem reichlichen Nachmittagsimbiss im Böhmischen Prater hatte nur Anton Appetit. Er konnte immer etwas verdrücken, auch wenn man es ihm nicht ansah. Trotz seiner Liebe zum guten Essen war er groß und hager.
»Die Wahrsagerin, Frau Natalia, hat behauptet, es handele sich bei der Leiche um eine Frau, die Mizzi Novotny hieß. Sagt dir der Name etwas?« Ernestine sah Erich fragend an.
»Es ist tatsächlich so, dass 1919, also nach dem Krieg, eine junge Frau als vermisst gemeldet wurde. Sie hieß Mizzi Novotny. Die Frau ist nie aufgetaucht.«
»Wer hat sie denn als vermisst gemeldet? Ihre Eltern, ihre Geschwister, ihr Ehemann?«, wollte Ernestine wissen.
»In den Unterlagen, die ich vorhin überflogen habe, stand der Name Milan Benesch«, sagte Erich.
»Das ist der Mann von den Schaukeln!«, rief Rosa. »Der Hutschenschleuderer.« Das Mädchen freute sich, dass es sich den Namen gemerkt hatte und etwas beitragen konnte.
»Stimmt!« Ernestine war beeindruckt.
»Ich habe den Namen gelesen, als wir in der Schlange gewartet haben«, sagte Rosa stolz.
»Du bist eine aufmerksame Beobachterin«, lobte Ernestine. »Vielleicht wirst du einmal Detektivin oder Polizistin.«
»Um Himmels willen«, rief Heide entsetzt. »Ein Polizist in der Familie reicht. Setz Rosa keine Flausen in den Kopf.«
Aber Ernestines Worte wirkten bereits. Rosa schien in Gedanken schon Pläne zu schmieden.
»Solange wir keine Sicherheit darüber haben, wessen Leiche da gefunden wurde, würde ich gerne alle Spekulationen in dieser Sache bleiben lassen«, sagte Erich ernst. »Erzählt uns lieber, wie der Nachmittag im Böhmischen Prater war. Abgesehen von dem unerfreulichen Fund.«
»Ich bin auf einem Pony geritten«, erzählte Rosa. »Und ich habe Powidltascherl bestellt. Die haben mir aber nicht geschmeckt. Der Opa hat sie aufgegessen.«
»Du hast zwei Portionen gegessen?«, fragte Heide. Seit Dr. Fellner, Antons Hausarzt, ihn ermahnt hatte, weniger Zucker und Fett zu essen, wachte Heide mit strengem Blick darüber, was ihr Vater zu sich nahm. Sehr zu Antons Leidwesen.
»Es waren bloß drei Tascherl«, meinte er.