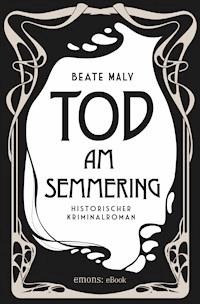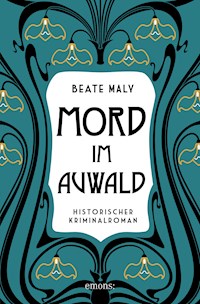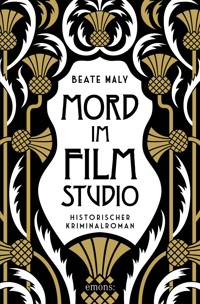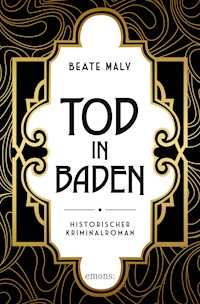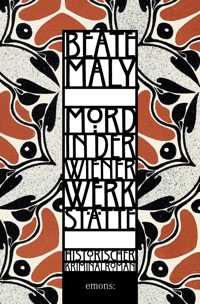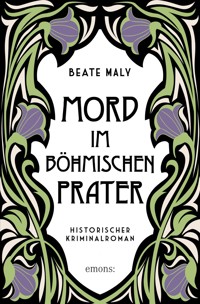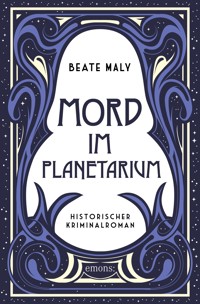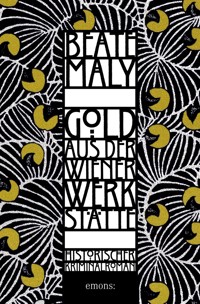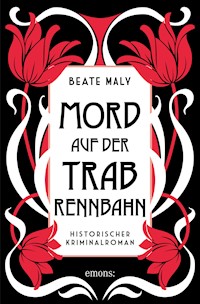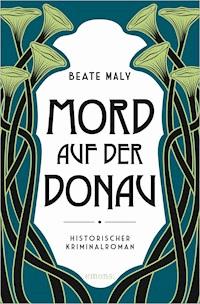
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ernestine Kirsch und Anton Böck
- Sprache: Deutsch
Ein feinsinnig-unterhaltsamer Kriminalroman im Stil von Agatha Christie. Entlang der Donau, 1923: Auf einem Luxusdampfschiff, das von Wien nach Budapest fährt, stirbt ein Gast. Zuerst sieht es aus, als wäre ihm die Szegediner Fischsuppe nicht bekommen, doch die pensionierte Lehrerin Ernestine Kirsch und ihr Freund Anton Böck haben ihre Zweifel: Einige der Schiffspassagiere scheinen ein Motiv für einen Mord zu haben. Gemeinsam gehen sie der Sache auf den Grund – und damit dem Mörder fast in die Falle... Band 3 der Reihe »Ernestine Kirsch und Anton Böck«. Alle Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Beate Maly wurde 1970 in Wien geboren, wo sie bis heute mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt. Zum Schreiben kam sie vor rund zwanzig Jahren. Zuerst verfasste sie Kinderbücher und pädagogische Fachbücher. Seit rund zehn Jahren widmet sie sich dem historischen Roman und seit »Tod am Semmering« auch dem Kriminalroman.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Lunetskaya
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Christine Derrer
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-419-3
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Im Grunde glaubt niemandan seinen eigenen Tododer, was dasselbe ist:im Unbewußten sei jeder von unsvon seiner Unsterblichkeit überzeugt.
Sigmund Freud, 1915
PROLOG
Ungarn, 1873
Orangerot flimmerte die Sonne über der ockerfarbenen Steppe und tauchte die ungarische Puszta in ein sanftes, spätsommerliches Licht. Eine leichte Brise bewegte trockene Halme und brachte sie zum Knistern. Insekten schwirrten über der dunkelbrauen Erde, Grillen zirpten im Gras. In der Ferne weidete eine Schafherde träge neben einem der vielen Ziehbrunnen, deren schmale Silhouetten charakteristisch für die schier endlose Weite der Landschaft waren.
Gleich neben dem Brunnen befand sich ein Gebiet, das von den Bewohnern der Gegend liebevoll »Eichenwäldchen« genannt wurde. Niemand wusste, woher der Name stammte, denn seit Menschengedenken wuchsen dort keine Eichen mehr. Hüfthohes Gebüsch, winzige Blüten in Lila und Weiß sowie niedrige Erlen, deren faustdicke Stämme mit einem einzigen Axthieb eines kräftigen Mannes umgehauen werden konnten, prägten das Bild.
Dennoch zog der Landschaftsstreifen mehr Menschen an als die übrige Puszta. Hinter den Erlen gab es ein riesiges Pferdegestüt und zwei Bauernhöfe.
Vor einem der einfachen Gebäude, in dessen dichtem Schilfdach sich Insekten tummelten, spielte die fünfjährige Ilona. Wie immer war sie sich selbst überlassen. Ilona war nicht die Tochter der Bauern, sondern bloß ein Pflegekind, von dem niemand so recht wusste, wer die leiblichen Eltern waren. Kurz nach ihrer Geburt hatte ein junger Bursche sie am Hof abgegeben und für ihre Versorgung Geld versprochen. Besucht oder nach dem Mädchen erkundigt hatte sich in all den Jahren nie jemand. Alle vier Wochen kam, wie vereinbart, ein absenderloses Kuvert, in dem sich eine bescheidene Summe befand. Mit dem Zusatzverdienst hatte die Bäuerin zwei neue Legehühner und vor ein paar Wochen eine Ziege gekauft.
»Solang ich die Briefe erhalte, kannst du hierbleiben«, sagte die Bäuerin regelmäßig. Ilona wusste also, dass sie den Hof verlassen musste, sobald ihre Post ausbleiben würde.
Im Moment stampfte die Bäuerin Butter in der Küche. Der Bauer war am Feld, gemeinsam mit zwei Knechten. Meistens nahm er Ilona mit, dann musste sie genau wie die Erwachsenen das Gras mit einer Sichel schneiden, die für ihre jungen Hände viel zu groß war, Saat ausbringen oder bei der Ernte mithelfen. Heute war sie am Hof geblieben, weil der Bauer einen Zaun ausbesserte. »Dabei bist du bloß im Weg«, hatte er gemeint. Ilona war es recht. Jetzt hockte sie in ihrem alten, löchrigen Kleid auf dem staubigen Boden und zog mit einem Stecken Endlosschleifen in den Sand. Die Spuren verliefen zuerst zu kleinen konzentrischen Kreisen, um dann wieder größer zu werden. Das Muster, das sich bildete, war dem auf der Töpferscheibe ähnlich, die im hintersten Schuppen stand. Manchmal drehte Ilona das verstaubte Gerät. Sie mochte das knarrende Geräusch, das dann ertönte. Es klang beinahe wie Musik. Natürlich wagte Ilona sich nur an die Scheibe, wenn sicher war, dass niemand sie sehen konnte. Hätte die Bäuerin sie dabei erwischt, hätte sie mit dem Kochlöffel zugeschlagen oder schlimmer noch mit der Peitsche. Die Strafen der Bäuerin waren brutal. Ilonas schmaler Rücken war mit blauen Flecken und roten Striemen übersät. Mittlerweile spürte sie es kaum noch, wenn die Alte zuschlug. Nur wenn die Bäuerin besonders grausam war und darauf bestand, dass Ilona ihr Kleid auszog, und die feine Haut bei jedem ihrer Hiebe aufplatzte, brannten die Wunden oft tagelang.
Ilona hielt im Zeichnen inne und presste beide Hände fest gegen ihren Magen. Er knurrte laut. Seit dem Frühstück hatte sie kein Essen bekommen. Das war nicht ungewöhnlich. Ilona kannte kein Gefühl der Sättigung. Sie hatte immer Hunger. Als Pflegekind hatte sie kein Anrecht auf eigene Mahlzeiten. Zumindest behauptete der Bauer das. Sie sei der Abschaum der Gesellschaft. Ein Balg, den die eigenen Eltern nicht haben wollten. Ilona wusste nicht, was der Abschaum der Gesellschaft war, aber sie spürte, dass sie weniger wert war als das Vieh am Hof. Während die Ziegen regelmäßig gefüttert wurden, musste sie sich mit den Abfällen der anderen zufriedengeben. Manchmal gab es mehr, meist aber weniger. Heute Morgen war ihre Portion besonders bescheiden ausgefallen. Sie hatte lediglich eine winzige Kante trockenen Brotes erhalten.
Aber Ilona war schlau. Wenn sie nicht mit aufs Feld musste, schlich sie sich, sobald der Bauer und die Knechte weg waren, in den Stall. Wenn sie Glück hatte, fand sie noch einen kleinen Rest Milch im Eimer. Heute war er allerdings völlig leer gewesen. Die rot gefleckte Hofkatze war ihr zuvorgekommen.
Ein leises Brummen ließ Ilona aufschrecken. Zwei fette schwarze Fliegen surrten an ihrer Nase vorbei. Ilona schüttelte den Kopf und verscheuchte sie mit der Hand. Doch die Insekten waren hartnäckig. Eine Fliege setzte sich auf ihre Schulter, die andere auf ihren nackten Unterarm. Rasch sprang Ilona auf. Die Bewegung war zu schnell, sofort wurde ihr schwindelig. Auch dieses Gefühl war ihr nicht fremd. Es passierte immer dann, wenn sie den ganzen Tag über nichts getrunken hatte. Normalerweise schöpfte Peter, der alte Knecht, Wasser aus dem Ziehbrunnen für sie. Aber heute hatte er es vergessen. Ilona könnte die Bäuerin fragen, aber wenn die schlecht gelaunt war, und das war sie beim Butterstampfen immer, würde sie bloß laut schimpfen. Sie würde gewiss wütend reagieren, wenn Ilona sie in ihrer Arbeit unterbrach. Ilona selbst war noch zu klein, um den Brunnen zu bedienen. Auch wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte und streckte, konnte sie den Hebel des Ziehbrunnens nicht erreichen. Sie hatte es erst vorgestern probiert. In einem Jahr, wenn sie ein paar Zentimeter größer war, würde sich dieses Problem gelöst haben.
Ilona hielt die Hand schützend über ihre Augen und blinzelte in die Ferne. Die Sonne stand bereits tief. Bald würden der Bauer und die Knechte zurückkehren. Mit etwas Glück fielen beim Abendessen mehr Reste für sie ab als heute Morgen. Wenn Peter sie bemerkte, langte er noch einmal nach und schob seine eigene Schüssel zu Ilona. Der alte Knecht mit dem faltigen Gesicht und dem gekrümmten Rücken war der Einzige am Hof, der hin und wieder freundlich zu ihr war. Aber Peter sah nicht mehr gut, und er war beinahe taub. Meistens bekam er gar nicht mit, dass Ilona hungrig war.
Aus der Küche roch es verführerisch nach gerösteter Zwiebel und Paprika, im großen Suppentopf der Bäuerin kochte seit Stunden ein Gulasch. Wenn die Männer vom Feld kamen, würden die Fleischstücke so weich sein, dass man sie mit der Zunge am Gaumen zerdrücken konnte. Ilona hoffte inständig, ein paar Happen zu erwischen.
Als sie sich umdrehte, nahm sie einen vorbeiziehenden Schatten neben sich wahr. Die Rotgefleckte sprang vom Stalldach und kam mit aufgestelltem Schwanz und geschmeidigen Bewegungen auf sie zu. Ilona mochte die Katze, die ihr nicht feindlich gesinnt war. Aber ähnlich wie Peter war auch die Katze launisch. An manchen Tagen ließ sie sich streicheln und schnurrte behaglich, und in besonders kalten Nächten kam sie zu Ilona in den Stall und schmiegte sich an ihren mageren Körper. Dann wieder kehrte sie ihr den Rücken zu und lief weg, sobald Ilona sich ihr nähern wollte.
Heute schien einer der Tage zu sein, an denen die Katze zutraulich war. Sie umrundete Ilonas nackte Beine. Ihr weiches Fell kitzelte ihre Waden. Ilona bückte sich, um die Katze hinter den Ohren zu kraulen, aber die Rotgefleckte wich geschickt aus und lief Richtung Stall. Schon nach wenigen Metern blieb das Tier stehen und drehte sich nach Ilona um, so als wollte sie das Mädchen dazu auffordern, ihr zu folgen. Bereitwillig warf Ilona den Stecken weg und lief dem Tier hinterher. Die Katze bewegte sich schnurstracks auf den Kuhstall zu und verschwand hinter dem schiefen Holztor.
Nach der prallen Sonne war es im fensterlosen Gebäude düster. Durch die Ritzen der Holzlatten drang noch ein wenig Tageslicht. Es roch nach frischem Heu und dem scharfen Urin der Tiere. Nach kurzer Zeit gewöhnten sich Ilonas Augen an das Halbdunkel. Sie wusste, dass zwei Kühe im hinteren Teil des Stalls waren. Die Bäuerin hatte sie heute Morgen nicht rausgelassen.
Als Ilona sich den riesigen Tieren näherte, hoben sie träge den Kopf, ohne dabei ihre Kaubewegungen zu unterbrechen. Die Rotgefleckte sprang leichtfüßig auf einen Futtertrog und balancierte problemlos über den schmalen Rand. Wieder vergewisserte sie sich, dass Ilona hinter ihr war. Am Ende des Trogs hielt die Katze inne. Ihre Nase beschnupperte einen Gegenstand am Boden. Ilona konnte noch nicht erkennen, worum es sich handelte. Mit flinken Schritten erreichte sie die Katze und konnte ihr Glück kaum fassen. Da stand ein halb voller Eimer Milch. Eine der Mägde musste ihn vergessen haben. Vielleicht war sie zu einer anderen Arbeit gerufen worden. Vorsichtig drehte Ilona sich um. Niemand war ihr gefolgt. Bis auf die Katze und die beiden Kühe war sie allein im Stall. Keiner würde bemerken, wenn sie ein paar Schlucke der warmen, süßen Milch trank. Aber der Eimer war schwer. Viel zu schwer für eine Fünfjährige. Ilona kniete sich auf den Boden. Das Heu stach in ihre nackten Knie, doch sie nahm es kaum wahr. Die Vorfreude auf die Milch war zu groß. Sie fasste mit beiden Händen in den Eimer. Ihre kurzen Kinderfinger durchbrachen die dicke Fettschicht, die sich auf der Milch gebildet hatte. Darunter befand sich lauwarme, sämige Flüssigkeit. Gierig formte Ilona eine Schale mit den Händen und führte sie zum Mund. Der süße Rahm schmeckte nach Heu, Fett und Kuh. Aus ihren Mundwinkeln tropfte die Milch auf ihr Kleid. Hastig wischte Ilona die Flecken mit dem Ellbogen weg. Eine Milchspur rann über ihren Unterarm. Die Rotgefleckte kam näher und schleckte mit ihrer rauen Zunge die Tropfen weg. So als wollte die Katze die verräterischen Spuren beseitigen, um Ilona vor etwaigen Strafen zu bewahren.
Die kleine Portion Milch war nicht genug, Ilonas Magen knurrte jetzt noch lauter als zuvor. Sie brauchte noch mehr von der sättigenden Milch und tauchte die Hände erneut in den Eimer. Zu spät nahm sie das Geräusch hinter sich wahr. Erschrocken fuhr sie herum und sprang auf, dabei stieß sie mit der rechten Ferse gegen den Eimer. Sie versuchte ihn festzuhalten, aber es war vergebens. Mit einem dumpfen Geräusch polterte der Holzeimer auf den festgestampften Erdboden. Die kostbare Milch versickerte zwischen losen Strohhalmen. Fassungslos starrte Ilona der Flüssigkeit nach. Sie wollte sie aufhalten, fiel auf die Knie und fasste mit den milchfeuchten Händen ins Stroh. Einzelne Halme blieben an ihren Fingern kleben. Aber es half nichts, die Milch war verschüttet.
»Du elende Diebin.« Das kantige, vom Alter gezeichnete Gesicht der Bäuerin färbte sich vor Wut dunkelrot. Hinkend, denn eines ihrer Beine war kürzer als das andere, kam sie auf das Mädchen zu.
Ilona war wie gelähmt vor Angst. Sie hatte den richtigen Augenblick verpasst. Wäre sie gleich weggelaufen, hätte sie das Schlimmste verhindern können. Aber nun würde die Bäuerin erbarmungslos zuschlagen. Die Rotgefleckte war klüger gewesen. Sie hockte bereits auf einem der massiven Dachbalken über der Kuh und beobachtete das Geschehen aus sicherer Entfernung. Ihr Schwanz peitschte aufgeregt zur Seite.
»Ich werde dir Ehrlichkeit beibringen!« Die Bäuerin schnappte sich die Mistgabel, die an der Wand lehnte. Sie richtete die spitzen Zacken direkt auf Ilonas schmale Brust. »Statt dankbar zu sein, dass ich dich aufgenommen habe, bestiehlst du mich. Du verlogener Balg!«
Immer noch war Ilona unfähig zu fliehen. Mit angstgeweiteten Augen starrte sie zuerst auf das Werkzeug in den knorrigen, alten Händen, dann in das Gesicht der Bäuerin. Rund um ihre schmalen Lippen befanden sich Paprikaspuren. Sie hatte vom Gulasch gekostet. Ilonas Blick blieb daran hängen, vielleicht, weil sie den harten Ausdruck in den Augen der Bäuerin nicht ertrug. Er war anders als sonst. Purer Hass loderte darin. Es war, als hätte die Alte den letzten Rest Menschlichkeit verloren. Die Heugabel in ihrer Hand erinnerte Ilona an den Teufel, von dem die Mägde in kalten Winternächten erzählten. Eine pelzige Gestalt mit einem Pferdefuß, Hörnern am Kopf und einer Mistgabel in den Klauen, um Sünder aufzuspießen.
»Vergreifst dich hinter meinem Rücken an meiner Milch. Das wird dir noch leidtun. Du schmutziges, kleines Biest. Undankbares Gesindel, wir hätten dich gleich im Brunnen ersäufen sollen.«
Schon war die Alte so nahe bei Ilona, dass die Zacken der Heugabel ihr Brustbein berührten. Das Antlitz der Frau war eine hässliche Fratze. Es war nicht das erste Mal, dass Ilona ein Missgeschick widerfahren war. Nur diesmal war die Bäuerin außer sich vor Wut. Sie würde zustechen und Ilona schwer verletzen, vielleicht sogar töten. Ilona spürte die Gefahr, ihr Leben hing an einem seidenen Faden. Mit klopfendem Herzen und trockenem Mund lehnte sie sich nach hinten, und genau in dem Moment setzte die Bäuerin mit der Waffe nach. Das schmutzige rostige Metall rutschte ab und bohrte sich tief in Ilonas rechten Oberschenkel. Das Mädchen schrie auf. Ihre weiche Kinderhaut platzte auf. Warmes Blut floss über Ilonas helles Knie und tropfte auf ihren Knöchel. Sie verdrängte den Schmerz. Alles, was sie sah, waren die stechenden Augen der Bäuerin. Ein lautes Miauen ertönte. Für einen Augenblick war die Bäuerin abgelenkt, richtete ihre Aufmerksamkeit auf den Balken, von dem der Schwanz der Rotgefleckten baumelte. Der Körper des Tiers war hinter einer Verstrebung versteckt. Ilona reagierte blitzschnell. Sie machte einen Schritt zur Seite, wich der Mistgabel aus und schoss an der Alten vorbei. Dabei stieß sie die Bäuerin zur Seite und rannte aus dem Stall, so schnell sie konnte. Sie spürte die Holzscheite nicht, auf die sie trat, nahm die Splitter nicht wahr, die sich in ihre Fußsohlen bohrten, und auch den Hühnerkot nicht, der zwischen ihren Zehen kleben blieb.
»Bleib stehen, du kleine Kröte«, rief die Bäuerin.
Aber schon hatte Ilona das Tor erreicht und trat ins Freie. Noch war der Hof leer, der Bauer und die Knechte waren heute länger am Feld. Niemand konnte sie aufhalten. Ilonas Lungen brannten, ihr Herz raste. Sie musste weg vom Stall und der tobenden Bäuerin, deren schimpfende Stimme hinter ihr hergeiferte: »Glaub ja nicht, dass du ungestraft davonkommst!«
Ilona hoffte, dass die Zeit für sie arbeiten würde. So verärgert die Bäuerin jetzt auch sein mochte, in ein paar Stunden würde sich ihr Jähzorn bestimmt gelegt haben. Dann würde der angsteinflößende, wahnsinnige Blick aus ihren Augen wieder verschwunden sein. Vielleicht schlug sie mit dem Kochlöffel zu, aber sie würde sie nicht mehr mit der Heugabel abstechen wollen. Ilona durfte sich die nächsten Stunden nicht sehen lassen, vielleicht war es besser, erst morgen wieder auf dem Hof aufzutauchen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie sich verstecken musste. Am besten hinter dem Haus, bei dem kleinen Teich. Im hohen Schilf würde man nicht nach ihr suchen. Jeder mied diesen Platz, an dem es von Stechmücken nur so wimmelte. Schon konnte Ilona das Zirpen der Grillen hören. Sie drehte sich noch einmal um. Die Bäuerin stand immer noch mit drohend emporgehaltener Heugabel im Scheunentor und schimpfte ihr nach. Aber ihre Stimme war jetzt nur noch ein unverständliches Keifen, das vom Surren der Insekten übertönt wurde.
Ilona konnte das abgestandene Wasser riechen, das ihr Sicherheit suggerierte. Der Schilfgürtel rückte mit jedem ihrer Schritte näher. Der Boden unter ihren Füßen wurde zunehmend feuchter, dunkler und dicker. Die matschige Erde quoll zwischen ihren nackten Zehen hindurch. Gleich war sie aus dem Sichtfeld der Bäuerin verschwunden. Hinter dem Schilf, das Ilona weit überragte, lag der Teich. Braunes Wasser, das nach abgestorbenen Blättern und Schlingpflanzen roch. Ilona hockte sich zwischen die zeigefingerdicken Schilfhalme. Ihr Herz raste noch immer, ihr Atem ging stoßweise. Hier würde ihr vorerst nichts passieren. Eine ihrer blonden Locken fiel ihr direkt in die Augen. Mit der Hand strich sie sie weg und stellte fest, dass ihre Haut immer noch klebrig war von der Milch. Vorsichtig ging sie in gebückter Haltung Richtung Wasser und tauchte ihre rechte Hand ins dunkle, kühle Nass. Nur langsam beruhigten ihr Atem und ihr Herzschlag sich wieder. Sie konnte den Boden des Teichs nicht ausmachen, denn das Wasser war trüb und schlammig. Um auch die andere Hand zu waschen, beugte sie sich noch ein Stück weiter nach vorn. Sie musste die Wunde auf ihrem Oberschenkel reinigen. Aber zuerst benötigte sie eine Rast. Manchmal wurde ihr übel, wenn sie ihr eigenes Blut sah. Besser, sie saß fest am Boden, bevor sie das Kleid hochhob.
Plötzlich sprang ein riesiger Fisch aus dem Wasser und fing eine Fliege. Ilona erschrak so heftig, dass sie das Gleichgewicht verlor. Sie versuchte mit beiden Armen nach hinten zu rudern und sich festzuklammern, aber vergebens. Kopfüber stürzte sie ins Wasser. Ilona begriff nicht sofort, was passiert war, spürte die Kälte nicht. Erst als das Wasser über ihr zusammenschlug, erkannte sie die Gefahr. Wie ein Sack voller Steine tauchte sie ab. Verzweifelt strampelte sie mit Armen und Beinen, schaffte es wieder an die Wasseroberfläche zu gelangen und nach Luft zu schnappen. Sie schrie aus Leibeskräften um Hilfe. Aber wer sollte sie hören? Sie hatte diesen abgeschiedenen Ort ja aufgesucht, um unentdeckt zu bleiben. Ihre Füße traten ins Leere. Eine schier übermächtige Kraft zog sie nach unten. So als hätte jemand ihre Beine gepackt und hielt sich nun daran fest. Ilona ruderte. Panisch streckte sie den Kopf in den Nacken, in der Hoffnung, Mund und Nase aus dem Wasser zu bekommen. Aber wieder schwappte eine Welle über sie. Wasser drang in ihre Nase. Sie spuckte und hustete. Ihre Lungen schwollen an. Ihre Augen drohten aus ihrem Kopf zu springen. Sie musste sich bewegen, aber mit jeder Bewegung ließ ihre Kraft nach. Das Schlagen ihrer Arme wurde langsamer, schon tauchte sie unter. Sie hielt die Augen weit offen. Für einen Moment war sie überrascht, wie hell es war. Die letzten Strahlen der Sonne drangen bis tief unter die Wasseroberfläche. Ilona sah nach oben zum Licht. Verschwommen nahm sie das Dunkelgrün des Schilfs wahr. In ihren Ohren surrte es, ihr Trommelfell drohte zu platzen, ihr Herz raste in teuflischer Geschwindigkeit. Sie wollte atmen und schluckte Wasser. In ihrer Brust wütete ein unerträglicher Schmerz. Fühlte sich so der Tod an? Ihr wurde übel, und mit einem Mal wurde es dunkel um sie herum. Es hatte keinen Sinn, sich weiter zu wehren. Der Kampf war aussichtslos, sie konnte ihn nicht gewinnen. Es war absurd, sie musste an das Gulasch denken, das sie heute Abend verpasste. Sie würde überhaupt nie wieder essen, aber auch nie wieder an Hunger leiden. Mit jedem Stück, das sie sank, verlor die Finsternis an Bedrohung und hüllte sie schließlich tröstend ein, wie ein warmer, schützender Mantel. Ilona ließ sich fallen.
EINS
Wien, Juli 1923
»Eigentlich ist der Abend viel zu schön, um in einem verdunkelten Saal zu sitzen.« Ernestine schlüpfte aus ihrer dünnen Strickjacke. Auf der Mariahilfer Straße war es deutlich wärmer als im Keller des Haydn. Die geschlossene Häuserfront hatte die Hitze des Tages gespeichert und gab sie nun langsam wieder ab.
»Aber der Besuch des Lichtspieltheaters hat sich gelohnt«, meinte Anton. »Der Film war großartig.« Bei der Erinnerung an Harold Lloyd, der sich in einer halsbrecherischen Szene auf dem Zeiger einer überdimensionierten Uhr festhielt, um nicht von der Fassade eines Wolkenkratzers zu stürzen, musste er immer noch schmunzeln.
»Der Streifen war zweifelsohne unterhaltsam, aber das nächste Mal möchte ich etwas Gefühlvolleres sehen. Erinnern Sie sich noch an die herrlichen Filme, die vor dem Krieg gedreht wurden? ›Quo vadis‹ oder ›Die Plünderung Roms‹. Verglichen mit diesen Kunstwerken sind die amerikanischen Komödien doch reichlich seicht.«
Anton räusperte sich. Er war anderer Meinung. Im Gegensatz zu Ernestine schätzte er amerikanische Komiker wie Charlie Chaplin, Buster Keaton oder Harold Lloyd. Aber er verkniff sich seine Bemerkung, denn er wollte keine Grundsatzdiskussion über historische Monumentalfilme mit Massenszenen und schwulstigen Handlungen versus amerikanischer Komiker führen. Und so sehr er davon überzeugt war, die besseren Argumente in der Hand zu haben, er wusste, dass schlussendlich Ernestine recht behalten würde.
Sichtlich zufrieden, dass Anton ihr nicht widersprach, hakte Ernestine sich bei ihm unter. Ein leichter Hauch von Pfefferminze, der die pensionierte Lateinlehrerin stets umgab, wehte in seine Nase. Anton war der Geruch vertraut. Er fand ihn angenehm, so wie er alles an seiner Untermieterin mochte.
Anton war Apotheker im Ruhestand. Vor einem Jahr hatte er die Leitung der Apotheke seiner Tochter Heide übergeben. Gemeinsam mit ihr und seiner Enkelin Rosa wohnte er direkt über dem Geschäft in der Kirchengasse. Die kleine Mansardenwohnung darüber hatte er an Ernestine Kirsch vermietet. Seit die beiden ein Wochenende am Semmering verbracht hatten, wo sie nicht nur Tango getanzt, sondern auch ein paar Morde aufgeklärt hatten, teilten sie sehr viel Zeit miteinander, womit Anton mehr als zufrieden war.
»Wollen wir den Abend bei einem Glas kühlem Weißwein ausklingen lassen, meine Liebe?«
»Furchtbar gern. Was halten Sie vom Café Ritter?«
»Eine hervorragende Idee.«
Das Kaffeehaus, das ursprünglich im ehemaligen Sommerpalais des Fürsten Esterhazy untergebracht worden war, übersiedelte vor rund fünfundvierzig Jahren an den jetzigen Standort, Ecke Amerlinggasse – Mariahilfer Straße. Es war eines der bevorzugten Kaffeehäuser der Schriftsteller Peter Rosegger und Ludwig Anzengruber gewesen. Anton schätzte es vor allem wegen der überbackenen Topfenpalatschinken, die der Koch mit in Rum eingelegten Rosinen verfeinerte. Das Lokal lag nur wenige Gehminuten von der Kirchengasse entfernt.
Auch wenn man es ihm nicht ansah – Anton war sein ganzes Leben lang hager gewesen –, so galt seine große Leidenschaft dem guten Essen und der Wiener Mehlspeisenküche. Während er ein Stück Apfelstrudel, einen Germknödel oder Husarenbusserl genoss, las er am liebsten den Sportteil diverser Tageszeitungen, wobei ihn vor allem die Fußballergebnisse interessierten. Im Café Ritter gab es beides: aktuelle Zeitungen und außergewöhnliche Mehlspeisen, weshalb Anton regelmäßig kam.
»Ich muss Ihnen beim Wein eine großartige Neuigkeit aus dem Haus der Rosensteins erzählen. Die habe ich bei meiner letzten Nachhilfestunde erfahren.« Ernestines runde Wangen glühten vor Begeisterung.
»Von den Rosensteins also …«, sagte Anton vorsichtig.
Er verbrachte gern seine Freizeit mit Ernestine, aber wenn sie den Namen des Süßwarenherstellers in den Mund nahm, hieß es auf der Hut zu sein. Nur zu gern gab die Familie Eintrittskarten für gesellschaftliche Ereignisse, die Herr Rosenstein lieber mied, an Ernestine weiter. Meist hatte Anton die Ehre, sie zu begleiten. Und weil er schlecht Nein sagen konnte, hatte er schon so manch seltsame Veranstaltung mit ihr erlebt.
»Die Familie macht heuer Urlaub im Süden. Ich habe Ihnen doch erzählt, dass Herr Rosenstein ein Haus am Meer geerbt hat, direkt neben dem ehemaligen Schloss von Ferdinand Maximilian, dem Bruder von unserem Kaiser Franz Joseph. Der Habsburger, der so tragisch in Mexiko verstarb.«
Anton hob die Augenbrauen. Auch noch fünf Jahre nach dem schrecklichsten Krieg aller Zeiten und dem Ende der Habsburgermonarchie sprachen die Österreicher von »ihrem Kaiser«. Selbst überzeugte Befürworter der neuen Republik, wie er und Ernestine, bildeten da keine Ausnahme. Es schien, als wäre der Kaiser tief in der österreichischen Volksseele verankert.
»Wie schön für die Rosensteins.«
»Ja, aber auch für uns, Anton! Sie haben mir diesmal Karten für eine ganz vortreffliche Vergnügungsfahrt vermacht, die sie aufgrund ihres Urlaubs nicht selbst nutzen können.«
Anton hielt abrupt an, und Ernestine stolperte beinahe.
»Warum bleiben Sie stehen?«, fragte sie empört und hielt sich an seinem Ellbogen fest, um nicht zu stürzen.
Anton bedachte sie mit einem besorgten Blick. »Liebste Ernestine, darf ich Sie daran erinnern, dass die Ausflüge, die wir anstelle der geschätzten Familie Rosenstein unternommen haben, jedes Mal in einem gefährlichen Abenteuer gemündet sind? Ich bin im Februar in wenigen Tagen um Jahre gealtert.«
Ernestine lachte. »Ach, Anton. Sie sind noch genauso jugendlich und frisch wie an dem Tag, an dem ich Sie kennengelernt habe. Und die kleine Narbe an Ihrer Schläfe verleiht Ihnen einen gewissen Hauch von Verwegenheit.«
Gegen seinen Willen errötete Anton. Er räusperte sich und griff sich an die Stirn, wo sich immer noch dieses kleine Andenken ihres letzten Unterfangens befand. Auch nach siebzehn Jahren schaffte Ernestine es, ihn mit ihren Bemerkungen in Verlegenheit zu bringen.
Langsam ging Anton weiter.
»Herr und Frau Rosenstein hatten vor, mit der ›Jupiter‹ nach Budapest zu fahren, um dort einen ungarischen Geschäftspartner zu treffen, aber dann kam die Sache mit dem Erbe dazwischen, und nun müssen sie ans Meer.«
»Hm.«
Die »Jupiter« war eines der modernsten und schnellsten Expresspersonendampfschiffe, das zwischen Passau und Giurgiu am Schwarzen Meer verkehrte. Vor dem Krieg hatte es den stolzen Namen des Kaisers getragen, danach hatte man es, wie vieles andere auch, rasch umbenannt. So war aus der »Wilhelm II« die »Uranus« und aus der »Franz Joseph I« die »Jupiter« geworden.
»Leider hatten die Rosensteins die Karten für die Schiffsfahrt auf der Donau bereits gekauft. Die DDSG ist nicht bereit, die Fahrscheine zurückzunehmen oder umzutauschen.«
»DDSG?«
»Ja, die Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft.«
»Dann sollte das Ehepaar die Reise wohl besser antreten.«
»Anton, ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass die Rosensteins in ihr Sommerhaus fahren müssen. Es gibt noch ein paar Fragen zu klären, bevor sie ihr Erbe antreten können. Auch die Kinder werden mitkommen.«
»Ernestine«, Anton wurde ernst und senkte seine Stimme, »mittlerweile glaube ich, dass die Familie Rosenstein vom Pech verfolgt ist.« Er hielt erneut an und überlegte kurz. Dabei legte sich seine hohe Stirn in Falten. »Oder sollte ich lieber sagen vom Glück? Schließlich haben sie selbst nie etwas von all den Aufregungen mitbekommen. Die Rosensteins haben sich den Tangotanzkurs erspart und die tödlich endende Vorstellung im Theater an der Wien.«
»Anton, also wirklich«, tadelte Ernestine im strengen Tonfall der Lateinlehrerin. »Sie werden im Alter doch nicht abergläubisch werden? Das wäre absolut lächerlich. Es war purer Zufall, dass wir zweimal über Todesfälle gestolpert sind.«
»Ich darf Sie daran erinnern, dass wir beide Male für das Ehepaar Rosenstein eingesprungen sind.«
»Das liegt daran, dass die Rosensteins in sehr interessanten Gesellschaftskreisen verkehren. Wir hätten uns nie das Wochenende im Panhans leisten können, und die Fahrt auf der ›Jupiter‹ ist ebenfalls ein kleines Vermögen wert.«
»Wenn interessante Gesellschaftskreise Menschen mit einem Hang zur Kriminalität sind, verzichte ich gern auf dieses Privileg. Ganz egal, wie viel die Karten auf der ›Jupiter‹ gekostet haben.« Seine Worte erinnerten ihn gerade an seine sechsjährige Enkelin. Rosa klang ähnlich trotzig, wenn sie sich weigerte, Fisolen zu essen.
»Sie werden den Schiffsausflug lieben, wenn Sie erfahren, was Sie dort erwartet.«
»Ein Walzerkurs zu den Arien einer Operettendiva?«
Ernestine ignorierte Antons bissige Bemerkung, die sich auf das Wochenende am Semmering und eine Premierenvorstellung im Theater an der Wien bezog.
»In Budapest werden wir das Café Gerbeaud besuchen. Sicher ist Ihnen bekannt, dass es dort die feinste heiße Schokolade nach Brüsseler Vorbild gibt.«
»Ich kann auch im Café Sacher oder beim Demel köstliche heiße Schokolade trinken!«
»Wenn das Gerbeaud Sie noch nicht überzeugen kann, dann das …« Ernestine machte eine dramatische Pause, die Anton jedoch nicht beeindruckte. »Nach einem mehrgängigen Abendessen werden die Luken des Salons am Schiff völlig verdunkelt und es wird ein Film gezeigt.«
»Ein Film?«
»Ja, einer der besten der letzten Jahre. Eine Sensation der expressionistischen Kunst.« Ernestine hob vor Begeisterung ihre Stimme. Eine Frau auf der anderen Straßenseite blieb stehen und schielte neugierig zu ihr. Etwas leiser fuhr Ernestine fort: »Raten Sie, Anton, um welchen Film es sich handelt.«
Anton machte einen Schritt rückwärts. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass Ernestines Ideen von guten Filmen nicht mit seinen übereinstimmten. Was würde er auf dem Schiff nach Budapest zu sehen bekommen? Ein Historienepos, eine dramatische Liebesgeschichte? Ihm wurde flau im Magen. Gerade noch war der Abend wundervoll gewesen, und jetzt musste er alle Register ziehen, um nicht wieder in eine Sache verstrickt zu werden, die sein ruhiges, beschauliches Leben durcheinanderbrachte.
»Ich weiß es nicht«, sagte er vorsichtig. »Verraten Sie es mir.«
»›Das Cabinet des Dr. Caligari‹«, platzte Ernestine hervor.
Es dauerte ein Weilchen, bis die Information zu Antons Gehirn durchsickerte. Eben noch hatte er sich gegen alle Schrecklichkeiten gewappnet, die es auf der Filmleinwand zu sehen gab, und nun nannte Ernestine den Titel eines Films, den er immer hatte sehen wollen. In allen deutschsprachigen Zeitungen hatten sich die Filmkritiker positiv über den Streifen geäußert und diesen mit wahren Lobeshymnen überschüttet.
»Sie meinen den Film über den wahnsinnigen Dr. Caligari, der mit Hilfe eines Schlafwandlers eine kleine Stadt in Angst und Schrecken versetzt?«
»Genau den! Der hochgelobte Film von Robert Wiene mit Conrad Veidt, Werner Krauß und der großartigen Lil Dagover in den Hauptrollen.« Auf Ernestines Gesicht lag der triumphierende Ausdruck einer Siegerin. »›Das Cabinet des Dr. Caligari‹ ist ein Meisterwerk expressionistischer Kunst. Der ganze Film wurde im Studio gedreht, die Kulissen von Künstlern gestaltet. Sogar die Lichter wurden aufgemalt.«
Anton musterte Ernestine von der Seite. »Haben Sie das Programmheft auswendig gelernt?« Etwas verlegen zuckte Ernestine mit den Schultern und neigte ihren Kopf, während Anton nachdenklich auf seiner Unterlippe kaute. »Ich habe es damals nicht geschafft, ins Lichtspieltheater zu gehen, als der Film gezeigt wurde. Immer ging die Arbeit in der Apotheke vor.«
»Ich weiß.« Vertraulich drückte Ernestine Antons Hand.
»Ich würde diesen Film wirklich sehr gern sehen«, gab Anton zu. Zu seinem Bedauern ließ Ernestine seine Hand wieder aus. Stattdessen hakte sie sich erneut bei ihm unter und zog ihn die Mariahilfer Straße entlang.
»Wir werden eine wundervolle Zeit an Bord der ›Jupiter‹ verbringen«, sagte sie zufrieden. Noch bevor Anton etwas erwidern konnte, fügte sie hinzu: »Denken Sie nur an all das gute Essen, das uns serviert werden wird, und an den Stadtrundgang in Budapest. Die Stadt soll ein kleines Juwel sein.«
»Ich weiß nicht …« Anton spürte, wie sein Widerstand langsam bröckelte.
»Heiße Schokolade nach Brüsseler Art, Anton, und Esterhazyschnitten«, schwärmte sie.
»Hm!«
»Beim Packen dürfen Sie auf keinen Fall Ihren Anzug vergessen. Der ist bei den Abendveranstaltungen verpflichtend, oder wollen Sie sich lieber gleich einen neuen zulegen?«
»Was, wieso?«, fragte Anton irritiert. Ein neuer Anzug? Er hatte ja noch nicht einmal zugestimmt.
Doch Ernestine schien das anders zu sehen. Für sie war der Ausflug nach Budapest bereits abgemacht.
Nachsichtig meinte sie: »Der Anzug war nur ein Vorschlag.«
»Ich kaufe ganz sicher keinen neuen Anzug«, murmelte Anton empört.
Mittlerweile waren sie beim Café Ritter angekommen, wo wegen des warmen Wetters kleine Tische und Stühle ins Freie gestellt worden waren. Neben einem zusammengeklappten Sonnenschirm entdeckte Ernestine die letzten freien Plätze. Rasch lief sie darauf zu und stellte besitzergreifend ihre Handtasche auf der Marmorplatte ab. Dann setzte sie sich. Kaum hatte auch Anton Platz genommen, kam schon Herr Franz, der Oberkellner des Cafés. Wie immer trug er einen Frack und wirkte genervt. Sein Gesicht war hochrot, Schweißperlen zeichneten sich auf seiner Stirn ab, und er schien außer Atem zu sein.
»’n schönen Abend, Herr Böck! Sie ham Glück, dass des Wetter so freindlich is, im Lokal geht’s zua wia im Gugelhupf.«
Herr Franz meinte damit Wiens älteste Irrenanstalt, den Narrenturm, der bereits von Maria Theresias Sohn Joseph II errichtet worden war. Das Gebäude war rund, weshalb die Wiener es liebevoll, wie die beliebteste Sonntagsjause, »Gugelhupf« nannten.
»Sind die Umbauarbeiten denn immer noch im Gange?«, fragte Anton besorgt. Seit Wochen wurde im Gästesaal des Cafés gehämmert, gesägt, gestrichen und tapeziert, was zu erheblichem Lärm und unangenehmer Staubbelastung führte.
»Angeblich soll nächste Woche ois fertig sein. Aber i glaub’s earst, wenn i’s seh. Hoffantlich bleibts Wetta so guad, sonst ham wir a echtes Problem.«
»Der Wetterbericht sagt, dass es in den nächsten Tagen sommerlich heiß werden soll«, meinte Ernestine. Sie beugte sich vertraulich zu Anton und fügte hinzu: »Das perfekte Wetter für eine Schiffsfahrt.«
Währenddessen wurde Herr Franz zu einem anderen Tisch gerufen. Mürrisch drehte er sich zu dem dicken Mann mit Schnurrbart und Brille. »Immer mit der Ruhe, der Herr. I bin ja ka Schnellzug.« Zu Anton und Ernestine sagte er freundlich: »Wie immer, Herr Böck?«
»Ja, bitte. Und zwei Gläser vom Grünen Veltliner!«
»Sehr gern. Darf’s für die Dame auch was Süßes sein?«
»Nein, danke. Ich muss auf meine Linie achten.« Ernestine zog ihren Bauch ein. Seit sie so viel Zeit mit Anton verbrachte, waren ihre Rundungen noch üppiger geworden.
Herr Franz lächelte charmant. »Aber gehns.«
Der dicke Herr am Nachbartisch wurde unruhig und begann zu schimpfen, worauf Herr Franz dem ungeduldig winkenden Gast demonstrativ den Rücken zudrehte.
»Glaubt der wirklich, dass i wegen der Schreierei schneller werd?« Verständnislos schüttelte er den Kopf.
Er lief schnurstracks in die Küche, um Antons Bestellung abzugeben, und ließ den Mann mit Schnurrbart warten. Der starrte ihm irritiert nach, resignierte schließlich und lehnte sich wieder in seinen Stuhl zurück. Es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass in Wiener Kaffeehäusern die Kellner das Tempo bestimmten und nicht die Gäste. Je gelassener man diese Tatsache hinnahm, umso zügiger wurde man bedient.
Als Herr Franz außer Hörweite war, fragte Ernestine erstaunt: »Essen Sie nun wirklich Topfenpalatschinken zum Weißwein?«
»Ja, warum nicht? Und wenn Sie mir versprechen, nicht weiter von neuen Anzügen zu reden, gebe ich Ihnen ein paar Bissen davon ab.«
»Versprochen.« Ernestine grinste. »Das heißt, wir fahren mit der ›Jupiter‹?«
»Ich denke schon.« Anton gab sich geschlagen.
ZWEI
»Opa, sieh nur, da hinten kommt das Schiff!«
Aufgeregt hüpfte die sechsjährige Rosa neben Anton auf und ab, stellte sich auf die Zehenspitzen und zeigte flussaufwärts, wo am Horizont ein tief im Wasser liegendes weißes Dampfschiff erkennbar wurde. Aus einem leicht schräg stehenden Rauchfang, der im Unterschied zum Rest des Schiffes dunkelgrün gestrichen war, stiegen helle Rauchwolken in den milchigen Morgenhimmel. Der Tag war noch jung. Als Anton und Ernestine vor einer Stunde aus der Kirchengasse aufgebrochen waren, war die Sonne gerade erst über den Dächern der Stadt aufgegangen. Dennoch war es bereits ungewöhnlich warm. Ein weiterer brütend heißer Sommertag kündigte sich an.
»Ich dachte, dass die DDSG mittlerweile über Motorschiffe verfügt«, bemerkte Heide nachdenklich.
Antons Tochter Heide und seine Enkeltochter hatten es sich nicht nehmen lassen, sie zum Landeplatz bei der Reichsbrücke zu begleiten. Der Hafen lag ohnehin auf ihrem Weg. Die beiden wollten später weiter Richtung Alte Donau zum Gänsehäufel, dem größten und modernsten Strandbad der Stadt, das sich auf einer Insel im Altarm der Donau befand. Hatten die Wiener vor ein paar Jahren noch in den Strombädern am Donaukanal nach Erfrischung gesucht, taten sie es nun in den großen Freibädern am anderen Donauufer.
»Ich habe gelesen, dass die DDSG ein paar Motorschiffe besitzt, aber der Stolz der Gesellschaft sind nach wie vor die großen Luxuspersonendampfer«, antwortete Ernestine auf Heides Frage. Mit vor Aufregung geröteten Wangen schaute sie auf den Dampfer, der sich langsam der breiten Anlegestelle näherte. Das Gelände, auf dem sie standen, war über Jahrhunderte hinweg weitgehend unbewohnt gewesen. Die Donau hatte sich ihren Weg durch eine naturbelassene Landschaft gebahnt, in der Fischer einfache Holzhütten aufgebaut hatten. Seit der Donauregulierung wurden auch hier zahlreiche neue Wohnhausanlagen errichtet, und die Gegend gehörte längst nicht mehr zu den dünn besiedelten der Stadt. Sogar eine Kirche, die man Franz von Assisi geweiht hatte, befand sich hier. Das imposante Gebäude dominierte den Volkswehrplatz.
»Opa, ich würde so gern mitkommen«, jammerte Rosa. »Eine Reise auf einem so schönen weißen Schiff ist sicher aufregend.«
»Ich verspreche, dass ich dir in drei Tagen alles ganz genau erzählen werde. Wenn es wirklich so viel Spaß macht, dann buchen wir demnächst eine Fahrt nach Dürnstein. Die Ausflugsschiffe starten vor der Urania. An einem Tag kann man bis Dürnstein und wieder zurück fahren.«
»Ist die Urania die Sternwarte?«
Anton nickte. Worauf Rosa ihre von der Sonne gebräunten Arme um Antons Hüften legte und schwärmte: »Das wird bestimmt wunderschön.« Ihre ungebremste Freude ließ Antons Herz schneller schlagen. Ganz egal, was er nach dieser Reise über die Schiffsfahrt denken mochte, er würde einen Tagesausflug mit Rosa machen.
»Und bis es so weit ist, lernst du schwimmen.« Heide tippte mit ihrem Zeigefinger auf den Korb, der mit Handtüchern, Jausenbroten und Limonade gefüllt war, und erinnerte Rosa daran, was sie heute vorhatten. Der Sonntag war für Heide der einzig freie Tag in der Woche, und den wollte sie gemeinsam mit ihrer Tochter verbringen. Letzte Woche hatte Rosa bereits ein paar Schwimmzüge allein bewältigt und sich selbstständig über Wasser gehalten. Dieses Können galt es heute zu perfektionieren.
»Eine tolle Idee«, sagte Anton begeistert.
Heide war wie so viele junge Frauen im letzten Jahr des Krieges Witwe geworden. Nach Jahren der Trauer fand sie nun langsam wieder ins Leben zurück. Seit einigen Monaten traf sie sich regelmäßig mit Erich Felsberg, einem ehemaligen Schüler von Ernestine, den sie im Februar kennengelernt hatte. Der Kriminalbeamte wollte am Nachmittag, sobald sein Dienst zu Ende war, ins Bad nachkommen.
»Ich frage mich, ob es nicht viel effizienter wäre, wenn man alle Schiffe umrüsten und nur noch mit Motorschiffen die Donau befahren würde. Schließlich hat Österreich seine Kohlereserven im Krieg verloren.« Ernestine hatte das Gespräch der drei nicht mitverfolgt. Sie dachte immer noch über die Vor- und Nachteile von Dampfschiffen nach und war in Gedanken ganz bei der DDSG.
»Die Kohle wird nicht der einzige Luxus auf dem Schiff sein.« Heide bestaunte den glänzenden Dampfer mit einer Mischung aus Bewunderung und Abneigung.
Oder war es Neid? Anton warf seiner Tochter einen prüfenden Blick von der Seite zu. Unter ihren Augen lagen dunkle Ringe. Sie schlief eindeutig zu wenig und arbeitete zu viel. Trotz der Müdigkeit in ihrem Gesicht war sie eine äußerst attraktive Frau. Rosa würde eines Tages genauso hübsch werden. Sie hatten beide große Ähnlichkeit mit Antons Frau, die leider schon kurz nach Heides Geburt verstorben war. Er nahm sich vor, Heide in den nächsten Wochen erneut wegen einer zusätzlichen Arbeitskraft anzusprechen. Bis jetzt hatte Heide eine Mitarbeiterin abgelehnt, aus Kostengründen. Doch Anton glaubte, dass sie sich den Lohn einer Apothekengehilfin leisten konnten.
Er kam nicht dazu, weiter darüber nachzudenken, denn seine Aufmerksamkeit wurde von einem unangenehmen Geräusch abgelenkt. Es erinnerte Anton an Fingernägel, die über eine Tafel gezogen wurden. Irritiert blickte er sich um. Eine Gruppe Reisender ging am kleinen Café vorbei, in dem ein paar Hafenmitarbeiter beisammenstanden und hastig eine Tasse Kaffee hinunterstürzten. Das Quietschen, das nun lauter wurde, stammte von den Rädern eines Rollstuhls, den eine junge Frau vor sich herschob. Ein alter Mann saß darin. Sie mühte sich mit der schweren Last ab, die sich nur schwerfällig über den geschotterten Kiesweg bewegte. Ihr Gesicht war von der Anstrengung gerötet, die Zöpfe, die zu einem kunstvollen Kranz um ihren Kopf gelegt waren, lösten sich. Trotzdem sah keiner der beiden Männer, die neben ihr gingen, sich genötigt, ihr zu helfen. Ebenso wenig die elegant gekleidete Frau, die auch zur Gruppe gehörte und in einigem Abstand folgte. Der alte Mann hatte trotz der schwülen Sommerhitze eine dicke, karierte Wolldecke über seinen Beinen liegen. Er trug einen schwarzen Anzug, ein akkurat gebügeltes Hemd und einen auffallenden roten Seidenschal. Sein weißes Haar war schulterlang und ungewöhnlich dicht für sein Alter. Die Männer neben ihm sahen aus wie zwei jüngere Ausgaben von ihm. Ihre edlen, maßgeschneiderten Anzüge mussten ein kleines Vermögen gekostet haben. Der kleinere und schmalere der beiden erinnerte Anton an einen der deutschen Schauspieler aus den Liebesfilmen, die Ernestine so gern sah. Sein blondes Haar war zu einer kunstvollen Rolle drapiert, die dank einer Ladung Brillantine nicht verrutschte.
Anton schaute verstohlen an sich selbst herab. Er hatte sich heute Morgen für eine leichte, helle Hose, ein einfaches, bequemes Hemd, ein luftiges Sakko und seinen Strohhut entschieden; schließlich würde er an Deck des Schiffes der prallen Sonne ausgesetzt sein. Jetzt überkamen ihn erste Zweifel, ob diese Wahl die richtige gewesen war. Zum Glück hatte Heide darauf bestanden, Ernestines Rat zu befolgen, und ihm gestern Abend noch den feinen Anzug in den Koffer gepackt.
»Jetzt ist das Schiff gleich da.« Rosa sprang aufgeregt von einem Bein auf das andere.
Tatsächlich war die »Jupiter« nur noch einige Meter von der Anlegestelle entfernt. Das regelmäßige Stampfen der schweren Maschinen wurde immer lauter. Mehrere Matrosen in dunklen Hosen, weißen Hemden und blauen Schirmmützen am Kopf standen an Deck. Fasziniert beobachtete Anton, wie der riesige Dampfer präzise auf sie zusteuerte, so als handle es sich um ein einfaches Ruderboot und nicht um ein tonnenschweres Ungetüm, das von einer Dampfmaschine angetrieben wurde. Die Drehbewegungen der beiden Schaufelräder, die sich seitlich am Rumpf befanden, wurden langsamer. Wasser spritzte auf den Kai. Der Rauch verbrannter Kohle drang in Antons Nase, er musste husten. Auf dem Landungssteg warteten bereits Hafenmitarbeiter. Gerade als einer der Matrosen auf der »Jupiter« ein dickes Seil zu einem der Männer an Land warf, nahm Anton ein lautes Brummen hinter sich wahr. Mit einem regelmäßigen Knattern fuhr ein schwarzes Automobil, ein Steyr II der OEWG, der Österreichischen Waffenfabriks-Gesellschaft, in den Hafen ein und hielt nur wenige Meter entfernt von ihnen an. Die Wagentür wurde aufgestoßen, und ein dicker Mann mit Glatze und einem mächtigen Schnurrbart stieg aus. Er stützte sich auf einen Gehstock mit einem goldenen Knauf. Hinter ihm kletterte zuerst eine zierliche Dame heraus, deren Gesicht von einem Hut mit Schleier verdeckt war, danach eine modern gekleidete junge Frau. Sie trug eine auffallende Ledermappe unter dem Arm.
Auch der Chauffeur verließ den Wagen, umrundete ihn und hievte drei riesige Gepäckstücke aus dem Kofferraum. Laut krachend stellte er sie am Kai ab.
»So passen Sie doch auf«, herrschte der Dicke den Chauffeur ungehalten an.
»Opa, was haben die Leute denn in den großen Koffern?« Rosa starrte neugierig zu den Reisenden.
Ratlos schüttelte Anton den Kopf. »Vielleicht übersiedeln sie nach Budapest?«
»Oder sie haben für jede Gelegenheit die passende Kleidung eingepackt.« Heide grinste. »Genau wie du, Papa!«
Anton räusperte sich verlegen, und Ernestine beugte sich zu ihm. »Anton, machen Sie sich keine Gedanken. Ein Mann von Welt strahlt auch im einfachsten Anzug eine natürliche Eleganz aus.«
»Meinen Sie?« Noch vor Kurzem hatte Ernestine ihn dazu überreden wollen, einen neuen Anzug zu kaufen.
»Ganz gewiss, mein Lieber.«
Rosa legte noch ein weiteres Kompliment nach. »Opa, du bist der eleganteste Herr, den ich kenne«, sagte sie voller Überzeugung und drückte liebevoll seine Hand.
Mittlerweile hatte die »Jupiter« fertig angelegt. Anton hatte verpasst, wie sie zum Stillstand gekommen war. Jetzt wurde eine schmale Metallleiter ausgefahren, über die die Gäste aufs Schiff gelangen konnten. Schon marschierte der dicke Mann mit dem Gehstock darüber. Er fuchtelte mit seinem Stock und wies einen der Matrosen an, seine Koffer zu holen.
Anton wandte sich Heide zu und verabschiedete sich. Sie umarmte ihn und küsste ihn auf beide Wangen.
»Ich wünsche euch eine wunderschöne Fahrt, genießt die Tage auf der Donau.«
Rosa klammerte sich an Antons Oberschenkel fest, als würde er zu einer wochenlangen Reise aufbrechen und nicht bloß drei Tage auf der »Jupiter« verbringen. »Mach’s gut, Opa.«
»Fräulein Kirsch, passen Sie auf, dass Papa nicht zu viele Esterhazyschnitten auf einmal isst.« Heide zwinkerte Ernestine zu.
»Ich werde mein Bestes geben.« Ernestine wandte sich an Rosa. »Und du, kleines Fräulein, siehst zu, dass du bei unserer Rückkehr richtig schwimmst, damit du mich im Winter zum Baden begleiten kannst.«
»Sind Sie immer noch Mitglied in diesem verrückten Verein ›Verkühle dich täglich‹?«, fragte Anton verständnislos. Er wusste, dass Ernestine regelmäßig zum Eisschwimmen bei der Aspernbrücke ging.
»Selbstverständlich«, sagte Ernestine stolz. »Sie sollten es unbedingt auch einmal versuchen.«
»Gott bewahre.« Anton stöhnte. »Ich hacke ganz sicher keine Eisdecke auf und springe bei Minusgraden ins Wasser. Ich stehe bestenfalls mit einer warmen Decke und einer Thermoskanne mit heißem Tee daneben und achte darauf, dass niemand erfriert.«
»Ich komm mit«, rief Rosa begeistert.
»Aber zuerst solltest du dich mehr als fünf Tempi lang über der Wasseroberfläche halten, Liebes.« Heide lachte.
Anton nahm seine kleine Reisetasche, und Ernestine schnappte ihren winzigen Koffer.
»Viel Spaß, Opa!« Rosa ließ von ihm ab und zog ein geblümtes Taschentuch aus ihrer Rocktasche, mit dem sie nun fröhlich winkte.
Beherzt erklomm Ernestine die Leiter, Anton folgte ihr etwas zögerlich. Obwohl das Schiff fest angeleint war, schwankte es sanft.
»Leiden Sie unter Seekrankheit?«, erkundigte sich Ernestine.
»Ich hoffe nicht. Passen Sie auf, meine Liebe. Die Leiter ist schmal.«
»Keine Angst, Anton. Ich bin absolut schiffstauglich. Als Kind bin ich mit meinem Großvater bis ans Schwarze Meer gefahren. Er hat als Heizer auf der ›Europa‹ gearbeitet, ich habe ihn mal als blinder Passagier begleiten dürfen.«
»Sie waren als Kind ein blinder Passagier?« Ernestine erstaunte ihn immer wieder aufs Neue.
Ernestine kicherte. »Ja, es war sehr aufregend. Die Heizer mussten wegen ihrer schmutzigen Kleidung in den hintersten Kabinen auf der Schiffsaußenseite wohnen. Dort hat sich nie jemand hin verirrt, weshalb ich völlig unbemerkt geblieben bin.«
»Aber, warum –«
Weiter kam Anton nicht, Ernestine vertröstete ihn. »Das ist eine lange Geschichte, die ich Ihnen ein anderes Mal erzähle. Jetzt müssen wir unsere Fahrkarten herzeigen.«
Am Ende der Leiter erwartete sie ein Mann in dunkelblauer Uniform. Er trug einen imposanten Schnurrbart, dessen Enden kunstvoll zu kleinen Schnecken gerollt waren.
»Guten Tag. Mein Name ist Herbert Neumeier, ich bin der zweite Kapitän und darf Sie ganz herzlich an Bord der ›Jupiter‹ begrüßen. Kann ich bitte Ihre Karten sehen?«
Bevor Anton fragen konnte, warum es zwei Kapitäne auf dem Schiff gab, überreichte Ernestine die Fahrkarten.
»Sie sind Herr und Frau Rosenstein?«, fragte Neumeier. Seine Stimme war tief und melodiös wie die eines Operettensängers.
»Nein, ich bin Ernestine Kirsch, ehemalige Lateinlehrerin, und das ist Herr Anton Böck, Apotheker im Ruhestand.«
Ein großes Fragezeichen machte sich auf Neumeiers Gesicht breit.
»Frau Rosenstein hat mir die Karten überlassen, weil sie mit ihrer Familie am Meer urlaubt.«
Neumeier schien immer noch nicht zu begreifen. Er tastete nach seiner rechten Schnurrbartschnecke und drehte sie vorsichtig um seinen Zeigefinger.
»Gibt es irgendein Problem?«, mischte sich Anton ein.
»Das kommt ganz darauf an«, sagte Neumeier vorsichtig. »Ich nehme an, Sie wissen, dass das Ehepaar Rosenstein eine Kabine für zwei gebucht hat.«
»Wenn ich recht informiert bin, verfügt die ›Jupiter‹ über zweiunddreißig Kabinen mit dreiundsiebzig Betten sowie einen Schlafraum mit achtundvierzig weiteren Betten. Es wird doch möglich sein, zwei getrennte Betten für uns aufzutreiben.«
»Haben Sie die Broschüre über unser Schiff auswendig gelernt?«, fragte Neumeier sichtlich beeindruckt.