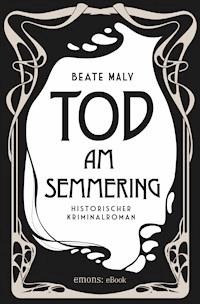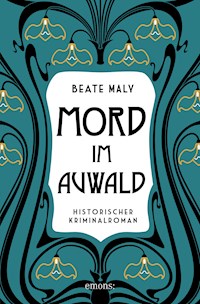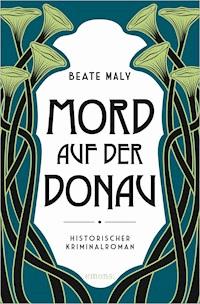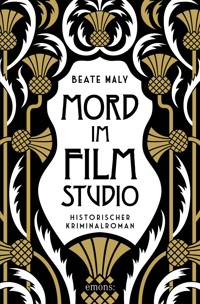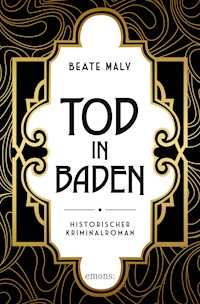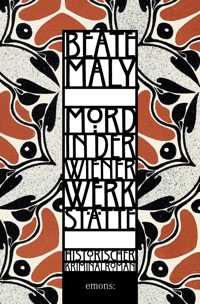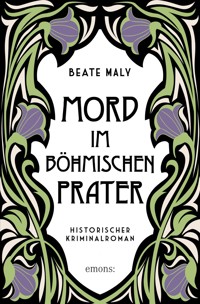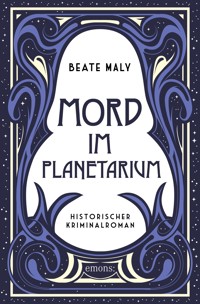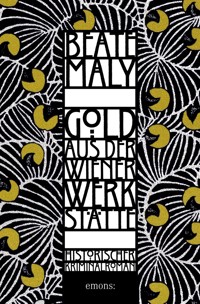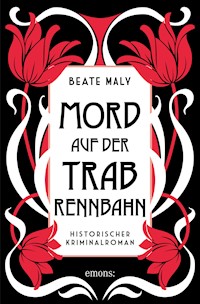10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ernestine Kirsch und Anton Böck
- Sprache: Deutsch
Vorhang auf für einen Mord! Wien, 1923. Während die Ballsaison in vollem Gange ist, stirbt Operettendiva Hermine Egger unter ungeklärten Umständen. War es ein Unfall – oder steckt mehr dahinter? Die pensionierte Lehrerin Ernestine Kirsch glaubt nicht an Zufälle und beginnt gemeinsam mit ihrem Freund Anton Böck zu ermitteln. Inmitten des Faschingstreibens stoßen sie auf Intrigen, Eitelkeit und gefährliche Geheimnisse hinter der Bühne des traditionsreichen Operettentheaters. »Tod an der Wien« von Beate Maly verbindet klassische Spannung mit historischem Flair – eine charmante Hommage an die Goldenen Zwanziger in Wien. Begleiten Sie Ernestine und Anton auf ihren zweiten Fall – ein Krimivergnügen voller Esprit, Rätselspaß und einer Prise Nostalgie! Band 2 der Reihe »Ernestine Kirsch und Anton Böck«. Alle Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Beate Maly wurde 1970 in Wien geboren, wo sie bis heute mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt. Zum Schreiben kam sie vor rund zwanzig Jahren. Zuerst verfasste sie Kinderbücher und pädagogische Fachbücher. Seit zehn Jahren widmet sie sich dem historischen Roman und seit »Tod am Semmering« auch dem Kriminalroman.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Lunetskaya
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Christine Derrer
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-286-1
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.
Maria Montessori
PROLOG
Wien 1900
Eisig kalter Januarwind pfiff erbarmungslos durch die Ritzen der hölzernen Fensterrahmen und brachte die verschneiten Glasscheiben zum Zittern. Die Schlafsäle der Schüler waren die einzigen Räume im gesamten Schulgebäude, die trotz der dramatischen Temperaturen nicht geheizt wurden. Es gab auch keine Zusatzdecken auf den schmucklosen Stahlrohrbetten, die Schutz gegen die klirrende Kälte geboten hätten. Sommer wie Winter lagen dieselben dünnen Stoffstücke auf den harten Rosshaarmatratzen. Das Material fühlte sich kratzig, rau, im Moment auch klamm und steif an. Die meisten Schüler hatten sich vollständig darunter verkrochen und schliefen.
Trotz der Müdigkeit, die in seinen Knochen steckte, lag Scipio wach im Bett und rieb seine nackten Füße geräuschlos gegeneinander, jedoch ohne Erfolg, sie blieben kalt.
Sorgenvoll warf er einen Blick zu seinem Freund, der im Bett neben ihm lag. Auch er fand keinen Schlaf und wälzte sich von einer zur anderen Seite. Ein gefährliches Unterfangen, denn es war den Burschen strengstens untersagt, sich im Bett zu bewegen. Sobald das Licht im Schlafsaal abgedreht war, mussten alle regungslos liegen, egal, ob ihr Körper eine entspannende Position für einen erholsamen Schlaf gefunden hatte oder nicht.
Nur so konnte Professor Johanni sicher sein, dass niemand »auf dumme Gedanken kam«, wie er es nannte. Wer gegen seine Vorschrift verstieß, den erwarteten drakonische Strafen. Erst gestern musste Laelius fünf Minuten lang unter der eiskalten Dusche verharren, bevor er nass ins Bett zurückkehren durfte. Wegen seines Fiebers war er am Gang zusammengebrochen und dort die ganze Nacht liegen geblieben, bis er kurz vor Sonnenaufgang den Weg ins Bett geschafft hatte.
Scipio hatte es nicht bemerkt, er hatte geschlafen. Jetzt fühlte er sich schuldig. Er hätte seinem Freund beistehen müssen. Heute Nacht würde ihm das nicht noch einmal passieren. Deshalb versuchte er, wach zu bleiben.
Sobald Maria Christina, die Krankenschwester, wieder im Internat war, würde sie dafür sorgen, dass Laelius auf die Krankenstation gebracht wurde. Aber im Moment war sie bei ihrer Familie am Land, und so lange waren die Schüler Johanni ausgeliefert. Scipio musste sich um seinen Freund kümmern.
Wenn Laelius doch nur aufhören würde zu husten. Professor Johanni bestrafte jede Art des Lärms. Die Schlafraumtür stand weit offen. Vom Gang drang das flackernde Licht zweier kleiner Gaslaternen herein. Sie brannten auch nachts. Nicht, um den Schülern die Angst vor der Dunkelheit zu nehmen, sondern um den diensthabenden Lehrern die Kontrolle ihrer Schützlinge zu erleichtern.
Professor Johanni nächtigte in der Kammer neben dem Schlafsaal. Auch seine Tür stand einen Spaltbreit offen, und sobald er das geringste Geräusch wahrnahm, sprang er auf und kam herüber, um den Übeltäter zu bestrafen. In manchen Nächten geschah gar nichts, dann schlief der Lehrer, ohne ein einziges Mal aufzustehen. In anderen schien er nur darauf zu warten, jemanden aus dem Bett zu ziehen.
Scipio hoffte, dass heute eine jener Nächte war, in denen Johanni schlief.
Er zog seine klamme Decke über seine mittlerweile gefühlslose Nase. Der Stoff stank nach billiger Seife und Flohpulver. Als er die Augen schloss, hörte er Laelius erneut husten. Am liebsten hätte Scipio ihm ein Tuch in den Mund gestopft, damit er damit aufhörte. Jetzt setzte der Freund sich sogar auf, um erneut zu husten. Es war ein trockenes, heiseres Geräusch, das schmerzvoll klang und tief aus seinen Lungen zu drängen schien. Endlich hörte er wieder auf. Erschöpft ließ sich der Kranke zurück in das harte Kissen sinken. Die Stäbe des Stahlrohrbettes knarrten.
Oh nein, dachte Scipio. Er wollte den Freund festhalten und an weiteren Bewegungen hindern. Sein Herz schlug schneller, angstvoll starrte er auf die offene Tür. Noch hatte sich nichts verändert. Der Gang war leer. Er zählte bis zehn. Wenn Professor Johanni bis dahin nicht erschien, war die Gefahr vorerst gebannt. Scipio lauschte angestrengt und beobachtete den hellen Lichtstreifen neben der Tür. Waren das die schlurfenden Schritte, mit denen der Lehrer über den Flur schlich? Scipio schloss die Augen und hielt sie nur einen Spaltbreit offen, in der Hoffnung, dass der Professor fest schlief.
… sechs, sieben, acht, neun …
Schon stand die verhasste dunkle Silhouette von Johanni im Türrahmen. Scipio konnte sein Gesicht im Gegenlicht nicht erkennen, aber das brauchte er auch nicht. Die grauen Augen und die vollen Lippen waren ihm bestens vertraut. Auf den ersten Blick wirkte der Lehrer liebenswürdig, vielleicht sogar gütig, aber Scipio kannte seinen wahren Charakter. Der Mann mit dem gebügelten Schlafanzug und dem akkurat gescheitelten Haar duldete keine Ausnahmen und bestrafte Vergehen mit eiserner Härte. Geräuschlos ging er durch den Korridor zwischen den Betten. Der Schlafsaal war kahl. Nackte weiße Wände, Stahlrohrbetten und Nachtkästen, die man nicht versperren konnte, sodass die Lehrer jederzeit nachschauen konnten, was die Schüler darin aufbewahrten. Jegliche Form von Privatsphäre war hier unerwünscht. Johanni blieb vor Laelius’ Bett stehen. Mit einem einzigen raschen Ruck zog er stumm die dünne Decke von Laelius’ Körper. Johanni sprach kein Wort. Das tat er im Schlafsaal nie, denn er wollte die anderen nicht wecken. Laelius zitterte, seine Zähne schlugen so laut gegeneinander, dass das Geräusch bis zu Scipio drang.
Jeder Schüler wusste genau, was er zu tun hatte, wenn Professor Johanni die Bettdecke wegzog. Dann hieß es, sich leise zu verhalten, denn sollte einer der anderen Schüler aufwachen, würden aus fünf Minuten unter der Dusche zehn werden.
Laelius schniefte, wischte mit dem Handrücken über seine Nase und setzte sich auf. Scipio hoffte inständig, dass er nicht weinte. Schwäche zu zeigen war gefährlich und stachelte Professor Johanni zu weiteren Gemeinheiten an. Seit einiger Zeit hatten Scipio, Laelius und ein paar andere der Klasse damit begonnen, einander mit fiktiven Namen anzusprechen, sobald sie unter sich waren. Ihre erfundene Identität suggerierte ihnen das Gefühl, vor dem Spott der Lehrer geschützt zu sein. Leider funktionierte das nicht immer.
Laelius stand auf, wankte und hustete erneut. Mit weichen Knien ging er vor dem Lehrer her und verließ den Raum. Mit seinen siebzehn Jahren war er um einen halben Kopf größer als der Professor. Auch wenn Laelius schmale Schultern hatte, so verfügte er, wenn er gesund war, über außerordentlich viel Kraft und Ausdauer. Scipio wusste das, er trainierte regelmäßig mit ihm und kannte den makellosen Körper seines Freundes. Doch körperliche Stärke nutzte in dieser Schule niemandem. Professor Johanni besaß die Macht, jeden einzelnen Schüler wegen eines noch so lächerlich erscheinenden Vergehens aus der renommierten Eliteschule zu werfen.
Das Johannesgymnasium war eine Bildungseinrichtung, die nur von den Söhnen der einflussreichsten und wohlhabendsten Männer der Monarchie besucht wurde. Ein Rauswurf war ein unvorstellbarer Skandal, der zu Klatsch und Tratsch führte und einer Familie Schande bereitete. Es kam einem gesellschaftlichen Suizid gleich. Die Erziehungsmaßnahmen hier wurden nicht nur geduldet, sondern von den Eltern, vornehmlich den Vätern, ausdrücklich gewünscht. Die spätere Elite des Reiches musste rechtzeitig lernen, was Anstand und Gehorsam bedeuteten, denn nur so konnte die Doppelmonarchie auf Dauer bestehen. Wie sollte man von Wien aus die Völker auf dem Balkan kontrollieren, wenn die eigenen Männer keine Disziplin an den Tag legten?
Scipio sah, wie der letzte Zipfel des grau karierten Morgenmantels aus dem Türrahmen verschwand. Johanni trug in seiner Rechten den verhassten Rohrstock, mit dem er gnadenlos zuschlug. Das trockene Husten seines Freundes hallte am Gang wider. Scipio musste ihnen folgen. Auch wenn er damit Strafen riskierte. Er konnte nicht zulassen, dass Laelius eine weitere Nacht frierend am Gang lag. Er wäre nicht der erste Schüler, der die Schule nicht lebend verließ. Erst im letzten Herbst war Marius aus einem der Fenster gesprungen, weil er dem Druck nicht mehr hatte standhalten können. Johanni hatte ihn vor der gesamten Schule mehrfach bloßgestellt und ihn nicht nur mit körperlichen Strafen drangsaliert, sondern ihn erniedrigt, gedemütigt und schließlich gebrochen. Das alles, weil er heimlich politische Schriften gelesen hatte. Marius hatte sich seinen Eltern anvertraut, aber sein Vater hatte ihn als Feigling und Schwächling beschimpft und Johanni die Erlaubnis erteilt, noch härter zuzugreifen, wenn es notwendig sein sollte. Eine Woche später war Marius gesprungen. Laelius hatte seinen zerschmetterten Körper im Schulhof gefunden.
Der Tod war für die Familie eine Schmach gewesen. Offiziell hatte man von einem Unfall gesprochen. Marius’ Vater hatte sich geweigert, dem Begräbnis seines Sohnes beizuwohnen. Es hatte heimlich und ohne große Zeremonie oder die Ansprache eines Priesters am Zentralfriedhof stattgefunden. Für Selbstmörder war im Himmel der katholischen Kirche kein Platz.
Marius’ Schulkollegen war die Teilnahme an der Beisetzung verweigert worden. Sie hatten sich von ihrem Freund nicht verabschieden dürfen. Erst in den Sommerferien waren Scipio und Laelius heimlich zum Friedhof gefahren und hatten nach dem schmucklosen Grab gesucht. Scipio hatte einen Bund Rosmarin neben den Grabstein gelegt. Es war Marius’ Lieblingsgewürz gewesen.
In diesem Sommer hatten er und Laelius sich geschworen, dass sie es nicht zulassen würden, dass Johanni einen von ihnen in den Tod trieb. Sie wollten einander beistehen, und deshalb musste Scipio jetzt die Decke zur Seite schieben. Bis auf leises, regelmäßiges Atmen, Schnarchen und den pfeifenden Wind war nichts im lang gestreckten Schlafsaal zu hören. Alle schliefen mehr oder weniger fest. Scipio setzte die nackten Füße auf den eisig kalten Fliesenboden. Er konnte keine Schuhe anziehen, die Sohlen würden zu viel Lärm verursachen, und Hausschuhe waren den Schülern nicht erlaubt. Niemand sollte sich hier wohlfühlen.
Vorsichtig schlich er zur Tür. Der Schlafsaal befand sich am Ende einer Galerie im zweiten Stock des über zweihundert Jahre alten Gebäudes, es war kurz nach der zweiten Türkenbelagerung Wiens entstanden. Am anderen Ende lagen die nachträglich eingebauten Waschräume und die Toiletten. Das Internat verfügte über Fließwasser.
Laelius und Johanni hatten die Nassräume beinahe erreicht. Zwei schmale Wendeltreppen führten an beiden Seiten des Korridors hinab in die Halle, die manchmal für Festreden genutzt wurde. Eine Büste sowie ein Gemälde des Kaisers und seiner vor zwei Jahren verstorbenen Gemahlin Sissi befanden sich dort neben einem Kupferstich, der Fürst Metternich zeigte. Neben jedem Treppenabgang stützte eine breite, wenig dekorative Säule die Decke. Wenn Scipio sich geschickt verhielt, konnte er sich dort verstecken und warten, bis sein Freund wieder im Bett war, oder ihm helfen, wenn das notwendig werden sollte.
Sobald Laelius und Professor Johanni im Waschraum verschwunden waren, lief Scipio los. Die zwei Gaslampen warfen gruselige Schatten auf den schwarz-weiß gemusterten Fliesenboden und ließen das Muster wie tanzende Trolle erscheinen. Scipio versuchte den Figuren keine Beachtung zu schenken, aber es gelang ihm nicht. Bei jedem Schritt trat er einem Troll ins Gesicht. Keuchend und mit klopfendem Herzen erreichte er endlich die Säule. Mit vor Aufregung feuchten Händen versteckte er sich schnell dahinter.
Aus dem Waschraum hörte er bereits das Plätschern des Wassers. Es war ihm, als spürte er selbst die eiskalten Tropfen. Wie winzige Nadeln bohrten sie sich in seine Haut, klatschten auf seinen Kopf, liefen über seinen Körper. Scipio schauderte. Er zählte in Gedanken langsam bis sechzig. Die erste Minute war überstanden. Sie erschien ihm endlos. Verzweifelt begann er erneut zu zählen, wurde aber jäh unterbrochen. Aus dem Waschraum drang ein dumpfes Geräusch.
Laelius! Er musste gestürzt sein, genau wie Scipio befürchtet hatte. Das Wasser plätscherte weiter. Warum stellte Professor Johanni es nicht ab? Wollte er seinen Freund umbringen?
Scipio musste nachsehen. Egal, welche Konsequenzen auf ihn warteten. Er stürzte in den Waschraum. Sein Blick fiel auf Laelius. Der Freund kauerte zitternd auf dem weißen Fliesenboden. Er war nackt, seine Lippen blau. Die weißen Zähne schlugen in einem fort gegeneinander. Auf seiner rechten Schläfe befand sich eine blutende Platzwunde. Eine dünne rote Linie zog sich zu seinem Kinn. Das Blut floss in einem feinen Rinnsal über seinen hellen Körper, vermischte sich mit dem Wasser und hinterließ auf dem weißen Fliesenboden eine rötliche Spur.
»Warum überrascht es mich nicht, Sie hier zu sehen?«, sagte Professor Johanni unbeeindruckt.
Es schien, als würde er sich freuen, noch einen Schüler bestrafen zu können. Hatte er damit gerechnet, dass Scipio seinem Freund helfen würde? Oder hatte er zuvor bemerkt, dass er gar nicht geschlafen hatte?
Der Lehrer stand neben der Dusche, hielt den Rohrstock in der rechten Hand und klatschte ihn drohend in die offene linke Handfläche.
»Der Retter in der Not.« Ein böses Grinsen breitete sich auf Johannis Gesicht aus.
Scipio fühlte sich an eine der Darstellungen in der Schulkapelle erinnert. Auf dem bunten Deckengemälde hatte einer der kleinen Teufel, der die Sünder im Fegefeuer festhielt, das gleiche Grinsen. Ob Johanni dem Künstler als Vorbild gedient hatte?
»Sie können sich gleich dazustellen. Am besten im Schlafanzug, in dem Sie dann die restliche Nacht verbringen werden.« Mit dem Rohrstock wies er Scipio den Weg unter die Dusche.
»Und wenn ich es nicht mache?«, fragte Scipio mit unterdrücktem Zorn.
Woher nahm er den Mut? Er hatte dem Lehrer noch nie widersprochen. Genauso gut konnte er gleich seine Koffer packen oder wie Marius aus dem Fenster springen. Sein Vater würde ihn enterben und verstoßen, die Gesellschaft würde ihn verachten. Es war der Anblick seines leidenden Freundes, der die Worte aus ihm herauslockte.
Für einen Moment war Johanni sprachlos. Er schien von Scipios Frage ebenso überrascht wie dieser selbst.
Nach einer schier endlosen Pause sagte der Professor leise, beinahe amüsiert: »Sie fragen mich, was passiert, wenn Sie sich weigern?« Er hob erheitert eine Augenbraue, machte langsam einen Schritt vorwärts und holte rasch und blitzschnell aus. Mit voller Kraft schlug er zu.
Der Rohrstock traf Scipio im Gesicht. Die Haut platzte augenblicklich auf, Scipio taumelte, aber er blieb stehen. Eine hässliche Blutspur verlief von seinem Ohr bis zu seinem Mund. Die Wunde brannte heiß. Scipio schrie nicht auf, er zuckte nicht einmal mit den Wimpern, sondern starrte Johanni voller Hass an.
Schade, dass sein Vater ihn jetzt nicht sehen konnte. Er behauptete immer, er sei ein Waschlappen und Feigling.
»Ich werde Sie Gehorsam lehren«, schrie Johanni zornentbrannt. »Los, unter die Dusche!« Er schlug erneut zu, traf diesmal nur Scipios Schulter und drängte ihn zu Laelius.
Das eiskalte Wasser prasselte auf Scipios Kopf, durchnässte sein Haar, traf seine Schultern und durchdrang den gestreiften Schlafanzug. Er fühlte die Kälte kaum, hörte nur das Zähneklappern des Freundes und sah den Triumph in den Augen des Lehrers. Vielleicht war es die Wut, die Scipio wärmte, oder die Wunde, die in seinem Gesicht pochte. Er zitterte nicht. Auch wenn seine Finger steif und seine Lippen blau waren. Der Schlafanzug klebte nass an seinem Körper. Jetzt spürte er, wie Laelius nach seinen Beinen griff, er umklammerte sie mit seinen Armen, die förmlich bebten. Wie in einem wilden Tanz schlugen sie gegen seinen Körper.
Nicht weinen, bitte nicht weinen, flehte Scipio den Freund in Gedanken an. Aber die Sorge war unbegründet. Vor Laelius’ Augen lag ein dichter Schleier aus Schmerz und Fieber.
Mit einem Mal setzte der Eiswasserschauer aus. Für einen winzigen Moment fühlte Scipio Wärme, aber das Gefühl ließ sofort wieder nach. Nun zitterte auch er.
»Ab ins Bett mit Ihnen. Aber glauben Sie mir, diese Nacht wird ein Nachspiel haben, und zwar für Sie beide.« Professor Johanni zeigte mit dem Rohrstock Richtung Galerie.
Laelius war unfähig, allein aufzustehen. Scipio musste ihm helfen. Er zog ihn auf die Beine und stützte ihn.
»Lassen Sie ihn sofort aus. Wer es nicht allein ins Bett schafft, muss am Boden schlafen«, forderte Johanni.
Nur widerwillig gehorchte Scipio. Laelius war nun auf den Beinen und torkelte einem Betrunkenen gleich aus dem Waschraum. Scipio folgte ihm. Eine der beiden Gaslaternen in der Galerie hatte zu flackern aufgehört. Die Trolle am Boden waren noch finsterer geworden und tanzten einen ebenso wilden Tanz wie zuvor. Orientierungslos blieb Laelius stehen.
»Los, weiter!«, zischte Johanni.
Wieder schlug er völlig unerwartet zu. Er traf Laelius’ nackten Rücken. Der Junge ging in die Knie. Scipio versuchte zu verhindern, dass der Freund stürzte. Aber Johanni war schneller. Er trat nach vorn, um erneut zuzuschlagen, dabei stolperte er über Scipios Fuß. Er prallte gegen das Geländer, fluchte und verlor das Gleichgewicht. Wie in einem Possenstück ruderte er hilflos mit beiden Armen, bevor sein Oberkörper sich gefährlich nach hinten beugte.
Scipio ließ Laelius los und trat auf den Lehrer zu, um ihm zu helfen. Aber Johanni schrie auf: »Bleiben Sie stehen.«
Angst stand in seinen Augen, fühlte er sich etwa bedroht?
Johanni holte erneut mit seinem Rohrstock aus, um Scipio zurückzuhalten oder noch einmal zuzuschlagen. Die Absicht seiner unkontrollierten Bewegung war nicht eindeutig erkennbar. Johanni überstreckte sich dabei, verlor endgültig das Gleichgewicht und kippte nach hinten. Hilfesuchend versuchte er nach Scipio zu greifen, doch der machte nun einen Schritt rückwärts und wich aus. Er sah den toten Körper seines Freundes Marius vor sich. Das schreckliche Bild lähmte ihn. Heiser schrie Johanni auf. Er stürzte in die Festhalle. Mit einem dumpfen Aufprall landete er direkt auf der Büste der Kaiserin. Sissi blieb unberührt stehen, während Johanni mit verrenktem Körper leblos danebenlag.
Scipio presste seine Faust in seinen Mund und biss darauf, um nicht entsetzt aufzuschreien. Nach einer Weile sagte er leise: »Er ist tot.«
»U-u-und je…tzt?«, fragte Laelius mit bebender Stimme. Er hockte zusammengekauert am Boden, die Beine an den Oberkörper gezogen. Er konnte den Leichnam nicht sehen.
Scipios Herz raste. Er starrte auf den toten Johanni, dann auf seinen nassen Schlafanzug. Auf den schwarz-weißen Fliesen unter seinen nackten Füßen hatten sich Pfützen gebildet, die Trolle waren verschwunden. Mit einem Mal wurde ihm entsetzlich kalt.
Mit erstaunlicher Ruhe sagte er: »Jetzt ziehen wir uns trockene Kleidung an und legen uns ins Bett.«
Widerstandslos ließ sich Laelius aufhelfen und ins Bett bringen.
EINS
Wien, Februar 1923
Anton wollte gerade den großen Topf Erdäpfelgulasch vom Herd nehmen, als es an der Wohnungstür klopfte.
»Erwartet ihr noch jemanden?«
Er schaute ins Wohnzimmer, wo seine Tochter Heide und seine Enkeltochter Rosa saßen. Beide verneinten. Also schob Anton den Topf zur Seite und ging zur Tür.
Seine Wohnung befand sich in der Kirchengasse direkt über der Apotheke, die er mehr als dreißig Jahre geführt und im letzten Sommer offiziell an seine Tochter übergeben hatte. Anton half zwar immer noch aus, mischte Hustensaft, drehte Lutschpastillen und beriet Stammkunden, aber Heide war jetzt die Apothekerin und verantwortlich für das Geschäft. Seither hatte Anton deutlich mehr Zeit für seine Enkeltochter Rosa, die im Herbst in die Schule kam, und für seine Leidenschaften: das Kochen, das gute Essen und seit geraumer Zeit das Schachspiel. Er traf sich regelmäßig mit Freunden im Café Dobner, wo es mit Abstand den besten Apfelstrudel und die cremigste Melange gab.
Leider konnte Anton nicht all seine Kochträume verwirklichen, denn die Lebensmittelpreise waren wegen der anhaltenden Inflation unverschämt hoch. Auch fünf Jahre nach Ende des schrecklichsten Krieges der Menschheit hatte Österreich sich noch nicht von der Niederlage erholt. Die neu gegründete Republik war hoch verschuldet, und viele Menschen litten an Armut.
Doch Anton konnte und wollte sich nicht beschweren. Die Apotheke lief gut, seine Tochter hatte die große Trauer über den Tod ihres Ehemanns, der wie so viele junge Männer einen sinnlosen Tod im letzten Kriegsjahr gestorben war, überwunden, und es war eine Freude, Rosa beim Heranwachsen zuzusehen. Außerdem hatte Anton seine Freundschaft zu seiner Untermieterin, der pensionierten Lateinlehrerin Ernestine Kirsch, im letzten Jahr intensiviert. Seit die beiden ein gemeinsames Wochenende am Semmering verbracht, dort an einem Tangotanzkurs teilgenommen und nebenbei ein paar Mordfälle aufgeklärt hatten, sahen sie sich häufig.
Es überraschte Anton daher nicht, dass es Ernestine war, die jetzt vor seiner Wohnungstür stand.
»Einen wunderschönen guten Abend«, sagte sie so fröhlich, dass es beinahe klang, als würde sie singen.
Ernestine war eine kleine, rundliche Frau mit einem freundlichen Gesicht, rosigen Backen und einer gelockten Kurzhaarfrisur. Im Moment waren die grauen Locken, die ihr immer etwas wirr vom Kopf abstanden, von ihrem schwarzen Filzhut bedeckt.
»Auch Ihnen einen schönen Abend«, antwortete Anton.
Die regelmäßigen Treffen hatten nichts daran verändert, dass sein Herz jedes Mal einen jugendlich schnellen Rhythmus schlug, sobald er in Ernestines hellblaue Augen blickte.
»Haben Sie schon zu Abend gegessen? Ich habe Erdäpfelgulasch gekocht. Es ist gerade fertig geworden. Heide, Rosa und ich würden uns freuen, wenn Sie uns Gesellschaft leisten.«
Es war wie verhext, sobald er sie in seine Wohnung bat, errötete er.
»Vielen Dank«, sagte Ernestine. »Aber ich habe bei der Familie Rosenstein gerade üppig gejausnet.«
Um ihre bescheidene Pension aufzubessern, gab Ernestine den Kindern der Zuckerwarenhersteller Rosenstein regelmäßig Nachhilfeunterricht.
»Wenn ich darf, leiste ich Ihnen dennoch Gesellschaft, denn ich habe wundervolle Neuigkeiten.«
Anton hob alarmiert beide Augenbrauen. Wenn Ernestine »wundervolle Neuigkeiten« hatte, musste er auf der Hut sein. Sosehr er sie verehrte, sie hatte manchmal ganz absonderliche Ideen, die meist mit Unannehmlichkeiten für ihn endeten.
Elegant schob sich Ernestine an Anton vorbei, nahm ihren Hut ab, ließ sich aus dem Mantel helfen, reichte beides Anton und ging ins Wohnzimmer.
»Servus, Fräulein Kirsch«, rief Rosa.
Antons Enkeltochter saß an seinem Schreibtisch, einem kostbaren Erbstück, das aus der Zeit des Wiener Kongresses stammte und über so viele Laden und Fächer verfügte, dass Anton jedes Mal vergaß, wo er was aufbewahrte. Rosa liebte die Laden und benutzte sie als Geheimfächer für ihre Schätze: bunte Federn, herzförmige Steine, leere Schneckenhäuser und Ähnliches.
Jetzt hielt sie in einer Hand einen Stift, in der anderen ein Blatt Papier. Mit dem wedelte sie Ernestine stolz entgegen. »Ich habe meinen Namen geschrieben und den von Mama und den von Opa. Jetzt fehlt nur noch Ihrer. Anfangen muss ich mit einem E, aber wie geht es dann weiter?«
Ernestine trat zu Rosa an den Schreibtisch. Sie nahm Rosa das Blatt ab. »Du kannst ja tatsächlich schon schreiben«, sagte sie beeindruckt.
Da standen nicht nur Namen, sondern auch andere Worte wie Hose, Ball, Kind, Suppe und Regen. Außerdem hatte Rosa eine Prinzessin und ein Schloss gezeichnet.
Heide, die gerade dabei war, den Tisch zu decken, holte einen weiteren Teller aus der Anrichte an der Wand. Genau wie ihre Tochter hatte sie dichtes blondes Haar, das sie mit Kämmen und Spangen nur notdürftig bändigte. Eine Strähne hing ihr in die Stirn, sie versuchte sie wegzublasen, begrüßte Ernestine und meinte dann: »Sie sollten Papas Gulasch kosten. Es schmeckt wirklich vorzüglich.«
Ein betörender Geruch nach Paprika, Zwiebel und Kümmel lag in der Luft. Ernestine lehnte kein zweites Mal ab. »Ein kleines Löffelchen kann nicht schaden«, meinte sie und wandte sich dann wieder Rosa zu. »Das Schloss ist dir besonders gut gelungen«, lobte sie. »Weißt du schon, in welche Schule du gehen wirst?«
»Kennen Sie das Kinderhaus in der Troststraße?«, fragte Heide. »Lili Roubiczek hat es aufgebaut. Ab Herbst wird es dort auch eine Schule geben.«
Ernestine nahm einen Stift, schrieb ihren Namen in Großbuchstaben auf das Blatt und reichte es Rosa wieder.
»Ist das die Schule, die nach dem Konzept der italienischen Ärztin geführt wird?«
»Dr. Maria Montessori!«
»Ich habe in einer Fachzeitschrift zwei Artikel der Italienerin gelesen«, sagte Ernestine. »Was sie schreibt, erscheint mir sehr vernünftig. Es ist höchste Zeit, dass bestimmte Praktiken in der Pädagogik überdacht werden.«
Anton hatte Ernestines Mantel aufgehängt und kam nun auch ins Wohnzimmer. Trotz seiner Liebe zum guten Essen war er ein großer, hagerer Mann. Er hielt die Arme vor seiner schmalen Brust verschränkt.
»Heide will, dass Rosa dort in die Schule geht. Aber wir wohnen in der Kirchengasse, und die Troststraße ist nicht gerade um die Ecke«, sagte er mit gerunzelter Stirn.
»Ich will nicht, dass meine Tochter mit Rohrstock und Schlägen unterrichtet wird. Sie soll die Freude am Lernen nicht verlieren!« Heide hob ihre Stimme. Sie knallte den geblümten Porzellanteller für Ernestine gefährlich heftig auf den Tisch.
»Das Geschirr kann nichts dafür, dass wir unterschiedlicher Meinung sind«, sagte Anton.
Sie hatten diese Diskussion in den letzten Tagen schon öfter geführt. Jedes Mal hatte das Gespräch in einem Streit geendet. Anton fand es völlig verrückt, quer durch Wien zu fahren, um eine bestimmte Schule zu besuchen. Er verstand nicht, was schlecht an der sein sollte, die sich gleich um die Ecke befand. Auch Heide hatte sie besucht und unbeschadet überstanden.
»Nicht alle Lehrer verwenden den Rohrstock«, verteidigte sich Ernestine und fügte hinzu, »jedoch sehr viele. Aber damit wird bald ein für alle Mal Schluss sein, sobald die Schulreform von Glöckel gegriffen hat.«
Seit Wien im Vorjahr ein eigenes Bundesland geworden war, war der Sozialdemokrat Otto Glöckel der erste geschäftsführende Präsident des Stadtschulrates. Sein besonderes Interesse galt der Trennung von Kirche und Ausbildung sowie der Einrichtung einer Gesamtschule, die allen Kindern nach Absolvierung der Pflichtschulzeit einen Umstieg ins Gymnasium ermöglichen sollte. Seine Ideen waren revolutionär und durchaus umstritten, besonders im Lager der politischen Gegner und in der katholischen Kirche.
Anton wollte heute Abend weder über Politik noch über Schule reden, er hatte dieses Thema in den letzten Wochen zu oft durchgekaut.
»Das Gulasch ist fertig, wir sollten es nicht auskühlen lassen.« Er ging in die Küche, holte den großen, dampfenden Emailtopf und stellte ihn vor Ernestine ab.
»Hmm!« Ihre kleine Nase kräuselte sich. »Gut, dass Sie mich überredet haben. Ich sollte wirklich davon kosten.«
»Gewiss sollten Sie das.« Schon füllte Anton ihren Teller bis zum Rand voll. Danach den von Rosa und Heide und schließlich seinen eigenen. Heide reichte einen Korb mit frischem Landbrot herum.
Bevor sie wieder mit dem Thema Schule beginnen konnte, richtete Anton seine Worte an Ernestine: »Sie haben immer noch nicht verraten, welche wundervollen Neuigkeiten Sie haben.«
»Ja, richtig.« Ernestine strahlte. Sie nahm einen Löffel Gulasch und nickte anerkennend. »Anton, Sie haben wirklich Talent. Das ist mit Abstand das beste Erdäpfelgulasch, das ich je gegessen habe.«
»Danke.« Blut schoss in Antons Wangen. Aus den Augenwinkeln sah er, dass Heide schmunzelte.
»Sie wissen doch, dass Frau Rosenstein eine begeisterte Operettenliebhaberin ist«, sagte Ernestine. »Sie besitzt ein Theaterabonnement im Theater an der Wien.«
Anton wusste davon, schließlich begleitete Ernestine die Zuckerwarenfabrikantin regelmäßig in das Theater, das einst Emanuel Schikaneder erworben hatte und in dem seither Opern und Operetten zum Besten gegeben wurden. Herr Rosenstein teilte die Leidenschaft seiner Ehefrau nicht, weshalb er froh darüber war, wenn Ernestine seine Karte übernahm.
»Am 9. Februar wird eine neue Operette von Franz Lehár uraufgeführt«, schwärmte Ernestine. Ihre Augen glänzten vor Begeisterung. »Frau Rosenstein hat Karten in einer der vordersten Reihen im Parkett.«
»Wie schön«, sagte Anton. »Sicher können Sie sie wieder begleiten.«
»Leider nein.«
Anton suchte vergeblich nach dem Bedauern in Ernestines Gesicht.
»Es ist viel besser«, platzte sie heraus. »Frau Rosenstein hat mir beide Karten geschenkt, denn sie und ihr Mann sind zu einem Ball im Hotel Continental eingeladen.«
Der Februar war der Höhepunkt der Faschingssaison. Trotz der Armut vieler Menschen wurden in den Palais und Ballsälen der Stadt wieder rauschende Feste veranstaltet, bei denen nicht nur gefeiert, sondern auch wichtige Geschäftsverbindungen geknüpft wurden.
»Wie heißt die Operette denn?«, wollte Heide wissen.
»›Die gelbe Jacke‹.«
Für einen Moment schwiegen alle.
»›Die gelbe Jacke‹?«, wiederholte Anton irritiert. »Sind Sie sicher, dass es sich dabei nicht um die Werbeveranstaltung eines Modehauses handelt?«
Heide konnte sich ein Kichern nicht verkneifen.
»Aber nein, lieber Anton«, sagte Ernestine, griff nach der Serviette und tupfte sich damit die Paprikaspuren von den Lippen. »In dem Stück geht es um Lisa, die Tochter eines Wiener Grafen. Sie gewinnt ein Reitturnier und wird dem chinesischen Prinzen vorgestellt, in den sie sich verliebt. Sie geht mit ihm nach Peking, muss aber feststellen, dass er noch vier weitere Frauen heiraten wird. Ihr ehemaliger Verehrer Gustl reist ihr nach. Lisa ist über die vier Nebenfrauen so empört, dass sie wieder flieht, gemeinsam mit Gustl.«
Anton hielt seinen Löffel über seiner Schüssel und starrte Ernestine mit weit geöffneten Augen an. Er wartete darauf, dass noch irgendetwas kommen würde, aber dem war nicht so. Hilfesuchend sah er zu seiner Tochter.
»Wie schade, dass ich am 9. Februar Besuch von Gerti aus der Steiermark bekomme. Sie ist selten in Wien und bleibt nur diesen einen Abend.« Das Bedauern in Heides Stimme passte nicht zu der Erleichterung in ihren Augen.
Antons Blick wanderte zu seiner Enkeltochter, die an Ernestines Lippen hing. Die Geschichte vom chinesischen Prinzen und der reitenden Lisa gefiel ihr.
»Kinder dürfen noch nicht ins Theater«, sagte Heide schnell.
»Das ist gemein.« Rosa zog einen Schmollmund. »Die besten Dinge sind immer nur für Erwachsene.«
»Ich bringe dir ein Programmheft mit«, versprach Ernestine. »Darin sind Fotos von den Sängern und Sängerinnen. Sie tragen alle Kostüme.«
»Ich nehme an, gelbe Jacken«, sagte Heide.
»Es wird ein wundervoller Abend«, seufzte Ernestine. »Lieber Anton, ist es nicht ein großes Glück, dass das Theater direkt neben dem Kaffeehaus Dobner liegt, in dem sich Ihr Schachclub trifft. Wir könnten hinterher ein Gläschen Wein trinken gehen. Angeblich verkehren dort auch die Künstler.«
»Wir?«, fragte Anton. Geräuschvoll landete sein Löffel auf seiner Suppenschüssel.
»Sie sollten beide etwas vorsichtiger mit Ihrem Geschirr umgehen«, mahnte Ernestine. Sie sah von Anton zu Heide und wieder zurück. »Es ist wunderschönes handbemaltes Porzellan. Ewig schade, wenn es in Brüche ginge.«
Sie hatte Antons Frage nicht beantwortet.
Das übernahm Rosa. »Opa, du hast es gut. Du darfst Fräulein Kirsch zum singenden chinesischen Prinzen begleiten.«
»In der gelben Jacke«, ergänzte Heide. Sie musste sich die Hand vor den Mund halten. Anton konnte ihr Lachen dennoch sehen. Sie stand auf, um den Wasserkrug in der Küche neu zu füllen.
»Ich, also … ich weiß nicht …«, stotterte Anton. »Eigentlich bin ich ja ein … Musikbanause.«
»Aber, aber«, Ernestine hob ihren rechten Zeigefinger, »ich kann mich gut daran erinnern, wie elegant Sie am Semmering das Tanzbein geschwungen haben und über das Parkett gefegt sind. Musikbanausen können das nicht.«
Anton hörte, wie Heide in der Küche versuchte, ein Lachen mit einem Hüsteln zu überspielen.
»Sicher werden Sie die Musik von Franz Lehár mögen. Die Lieder gehen gefällig ins Ohr. Man bekommt sie tagelang nicht aus dem Gedächtnis.«
Ernestine summte eine Melodie, die Anton weder kannte noch sonderlich hübsch fand.
»Nun ja …« Er räusperte sich.
Was Ernestine als eine Zusage auslegte. Sie klatschte in die Hände. »Wir werden einen wundervollen Abend miteinander verbringen! Bestimmt wird das Stück bald zu Ihren Lieblingsoperetten gehören.«
Anton schluckte, er konnte Operetten nicht ausstehen, weil er die Handlung absurd und die Musik schrecklich fand. Aber das sagte er nicht, denn Ernestine lehnte sich über den Tisch, ergriff seine Hand und drückte sie zärtlich.
Vielleicht würde es ja nicht so schlimm werden, und nach der Vorstellung würde er sich mit einem großen Stück Apfelstrudel im Dobner belohnen.
»Und ich bekomme ein Programmheft«, erinnerte Rosa.
»Versprochen«, sagte Ernestine. »Eines mit der Unterschrift der Hauptdarstellerin, Hermine Egger.«
Den Rest des Abends verbrachte Ernestine damit, einen Überblick über die bekanntesten Sänger und Sängerinnen zu geben und Rosa von den beliebtesten Operetten zu erzählen.
Anton fragte sich, ob es nicht besser gewesen wäre, das leidige Schulthema zu besprechen, doch dazu war es nun zu spät, denn Rosa konnte nicht genug von den Verwechslungs- und Liebesgeschichten bekommen, die große Ähnlichkeit mit den Märchen hatten, die sie so liebte.
ZWEI
In den frühen Morgenstunden hatte es angefangen, heftig zu schneien, und auch zu Mittag fielen unaufhörlich dicke weiße Flocken vom Himmel. Als auch am Nachmittag kein Ende der Schneefälle in Sicht war, kam Ernestine aufgeregt in die Apotheke.
»Wenn wir nicht mindestens eine Stunde früher aufbrechen, kommen wir zu spät zur Vorstellung. Sobald ein paar Zentimeter Neuschnee liegen, kann man sich auf die Straßenbahn nicht mehr verlassen, und wir wollen doch auf jeden Fall pünktlich da sein.«
Also ging Anton schnell noch einmal nach draußen, schaufelte zum dritten Mal an diesem Tag den Gehsteig frei, bevor er seinen besten und einzigen Anzug aus dem Kasten holte, die Lavendelsäckchen entfernte und sich in das unbequeme Kleidungsstück zwängte. Es war ein Jahr her, dass er ihn zuletzt angehabt hatte.
»Schön schaust du aus«, schwärmte Rosa.
Sie hatte den ganzen Nachmittag im Hinterhof mit ihren Freunden an einem Schneemann gebaut. Jetzt saß sie mit roten Wangen vor einer Tasse heißer Honigmilch und betrachtete stolz ihren Großvater. Ihr verliebter Blick versöhnte Anton mit dem Gedanken, den ganzen Abend im Anzug mit Fliege verbringen zu müssen.
Kurz darauf klopfte Ernestine an der Tür. Auch sie sah in ihrem schlichten dunklen Kleid, das ihr bis zu den Knöcheln reichte und am Hals und an den Ärmeln mit Spitze versehen war, hinreißend aus. Um ihren Hals baumelte eine einfache Perlenkette. Rosa machte auch ihr ein Kompliment, über das Ernestine sich freute. Das Mädchen wünschte beiden einen schönen Abend und erinnerte Ernestine ein letztes Mal an das Programmheft.
»Sollen wir statt der Straßenbahn lieber ein Taxi rufen?«, fragte Anton. Besorgt sah er auf Ernestines dunkle Halbschuhe, die zwar zum Kleid passten, für die Wetterlage aber gänzlich ungeeignet waren.
Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich habe es mir anders überlegt. Wir gehen zu Fuß, es ist ja nicht weit.«
Schon nach wenigen Metern zitterte Ernestine. Ihre Schultern bebten, und sie vergrub ihre Hände tief in ihren Manteltaschen. Anton war sicher, dass ihre Lippen unter dem kirschroten Lippenstift blau waren.
»Zurück nehmen wir ein Taxi«, entschied er. Diesmal entgegnete Ernestine nichts.
Der Weg führte sie über eine tief verschneite Mariahilfer Straße und einen ebenso verschneiten Getreidemarkt zur Linken Wienzeile. Als sie endlich die Wien erreichten, die sowohl der Stadt als auch der Straße und dem Theater ihren Namen gab, atmete Anton erleichtert durch.
Nachdem der Fluss jahrelang für Überschwemmungen verantwortlich gewesen war, hatte man sich unter Kaiser Franz Josef dazu entschieden, das Gewässer in einem streng regulierten Bett ein für alle Mal im Zaum zu halten. Vor dem Theater war die Wien kanalisiert und mit einem Deckel versehen. Darauf befand sich der Naschmarkt mit seinen zahlreichen fixen Verkaufsständen.
Dem Markt gegenüber lag das Theater. Der kleine überdachte Vorbau, der in die Eingangshalle führte, war festlich beleuchtet. Gerahmte Plakate rechts und links davon kündigten die Operette an. Ein chinesisch anmutender Prinz in einer gelben Jacke und drei Frauen waren darauf abgebildet. Noch standen keine Besucher vor dem Gebäude, was damit zusammenhing, dass Anton und Ernestine viel zu früh hier waren. Dennoch beschleunigte Ernestine ihre Schritte. Ihr war bitterkalt.
Anton holte seine alte Taschenuhr unter seinem Mantel hervor. »Die Vorstellung beginnt erst in einer Stunde. Sollen wir zuvor eine Melange im Dobner trinken?«
»Auf keinen Fall«, sagte Ernestine. »Ich werde ein Programmheft kaufen und eine Unterschrift von Hermine Egger holen.«
»Vor der Vorstellung?«
»Ja, natürlich. Nachher stehen ihre Bewunderer vielleicht Schlange. Besser, wir erledigen das gleich.«
»Wie Sie meinen.«
Anton wollte sich weder vor noch nach der Vorstellung vor eine Künstlergarderobe stellen und um eine Unterschrift bitten. Lieber suchte er das Büfett des Theaters auf und genehmigte sich eine Melange.
»Wussten Sie, dass Ludwig van Beethoven zwei Jahre im hinteren Teil des Theaters gewohnt und seine Oper Fidelio für die Bühne geschrieben hat?«
Diese Information hatte Anton gestern in der Kronenzeitung gelesen, dort hatte ein Journalist einen Artikel über Lehárs Stück und das Theater an der Wien geschrieben.
»Tatsächlich?«
Ehrfürchtig blieb Ernestine vor dem Eingang stehen und blickte die graue Fassade hoch. Aus den Fenstern des erhabenen Singspielhauses drang warmes Licht auf die Straße. Ernestines Körper überzog ein Schauer, was nicht auf ihren Respekt vor dem Gebäude und den Menschen, die darin aufgetreten und gearbeitet hatten, zurückzuführen war, sondern mit der Kälte zu tun hatte. Anton ergriff ihren Ellbogen und zog sie sanft weiter.
»Sie können das Theater ebenso gut von innen bestaunen«, sagte er entschieden. »Übrigens, Heinrich Kleist hat sein ›Käthchen von Heilbronn‹ ebenfalls für das Theater geschrieben.«
Anton war dem Reporter dankbar für den Artikel. Es kam selten vor, dass er Ernestine mit kulturellem Wissen beeindrucken konnte. Normalerweise ließ er diese Seiten bei der Lektüre der Zeitung aus, viel lieber studierte er den Sportteil und informierte sich darüber, ob der Jüdische Fußballclub Hakoah wieder einmal den Arbeiterclub Rapid geschlagen oder der Club der Wiener Tschechen SK Slovan mehr Punkte in der Meisterschaft erzielt hatte.
»Ich habe mit dem schwulstigen Ritterschauspiel nie etwas anfangen können. Die ganze Handlung erscheint mir sehr konstruiert«, sagte Ernestine.
»Kleist ist schwulstig?« Anton öffnete die Tür und hielt sie für Ernestine auf.
»Aber ja doch, kitschig, überladen, furchtbar dramatisch und wirklichkeitsfern.«
»Darf ich Sie daran erinnern, dass wir jetzt eine Geschichte über eine junge Frau ansehen, die …«
Weiter kam er nicht, denn Ernestine hielt an, fasste Anton am Unterarm und richtete ihre Aufmerksamkeit auf gerahmte Sepiafotografien, die im Foyer hingen. Es waren Bilder der Schauspieler, die heute Abend auftraten.
»Sehen Sie nur«, sagte sie begeistert und blieb vor einem der Fotos stehen. »Das ist Hermine Egger. Ist sie nicht hinreißend? Sie hat eine glockenklare Stimme, jeder Ton passt. Sie singt einfach himmlisch, wie eine … Göttin.«
»Eine furchteinflößende Göttin«, meinte Anton.
Die Frau auf dem Porträt sprach ihn nicht an. Das Gesicht war von so viel Schminke bedeckt, dass man nur erahnen konnte, wie die Züge darunter aussahen. Sie hielt eine Zigarettenspitze samt Zigarette in der Hand. Der helle Qualm legte eine Art weichen Schleier über das hart erscheinende Gesicht. Die Augen waren mit dunkler Farbe umrandet, die Lippen glänzten unnatürlich. Würde Anton der Sängerin nachts allein auf der Straße begegnen, würde er sich zweifelsohne fürchten.
»Unsinn, Anton!«, sagte Ernestine empört. »Sie ist die überzeugendste Soubrette, die derzeit in Wien auftritt, und sie ist eine sehr attraktive Frau im besten Alter.«
Anton beschloss, dass es besser war, zu diesem Thema zu schweigen und die nächste Bemerkung, die ihm bereits auf der Zunge lag, hinunterzuschlucken. Ernestine könnte es als persönliche Beleidigung verstehen, würde er die Künstlerin, die sie so sehr verehrte, kritisieren.
»Lassen Sie uns die Mäntel abgeben«, schlug er vor.
Durch das mit rotem Teppich ausgelegte Foyer gingen sie zur Garderobe. Dort saß ein Mann in Antons Alter, der nur noch einen Arm hatte. Er war einer der vielen Soldaten, die der Krieg als Krüppel zurückgelassen hatte. Männer, die froh sein mussten, wenn sie irgendwo eine Tätigkeit fanden, die sie trotz ihrer körperlichen Einschränkungen ausüben konnten. Der Invalide las in einer Zeitung und schenkte weder Anton noch Ernestine Beachtung.
»Guten Abend«, sagte Ernestine gut gelaunt.
Anton half ihr aus ihrem weichen Wollmantel, legte ihn auf dem Pult ab, schlüpfte aus seinem eigenen und gab ihn dazu.
»’n Abend«, knurrte der Garderobier. »Des Stück fangt erst in ana Stund an.«
»Das wissen wir. Wir waren schneller als gedacht. Verfügt das Theater über ein Büfett?«
»Des is obn.« Er zeigte mit dem Daumen seiner verbliebenen Hand zur Decke und meinte damit wohl ein darüber liegendes Stockwerk.
Obwohl die Mäntel auf dem Pult lagen, machte der Garderobier keine Anstalten, die Kleidungsstücke entgegenzunehmen, seelenruhig blätterte er in seiner Zeitung und widmete sich dem Sportteil.
»Wir wollen unsere Mäntel abgeben«, erklärte Ernestine, nun nicht mehr so freundlich wie zuvor.
Mit mürrischem Blick schob der Garderobier seine Zeitung zur Seite. Er wirkte wie jemand, den man gerade bei seiner wohlverdienten Pause störte, und nicht wie einer, der seiner Arbeit nachging, für die er bezahlt wurde. Er nahm die beiden Mäntel und hängte sie im Schneckentempo auf einen der Haken hinter sich.
Anton stellte sich vor, wie er mit seinem Verhalten in einer Stunde eine lange Schlange wartender Menschen zur Weißglut bringen würde. Gut, dass sie so früh dran waren.
Der Garderobier reichte Ernestine ein Kartonkärtchen mit einer Nummer.
»Kann ich bei Ihnen ein Programmheft kaufen?«
»Na.« Er setzte sich, schleckte den Zeigfinger seiner Hand ab und blätterte die Zeitung um.
»Und wo bekomme ich eines?«
»Dort drüben.«
Ohne aufzuschauen, zeigte er auf einen Billetteur, der vor dem Eingang zum Publikumssaal saß. Auch er war ein Kriegsversehrter und hatte nur noch einen Fuß, der fehlende war durch eine Prothese ersetzt worden.
»Danke«, sagte Ernestine. Als sie außer Hörweite waren, echauffierte sie sich. »Unglaublich, wie unhöflich der Mann ist. Er sollte sich besser nach einer Tätigkeit am Zentralfriedhof oder im Leichenschauhaus umsehen.«
Zielstrebig ging sie zum Billetteur, um ein Programmheft zu kaufen. Anders als sein Kollege begrüßte er sie freundlich und gab ihr bereitwillig Auskunft, als sie nach den Künstlergarderoben fragte. Was bewies, dass ein grausames Schicksal nicht zwingend zu unfreundlichem Verhalten führte.
»Die Garderoben der Sänger sind im hinteren Teil«, erklärte er höflich. »Sie müssen den Künstlereingang, das Papagenotor in der Millöckergasse, nehmen.«
»Kann ich dort denn einfach hinein?«, wollte Ernestine wissen.
»Um die Uhrzeit ganz gewiss. Viele der Künstler kommen immer a bisserl z’ spät.« Er zwinkerte ihr zu. »Deshalb ist des Tiardl offen.«
»Vielen Dank«, sagte Ernestine.
Anton zahlte für das Programmheft und gab ein kleines Trinkgeld. Der Billetteur ließ die Münze in der Tasche seines Sakkos verschwinden.
»Die Frau Egger is in der Garderobe Nummer fünf.«
Als sie wieder im Foyer waren, fragte Anton: »Warum wusste der Mann, dass Sie zu Hermine Egger wollen?«
»Weil sie ein Star ist und von allen bewundert wird. Außer von Ihnen, lieber Anton.«
Lag Vorwurf in ihrer Stimme? Anton war sich nicht sicher.
»Aber Sie können sich ja selbst ein Bild machen«, sagte Ernestine. »Kommen Sie, gehen wir in den Künstlerbereich.« Schon marschierte sie los.
Anton zögerte. »Ach, wissen Sie, ich glaube, es ist besser, Sie machen das allein.«
Abrupt blieb Ernestine stehen.
»Vermutlich würde es mich beeinflussen, wenn ich die Diva schon vor der Vorstellung kennenlerne, und Sie wollen doch, dass ich mir ein objektives Bild über ihre künstlerischen Fähigkeiten mache«, rechtfertigte er sich.
Ernestine musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen. »Gut, dann treffen wir einander später bei den Plätzen«, sagte sie. Dann breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus. »Trinken Sie beim Büfett keine Melange. Man verwendet hier Obers statt Milchschaum. Das schmeckt Ihnen nicht.«
Sie hatte ihn durchschaut. Wieder einmal errötete Anton verlegen und versuchte abzulenken. »Soll ich Ihren Mantel holen?«
»Aber nein«, sagte Ernestine. »Es sind ja bloß ein paar Schritte. Bis Sie den mürrischen Garderobier davon überzeugt haben, dass er mir meinen Mantel wiedergeben soll, obwohl die Vorstellung noch nicht begonnen hat, ist Frau Egger bereits auf der Bühne.«
Sie drehte sich am Absatz um, winkte Anton noch einmal zu und lief, nur mit ihrem Kleid aus dünner Baumwolle bekleidet, zurück auf die Straße. Anton sah ihr kopfschüttelnd hinterher. Nur zu gern hätte er sie darauf hingewiesen, dass sie sich erkälten würde. Aber er wusste, dass das sinnlos war. Besser, er versorgte sie morgen früh mit Lindenblütentee und Spitzwegerichsirup. Jetzt suchte er erst mal nach der Treppe, die in den ersten Stock führte. Er folgte seiner Nase, die ihn zielsicher zu Kaffee und Faschingskrapfen brachte.
DREI
Ernestine trat erneut auf die Linke Wienzeile. Ein eisiger Wind pfiff ihr entgegen und blies ihr die Locken aus der Stirn. Rasch lief sie zur Millöckergasse, dabei watete sie durch knöchelhohen Schnee. Während der Gehsteig vor dem Theater geräumt war, hatte man beim Seiteneingang der Künstler darauf verzichtet.
Ursprünglich war dieses Tor der Haupteingang gewesen. Man hatte es nach Emanuel Schikaneders bekanntester Figur benannt und ihn in einer Skulptur des Papagenos gemeinsam mit seinen drei Söhnen verewigt. Schikaneder hatte den Grundstein für das Theater gelegt und den Text zu Wolfgang Amadeus Mozarts berühmter Oper »Die Zauberflöte« geschrieben.
Im Moment war Ernestine so kalt, dass sie weder dem Denkmal des berühmten Mannes noch der historischen Bedeutung des Ortes gebührend Aufmerksamkeit schenken konnte. Zitternd vor Kälte drückte sie mit der Schulter gegen die niedrige Tür in dem großen dunkelgrün gestrichenen Tor. Zu ihrer eigenen Überraschung spürte sie keinen Widerstand. Erstaunlich, wie einfach es war, ins Theater zu gelangen. Augenblicklich schlug ihr Wärme entgegen. Ihre Muskeln entspannten sich wieder. Neugierig sah sie sich um.
Auf der linken Seite befand sich eine Tür mit der Aufschrift »Portier«. Sie war verschlossen und führte zur Dienstwohnung des selbigen. Die kleine Kabine mit Glasfenster war leer. Ernestine ging daran vorbei, kam aber nicht weit, denn schon rief ihr eine schrille, laute Stimme hinterher.
»Halt, wo wolln S’ denn hin?«
Sie drehte sich um. Vor ihr stand eine kleine, stämmige Frau in einem grauen Arbeitskleid. Über dem Kleid trug sie eine ebenfalls graue Schürze. Ihr Haar hatte sie unter einem geblümten Kopftuch versteckt, das im Nacken zusammengeknotet war. Sie hatte beide Hände in die breiten Hüften gestemmt und musterte Ernestine feindselig.
»Ich suche die Künstlergarderobe von Frau Egger. Ich habe der Enkeltochter meines Freundes versprochen, ein signiertes Programmheft mitzubringen.«
Der Frau schienen Ernestines Erklärungen völlig egal zu sein. »Wer hat Ihna erlaubt, durchn Künstlereingang z’ kumma?«