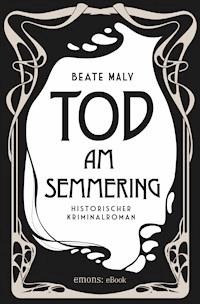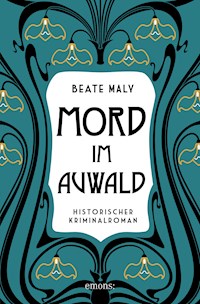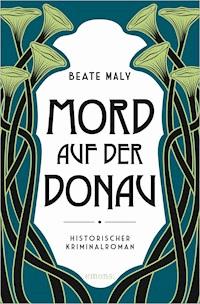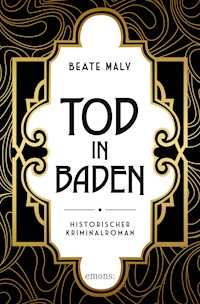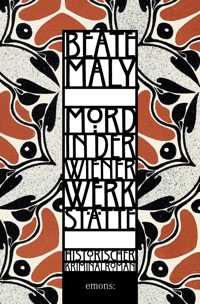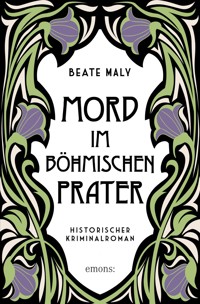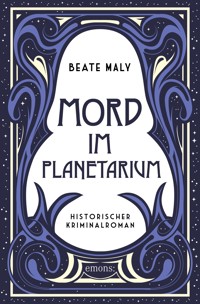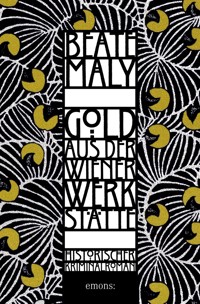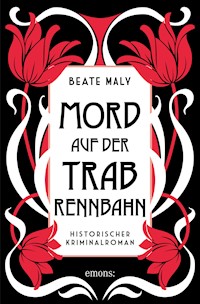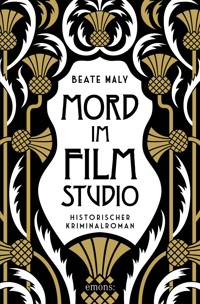
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ernestine Kirsch und Anton Böck
- Sprache: Deutsch
Ein feinsinniger Wohlfühlkrimi aus dem Wien der goldenen 20er Jahre. Wien 1925: Im Schönbrunner Schlosstheater wird »Der Rosenkavalier« gedreht. Die Filmmusik stammt von Richard Strauss, das Libretto von Hugo von Hofmannsthal. Für die aufwendige Produktion werden Tausende Statisten benötigt; auch Ernestine und Anton sind mit von der Partie. Als am zweiten Drehtag die Hauptdarstellerin mit einem Seidenschal erdrosselt in ihrer Garderobe aufgefunden wird, machen sich die beiden auf Spurensuche – und kommen dem Täter dabei näher, als ihnen lieb ist. Band 8 der Reihe »Ernestine Kirsch und Anton Böck«. Alle Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Beate Maly wurde 1970 in Wien geboren, wo sie bis heute lebt. Seit rund zwanzig Jahren widmet sie sich dem historischen Roman und dem historischen Kriminalroman. Beate Maly schreibt erfolgreich unter ihrem eigenen Namen und auch unter zwei Pseudonymen. 2019 war sie mit »Mord auf der Donau« für den Leo-Perutz-Preis nominiert, 2021 gewann sie den Silbernen Homer.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von shutterstock.com
Lektorat: Christine Derrer
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-082-2
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding.Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie:sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen.
Hugo von Hofmannsthal, »Der Rosenkavalier«,Komödie für Musik, S. Fischer, Berlin 1911
PROLOG
Wien, 1913, Graben 13, Lehr- und Erziehungsinstitut Gunesch (Lyzeum am Graben)
Auf Zehenspitzen schlich Theodora in den Schlafsaal. Der Raum war um diese Zeit leer, die anderen Mädchen befanden sich beim Handarbeits- oder Musikunterricht. Wegen ihrer gebrochenen Hand war Theodora seit einer Woche von beiden Fächern befreit.
»Du musst wirklich ein bisschen besser auf dich aufpassen«, hatte Fräulein Noir, die Französischlehrerin, zu ihr gesagt. »Das ist nun schon der dritte Unfall mit einem Knochenbruch in diesem Jahr. Du bist ein echter Tollpatsch.«
Das Fräulein konnte den wahren Grund der Verletzungen nicht erahnen. Theodora war nicht unvorsichtig oder ungeschickt, ganz im Gegenteil. Sie achtete auf ihre Bewegungen. Noch vor zwei Jahren hatte sie als großes Balletttalent gegolten. Das war, bevor sie ins Lyzeum gekommen war. Bevor sie ins Internat gezogen und bevor sie dem »Klub der Blutfeen« begegnet war.
Theodora lief zu ihrem Bett. Es stand an der Wand ganz am Ende des Saals. Anfangs hatte sie den Platz gemocht, da sie von hier aus einen guten Überblick über den Raum hatte. Mittlerweile hasste sie ihn. Ein Bett an der Wand nahm ihr die Möglichkeit, rechtzeitig davonzulaufen. Sie war hier gefangen, jeder Fluchtmöglichkeit beraubt.
Mit den weichen Ledersohlen ihrer neuen Schuhe bewegte sie sich fast geräuschlos über den gefliesten Boden. Eines der hohen Fenster war gekippt. Die Geräusche der Straße drangen herauf. Die fröhlichen Rufe einer Marktfrau, die ihre Lavendelsträuße mit kräftiger Stimme anbot. Das Rattern von Handkarren, deren Holzräder über das Kopfsteinpflaster holperten. Passanten, die sich unterhielten. Eine Mutter, die nach ihrem Kind rief. Alles klang nach Normalität, nach glücklichem Leben ohne Angst. Theodora beneidete sie alle. Selbst der Alltag des Werkelmanns am Ende des Platzes erschien ihr erstrebenswert im Vergleich zu ihrem Dasein.
Sie ließ sich auf ihrem Bett nieder. Die Sprungfedern der Matratze quietschten laut. Sie erschrak über den unerwarteten Lärm, zuckte zusammen und hielt sich mit der verletzten Hand am Metallrahmen ihres Betts fest. Blitzartig schoss ein Schmerz durch ihre Finger. Er breitete sich einer Welle gleich in ihrem ganzen Körper aus. Sie presste die Augen zusammen, bis er abebbte, dann blickte sie auf. Niemand betrat den Raum. Wie auch, sie saßen alle beim Flötenunterricht oder beim Spitzendeckensticken. Theodora konzentrierte sich auf ihren Atem und wartete, bis der Schmerz sich endgültig gelegt hatte. Dann hockte sie sich auf den Boden und zog ihren braunen Lederkoffer unter dem Bett hervor. Er gehörte ihrem Zwillingsbruder. Er hatte ihn ihr geliehen. Liebevoll strich sie darüber. Mit der unverletzten Hand klappte sie ihn auf und holte den Brief hervor. Das Kuvert war cremefarben. Ihr Name wand sich in verschnörkelter Schrift auf der Vorderseite. Er war mit dunkler Tinte geschrieben. Nichts an den Buchstaben deutete auf einen grausamen Inhalt hin. Mit etwas Phantasie hätte es ein Liebesbrief sein können. Sie drehte das Kuvert um. Nun leuchtete ihr die Bedrohung entgegen: blutrot und furchteinflößend. Wie ein leuchtendes Schandmal, das Schmerzen und Terror bedeutete. »Klub der Blutfeen.«
Allein der Name ließ Theodoras Herz rasen. Ihre Hände fingen an zu zittern, und die Härchen in ihrem Nacken stellten sich auf. Die Angst packte nach ihr mit eiskalten Klauen. Was würden sie ihr diesmal antun? Die Briefe waren stets die Ankündigung einer bevorstehenden Attacke. Beim ersten Mal hatten die Blutfeen sie brutal über die Treppe gestoßen. Es war ein Glück gewesen, dass sie sich nur den Knöchel gebrochen hatte. Der zweite Angriff war weitaus schlimmer gewesen. Sie hatten ihr nachts ein geknülltes Tuch in den Mund gestopft, damit sie nicht schreien konnte. Dann hatten sie ihr einen Sack über den Kopf gestülpt, unter dem sie beinahe erstickt wäre. So hatten sie sie in den Waschraum gezerrt. Zwei der Feen hatten sie festgehalten, während die dritte mit einer brennenden Kerze Theodoras Finger versengt hatte. Hinterher hatte eine der Feen gemeint, dass sie ihr bloß Angst hatten einflößen wollen. Die Verbrennungen waren nur ein Versehen. Theodora glaubte ihr kein Wort. Noch nie in ihrem Leben hatte sie sich so gefürchtet wie mit dem Sack über dem Kopf. Sie hatte gedacht, sie würden sie umbringen. Die Vorfälle den Lehrerinnen gegenüber zu erwähnen, war unmöglich. Niemand würde ihr Glauben schenken. Die Feen waren Mädchen aus einflussreichen Familien. Sie hatten Eltern, die es niemals zulassen würden, dass ihre Kinder in Schwierigkeiten gerieten oder eine böse Nachrede bekämen. Theodora hingegen wurde hier bloß geduldet. Eigentlich überstieg das Schulgeld des Lyzeums die Einkünfte ihrer Eltern. Nur mit Ach und Krach kratzten sie die Summe jeden Monat zusammen. Sie hofften, dass Theodora, die stets gute Noten geschrieben hatte, einmal eine bessere Zukunft hatte als sie selbst. Doch die herausragenden Schulleistungen waren Geschichte. Ihre Noten wurden von Überfall zu Überfall schlechter. Theodora konnte sich im Unterricht nicht konzentrieren. Nachts nässte sie ihr Bett ein, was sie der Häme der anderen aussetzte und wodurch sie sich den Ärger der Erzieherin zuzog. Jeden Morgen versuchte sie, das Malheur so gut es ging vor den Blicken der anderen zu verbergen. Sie hatte sich eine Zeit lang gewünscht, ihre Eltern würden kein Schulgeld mehr bezahlen und der Alptraum hätte ein Ende. Aber diese Hoffnung hatte sie aufgegeben.
Nach dem zweiten nächtlichen Vorfall hatte sie wochenlang Schmerzen beim Schreiben und beim Flötespielen gehabt. Die zwei verbrannten Fingerkuppen hatten sich entzündet. Die feinen Sticktüchlein, die sie bei Fräulein Meier im Handarbeitsunterricht bearbeiteten, waren vom Blut schmutzig geworden, worauf die strenge Lehrerin ihr das Tüchlein schimpfend weggenommen und ihr Strafpunkte verpasst hatte. Das boshafte Grinsen der Blutfeen war erniedrigend, der Ärger über die Strafpunkte schier unermesslich gewesen. Hatte man zu viele von den Punkten, durfte man am Wochenende keinen Besuch empfangen. Sie waren der einzige Lichtblick in Theodoras Leben. Ein paar Stunden Normalität, in denen sie einfach nur sie selbst sein durfte. Der letzte Überfall war erst zwei Wochen her. Die Feen hatten sie nach dem Turnunterricht in den Keller geschleppt, zwei hatten sie gehalten, während die dritte mit einem Prügel auf ihre Hand gedroschen hatte. Der Knochen brach sofort. Eine der Feen hatte sie augenblicklich losgelassen und die anderen gebeten aufzuhören. Was diese dann auch getan hatten. Sie waren alle davongelaufen. Zuerst hatte Theodora gehofft, dass die Verletzung sie alle erschreckt hätte.
Aber dann hatte die Anführerin lachend gerufen: »Wie kann man so ungeschickt sein? Schon wieder bist du über die Treppe gestürzt. Wir werden es Fräulein Bleibtreu sagen.«
Theodora war lange im Keller geblieben und hatte geweint. Dann war sie die Treppe hochgestiegen und wollte die Verletzung verbergen. Aber es war unmöglich gewesen. Bei der kleinsten Bewegung hatte sie höllische Schmerzen. Sie musste zum Arzt, der ihr eine Schiene und einen Verband verpasste. Nach dem Knochenbruch hatte eine der Feen ein leises »Entschuldigung« geflüstert. Aber ihre Angst war ebenso groß wie die von Theodora. Sie machte weiter mit, und die Abstände zwischen den Gemeinheiten wurden kürzer.
Theodoras Hand war lange noch nicht verheilt, trotzdem war heute Morgen der nächste Drohbrief auf ihrem Kopfkissen gelegen. Der Blutdurst der Feen war schier unersättlich.
Theodora öffnete den Koffer noch einmal. Sie holte ihr Tagebuch hervor und ein leeres Blatt Papier. Das Kuvert der Feen legte sie ungeöffnet in ihr Tagebuch, wo sie all die bisherigen Qualen genau festgehalten hatte. Sie wollte nicht lesen, was sie ihr diesmal androhten. Es hatte keine Bedeutung mehr. Sie würde das Spiel nicht weiter mitmachen. Sie würde aussteigen. Die Feen mussten sich ein neues Opfer suchen. Aus der Schublade ihres Nachtkästchens nahm sie einen Füllhalter. Ein Geschenk ihrer Mutter. Sie hatte ihn ihr als Glücksbringer in die neue Schule mitgegeben. Das Glück war leider ausgeblieben. Mit der zitternden gesunden Hand schrieb Theodora einen krakeligen Brief an ihre Eltern. Sie wollte, dass sie wussten, wie sehr sie sie liebte. Während sie schrieb, klatschten dicke Tränen auf das hellblaue Papier. Ihre Buchstaben verschwammen. Theodora tupfte die nasse Tinte mit der weißen Schürze ihres Kleides trocken. Hässliche Flecken blieben zurück. Fräulein Bleibtreu, die Erzieherin, würde darüber schimpfen. Aber sowohl die Schürze wie auch die Erzieherin hatten an Wichtigkeit verloren. Auch das stinkende, feuchte Laken auf ihrem Bett, das sie letzte Nacht wieder eingenässt hatte. Theodoras Zukunft war eine ohne Strafen, ohne Schmerz und vor allem ohne Angst. Sie würde friedlich schlafen, für immer.
»Vergesst nie, ich liebe euch! Und seid mir bitte nicht böse für das, was ich tue! Eure Theo«. Damit beendete sie den Brief an ihre Familie. Sie faltete das Blatt sorgfältig zusammen und steckte es ebenfalls in ihr neues Tagebuch. Das alte hatte sie gestern gemeinsam mit den anderen Briefen an ihre Eltern geschickt. In ein paar Tagen sollte es bei ihnen ankommen. Buch und Brief legte sie in ihr Nachtkästchen. Dort, wo sie die Schokolade versteckt hatte, die ihre Mutter ihr geschickt hatte. Sollte sie sie noch essen? Es wäre schade, wenn Fräulein Bleibtreu sie wegwerfen oder selbst vernaschen würde. Hastig wickelte sie die Süßigkeit aus dem silbernen Stanniolpapier und stopfte sich den ganzen Riegel in den Mund. Der süße Schokoladengeschmack gaukelte für einen winzigen Moment Normalität vor. Aber nichts war normal. Der Raum war ebenso irreal wie das, was sie jetzt vorhatte. Theodora warf einen Blick auf die Wanduhr über der Tür. In zehn Minuten würde der Flötenunterricht enden. Dann würde ein Teil der Schülerinnen in den Schlafsaal zurückkehren. Die, die Handarbeitsstunde hatten, würden noch länger wegbleiben. Fräulein Meier war streng. Sie ließ so lange arbeiten, bis das Stundenpensum erfüllt war. Theodora sollte sich beeilen. Sie schluckte den Rest Schokolade hinunter. Der Geschmack mischte sich mit dem Salz ihrer Tränen. Dann schob sie das Nachtkästchen zum Fenster und kletterte rasch aufs Fensterbrett. Sie musste sich strecken, um den Hebel zu erreichen. Mit ihrer unverletzten Hand klappte sie ihn auf und öffnete den Flügel. Sie stellte sich so nah an den Rand, dass ihre Zehenspitzen über das Brett ragten. Schade um ihre neuen Schuhe – ob man sie mit ihr begraben würde? Warum dachte sie ausgerechnet an ihre Schuhe? Sie war im ersten Stock. Ob das reichte, um zu sterben? Konnte man einen Sturz aus dieser Höhe überleben? Unten auf der Straße gingen Passanten vorbei. Eine Frau mit einem aufgeklappten Sonnenschirm. Er hatte ein hübsches Muster in Rot und Rosa. Er würde Theodoras Schwester gefallen. Der Himmel war strahlend blau, keine Wolke trübte das Bild. Das Gold der Pestsäule glänzte üppig in der hellen Sonne. Theodora musste blinzeln, um nicht geblendet zu werden. Die Glocken vom Stephansdom schlugen die volle Stunde. Es war der perfekte Zeitpunkt zu gehen. In ein paar Sekunden würde alles vorbei sein. Sie holte tief Luft, als der Glockenklang von einer schrillen Stimme übertönt wurde. Die Blumenfrau vor der Pestsäule hatte sie entdeckt.
»Dort oben, ein Kind. Nein, nicht springen!«
Noch bevor andere in ihr Geschrei einstimmen konnten, ließ Theodora sich fallen. Die Aufregung, die folgte, nahm sie nicht mehr wahr. Theodoras Leiden hatte ein Ende. Der Tod war schlimm für die Lebenden, nicht für die Toten.
EINS
Wien, 1925
Eine Wespe, die Anton schon dreimal von seinem goldbraunen Frühstückskipferl vertrieben hatte, kehrte summend zurück, in der Hoffnung, etwas von der süßen Marillenmarmelade abzubekommen. Erneut scheuchte Anton sie mit dem Sportteil der Kronenzeitung weg.
»Findest du nicht auch, dass Heide in letzter Zeit müde ausschaut?«
Der pensionierte Apotheker hatte vor zwei Jahren nicht nur seine Apotheke an seine Tochter abgegeben, sondern auch seine Wohnung. Seither lebte er im neu renovierten Kutscherhäuschen im Garten gemeinsam mit der pensionierten Lateinlehrerin Ernestine Kirsch. Die beiden waren sich in den letzten Jahren erfreulich nahegekommen.
»Hm, warum ist der Briefträger immer noch nicht da?« Ernestine stand auf, um zum wiederholten Male an diesem Morgen zum Briefkasten zu gehen und den Inhalt zu überprüfen.
»Hörst du mir eigentlich zu?«, fragte Anton, als sie wieder zurückkam. Er legte die Zeitung zur Seite. Für gewöhnlich war Ernestine eine aufmerksame Zuhörerin. Es entging ihr nichts. Heute wirkte sie unkonzentriert.
»Wie bitte?« Sie setzte sich wieder zu ihm, nahm die Zeitung und erschlug die Wespe mit einem gezielten Klatsch. »So, das Vieh ist nicht mehr lästig.«
Anton zog die Augenbrauen hoch und sah auf die tote Wespe am Tisch. Ernestine schnippte den gekrümmten Körper mit dem Zeigefinger ins Gras.
»Hätte es nicht gereicht, wenn du sie vertreibst?«
»Seit eines der Biester Rosa in den Daumen gestochen hat, kenne ich kein Erbarmen mehr mit den Viechern.«
Anton erinnerte sich an die Schwellung, die alle nur erdenklichen Farben angenommen und seine geliebte Enkeltochter dazu gezwungen hatte, auf ein Flötenkonzert zu verzichten. Ernestine hatte völlig recht, den Wespen musste der Kampf angesagt werden.
»Hast du mir zuvor zugehört?«, fragte er erneut.
»Ja, natürlich. Das tue ich immer, mein Lieber.«
»Dann beantworte meine Frage.« Anton verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich zurück.
»Ich finde auch, dass Heide müde ausschaut«, stimmte Ernestine ihm zu. »Ich glaube, sie arbeitet zu viel.«
Offenbar konnte Ernestine sich selbst dann auf seine Worte konzentrieren, wenn ihre Gedanken beim Briefkasten waren. Anton war wieder einmal beeindruckt.
»Meinst du, ich sollte sie unterstützen?«, fragte er. Eigentlich hatte er vorgehabt, die Sommermonate gemeinsam mit Ernestine in Kritzendorf im Stelzenhaus seines Freundes zu verbringen, aber wenn Heide seine Hilfe benötigte, würde er darauf verzichten. Auch im nächsten Jahr würde es einen Sommer geben.
»Ihr hin und wieder unter die Arme zu greifen wäre bestimmt gut. Zumindest, bis sie Ersatz für Friedrich gefunden hat«, sagte Ernestine.
Friedrich war der Apothekengehilfe, den Heide vor ein paar Monaten eingestellt hatte. Letzte Woche hatte er gekündigt, da er ins Mühlviertel zu seiner Schwester ziehen wollte. Jetzt war Heide wieder allein in der kleinen Apotheke.
»Ich werde gleich heute damit beginnen. Schade, dass Erich für sie keine Stütze ist.«
Erich war Antons Schwiegersohn. Im Frühling hatte Heide endlich seinen Antrag angenommen und den attraktiven Kriminalbeamten geheiratet. Er war ein ehemaliger Schüler von Ernestine, die es nicht lassen konnte, ihre neugierige Nase immer wieder in seine Ermittlungsarbeiten zu stecken. Bei diesen Unternehmungen waren Anton und sie wiederholt in gefährliche Situationen geraten, gleichzeitig hatten sie Erich bei seiner Arbeit unterstützen und bei der Aufklärung kniffeliger Mordfälle mithelfen können.
Wieder stand Ernestine auf, um zum Briefkasten zu gehen.
»Worauf wartest du?«, fragte Anton.
Statt zu antworten, verschwand Ernestine im Treppenhaus. Kurz darauf kehrte sie mit beschwingten Schritten und höchst zufriedenem Gesichtsausdruck zurück. In der Hand hielt sie ein bereits geöffnetes Kuvert. Sie hatte den Brief gelesen und wedelte freudig damit in der Luft.
»Auf dieses Schreiben habe ich gewartet!« Sie lächelte Anton strahlend an. »Es sind wundervolle Nachrichten.«
»Ach ja?« Anton war vorsichtig.
Ernestines Vorstellung von wundervollen Nachrichten deckten sich nicht immer mit denen von Anton, der seinen Alltag gern gemütlich anging. Am besten mit einem guten Stück Gugelhupf im Schatten des Nussbaums im Garten. In den letzten Jahren hatte er Ernestine zuliebe an Tangotanzkursen teilgenommen, am Rundtanzen im Eislaufverein, er war in die Operette gegangen und zum Wetten auf die Trabrennbahn. Wundervolle Nachrichten konnten seine wohlverdiente Ruhe rasch in Gefahr bringen.
»Wir haben eine Zusage bekommen.« Ernestine zwinkerte ihm zu.
»Wofür? Haben wir uns um etwas beworben?«
»Ab morgen sind wir Schauspieler!«
Anton klopfte sich an sein Ohr. Ganz bestimmt hatte er sich eben verhört.
»Für den Dreh des ›Rosenkavaliers‹ wurden Statisten gesucht«, erklärte Ernestine stolz. »Wir sind zwei davon, ich habe uns angemeldet, und wir haben tatsächlich eine Zusage bekommen. Morgen schon beginnen die Kostümproben. Wir werden Rokokokostüme tragen. Ist das nicht großartig?«
Anton war völlig sprachlos. Rokokokostüme bei dieser Hitze? Rosenkavalier? Film? Er verstand bloß Bahnhof.
»Robert Wiene führt die Regie. Du warst doch vom Cabinet des Dr. Caligari begeistert. Jetzt dürfen wir den Mann persönlich kennenlernen und mit ihm arbeiten«, fuhr Ernestine begeistert fort. Ihre Wangen glühten vor Aufregung.
Anton wagte es nicht, zuzugeben, dass er die Hälfte des Stummfilms verschlafen hatte.
»Hugo von Hofmannsthal schreibt das Libretto zum Film, und die Musik stammt von Walzerkönig, Richard Strauss. Wir werden auf die ganz Großen der Kunstszene stoßen.«
Ernestine klatschte vor Freude in die Hände und hatte Ähnlichkeit mit Rosa, wenn sie länger aufbleiben durfte oder die Ferien vor der Tür standen.
Anton war immer noch sprachlos. Was war die Aufgabe von Statisten? Musste er sich den ganzen Tag die Füße in den Bauch stehen, während im Hintergrund Opernmusik erklang? Die Vorstellung war alles andere als erstrebenswert.
Ernestine trat auf ihn zu, beugte sich zu ihm und drückte ihm einen überschwänglichen, aber zärtlichen Kuss auf die Wange. »Du wirst den Filmdreh lieben«, versprach sie.
»Das bezweifle ich«, brummte Anton. Erst beim dritten Kuss lenkte er ein und ließ sich breitschlagen. Überzeugt war er deshalb lange noch nicht.
Schon am nächsten Morgen drängte Ernestine ihn zur Eile. »Beeil dich, Anton. Wir wollen doch nicht zu spät kommen.«
Anton hasste nichts mehr, als sich hetzen zu müssen. Sein ganzes Berufsleben lang hatte er schnell frühstücken müssen. Jetzt, im wohlverdienten Ruhestand, wollte er den Tagesbeginn gemütlich angehen. Widerwillig trank er seinen Milchkaffee aus und stellte das leere Häferl in die Spüle. Er langte nach seinem Strohhut und trat aus dem Kutscherhäuschen. Ernestine trug ein geblümtes Sommerkleid mit einem dazu passenden zitronengelben Sonnenhut. Ihre grauen Locken lugten darunter hervor. Gerade als Anton ihr ein Kompliment machen wollte, hüpfte Antons Enkeltochter Rosa aus dem Haus. Gemeinsam mit ihrer Mutter und Erich bewohnte sie Antons alte Wohnung, die für die Familie umgebaut worden war. Rosa hatte bald ihr zweites Schuljahr beendet und fieberte den Sommerferien entgegen. Ihr blondes Haar war artig zu zwei Zöpfen geflochten. Bestimmt war das Heides Werk. Ein paar der widerspenstigen Strähnen hatten sich schon wieder gelockert. Sie gaben Hinweis auf Rosas Temperament. Sie war ein aufgeweckter Wildfang, der stets für Abwechslung im Haus sorgte und Antons ruhiges Leben, ähnlich wie Ernestine, immer wieder auf den Kopf stellte.
»Opa, ich beneide dich!«, rief sie. »Du wirst ein Schauspieler.« Sie umarmte ihn so stolz, als hätte Anton sich eben in Harold Lloyd verwandelt.
»Na, so würde ich das nicht bezeichnen«, sagte er bescheiden.
»Du musst mir am Abend alles erzählen«, forderte Rosa. »Ich komme gleich nach dem Flötenunterricht zu euch.«
Anton hoffte inständig, dass Rosa heute auf eine Darbietung der neuesten Flötenstücke verzichten würde. Er liebte Rosa über alles, aber die Talente seiner Enkeltochter lagen eindeutig im Bereich der Bewegung. Sie war eine begnadete Eisläuferin und hervorragende Schwimmerin, aber beim Musizieren haperte es gewaltig.
»Ich werde in der Schule allen erzählen, dass mein Opa jetzt ein Schauspieler ist.«
»Ich bin bloß ein –« Weiter kam er nicht, denn Ernestine ergriff Antons Hand und zog ihn energisch mit sich.
»Wir freuen uns auf dich heute Abend. Dein Opa macht Palatschinken für uns.«
Sie schickte Rosa eine Kusshand und drängte Anton aus dem Garten. Das Mädchen winkte ihnen freudig hinterher. Die Palatschinken waren Antons Lichtblick für den Tag.
ZWEI
Mit der Straßenbahn fuhren sie die Mariahilfer Straße hoch bis zur Gumpendorfer Straße, wo die Filmfirma Listo ihren Sitz hatte. Listo war vor sechs Jahren vom jüdischen Kaufmann Heinrich Moses Lipsker und dem Zigarettenhülsenfabrikanten Adolf Stotter gegründet worden. Der Name setzte sich aus den Initialen der beiden Besitzer zusammen. Obwohl es für viele Filmfirmen aufgrund der starken Konkurrenz aus Übersee immer schwieriger wurde zu überleben, gelang es Listo, sich weiterhin am Markt zu behaupten. Das Unternehmen verfügte über ein gut ausgebautes Atelier. Listo setzte auf Filme, in denen die jüdische Identität eine tragende Rolle spielte. »Der verbrannte Jude« oder »Die gekreuzigt wurden« hatten zahlreiche Zuschauer in die Lichtspieltheater gelockt. Mit dem Rosenkavalier wollte man Oper und Film würdig miteinander verbinden. Gedreht werden sollte im Studio in der Gumpendorfer Straße, im Schlosstheater in Schönbrunn und an Schauplätzen in Niederösterreich. Für die aufwendige Produktion wurden weder Kosten noch Mühen gescheut. Die Premiere würde in der Semperoper in Dresden stattfinden mit Beteiligung eines großen Orchesters. Mit all diesen Informationen fütterte Ernestine Anton, während sie neben ihm auf der hölzernen Bank saß.
Die Bim hielt nur wenige Meter vom Filmgebäude entfernt. Es war ein dreistöckiger rotbrauner Backsteinbau mit einer frisch renovierten Fassade und einem verglasten Dachgeschoß, wo sich die Studios befanden. Vor dem Eingang des Gebäudes hatte sich eine lange Schlange Wartender gebildet. Menschen in allen Altersgruppen hofften darauf, eingelassen zu werden. Ernestine und Anton reihten sich am Ende ein.
»Gibt es hier etwas gratis?«, fragte Anton. Seine Laune sank auf einen Tiefpunkt. »Es kann Stunden dauern, bis wir drankommen.«
»Aber nein«, beruhigte ihn Ernestine. »Sieh nur, die Menschen geben ihre Einladungen ab und gehen ins Gebäude. Ich bin so aufgeregt. Wie es wohl im Inneren aussehen wird?«
Sie drückte Antons Hand. Sosehr er sich auch bemühte, seine Begeisterung hielt sich in Grenzen.
»Haben Sie auch eine Einladung bekommen?« Die junge Frau, die sich hinter ihnen anstellte, wirkte gehetzt. Sie hatte einen hochroten Kopf, ihr orange gefärbtes Haar hatte sich unter ihrem Hut gelöst und hing ihr strähnig ins schmale Gesicht. Sie schien das letzte Stück des Weges gelaufen zu sein.
»Ja«, sagte Ernestine.
»So ein Glück«, schnaufte die Frau. »Ich hatte schon Angst, dass ich zu spät bin.« Sie verzog entschuldigend den hübschen Mund. »Wäre nicht das erste Mal, dass ich einen Termin verschlafe.«
»Haben Sie schon öfter als Statistin gearbeitet?«, erkundigte sich Ernestine.
Die Frau lachte und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich kann gar nicht mehr mitzählen.«
»Wirklich?« Ernestines Augen weiteten sich in Bewunderung.
Die Frau nickte. »Jedes Mal hoffe ich, dass ich diesmal entdeckt werde. Ich bin Schauspielerin und trete in kleinen Rollen im Carltheater auf. Aber mein großer Traum ist der Film. Leider hilft es hier nichts, wenn man eine klare Artikulation und eine kräftige Stimme hat. Beim Stummfilm ist ausdrucksstarke Mimik gefragt.«
»Nun, vielleicht gelingt es eines Tages, den Ton mit auf die Leinwand zu bringen«, meinte Anton. »Dann wird es auch beim Film echte Schauspieler geben.« Es war kein Geheimnis, dass er die übertriebene Mimik der Künstler im Lichtspieltheater in der Komödie schätzte. Er mochte Filme mit Charly Chaplin oder Buster Keaton, aber Liebesfilmen und Monumentalaufnahmen konnte er nichts abgewinnen.
Die junge Frau stellte ihre Umhängetasche auf den Boden und holte einen zusammenklappbaren Hocker heraus. »Wollen Sie?« Sie hielt das praktische Utensil, das für Maler gedacht war, Ernestine entgegen. »Das Warten kann mitunter sehr lange dauern.«
Ernestine winkte dankend ab. Sie schaute zu Anton. »Aber mein Freund nimmt ihn sicher gern.«
»Willst du damit andeuten, ich wäre alt und klapprig?«, brummte er beleidigt.
»Nein, ich will dich bloß an dein Knie erinnern«, entgegnete sie fürsorglich.
»Dann nehme ich den Hocker gern«, sagte er.
Die junge Schauspielerin klappte den Hocker auf und reichte ihn Anton. »Mein Name ist übrigens Minna Meisel.« Sie streckte zuerst Ernestine, dann Anton die Hand entgegen. Ihr Händedruck war für eine so kleine, zierliche Frau ungewohnt kräftig.
»Freut mich. Ich bin Ernestine Kirsch, Lateinlehrerin im Ruhestand.«
»Anton Böck, Apotheker im Ruhestand.«
»Oh, wie schön, und jetzt gönnen Sie sich ein bisschen Filmluft. Wie aufregend.« Fräulein Meisel schulterte ihre leere Tasche wieder. »Hoffentlich werden wir alle drei genommen.«
»Ist das denn noch nicht sicher?«, fragte Ernestine.
»Heute findet bloß die Auswahl der Laienschauspieler statt«, erklärte Fräulein Meisel. »Die Regieassistenten wählen die Statisten aus, die ihnen passend erscheinen. Die Gesichter, die ihnen nicht zusagen, müssen wieder gehen.«
»Ach ja?« Antons Stimmung hellte sich auf. Ein Lichtblick tat sich am Horizont auf. Er währte nicht lange, denn Ernestine durchschaute ihn sofort.
»Mach dir keine Hoffnung, Anton. Dein Gesicht ist ausdrucksstark, hübsch und sympathisch. Du wirst mit Sicherheit genommen.«
Selten hatte er sich über ein Kompliment so wenig freuen können. Er ließ sich auf dem Hocker nieder. Gerade als er es sich bequem machen wollte, musste er wieder aufstehen und seine Sitzgelegenheit verrücken.
Eine Frau drängte ungeduldig an ihm vorbei. »Gehen Sie doch aus dem Weg.« Ungehalten wedelte sie mit einem Federfächer vor seiner Nase. Anton musste niesen. Ein Raunen ging durch die Wartenden. Alle bis auf Anton sprangen zur Seite.
Die Frau trug ein silbernes Paillettenkleid mit langen Ärmeln, was angesichts der Temperaturen erstaunlich war. Mit dem Kleid hätte sie bei jeder Abendveranstaltung ein passendes Bild abgegeben. Sie sah hinreißend aus. Ihr Gesicht war geschminkt, was ihre ohnehin attraktiven Züge noch weiter hervorhob. Die Augen umrahmten dunkle Striche, die Wangen waren leicht gerötet. Gerade so viel, dass es aussah, als hätte sie eben eine Stunde an der frischen Luft verbracht. Ihre Lippen glänzten verführerisch. Ihr kinnlanges Haar war streng nach hinten gekämmt und mit einem zum Kleid passenden Stirnband fixiert. Eine Feder, die farblich zum Fächer passte, steckte seitlich darin.
Anton schob den Hocker weg und trat zur Seite. »Bitte schön!« Er machte eine einladende Geste.
»Danke, mein Bester.«
Ihre Stimme klang unangenehm hoch. Sie passte nicht zu ihrem atemberaubenden Aussehen. Sobald sie genug Platz hatte, schwebte sie förmlich an Anton vorbei. Jeder ihrer Schritte erinnerte an einen Tanz, so präzise und geschmeidig bewegte sie sich. Eine betörende Duftwolke blieb zurück. Das blumige Parfüm kratzte in Antons Nase. Erneut nieste er.
»Gesundheit«, sagte Ernestine.
»Das war Louise Toupie«, flüsterte Fräulein Meisel ehrfurchtsvoll. »Sie spielt die Hauptrolle im Film.«
Ernestine sah der Frau nach. »Ich wusste, dass Louise Toupie schön ist. Aber in Wirklichkeit gleicht sie einer Göttin.«
»Einer Göttin mit schriller Stimme«, ergänzte Anton. In seinen Ohren hallte der Ton immer noch nach.
»Ist es nicht aufregend, dass wir die Diva kennenlernen werden?« Ernestine war entzückt.
»Machen Sie sich nicht zu viel Hoffnungen.« Fräulein Meisel bremste ihre Begeisterung. »Frau Toupie ist sehr wählerisch. Für gewöhnlich lässt sie sich nicht dazu herab, um mit Statisten zu sprechen.«
»Nun, wir werden sehen«, sagte Ernestine. Sie reihte sich wieder in die Warteschlange ein.
Anton nahm leidend wieder auf dem Hocker Platz und fragte sich, warum er sich das hier antat, wenn er doch zu Hause im Garten Zeitung lesen oder Heide in der Apotheke helfen könnte. Ernestine legte ihm liebevoll die Hand auf die Schulter, und er hatte die Antwort auf seine Frage. In seinem Innersten hoffte Anton, dass sein Gesicht den Filmemachern nicht ins Konzept passte.
Seine Wünsche wurden vom Universum ignoriert. »Sie da, wie heißen Sie?« Der Mann mit der Zigarette in der einen und dem Klemmbrett in der anderen Hand zeigte auf Anton. Er war einer der Regieassistenten und zuständig für die Statisten. Anton drehte sich um. Sicher meinte er eine andere Person weiter hinten. Aber der Mann kam direkt auf ihn zu. »Können Sie tanzen?«
Noch bevor Anton antworten konnte, kam ihm Ernestine zuvor. »Mein Freund ist ein hervorragender Tänzer. Wir haben gemeinsam einen Tangotanzkurs absolviert.«
Mit Schrecken erinnerte sich Anton an die gemeinsamen Tanzstunden am Semmering. Sosehr er Ernestine verehrte und schätzte, auf der Tanzfläche fanden sie einfach nicht zusammen. Ernestine hatte ein anderes Verständnis vom Takt als er. Auch beim Rundtanzen am Eis war es besser gewesen, wenn sie sich mit anderen Partnern zur Musik bewegt hatten.
»Tango interessiert mich nicht, können Sie sich zum Walzer drehen?«, wollte der Assistent wissen.
»Ich, also –«
Ernestine unterbrach Antons Stottern. »Wir sind begnadete Walzertänzer.«
Fassungslos starrte Anton sie an. Hatte sie das wirklich eben gesagt? Ernestine lächelte entschuldigend. Sie wünschte sich die Statistenrolle so sehr, dass sie bereit war zu lügen, ohne dabei mit der Wimper zu zucken.
Der Filmmensch musterte sie mit zusammengekniffenen Augen, machte einen Schritt rückwärts, um beide in voller Größe anzusehen. »Ja, das kann passen«, meinte er. »Tragen Sie Ihre Namen in der Liste bei meiner Kollegin ein und gehen Sie zur Kostümanprobe. Wir werden Sie bei den Dreharbeiten im Schlosstheater in die erste Reihe stellen. Sie sehen aus wie ein in die Jahre gekommener Baron mit seiner nicht mehr ganz taufrischen Ehefrau. Genau das brauchen wir.«
War das eben eine Beleidigung? Noch bevor Anton eine Antwort finden konnte, widmete der Mann sich den Nächsten in der Warteschlange.
Anton nahm Ernestine an der Hand und zog sie zur Seite. »Wie kannst du behaupten, wir wären ein eingespieltes Tanzpaar?«
»So ein paar Schritte im Dreivierteltakt kann nicht die Schwierigkeit sein.«
»Wann hast du das letzte Mal einen Linkswalzer getanzt?«
Ernestine steckte ihren Daumennagel in den Mund zum Nachdenken.
»Du kannst keinen Linkswalzer?«
»Ganz Wien tanzt im Fasching Linkswalzer, da werde ich es doch auch erlernen«, sagte sie zuversichtlich.
Anton seufzte. Er sah seine friedlichen Sommerabende dahinschmelzen und sich selbst und Ernestine beim blechernen Klang seines Grammophons im Garten Walzertanzen üben. Was grundsätzlich romantisch sein könnte. In ihrem Fall aber in anstrengenden Diskussionen enden würde.
Eine junge Frau mit einer modischen Bobfrisur und einem schicken dunklen Kleid winkte sie zu einem Tisch. Statt einer Kette hing eine Krawatte um ihren Hals. Sie wirkte überheblich und unfreundlich. Auf einem goldenen Namensschild an ihrer Brust stand: »Regieassistenz«.
»Tragen Sie hier Ihre Namen ein!«, forderte sie. Es war keine Bitte, sondern ein Befehl.
Nur zu gern kam Ernestine dem Wunsch nach, sie schien die Unfreundlichkeit in der Stimme gar nicht zu bemerken. Stolz setzte sie ihren eigenen Namen und den von Anton auf eine Liste. Kaum war es erledigt, erhielt jeder von ihnen einen kleinen Zettel überreicht.
»Damit gehen Sie zur Kostümprobe«, sagte die Frau schnippisch. »Das ist der Raum ganz am Ende des Gangs. Rasch jetzt. Die Nächsten warten schon.« Sie scheuchte sie weg wie lästige Insekten.
Auch Minna Meisel hatte ihren Namen in die Liste eingetragen. Sie stand hinter Anton und Ernestine, wurde aber von der unhöflichen Frau in einen anderen Raum geschickt. Bevor sie ging, flüsterte sie ihnen zu: »Das war Anouk Faucon. Die Frau ist eine Hexe. Lassen Sie sich nichts von ihr gefallen. Sie hält sich für unglaublich wichtig. Aber das ist sie nicht.«
»Ist sie Französin?«
»Ich glaube es nicht, aber sie ist furchtbar stolz auf ihren Namen und faucht jeden an, der ihn nicht richtig ausspricht.« Minna Meisel kicherte hinter vorgehaltener Hand. »Böse Zungen behaupten, dass es ein Künstlername ist, den sie sich ausgedacht hat, um wichtig zu erscheinen. Genau wie Louise Toupie. Aber sicher wissen tut es niemand.«
»Woher wissen Sie das alles?«, fragte Ernestine beeindruckt.
Fräulein Meisel zuckte bloß mit den Schultern. »Ich habe schon so oft Statistenrollen übernommen, dass es kaum jemanden beim Film gibt, dem ich nicht schon mal begegnet bin oder von dem ich nicht schon mal was gehört habe.«
Anton ergänzte in Gedanken, dass die junge Frau wohl ein großes Interesse an Klatsch und Tratsch zu haben schien. Sie und Ernestine würden sich großartig verstehen.
Anouk Faucon zeigte mit mürrischerem Blick einen fensterlosen Flur entlang. Vielleicht hatte sie die Worte von Frau Meisel gehört, sie wirkte noch grimmiger als zuvor. »Worauf warten Sie noch, los, gehen Sie! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit für Statisten.«
Als sie außer Hörweite waren, brummte Anton verärgert: »Die gute Frau ist wohl mit dem linken Fuß aufgestanden.«
Ernestine nahm seine Bemerkung nicht wahr. Sie schien immer noch im Filmhimmel zu schweben. Glücklich lächelnd marschierte sie den Gang entlang. Frau Faucon konnte ihre Seligkeit nicht trüben.
An den Wänden rechts und links hingen Fotografien von Schauspielern und Schauspielerinnen, die für Listo-Filme gearbeitet hatten.
Bei jedem Bild hielt Ernestine an. »Kennst du den Mann?«
Anton las den Namen: »Hans Moser.« Er schüttelte den Kopf. »Noch nie gehört.«
»Er schaut lustig aus«, meinte Ernestine.
Sie setzten ihren Weg fort. Die Tür zur Garderobe stand weit offen. Eine Geruchsmischung aus Staub, Parfüm, Puder und Schweiß schlug ihnen entgegen. Der Raum war vollgesteckt mit Kostümen. Sie hingen auf Kleiderstangen, die in langen Reihen den Raum in schmale Gänge teilten. Die Stangen bogen sich unter der Last aus buntem Stoff und Rüschen. In einer Ecke probierten Statisten hinter Vorhängen Kleider. Eine Frau, die aus einer der Stoffkabinen hervortrat, sah aus wie ein Zimmermädchen. Andere verwandelten sich in Köchinnen oder Diener.
»Ich hoffe, wir bekommen schönere Kleider«, flüsterte Ernestine.
Schon kam eine Frau in weiten, ausgestellten Hosen zu ihnen. Ihr blondes Haar war radikal kurz geschnitten. Sie hielt eine Zigarette auf einem Zigarettenhalter von sich. Mit der anderen Hand nahm sie ihnen die Zettel ab. »Kommen Sie mit.« Sie nahm einen Zug von der Zigarette und blies den Rauch seitlich aus. »Mein Name ist Elfi Horvath. Ich bin für die Kostüme zuständig.«
Die Frau ging ihnen voraus. Sie humpelte. Eines ihrer Beine war steif. An zwei hohen Spiegeln und einem Kleiderständer, der mit Federboas und Ketten behängt war, ging es in den hinteren Teil des Raums. Hier befand sich eine Kleiderstange mit Kostümen aus Spitze, Rüschen und Tüll. Die Farben der Stoffe waren kräftig. Sattes Rosarot hing neben Flaschengrün und Sonnengelb.
»Die Kostüme sind kleine Kunstwerke«, erklärte Frau Horvath stolz. »Wir haben sie eigens für den Film in der Wiener Werkstätte anfertigen lassen. Die Stoffe wurden extra für uns entworfen und bedruckt. Künstlerinnen haben sich wochenlang mit dem Rokoko beschäftigt. Sehen Sie sich nur die herrlichen Muster an.«
Sie zog eines der Kleider hervor. Es bestand aus drei übereinanderliegenden Stoffschichten. Ein üppiges Rosenmuster bildete die unterste Lage, dazu passende Rot- und Rosatöne die darüberliegenden. Mit Schleifen und Maschen waren die Stoffbahnen wie Vorhangteile hochgebunden und zu Rüschen drapiert, sodass alle Muster sichtbar waren.
Frau Horvath hielt Ernestine das Kleid an den Körper. Sie kniff die Augen zusammen und spitzte die knallroten Lippen. Auch sie war stark geschminkt. Offenbar gehörte das beim Film dazu. »Hm, ich glaube, wir brauchen einen anderen Farbton.«
Sie hing das Kleid zurück und langte zielstrebig nach dem daneben. Es war türkis und dunkelgrün mit zarten Rüschen in Himmelblau. »Das unterstreicht Ihre Augen«, erklärte Frau Horvath. Sie reichte Ernestine das Kleid. »Dazu brauchen wir ein Mieder und eine Perücke. Ich bin gleich wieder da.« Sie ging zur anderen Seite des Raums, wo auf einer Kommode Perückenständer aufgereiht waren.
»Was meinst du, sieht das Kleid nicht umwerfend aus?«
Anton suchte nach diplomatischen Worten, ohne dabei lügen zu müssen. Er wollte Ernestines gute Laune nicht zerstören. Die Rüschen, Schleifen, Tüllschichten hätten Rosa vor Entzückung aufjauchzen lassen, ihn erfasste eine Unruhe. Er fühlte sich von dem Farben- und Musterrausch schier erdrückt, dabei hielt Ernestine das Ding bloß in der Hand und hatte es noch nicht einmal an.
Ein Schluchzen ließ ihn aufhorchen. Auch Ernestine nahm es wahr. Sie drehten sich zeitgleich um. Hinter ihnen kniete eine Frau neben einem der vielen Spiegel. Sie packte Kämme und Flaschen in eine Ledertasche.
»Können wir Ihnen helfen?«, fragte Ernestine.
Erschrocken zuckte die junge Frau zusammen. Ihre Augen waren rot unterlaufen, ihre Schminke verschmiert. Rasch wischte sie mit dem Handrücken die Tränen weg und machte das Malheur in ihrem Gesicht damit noch schlimmer.
»Nein, danke«, schniefend rappelte sie sich auf. Es war ihr sichtlich unangenehm, weinend entdeckt worden zu sein. Sie trug ein geschmackvolles cremefarbenes Kleid, dessen Ärmel Schminkspuren aufwiesen. Das braune Haar, das zu einer adretten Flechtfrisur hochgesteckt war, löste sich hier und dort. Gerade als sie weggehen wollte, kehrte Frau Horvath mit zwei Perücken zurück.
»Franzi, was ist los?«, fragte sie betroffen.
»Sie will mich rauswerfen lassen.« Die Stimme der Frau war piepsig und brüchig.
Frau Horvath reichte Ernestine die Perücken, langte in ihre Hosentasche und holte ein geblümtes Taschentuch heraus. Sie reichte es der weinenden Frau. »Das kann sie nicht machen. Du bist eine großartige Maskenbildnerin und die beste Friseurin, die wir je hatten. Sieh dir nur mein Haar an.« Stolz fasste sie sich mit beiden Händen an ihren Kurzhaarschnitt. Die Zigarette hatte sie am Weg irgendwo entsorgt.
»Angeblich habe ich Frau Toupies Frisur zerstört. Sie beschwert sich gerade bei Robert Wiene über mich und verlangt nach einer anderen Friseurin. Wenn sie ihren Willen durchsetzt, bin ich meine Anstellung los. Ich brauche das Geld. Ohne regelmäßiges Einkommen bin ich aufgeschmissen.«
»Mach dir keine Sorgen, Schätzchen.« Beschwichtigend legte Frau Horvath ihre Hand auf die Schulter der Friseurin. Die Geste wirkte eine Spur zu vertraut für Arbeitskolleginnen.
»Wiene kennt Louise. Er weiß, wie schwierig sie ist. Sie sollte aufpassen, dass sie mit ihren Spielchen nicht übertreibt. Wiene will auch hinter der Kamera seine Leute behalten. Er weiß, wie wichtig wir alle sind. Louise sollte sich ein bisschen mehr vorsehen, denn Caroline Pressbaum wartet bereits in den Startlöchern. Sollte Toupie sich einen groben Schnitzer leisten, kommt Pressbaum zum Zug.« Sie schürzte die Lippen. »Wobei ich bezweifle, dass sie freundlicher mit den Leuten hinter der Leinwand umgehen wird.«
Die junge Frau schniefte leise.
»Alles wird gut. Mach dir keine Sorgen.«
Die Worte schienen die junge Friseurin nicht beruhigen zu können. Sie prustete traurig in das Taschentuch, wischte damit über ihre Augen und verteilte die schwarze Farbe nun auch auf die Wangen und den Mund. Sie sah aus wie ein trauriger Clown.
»Ich brauche hier noch ein bisschen, geh in der Zwischenzeit in die Cafeteria, ich komme nach, sobald ich etwas Luft habe. Trink einen Kaffee oder eine kühle Limonade. Dann besprechen wir in Ruhe, was zu tun ist.« Frau Horvath schob die verzweifelte Kollegin zum Ausgang. Sie streichelte ihr dabei kaum merklich über den Rücken. »Wir finden eine Lösung, versprochen.« Die junge Frau fügte sich bereitwillig.
»Gibt es Probleme?« Ernestine konnte es nicht lassen. Die Neugier lag ihr im Blut. Antons vorwurfsvollen Blick, der sie wegen ihres Verhaltens gern in die Schranken wies, ignorierte sie geflissentlich.
»Ach, es ist immer das Gleiche.« Frau Horvath machte eine wegwerfende Handbewegung. Sie schien auf die Frage gewartet zu haben, um sich über die Hauptdarstellerin auslassen zu können. »Sobald Louise Toupie eine bedeutende Rolle spielt, gibt es Probleme am Filmset. Diesmal hat sie es auf Franziska abgesehen. Dabei ist Franziska Schilling eine talentierte Maskenbildnerin. Sie kann nichts dafür, dass Toupie Falten bekommt und einen frustrierten Mund hat. Da hilft auch die beste Schminke der Welt nicht. Das ist nicht zu verbergen.«
Anton hatte zuvor vor lauter Schminke keine Falten gesehen und fragte sich, wie ein frustrierter Mund aussah.
»Wird Fräulein Schilling jetzt Schwierigkeiten bekommen?«, wollte Ernestine wissen.
»Das werde ich zu verhindern wissen«, antwortete Frau Horvath entschlossen. »Das arme Ding hat so schon genug Probleme am Hals. Ich werde ein gutes Wort an den richtigen Stellen für sie einlegen.«
Für Anton klang das alles nach einer riesigen Schlangengrube. Nur zu gern wäre er auf der Stelle gegangen. Ernestine hingegen war in ihrem Element. Ihrer Neugier waren Türen und Tore geöffnet.
»Wie traurig«, meinte sie einfühlsam. »Ein so junger Mensch sollte ein sorgenfreies Leben führen dürfen.«
»Wer kann das schon?« Frau Horvath seufzte laut, als spreche sie von sich selbst. »Wenn Sie mit Ihren Perücken nicht zurechtkommen, wenden Sie sich an Fräulein Schilling. Sie sorgt dafür, dass sie im Nu wieder sitzen.«
»Bekommen wir beide Perücken?« Anton fasste sich an seine grauen Schläfen.
»Ja, natürlich. Aber zuvor brauchen wir noch ein Kostüm für Sie.« Frau Horvath musterte Anton vom Scheitel bis zur Sohle. »Ich rate zu etwas Elegantem. Einem hübschen Rüschenhemd. Statt des Sakkos nehmen wir nur eine Weste aus dunklem Samt und mit großen goldenen Knöpfen. So schlank, wie Sie sind, sieht das bestimmt gut aus. Wollen Sie weiße Strümpfe oder welche in Rosarot?«
»Rosarote Strümpfe?« Hatte Anton sich eben verhört. Der Fasching war längst vorbei.
»Na, ich schau mal, was wir haben.« Noch bevor Frau Horvath fertig gesprochen hatte, sauste sie los und flitzte trotz ihres steifen Beins durch die Reihen der Kleiderständer. Sie kehrte mit einer Kniebundhose in einem glänzenden Dunkelblau zurück.
»Ich habe weiße Strümpfe genommen«, erklärte sie. »Damit die Seidenschleifen voll zur Geltung kommen.« Jetzt erst entdeckte Anton die breiten Bänder. Sie dienten dazu, die Kniebundhosen festzubinden. Wo war er da nur wieder hineingeraten? Das Hemd, das Frau Horvath ihm entgegenhielt, war am Revers mit fliederfarbenen Rüschen versehen. Es war der Alptraum. Wenn einer seiner Freunde ihn so sehen und erkennen würde, wäre er bis zu seinem Lebensende ihrem Spott ausgesetzt. Wie gut, dass die Bilder bloß in Schwarz-Weiß auf der Leinwand gezeigt wurden.
Frau Horvath klatschte fröhlich in die Hände. »So, hopp, hopp!«, meinte sie. »Wir haben schon genug Zeit verloren. Ich muss noch zwanzig weitere Statisten ausstatten. Die Garderoben befinden sich im Nebenraum. Ich komme zu Ihnen, sobald Sie alles anhaben. Mit den Perücken helfe ausnahmsweise ich Ihnen, Franzi braucht eine kleine Pause.«
Als Anton kurz darauf vor einem goldgerahmten Spiegel stand, war er sich nicht sicher, ob er lachen oder weinen sollte. Er sah lächerlich aus. Seine Waden steckten in weißen Strümpfen, die Schuhe, die man ihm gereicht hatte, hatten Absätze und Goldschnallen. Er fühlte sich damit wie ein herumstolzierender Gockel. Er musste sich konzentrieren, um nicht zu stolpern. Das Schlimmste aber waren die lila Schleifen unterhalb seiner Knie und in der Perücke. Das weiß gepuderte Monstrum hatte einen schulterlangen Zopf, der ebenfalls von einer Seidenschleife zusammengebunden war.
Frau Horvath kam auf ihn zu und schien entzückt. »Wunderbar!«, meinte sie freudestrahlend.