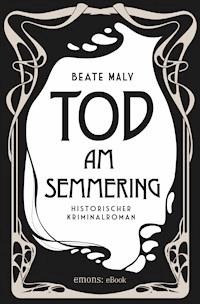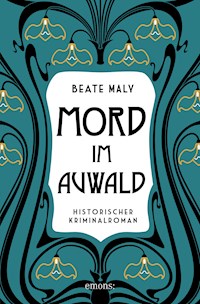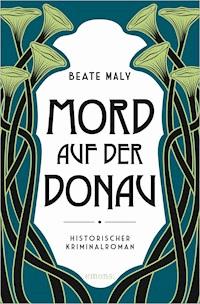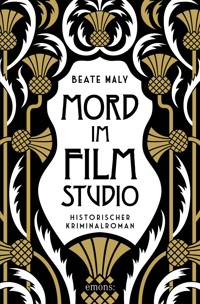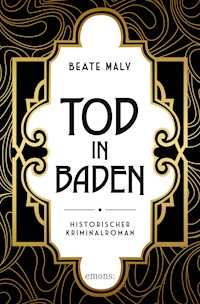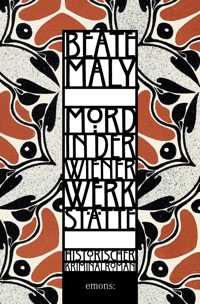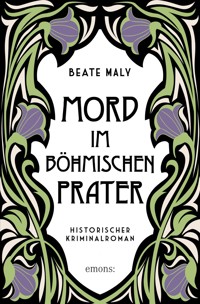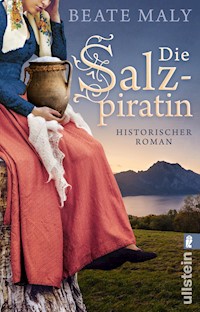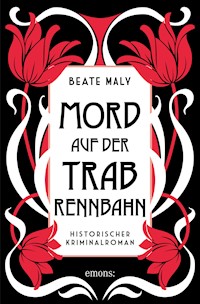9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für alle Sinne: zarte Stoffe, kräftige Farben und eine Heldin, die um ihr Glück kämpft Nürnberg, 1535: Für Emilia gab es nichts Schöneres, als ihrem Vater beim Malen zuzuschauen und selbst mit Farben zu experimentieren. Doch nach dem Tod des Vaters muss sie allein für ihre Schwestern aufkommen. Als Wirkerin hilft sie der berühmten Kunigunde Löffelholz bei der Herstellung von Tapisserien. Heimlich malt sie außerdem Auftragsporträts ihres Vaters weiter. Dabei wird sie von einem reisenden Künstler erwischt. Jan Vermeyen schwört, ihr Geheimnis für sich zu behalten, und die beiden verlieben sich ineinander. Doch die Schulden der Familie werden erdrückend, und in ihrer Not nimmt Emilia den Antrag eines reichen Tuchkaufmanns an. Jan verlässt die Stadt und erfährt fast zu spät, dass Emilia enttarnt wurde und im Kerker auf ihren Prozess wartet. Wird er rechtzeitig kommen, um seine Geliebte zu retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Bildweberin
BEATE MALY, geboren in Wien, ist Bestsellerautorin zahlreicher Kinderbücher, Krimis und historischer Romane. Ihr Herz schlägt neben Büchern für Frauen, die entgegen aller Widerstände um ihr Glück kämpfen.
Von Beate Maly sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Hebamme von WienDie Hebamme und der GauklerDer Fluch des SündenbuchsDie DonauprinzessinDer Raub der StephanskroneDie SalzpiratinDie KräuterhändlerinFräulein Mozart und der Klang der LiebeDie Frauen von SchönbrunnDie Kinder von Schönbrunn
Beate Maly
Die Bildweberin
Historischer Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Februar 2024© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Umschlaggestaltung: zero-media.de, MünchenTitelabbildung: © Rebecca Stice / Trevillion Images
Autorenfoto: © Fabian Kasper E-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-3077-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nachwort
Leseprobe: Die Kräuterhändlerin
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
1
Nürnberg, 1534
Über dem Hauptportal der Kirche »Zu Unserer Lieben Frau« thronte die Statue Kaiser Karls IV. Wie jeden Tag zur Mittagsstunde öffneten sich nach dem Schlagen der Stundenglocke die beiden Türen links und rechts der vergoldeten Kupferstatue, und die sieben Kurfürsten traten heraus. Sie zogen dreimal um den goldenen Kaiser herum, der grüßend sein Zepter bewegte. Das technische Wunderwerk wurde von den Nürnbergern liebevoll »Männleinlaufen« genannt, doch nur die wenigsten schenkten dem Schauspiel besondere Beachtung.
Emilia Baumgart hatte sich das Spektakel angesehen und widmete ihre Aufmerksamkeit nun wieder dem bunten Treiben am Platz rund um den Schönen Brunnen mit seinen vierzig bunt bemalten und vergoldeten Figuren. Vorsichtig hielt sie den Einkaufskorb dicht an ihren Körper gepresst, damit ihr Einkauf nicht den gierigen Händen flinker Diebe zum Opfer fiel. Immer unverfrorener waren die Methoden der Burschen, die sich zu kleinen Banden zusammenrotteten, um noch hinterhältiger agieren zu können. Erst letzte Woche hatte einer von ihnen Emilias Schwester Barbara ein saftiges Stück Beinschinken und eine große Ecke Käse aus dem Korb stibitzt. Tagelang hatte die kleine Familie sich mit einfachem Hirsebrei zufriedengeben müssen. Emilia sehnte sich danach, endlich wieder etwas Würziges, Kaubares zwischen die Zähne zu bekommen.
Geschickt drängte sie sich durch die immer dichter werdende Menschenmenge. Kurz vor Marktschluss fanden sich besonders viele Käufer am Marktplatz ein. Sie kamen aus den umliegenden Dörfern, aber auch von weiter her, um am großen Nürnberger Markt erlesene Waren zu erstehen. Genau wie Emilia hofften sie, mit etwas Verhandlungsgeschick günstige Preise zu erzielen. Die meisten Händler wollten ihre Ware nämlich nicht wieder nach Hause schleppen. Lieber ließen sie vom veranschlagten Preis ein wenig nach.
Emilia hielt kurz an. Sie hörte Dialekte aus dem Süden wie aus dem hohen Norden des Reiches. Mehrere Wechsler boten ihre Dienste an. Bei ihnen konnten ausländische Käufer ihre Münzen gegen Nürnberger Währung eintauschen.
Es roch nach eingelegtem Hering, heißem Schmalzgebäck, gebratenem Spanferkel und geräuchertem Wildbret. An einem Stand wurden getrocknete Kräuter verkauft. Die Büschel hingen von einem Balken, den man über dem Verkaufstisch aufgebaut hatte. In großen Körben befanden sich abgerebelte Blättchen, die man lose nach Gewicht kaufen konnte. Emilia sog den würzigen Duft von Rosmarin, Lorbeer, Liebstöckel und wildem Thymian ein. Er erinnerte sie daran, dass sie in den nächsten Tagen Pflanzen fürs Färben der Garne und Stoffe sammeln musste. Ihre Dienstgeberin Kunigunde Löffelholz hatte sie schon mehrmals dazu aufgefordert, nur war bislang das Wetter zu schlecht gewesen.
Am nächsten Stand gab es exotische Gewürze aus fernen Ländern: Zimtrinde, Gewürznelken, Vanilleschoten. Emilia lief das Wasser im Mund zusammen angesichts all der Köstlichkeiten. Die Zutaten fürs eigene Abendessen hatte sie bereits im Korb: billige Flusskrebse, die die Fischer eimerweise aus der Pegnitz holten, und frisches Brot. Das Geld, das noch in dem kleinen Beutel an ihrem Gürtel lag, musste sie für andere Dinge als Nahrungsmittel aufbewahren. Zielstrebig ging sie an den Leder- und Tuchhändlern, den Hafnern und Knopfmachern vorbei. Sie verweilte nicht am Stand mit den hübschen, geklöppelten Spitzen aus Flandern und schenkte auch dem Käsestand keine Beachtung. Schnurstracks lief sie zum Farbenhändler Auer. Er kam nur zweimal im Monat in die Stadt, um seine Ware feilzubieten. Heute war eine dieser seltenen Gelegenheiten.
»Ein Zehennagel vom heiligen Antonius gefällig?« Ein Reliquienhändler trat ihr in den Weg und hinderte sie am Weitergehen. Seine bizarre Ware trug er in einem hölzernen Bauchladen vor sich her. »Oder lieber eine Locke der heiligen Barbara? Beides heute zum Spottpreis zu haben.«
»Danke, nein!«
Der Mann, dessen Kleidung schon bessere Tage gesehen hatte, ließ nicht locker. »Ich sehe, Ihr seid eine anspruchsvolle Kundin.« Er senkte die Stimme und beugte sich ganz nah zu ihr. Sein Atem roch unangenehm nach Zwiebeln.
Emilia trat einen Schritt zurück und stieß mit einer dicken Frau zusammen, bei der sie sich sofort entschuldigte. »Für Euch habe ich einen Splitter vom wahren Kreuze Christi. So was bekommt Ihr nicht alle Tage.«
»Auch daran habe ich kein Interesse. Vielen Dank!« Emilia wollte an dem aufdringlichen Mann vorbei, doch aus unerfindlichen Gründen sah er in Emilia eine potenzielle Kundin.
»Eine hübsche junge Frau wie Ihr kann gewiss den Segen und das Glück eines Heiligen benötigen.«
»Sehe ich etwa so aus, als würde ich Hilfe brauchen?« Der Verkäufer machte Emilia wütend.
»Jeder kann die Hilfe eines Heiligen brauchen«, meinte der Reliquienhändler versöhnlich. »Sorgen mit dem Liebsten zum Beispiel. Ihr seid immer noch nicht unter der Haube.« Er deutete auf ihre unberingte Hand. »Ein bisschen Hilfe von oben kann da nicht schaden.«
»Danke, darauf kann ich verzichten«, entgegnete Emilia verärgert. Was bildete dieser Mann sich ein? Es ging ihn überhaupt nichts an, ob sie einen Ehemann hatte oder nicht. »Ich vertraue auf meinen eigenen Hausverstand. Und nun tretet bitte zur Seite, damit ich weitergehen kann. Ich habe nicht ewig Zeit.«
Der Mann bewegte sich kein Stückchen.
»Ihr sollt mir nicht länger im Weg stehen, sonst rufe ich die Stadtwache. Und solltet Ihr es vergessen haben: Die Stadt Nürnberg bekennt sich zur Lehre Luthers.«
»Schon gut. Immer mit der Ruhe!« Er hob beschwichtigend beide Hände, drehte sich nach allen Seiten und hielt nach dem nächsten Opfer Ausschau, dem er seine fragwürdige Ware anbieten konnte.
Emilia fragte sich, wie viele Kreuze Christi es wohl geben mochte. In den fünfundzwanzig Jahren, in denen sie nun auf der Welt war, waren ihr so oft Splitter zum Kauf angeboten worden, dass man damit gut und gerne drei große Kreuze hätte zusammensetzen können. Als der lästige Mann endlich weiterging, warf Emilia einen Kontrollblick in ihren Korb. Zum Glück war alles noch da. Die Flusskrebse schienen für Diebe nicht so attraktiv zu sein wie ein großes Stück Schinken.
Emilia setzte ihren Weg fort. Am Ende der Reihe hatte der Farbenhändler seinen Stand aufgebaut. Es war bloß ein kleiner Tisch mit überschaubarem Angebot. In einem Holzkasten, der in mehrere Fächer unterteilt war, befanden sich winzige Mengen wertvoller Farbpigmente. Der Händler war ein kleiner, dünner Mann mit schütterem Haar und einer langen gekrümmten Nase, die ihm womöglich schon einmal gebrochen worden war. Als er Emilia erkannte, hellte sich sein Gesicht auf.
»Was für eine Freude! Die schöne Tochter von Walter Baumgart. Eine hübschere Maid gibt es nicht auf diesem Markt. Die Sonne erblasst angesichts Eurer Schönheit.« Er deutete eine Verbeugung an.
»Guten Tag, Herr Auer. Ihr könnt Euch die Komplimente für andere Kundinnen aufheben. Ich bin nicht hier, um schöne Worte zu hören.«
Der Farbhändler lächelte. »Das habe ich auch nicht erwartet. Dennoch seht Ihr allerliebst aus.«
»Danke.« Emilia wusste, dass sie hübsch war. Sie besaß zwar keinen eigenen Spiegel, aber Barbara hatte einen, den sie sich gelegentlich ausborgte. Emilia hatte das rötliche Haar ihrer Mutter geerbt, das in weichen Locken herabfiel, wenn sie es offen trug. Natürlich flocht sie es stets in sittsame Zöpfe, die sie wie eine Krone um ihren Kopf legte. Ihre Augen waren bernsteinbraun und ihre Haut stets von einer vornehmen Blässe, sah man von den Sommersprossen ab, die in der warmen Jahreszeit ihre Nase und Wangen überzogen. Wie der Reliquienhändler erkannt hatte, war sie immer noch ledig. Das lag nicht an fehlenden Heiratskandidaten, sondern daran, dass ihr Vater zu wenig Geld hatte, um eine Mitgift für beide Töchter zahlen zu können.
»Womit kann ich Euch heute dienen?«
»Mein Vater benötigt neues Farbpulver.«
»Hab ich es mir doch gedacht«, entgegnete der Farbenhändler. »Wo ist Euer werter Vater? Ich hoffe, er ist wohlauf und es fehlt seiner Gesundheit nichts.«
»Meinem Vater geht es sehr gut.« Emilia log, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie war es gewohnt, die Wahrheit zu beschönigen, wenn es um die Gesundheit ihres Vaters ging. Er war nach dem Tod seiner Frau in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen. An manchen Tagen schaffte er es nicht einmal aus dem Bett, so niedergeschlagen fühlte er sich. Die Ärzte konnten keinen Grund für seine Schwäche finden. Körperlich war er trotz seiner fünfundfünfzig Jahre kräftig und gesund. Aber sein Geist hatte keine Lebensfreude mehr. Es verging kein Tag, an dem er nicht erwähnte, dass er gerne sterben würde. Das war eine Sünde, denn niemand durfte sich den eigenen Tod wünschen. Wann das Leben endete, entschied Gott und niemand sonst.
»Das freut mich zu hören«, sagte Auer. »Welche Farben benötigt er denn diesmal?« Er zwinkerte Emilia aufmunternd zu. »Euer Vater hat großes Glück, dass seine Tochter über ein so ausgeprägtes Wissen und Verständnis für Farben und Malerei verfügt. Das ist keine Selbstverständlichkeit.«
Das war es in der Tat nicht. Emilia war durch eine harte Schule gegangen. Ganze Tage und manchmal auch Nächte hatte sie an der Seite ihres Vaters verbracht, um sein Handwerk zu erlernen. Sie beherrschte die hohe Kunst der Farbherstellung und wusste, wie wichtig es war, die Pigmente zu feinem Pulver zu zerreiben. Sie kannte sich aus, wie man die Farbe mit Öl, Ei und Wasser abrührte und wie man das Pulver und das Bindemittel mischte. Dazu brauchte man den Läufer, einen rund geschliffenen Stein, den man immer und immer wieder über eine Steinplatte ziehen musste, damit die feinen Farbpigmente vollständig mit Bindemittel umhüllt wurden. Für diese Arbeit waren Sorgfalt und Erfahrung erforderlich, denn nur so konnte eine geschmeidige Malfarbe entstehen, die die nötige Leuchtkraft und Farbtiefe besaß, um damit große Kunstwerke zu erschaffen. Doch Walter Baumgart hatte seiner Tochter nicht nur das Farbmischen beigebracht, sondern sie auch im Malen unterrichtet, was für eine Frau nicht nur sehr ungewöhnlich war, sondern auch als sündhaft und anmaßend galt.
»Meinem Vater sind alle Blautöne ausgegangen«, erklärte sie.
»Und ohne Blau kein Himmel«, erwiderte Auer und rieb sich die Hände.
Blau gehörte zu den teuersten Farbpigmenten. Das beliebte Ultramarinblau wurde aus dem kostbaren Lapislazuli hergestellt. Der Edelstein musste aus dem fernen Osten nach Nürnberg gebracht werden, weshalb das Pigment beinahe mit Gold aufzuwiegen war. Walter Baumgart begnügte sich mit dem etwas günstigeren Azurit oder Kobalt. Auch diese Farben waren teuer, aber der Preis war nicht vergleichbar mit dem von Ultramarinblau.
Emilia beugte sich über den hübschen Holzkasten und bewunderte die Farben. In der obersten Reihe befanden sich die Rottöne – vom tiefen, dunklen Weinrot bis zum kräftigen Scharlachrot. Die nächste Reihe enthielt Gelbtöne, vom satten, weichen Goldgelb bis zum zarten Zitronengelb. Eine weitere Reihe bot alle Abstufungen vom hellen Lindgrün bis zum kräftigen Tannengrün. Die Blautöne bildeten den Abschluss. Emilias geschultes Auge erkannte sofort das teure Ultramarinblau, ein sattes, leuchtendes Pulver, das an einen strahlenden Sommerhimmel erinnerte. Dagegen wirkte das Azurit gleich daneben matt und langweilig. Ihr Vater würde sich dennoch damit begnügen müssen, denn die Münzen in Emilias Beutel reichten gerade für eine fingerhutgroße Menge davon aus. Und auch dazu musste sie nun all ihr Verhandlungsgeschick anwenden.
»Das Pulver ist schön«, meinte sie mit gespieltem Desinteresse. »Aber das letzte Mal musste ich es über zwei Stunden mit dem Läufer bearbeiten, damit wenigstens ein paar der winzigen Farbpigmente vom Leinöl aufgenommen wurden.«
»Das kann nicht sein!« Auer schüttelte den Kopf. »Mein Farbpulver ist von höchster Qualität. Ich habe jahrzehntelang Albrecht Dürers Werkstatt beliefert. Der große Meister hat auf meine Ware geschworen. Seine Werkstatt verwendet noch immer meine Produkte. Besseres Farbpulver werdet Ihr nirgendwo finden.«
»Mag sein, dass Eure Ware vor sechs Jahren, als Dürer noch lebte, einwandfrei war. Mein Vater hat jahrelang in seiner Werkstatt gearbeitet«, sagte Emilia unbeeindruckt. »Aber heute gibt es andere Anbieter, die bessere Qualität zu günstigeren Preisen verkaufen.«
»Nennt mir einen Namen«, forderte der Farbenhändler, der nicht beleidigt zu sein schien, sondern eher amüsiert. Er genoss das Feilschen und Verhandeln. Für ihn war es ein Spiel, auf das Emilia sich bereitwillig einließ.
»Ich werde mich davor hüten, Euren Konkurrenten zu nennen. Am Ende geht Ihr zu ihm und ratet ihm, ebenfalls mehr Geld zu verlangen. Bei wem soll ich dann meine Ware kaufen?«
»Bei mir, Jungfer Emilia.« Auers Mundwinkel zuckten. Er breitete beide Arme weit aus. »Was will denn mein angeblicher Konkurrent für einen Fingerhut vom Azurblau?«
Emilia nannte eine Summe, von der sie wusste, dass sie viel zu niedrig war. Niemals würde der Farbenhändler sich damit zufriedengeben. Und tatsächlich setzte er zu lautem Lachen an. »Jungfer Emilia, Ihr seid aber lustig. Vielen Dank für die gute Unterhaltung.« Er wischte sich Tränen aus den Augenwinkeln.
Während ihrer Verhandlungen war ein Mann an den Stand getreten. Emilia drehte sich zu ihm und musterte ihn. Er war groß und breitschultrig, seine Haut war vom Wetter gegerbt, und seine Kleidung ließ darauf schließen, dass er ein Fremder war. Ein strahlend weißer Kragen blitzte unter seinem Wams hervor, und auf dem Kopf trug er einen breitkrempigen Hut, den drei lange Federn zierten. Emilia fand, dass er wie jemand aussah, der das Abenteuer liebte und suchte. Vielleicht war er ja ein Kaufmann, der über die Weltmeere segelte?
»Ich gebe der jungen Frau recht«, mischte er sich ein. »Die Pigmente sind verunreinigt. Niemals kann man damit eine deckende Malfarbe mischen, die genug Leuchtkraft besitzt, um einen überzeugenden Himmel auf die Leinwand zu zaubern. Nicht einmal die Meereswogen an einem verregneten Herbsttag lassen sich damit malen.«
Sein Akzent verriet, dass er aus den Niederlanden stammte.
»Guter Herr, ich begreife nicht, wie Ihr zu diesem Schluss kommt.« Auers Freude am Verhandeln schien am Ende angelangt zu sein. Es war eine Sache, mit einer jungen Frau um den Preis zu feilschen, und eine ganz andere, die eigene Ware von einem Fremden kritisieren zu lassen. »Ich kann Euch versichern, dass meine Pigmente von allerbester Qualität sind. Namhafte Künstler, die im Auftrag von Kaiser Karl malen, sind damit sehr zufrieden. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was Ihr daran zu beanstanden habt.«
»Das will ich Euch sagen …« Der Fremde trat noch einen Schritt näher. »Wäre Euer Azurblau tatsächlich von so guter Qualität, wie Ihr behauptet, dann dürften sich im Pulver keine grauen Teilchen befinden. Sie verunreinigen die Farbe und wirken sich negativ auf die Leuchtkraft aus.«
Auer stemmte die Hände in die Hüften und schnaufte verärgert. »Ich bezweifle, dass Ihr in der Lage seid, das zu beurteilen!«
Immer mehr Schaulustige waren gekommen, um den Verhandlungen zu lauschen. Es waren Menschen, die nichts vom Malen verstanden, sich aber einen heftigen Schlagabtausch nicht entgehen lassen wollten.
»Mein Name ist Jan Cornelisz Vermeyen. Ich bin Niederländer und als Hofmaler bei Margarete von Österreich tätig, verdiene also mein Geld mit Malerei. Wenn ich nicht in der Lage wäre, saubere Pigmente von verunreinigten zu unterscheiden, hätte ich meinen Beruf verfehlt.«
Auers Kinnlade fiel nach unten. Auch Emilia war überrascht. Sie betrachtete den Mann mit neuem Interesse. Dabei fielen ihr die verräterischen Farbreste unter seinen Fingernägeln auf.
Sichtlich nervös fuhr sich Auer mit der Zunge über die schmalen Lippen. Ihm schien klar zu sein, dass die Diskussion ihm zum Schaden gereichen könnte. Sein guter Ruf stand auf dem Spiel, wenn sich herumsprach, dass ein berühmter Maler seine Ware als minderwertig darstellte.
»Ich versichere Euch, dass meine Pigmente einwandfrei sind«, wiederholte er.
»Und ich sage Euch, sie sind es nicht«, entgegnete Vermeyen. »Gebt der Jungfer das Pulver zum Preis, den sie vorgeschlagen hat.«
Entsetzt weiteten sich die Augen des Farbenhändlers. »Dabei würde ich einen großen Verlust schreiben.«
»Es ist zu Eurem Vorteil, glaubt mir«, versicherte Vermeyen. »Wenn Ihr der hübschen Kundin das Azurblau verkauft, nehme ich die fünffache Menge vom Ultramarinblau.«
»Die fünffache Menge?« Auer schien in Gedanken die Zahlen durchzurechnen. Selten verkaufte er so große Mengen vom teuersten Farbpigment.
»Das Pulver gefällt mir«, fuhr Vermeyen fort. »Die Qualität sieht einwandfrei aus. Ich zahle Euch eine angemessene Summe.«
Sofort nannte der Farbenhändler einen unverschämt hohen Betrag. Ohne mit der Wimper zu zucken, willigte der niederländische Maler ein.
Emilia fragte sich, warum der Mann nicht einmal versuchte, den Preis zu drücken. Nun, sollte er mit seinem Geld anstellen, was er wollte. Sie würde das Azurblau günstiger erstehen als erhofft, und mit dem Geld, das ihr blieb, konnte sie fürs Abendessen noch ein kleines Stück Butter oder einen Topf süßen Rahm kaufen. Allein beim Gedanken daran knurrte ihr Magen.
Bevor Auer es sich anders überlegen konnte, schloss sie das günstige Geschäft ab und verabschiedete sich. Als sie ging, spürte sie die neugierigen Blicke des niederländischen Malers in ihrem Rücken. Hätte sie sich bei ihm bedanken sollen? Nein, auf keinen Fall. Damit hätte sie dem Farbenhändler gegenüber zugegeben, dass sie zu wenig bezahlt hatte. So konnte sie beim nächsten Einkauf versuchen, denselben Preis zu erzielen.
Emilia bahnte sich einen Weg durch die Menschenmenge, direkt zum Stand der Bäuerin, bei der sie letztes Mal die Butter gekauft hatte. Das Geschäft mit dem Azurblau musste heute Abend ordentlich gefeiert werden.
2
Die Pegnitz teilte Nürnberg in einen nördlichen und einen südlichen Teil, die zugleich die Pfarrbezirke von St. Lorenz und St. Sebald bildeten. Im Lorenzer Teil, der südlich des Flusses lag, wohnten vorwiegend Dienstboten, Handwerker und kleine Kaufleute. Der nördliche Teil nahe der Burg war deutlich älter und gehörte den wohlhabenden Familien, den Ratsherren, Großkaufleuten, Ärzten, Juristen und Goldschmieden. Emilia, ihre Schwester Barbara und ihr Vater wohnten im nördlichen Teil.
Emilias Mutter Gertrud entstammte der Patrizierfamilie Imhoff, die dem Inneren Rat angehört hatte. Heinrich Baumgart, Emilias Großvater väterlicherseits, war als recht erfolgreicher Kunstmaler nach dem Tod seiner Frau zusammen mit seinem Sohn Walter aus einer Kleinstadt im Norden nach Nürnberg gezogen, weil er sich hier bessere Verdienstmöglichkeiten erhoffte. Leider hatte sich seine Hoffnung nur vorübergehend erfüllt. Nach einigen sehr guten Jahren, in denen er das schöne Wohnhaus mit der Werkstatt hatte errichten lassen, verlor er sein Augenlicht und konnte seinem Beruf nicht mehr nachgehen. Zu dem Zeitpunkt hatte sein Sohn bereits Gertrud Imhoff geehelicht und nach einigen Lehrjahren bei Alfred Dürer übernahm er die Werkstatt vom Vater. Heinrich verlor seine Lebensfreude und starb schon bald. Walter arbeitete viele Jahre in der Werkstatt und übernahm Auftragsarbeiten reicher Bürger. Doch dann erkrankte seine Ehefrau, und er musste viel Geld in die kostspieligen Behandlungen stecken, die letztlich erfolglos blieben. Seit Gertruds Tod fehlte ihm die Kraft zum Arbeiten. Porträts malte er nur noch selten, und die meisten seiner Arbeiten musste Emilia heimlich für ihn vollenden, doch von diesem Geheimnis durfte niemals jemand erfahren. Es war Frauen streng untersagt, sich als Malerinnen zu betätigen. Niemand wollte ein Porträt in der Stube hängen haben, das eine Frau angefertigt hatte.
Die enge Gasse, in der sich das Wohnhaus der Baumgarts befand, lag nur wenige Gehminuten von Dürers Werkstatt entfernt. Emilia beschleunigte ihre Schritte.
»Obacht!« Im letzten Moment sprang sie zur Seite, als eine Hausfrau direkt neben ihr den Unrat aus dem Fenster kippte. Die unappetitliche Brühe klatschte neben ihr auf den Boden und bespritzte den Saum ihres Kleides.
»Passt besser auf!«, schimpfte Emilia nach oben. »Ihr hättet mich beinahe erwischt!« Doch das Fenster schloss sich schon wieder. Kaum hatte Emilia ihren Weg fortgesetzt, musste sie ihren Korb schützend in die Höhe halten. Die Schweine der Nachbarin waren wieder einmal auf der Straße, da die Dienstmagd vergessen hatte, die Tiere in den Garten zu sperren.
»Ksch, geht ihr wohl weg!«, verscheuchte sie die Tiere. Grunzend drehten sie ihr die Hinterteile zu und trotteten gemächlich davon. Emilia ging eilig weiter. Endlich hatte sie die Eingangstür ihres Häuschens erreicht. Bis auf die Größe unterschied es sich kaum von den umliegenden Bürgerhäusern. Das Erdgeschoss bestand aus Sandsteinquadern, die Etagen darüber waren aus Fachwerk mit roten Holzbalken, die dringend einen neuen Anstrich gebraucht hätten. Emilias Großvater hatte sowohl auf holzgeschnitzte Erker als auch auf die Ausgestaltung der Giebel verzichtet. Das Haus schmückte allein eine schlichte steinerne Madonnenfigur, die auch nach der Entscheidung des Rats für die Lehre Luthers nicht entfernt wurde. Solange sich niemand daran störte, würde sie oberhalb der Eingangstür hängen bleiben.
Im vorderen Teil des Hauses war Walter Baumgarts Werkstatt untergebracht, im Obergeschoss die Wohnräume, eine gute Stube und drei Schlafkammern. Der begrünte Innenhof enthielt den Garten, in dem Barbara Kräuter, Obst und Gemüse anbaute. Im Rückgebäude befanden sich die Küche und die Vorratskammer, die ebenfalls Barbaras Reich waren. Seit dem Tod der Mutter vor ein paar Jahren besorgte sie den Haushalt der Familie, während Emilia als Bildwirkerin in Kunigunde Löffelholz’ Werkstatt für ein regelmäßiges Einkommen sorgte.
Emilia griff nach dem Schlüssel, den sie am Gürtel neben ihrem bestickten Beutel trug. Der Beutel enthielt ein Messer und einen Löffel als Zeichen ihrer Stellung im Haushalt und in der Gesellschaft. Emilia hätte es vorgezogen, wenn darin ein Pinsel und ein Silberstift gesteckt hätten. Der Beutel war ein Erbstück ihrer Mutter, und ihr als älterer Schwester stand es zu, ihn zu tragen, auch wenn Barbara mehr damit hätte anfangen können.
Sie sperrte die Haustür auf und trat ein. Wie so häufig lag die Werkstatt verlassen da. Die Fensterläden und die Tür zum Innenhof waren verschlossen, die Staffelei mit einem dunklen Tuch verhängt. Ein schwacher Geruch nach Leinöl, Harz und Kreide hing in der Luft. Es lag schon einige Zeit zurück, dass ihr Vater an dem Bild auf der Staffelei gearbeitet hatte. Das Porträt von der Ehefrau des Ratsherren Pöltl hätte schon vor Tagen abgegeben werden sollen. Der Ratsherr hatte einen Teil der ausgehandelten Summe für das Bild bereits im Voraus bezahlt, doch schon nach wenigen Stunden in der Werkstatt war Walter Baumgart erschöpft ins Bett gekrochen, wo er seither lag. Nur zum Einnehmen der Mahlzeiten kam er über den Innenhof in die Stube. Es würde wieder einmal Emilias Aufgabe sein, das angefangene Gemälde des Vaters zu vollenden.
Sie durchschritt die Werkstatt und ging zum hohen Regal im hinteren Teil. Gezielt griff sie nach einem der Tontöpfe, öffnete den Deckel und schüttete das kostbare Azurblau hinein, das sie eben erstanden hatte. Sorgfältig verschloss sie den Topf und stellte ihn wieder zurück ins Regal zu den anderen Behältern. Liebevoll strich sie mit dem Zeigefinger über den glasierten Ton. Sie kannte die Inhalte aller Töpfe genau und wusste, in welchem Verhältnis sie die unterschiedlichen Pulver anrühren musste, um ganz bestimmte Farbtöne zu erzielen. Als ihr Finger den Topf mit dem Krapp für Rottöne berührte, fiel durch die Ritze des Fensterladens ein dünner Lichtstrahl, in dem winzige Staubteilchen tanzten. Die Maserung des Holzregals trat intensiv hervor und war Emilia noch nie so schön erschienen wie eben jetzt. Neben den Töpfen lag eine Pfauenfeder, die jemand dort vergessen hatte. Emilias Finger juckten, wie gerne hätte sie sofort zu Pinsel und Farbe gegriffen und ein Stillleben gemalt. Aber in diesem Augenblick riss eine Stimme sie aus ihren Tagträumen.
»Emilia?«
Das war ihre Schwester. Sie war drei Jahre jünger als Emilia und die Energischere von ihnen. Mitunter konnte sie herrisch und ungehalten sein, und Emilia wollte auf gar keinen Fall Streit mit ihr.
»Ich komme gleich!«, rief sie. Eilig griff sie nach dem Korb mit den Einkäufen, überquerte den Innenhof und betrat die Küche, wo Barbara mit hochrotem Kopf am Tisch stand und einen Teig knetete. Ihr blondes Haar hatte sie achtlos zu einem Knoten hochgebunden. Ein paar Strähnen waren in die verschwitzte Stirn gerutscht.
»Du bist aber spät dran. Wo warst du so lange?«, fragte sie in vorwurfsvollem Tonfall. Barbara war eine kleinere, zierlichere Ausgabe von Emilia, mit härteren Gesichtszügen. Schon jetzt standen steile Falten auf ihrer Stirn, die sich in ein paar Jahren sicherlich tief in ihre Haut graben würden. Ihre Lippen waren schmäler als Emilias, dafür von einem wunderschönen, tiefen Kirschrot. Ein Farbton, um den Emilia die Schwester beneidete.
»Ich habe mit Herrn Auer wegen Vaters Farben länger verhandeln müssen.«
Barbara richtete sich auf. Eine weitere Strähne fiel in ihre Stirn, die sie mit dem Unterarm wegwischte, da ihre Hände voller Mehl waren.
»Vater braucht keine Farben mehr«, sagte sie. »Er wird nicht mehr malen.«
»Du weißt so gut wie ich, dass wir ohne seine Bilder nicht überleben können«, entgegnete Emilia. »Der mickrige Lohn, den Frau Kunigunde mir zahlt, reicht niemals für uns drei. Wir müssten unser Haus verkaufen und auf die andere Seite der Pegnitz ziehen.«
»Ich werde hier ohnehin nicht mehr lange wohnen«, sagte Barbara. »Sobald ich Hannes geheiratet habe, ist mir dieses Haus einerlei.«
Emilia seufzte laut. Es war immer das gleiche Thema. Barbara war seit Jahren in Hannes Schütt verliebt, den Sohn des Müllers. Sie traf sich heimlich mit ihm vor den Stadtmauern und verbrachte ganze Nachmittage mit ihm. Doch Hannes’ Vater forderte für seinen Sohn eine unverschämt hohe Mitgift, die Walter Baumgart nicht in der Lage war, zu bezahlen.
»Lass uns über etwas anderes reden«, bat Emilia. Sie stellte den Korb mit den Flusskrebsen, der Butter, dem Brot und dem Rahm auf den Tisch neben die bemehlte Arbeitsfläche. »Schau, was ich gekauft habe.«
Barbara spähte in den Korb und verzog säuerlich den Mund. »Kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier?«
»Die Flusskrebse waren billig. Und das Azurblau habe ich zu einem fairen Preis bekommen«, erklärte Emilia. »Ich wusste doch nicht, dass du Brot backen wirst.«
»Das tue ich auch nicht«, sagte Barbara. »Ich mache Schmalzgebäck.«
»Oh, wie schön!« Emilia liebte die kleinen Bällchen mit der knusprigen Hülle und dem weichen Kern. »Du wärst stolz auf mich gewesen, wie ich um den Preis für das Azurblau gefeilscht habe.«
Barbara verdrehte die Augen. Sie hielt nichts davon, dass Emilia die Bilder anstelle ihres Vaters fertig malte. Zu groß war die Gefahr, dass jemand das Geheimnis aufdeckte. Wenn die Wahrheit ans Tageslicht käme, würde auch Barbaras makelloser Ruf darunter leiden, und ihre Chancen, doch eines Tages Hannes’ Ehefrau zu werden, wären für immer dahin.
»Heute Morgen war ein Mann da, der die leer stehende Kammer mieten möchte«, erzählte Barbara, während sie aus der Teigkugel weitere kleine Bällchen formte, die sie mit einem Tuch zudeckte.
»Hat er vertrauenswürdig gewirkt?«
Seit Monaten versuchten sie, einen Untermieter zu finden, um neben Emilias Lohn eine weitere Einnahmequelle zu haben. Bisher hatten sich leider bloß zwielichtige Personen gemeldet, die sie auf keinen Fall im Haus haben wollten. Letzten Monat war ein Wanderprediger da gewesen, der für die Unterkunft nichts hatte zahlen wollen. »Gott wird Euch eines Tages für Eure Mühe belohnen«, hatte er versichert, doch so lange konnten sie nicht warten. Vor ein paar Tagen hatte ein Zimmermann nach der Kammer gefragt, doch sein Gesicht war vom Branntwein aufgedunsen und die Kleidung voller Wanzen und Flöhe gewesen. Barbara hatte ihn nicht einmal in den Innenhof gelassen, geschweige denn in die saubere Kammer oberhalb der Werkstatt.
»Der Mann vorhin sah ganz in Ordnung aus«, meinte sie. »Ich habe ihn weggeschickt und ihm gesagt, dass er wiederkommen soll, wenn du wieder da bist. Eine solche Entscheidung mag ich nicht allein treffen, schließlich wird ein Wildfremder in unserem Haus wohnen. Du weißt ja, was ich davon halte.«
Wieder seufzte Emilia. Manchmal war es zum Verzweifeln. Ihre Schwester wollte keinen Untermieter aufnehmen, sie war dagegen, dass Emilia anstelle ihres Vaters malte, und gleichzeitig jammerte sie ständig über die Geldnot.
»Er wird hoffentlich wiederkommen«, sagte Emilia.
Barbara zuckte mit den Schultern. »Wenn er nichts Besseres findet.«
»Hat ihm die Kammer denn gefallen? Du hast sie ihm doch gezeigt, oder?«
»Ja, natürlich. Allerdings habe ich keine Ahnung, was er davon hält. Ich habe mich nicht lang mit ihm unterhalten. Er sah aus wie ein Kaufmann auf der Durchreise. Wahrscheinlich würde er ohnehin nicht lange bleiben.«
Emilia hoffte inständig, dass ihre Schwester den Mann nicht vergrault hatte. Sie brauchten das Geld dringend.
»War Vater heute schon in der Stube?«
Ein Schatten legte sich über Barbaras Gesicht. »Er hat den ganzen Tag sein Bett nicht verlassen. Es ist wieder einmal besonders schlimm.«
Emilia wusste, dass ihre Schwester trotz ihrer ruppigen Art eine herzensgute Frau war, die sich um ihre Liebsten sorgte.
»Hat er etwas gegessen?«, fragte sie.
»Nein.«
»Getrunken?«
»Bloß ein paar Schlucke vom gewässerten Bier.«
»Ich werde gleich nach ihm sehen«, sagte Emilia.
»Tu das«, meinte Barbara ernst. »Auf dich hört er noch eher als auf mich.«
»Ich wünschte, es wäre so«, sagte Emilia seufzend.
Sie hängte ihr Schultertuch an den Haken neben der Küchentür und ging zurück zum Vorderhaus. Über eine schmale Holztreppe gelangte sie in den oberen Stock mit den drei kleinen Schlafkammern. Eine davon teilte sie sich mit ihrer Schwester, in der zweiten schlief ihr Vater, und die dritte stand derzeit leer und konnte hoffentlich bald vermietet werden. Daneben lag die Stube, das Herzstück des Hauses, mit einem grünen Kachelofen, auf dessen Fliesen Motive aus der Bibel zu sehen waren. Die Fenster aus hübschen, grünen Butzenscheiben und die dunkle Holztäfelung an der Decke und den Wänden zeugten vom einstigen Wohlstand der Familie.
Emilia ging an der Stube vorbei und blieb vor der Kammer des Vaters stehen. Sie klopfte gegen die niedrige Tür. Nichts rührte sich. Sie klopfte erneut, diesmal lauter und eindringlicher.
»Vater?«
Ein leises Wimmern kam als Antwort. Emilia öffnete die Holztür und trat ein. Die Fensterläden waren geschlossen und die Luft im kleinen Raum stickig. Es dauerte einen Moment, bis sich ihre Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten. Sie spähte zum Bett hinüber, das ihr Vater früher mit seiner Ehefrau geteilt hatte. Schon seit Jahren lag er allein darin. Sein abgemagerter Körper verschwand unter den zahlreichen Decken und Kissen. Emilia erschrak über den Anblick, und für einen kurzen Moment hatte sie das Bild eines Toten vor sich. Rasch schob sie es zur Seite und ging mit energischen Schritten zum Fenster. Sie öffnete beide Flügel, dann stieß sie die Fensterläden nach außen auf. Augenblicklich drang helles Sonnenlicht in die Kammer. Walter Baumgart stöhnte leidend auf.
»Mach das Fenster wieder zu«, bat er leise.
»Sobald die Sonne untergegangen ist, werde ich das tun«, entgegnete Emilia und bemühte sich, fröhlich zu klingen.
»Ich bin müde, lass mich schlafen.«
»Es ist früher Nachmittag. Du hast lang genug im Bett gelegen. Komm, steh auf, die Arbeit wartet auf dich.«
»Es gibt keine Arbeit mehr für mich.« Ihr Vater wandte sich ab und zog die Decke übers Gesicht.
»Da irrst du gewaltig«, entgegnete Emilia. »Ich habe eben eine hübsche Menge Azurblau beim Farbenhändler Auer erstanden. Damit kannst du einen wunderschönen Himmel zaubern. Ebenso blau und wolkenlos, wie er sich gerade präsentiert. Sobald du aufgestanden bist, wirst du ihn sehen.«
»Ich kann nicht.«
»Unsinn«, widersprach Emilia. Sie trat näher ans Bett. Mit einer energischen Bewegung zog sie die Decke weg und schüttelte sie auf.
»Mir ist kalt«, protestierte ihr Vater und klang dabei wie ein weinerliches Kind.
»Wenn du in der Sonne sitzt, wird sie dich wärmen. Komm jetzt, Vater. Barbara bereitet eine köstliche Mahlzeit für uns zu. Wir können den Tisch im Innenhof decken, dann sitzen wir direkt in der Sonne.«
»Man isst nicht im Freien, das gehört sich nicht.«
Emilia lachte. »Schön, dass du trotz deiner Melancholie noch weißt, was sich gehört und was nicht. Niemand sieht uns, wir können essen, wo wir wollen.«
Widerwillig rappelte Walter Baumgart sich auf und ließ seine dürren Beine über die Bettkante baumeln. Emilia erschrak. Die Waden schienen nur noch aus faltiger Haut und Knochen zu bestehen.
»Vater, du musst mehr essen«, sagte sie besorgt. »Sonst fällst du aus lauter Schwäche um.«
»Ich habe keinen Hunger.«
»Der Appetit kommt mit dem Essen. Auf jetzt!« Sie ging zum Schrank, wo die Kleidung aufbewahrt wurde. Sie nahm ein frisches Hemd und ein sauberes Wams heraus und legte beides neben ihrem Vater aufs Bett. Dann bückte sie sich nach dem Nachttopf. Er war leer. Was sollte auch darin sein, wenn ihr Vater weder aß noch trank?
Emilia wandte sich zum Gehen, als ihr Vater sie zurückhielt. »Emilia!«
Sie drehte sich um. »Ja?«
»Ich kann das Porträt von Sibille Pöltl nicht fertig malen.«
»Natürlich kannst du das. Und es wird dir auch helfen, aus deiner Verstimmung wieder herauszufinden«, entgegnete Emilia. So war es bisher immer gewesen. Sobald ihr Vater einen Pinsel in der Hand hielt, vergaß er für ein paar Stunden seine Melancholie. Sie schien ihm sogar dabei zu helfen, noch ausdrucksvoller zu malen und die wahren Charakterzüge seiner Modelle besser zu erfassen.
»Es geht wirklich nicht«, erklärte ihr Vater niedergeschlagen. »Ich habe es gestern versucht. Drei Stunden habe ich vor der Leinwand gesessen, ohne auch nur einen einzigen Strich auszuführen.«
»Heute wird es besser gehen«, meinte Emilia und wünschte, ihre gespielte Zuversicht würde der Wahrheit entsprechen. Die Vorstellung, dass ihr Vater nun auch nicht mehr malte, war ihr unerträglich. Es würde bedeuten, dass er sich endgültig aufgab.
Er schüttelte traurig den Kopf. »Ich bin leer.«
Emilia kehrte zu ihm zurück. Sie setzte sich neben ihn auf die Bettkante und ergriff seine Hand. Sie war eiskalt, die faltige Haut fühlte sich wie brüchiges Pergament an. »Was soll das heißen, du bist leer?«, fragte sie.
»Ich fühle nichts mehr.« Er hob den Kopf und sah sie aus wässrigen Augen an, die einst türkisblau gewesen waren, nun jedoch farblos wirkten und in tiefen, dunklen Höhlen lagen. »Zum Malen braucht man Leidenschaft, man muss etwas fühlen. Aber wenn ich in mich hineinhorche, ist da nichts. Nur gähnende Leere.«
»Das kann nicht sein, Vater!« Emilias Kehle schnürte sich zusammen. »Du musst doch auch an Barbara und mich denken. Wir sind deine Töchter. Wir brauchen dich.«
Nun füllten sich seine Augen mit Tränen. Sie liefen über seine grauen, eingefallenen Wangen und tropften schwer auf den Kragen seines Nachthemds. »Ich wäre so gerne für euch da, das musst du mir glauben. Aber ich kann nicht. Es zieht mich immer tiefer in den Abgrund. Am liebsten möchte ich für immer schlafen.«
»Psst!« Emilia legte ihm den Zeigefinger an die Lippen. »Das darfst du nicht sagen. Du darfst es nicht einmal denken.«
»Es ist aber die Wahrheit.«
»Ich will diese Worte nie wieder hören. Hast du mich verstanden?« Emilia stand auf. Sie strich ihre Röcke glatt und wandte sich ab, damit ihr Vater nicht merkte, dass auch ihre Augen feucht geworden waren. Was half es ihm, wenn er sah, wie sehr sie litt?
»Zieh dich an«, forderte sie. »Dann können wir gemeinsam essen.«
Als sie sich zum Gehen wandte, hielt er sie noch einmal zurück. »Du wirst das Porträt von Sibille Pöltl vollenden müssen.«
»Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll.«
»Das stimmt nicht«, widersprach er. »Natürlich weißt du, was du tun musst. Deine Pinselführung ist exakt und dein Gespür für Farben einzigartig.«
Sie fühlte, dass sie die Tränen bald nicht mehr zurückhalten konnte.
»Jetzt komm zum Essen«, sagte sie eilig.
Als sie auf dem Gang stand und die Tür hinter sich geschlossen hatte, lehnte sie sich gegen die weiß gekalkte, kühle Wand. Nun bahnten sich die Tränen hemmungslos ihren Weg. Wie sollte ihr Vater aus dem tiefen Tal der Trauer herausfinden? Welcher Arzt, welcher Bader konnte ihm helfen? Die freudige Stimmung, die sich nach dem Kauf der Farbe eingestellt hatte, war mit einem Schlag verschwunden.