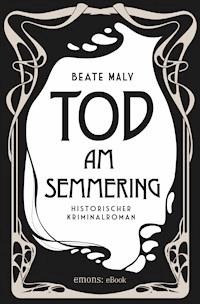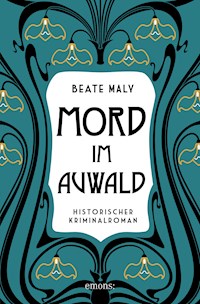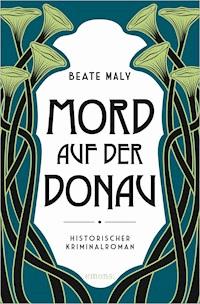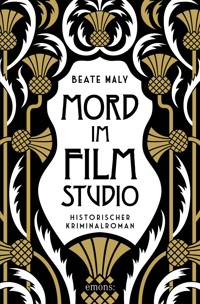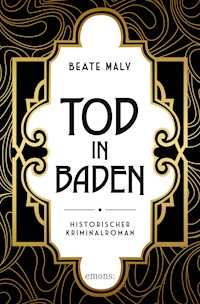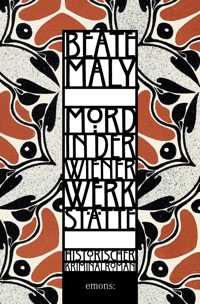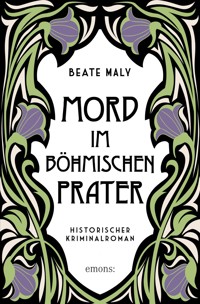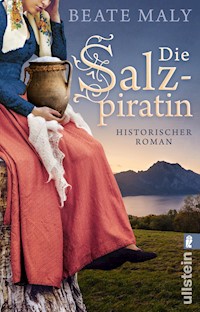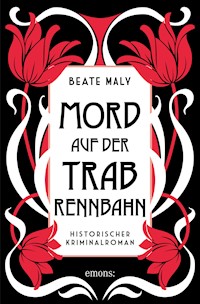4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus den Trümmern in die Zukunft – die wahre Geschichte einer mutigen Frau, die im Wien der Nachkriegszeit für ein besseres Morgen kämpft Wien, 1946: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sieht die nach London geflüchtete jüdische Lehrerin Stella nur einen Weg in die Zukunft: Sie muss in ihre Heimat zurückkehren. Doch als sie am Westbahnhof ankommt, erkennt sie ihr geliebtes Wien kaum wieder. Das Haus, in dem sie einst wohnte, gibt es nicht mehr, und auch viele Schulen sind zerstört. Als Stella dennoch eine Anstellung findet, eckt sie mit ihrer fortschrittlichen Art zu unterrichten an. Im Gegensatz zu ihren Kollegen ermutigt sie die Kinder, über den Krieg und das erlebte Leid sprechen. Dabei wird Stella jedoch auch immer mehr von ihren eigenen Traumata eingeholt. Und als sie einem Mann begegnet, der neue Hoffnung in ihr entfacht, muss sie sich nicht nur ihrer Vergangenheit stellen, sondern auch den Mut für eine neue Liebe finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Trümmerschule – Zeit der Hoffnung
BEATE MALY, geboren in Wien, ist Bestsellerautorin zahlreicher Kinderbücher, Sachbücher und historischer Romane. Ihr Herz schlägt neben Büchern für Frauen, die gegen alle Widerstände um ihr Glück kämpfen.
Aus den Trümmern in die Zukunft – die wahre Geschichte einer mutigen Frau, die im Wien der Nachkriegszeit für ein besseres Morgen kämpft
Wien, 1946: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sieht die nach London geflüchtete jüdische Lehrerin Stella nur einen Weg in die Zukunft: Sie muss in ihre Heimat zurückkehren. Doch als sie am Westbahnhof ankommt, erkennt sie ihr geliebtes Wien kaum wieder. Das Haus, in dem sie einst wohnte, gibt es nicht mehr, und auch viele Schulen sind zerstört. Als Stella dennoch eine Anstellung findet, eckt sie mit ihrer fortschrittlichen Art zu unterrichten an. Im Gegensatz zu ihren Kollegen ermutigt sie die Kinder, über den Krieg und das erlebte Leid sprechen. Dabei wird Stella jedoch auch immer mehr von ihren eigenen Traumata eingeholt. Und als sie einem Mann begegnet, der neue Hoffnung in ihr entfacht, muss sie sich nicht nur ihrer Vergangenheit stellen, sondern auch den Mut für eine neue Liebe finden.
Beate Maly
Die Trümmerschule – Zeit der Hoffnung
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Mai 2025© Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin 2025Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bittean produktsicherheit@ullstein.deUmschlaggestaltung: buerosued.de, MünchenTitelabbildung: © Natasza Fiedotjew / Trevillion Images (Frau mit Kind auf Treppe)Autorinnenbild: © Fabian KasperE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-3555-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Eins
Motto
»Der Westbahnhof in Wien: Lärm und Bewegung, Baracken, Unordnung, Chaos. Die Straßen: alle bekannt – alle fremd. Schwarze augenlose Ruinen, verdorrte Bäume, tiefe Löcher, über die man holperte und stolperte. Langsam wich die Starre einem Gefühl der Empörung, des Zähneknirschens, des Zornes. ›Das haben sie dir angetan, geliebtes Rotes Wien.‹ Aber ›sie‹, das waren nicht die Flugzeuge und Panzer der Alliierten, sondern die für den Krieg Verantwortlichen.«
Stella Klein-Löw, Erinnerungen
Eins
Wien 1946
Eintönig ratterte die Eisenbahn schon seit Stunden über einen schier endlosen Schienenstrang. Stella hörte das Geräusch längst nicht mehr und nahm auch den beißenden Gestank verbrannter Kohle nicht wahr, der aus dem Rauchfang der Lokomotive in die Waggons dahinter drang. Längst war er in ihre Kleidung und ihr Haar gekrochen.
Die Landschaft hinter dem staubigen Fenster wurde zunehmend flacher. Die hohen schneebedeckten Alpen waren vorbeigezogen und grünen saftigen Hügeln gewichen, auf denen vereinzelt Kühe und Schafe weideten. Immer noch ein bisschen nervös dachte Stella an die letzte Passkontrolle an der sowjetisch-amerikanischen Zonengrenze zurück. Es waren die ersten unvorhersehbaren Komplikationen auf ihrer dreitägigen Reise gewesen.
Stella besaß keinen viersprachigen Identitätsausweis, wie ihn alle Österreicher seit Kriegsende benötigten, wollten sie von einer Besatzungszone in die andere gelangen. Bis nach Linz hatte ihr Reisepass völlig ausgereicht. Sie war damit problemlos von Dover nach Calais gekommen, und auch die Reise durch Frankreich und in die Schweiz war bis auf ein paar technische Pannen und Wartezeiten ohne große Aufregung verlaufen. In Vorarlberg hatten die Franzosen die Passagiere kontrolliert, an der Grenze zu Salzburg die Amerikaner und in Linz schließlich die Sowjets. Der russische Soldat hatte an der Echtheit ihrer Papiere gezweifelt, die in London ausgestellt worden waren. »Mitkommen«, hatte er in gebrochenem Deutsch gefordert. Erst nach Intervention seines amerikanischen Kollegen hatte er Stella die Dokumente zurückgegeben.
Andere waren nicht so glimpflich davongekommen. Stella hatte beobachtet, wie eine junge Frau aus dem Nebenabteil abgeführt und am Bahnsteig in einen Jeep gezerrt worden war. Der Vorfall hatte bei ihr Erinnerungen wachgerufen, die sie beiseiteschob, so gut es ging. In den letzten acht Jahren hatte sie gelernt, wie sie den Schlag ihres rasenden Herzens verlangsamen und das Zittern ihrer Hände verringern konnte, wenn die Angst vor Verfolgung und Tod sie heimsuchte. Manchmal gelang es ihr besser, manchmal schlechter. Es waren Bilder von jungen Burschen, deren Schläfen bluteten, weil man ihre Locken brutal mit dem Reibeisen abrasiert hatte. Von jungen Frauen, die mit Zahnbürsten die Gehsteige Wiens hatten reinigen müssen. Bilder von abgebrannten Synagogen und eingeschlagenen Fensterscheiben. Wegen dieser Ereignisse hatte sie Wien verlassen, doch die Erinnerungen suchten sie immer noch heim, wenn sie nachts wach lag und nicht schlafen konnte.
In den letzten Wochen vor ihrer Abreise hatte man sie immer wieder gefragt, warum sie zurück nach Wien wolle. Ausgerechnet in die Stadt, in der die jüdische Bevölkerung so grausam verfolgt worden war. Eines der Gespräche war Stella beinahe wörtlich im Gedächtnis geblieben. Sie und ihr Arbeitskollege Tom hatten gemeinsam im Speisesaal des Heims für schwer erziehbare Kinder zu Mittag gegessen, einen viel zu schwach gewürzten Bohneneintopf mit Lamm. Die ihnen anvertrauten Kinder hatten schon eine Stunde zuvor gegessen, weshalb der Raum jetzt leer war.
»Warum gehst du weg aus London?«, hatte Tom sich erkundigt. »Du wohnst direkt neben dem Hyde Park, hast einen interessanten Job und gute Freunde. Was brauchst du mehr, um zufrieden zu sein?«
Stella hatte nach einer Antwort gesucht. Wie erklärte man Heimweh? Wie den Wunsch, dorthin zurückzukehren, wo man eben nicht nur schlimme Dinge erlebt, sondern auch viele glückliche Erfahrungen gesammelt hatte? In Wien hatte sie ihre Ausbildung gemacht und inspirierende Menschen wie Anna Freud und Charlotte Bühler kennengelernt. Hier hatte sie in den Kaffeehäusern der Stadt stundenlang über Pädagogik und Psychologie diskutiert und die Begründung der Psychoanalytischen Pädagogik miterlebt. In den hell erleuchteten Ballsälen Wiens hatte sie nächtelang Walzer getanzt und in den verrauchten Klubs der Innenstadt Jazz gehört. Sie war durch den blühenden Prater spaziert und hatte im Burggarten zum ersten Mal einen Mann geküsst. Und all diese schönen Momente hatte sie mit ihren Freunden geteilt, insbesondere ihrer besten Freundin Felicitas Straubinger. Wien hatte ihr so viel Schönes geboten – zu einer Zeit, in der sie als Jüdin nirgendwo sonst diese Möglichkeiten bekommen hätte. Während in Ungarn Juden nicht mehr hatten studieren dürfen, hatte Stella in Wien Karriere gemacht. Die Stadt und ihre Freunde konnten nichts dafür, dass ein Heer von Stiefel tragenden Braunhemden die Menschlichkeit zu Grabe getragen hatte. Jetzt, da die Stadt nach dem Krieg am Boden lag, konnte Stella nicht einfach tatenlos aus der Ferne zusehen.
»Ich gehe zurück, weil ich beim Wiederaufbau mithelfen möchte«, hatte sie schließlich erklärt.
»Aber warum? Du schuldest der Stadt gar nichts. Man hat dich und deine Familie vertrieben. Deine Verwandten sind im KZ umgekommen.«
»Die Nazis haben mich vertrieben, nicht meine Freunde und nicht die Stadt«, hatte Stella widersprochen und dann traurig hinzugefügt: »Ich will nach Hause.«
»Du wünschst dir etwas, das es nicht mehr gibt. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen und Dinge ungeschehen machen. Das Wien, das du verlassen hast, ist Geschichte.«
»Trotzdem sehne ich mich danach.«
Tom hatte bloß mit dem Kopf geschüttelt. Stella sah immer noch seinen verständnislosen Blick vor sich. Seine fassungslose Miene, die ausdrückte, dass er sie am liebsten an den Schultern gepackt und wachgerüttelt hätte.
Ein Rascheln riss sie aus ihren Überlegungen. Die Frau, die ihr gegenübersaß, packte ein Butterbrot aus einem Stück Zeitungspapier. Der Kleidung nach zu urteilen, stammte sie vom Land, vielleicht war sie eine Bäuerin. Über ihrem einfachen Kleid trug sie eine Schürze, auf dem Kopf ein graues Tuch, das unter dem Kinn zusammengeknotet war. Während sie genüsslich in das Brot biss, waren zwei Paar große Kinderaugen auf sie gerichtet.
Seit Linz saßen die beiden Mädchen schweigend auf einer Bank schräg gegenüber von Stella. Ein alter Mann hatte sie, bloß mit einem kleinen Korb ausgestattet, in den Zug gesetzt. »In Wien holt euch Tante Berta ab. Haltet das rote Tuch in die Höhe, dann wird sie euch erkennen.« Dabei hatte er der Größeren ein rotes Halstuch in die Hand gedrückt. Stella hatte gesehen, wie die beiden Mädchen mit den Tränen gekämpft hatten. Ohne ein weiteres Wort war der Mann wieder aus dem Zug gestiegen und hatte den Kindern zum Abschied nicht einmal zugewinkt.
Beide waren blass und viel zu dünn, die Kleidung war löchrig. Kein ungewöhnliches Bild. Seit Stella die österreichische Grenze überschritten hatte, sah sie ständig unterernährte Kinder und ausgemergelte Erwachsene, denen der Mangel des Kriegs ins Gesicht geschrieben stand. Die beiden Mädchen hockten schweigend nebeneinander und hielten einander an den Händen. Es schien, als wollten sie sich gegenseitig Halt geben. Das rote Tuch lag zerknüllt im Schoß der Älteren.
»Ich hab Hunger«, sagte die Jüngere leise.
»Pst!« Die Größere drückte warnend den Finger an ihre Lippen.
Völlig unbeirrt aß die Frau mit dem Kopftuch weiter. Teilen kam für sie nicht infrage.
Stella holte ihren kleinen Koffer aus der Gepäckablage. Tom hatte ihr vor der Abreise noch eine Packung Haferkekse aufgedrängt, sein Lieblingsgebäck. Sie klappte den Koffer auf. Ganz oben lag die blau-weiß gestreifte Packung mit der Aufschrift Oatmeal Cookies. Stella öffnete die Packung und hielt sie den Mädchen hin. »Wollt ihr einen Keks?«
Die beiden starrten sie ungläubig an, als hätte Stella ihnen eben einen großen Schatz angeboten.
»Greift zu«, ermutigte sie die Mädchen. »Die Kekse sind trocken, aber durchaus genießbar.«
»Danke!« Rasch schnappte sich das ältere Mädchen zwei Kekse. Den einen davon reichte sie ihrer Schwester, die vermutlich zu schüchtern war, um selbst zuzugreifen. Gierig stopfte sich die Jüngere den Keks in den Mund, während die Ältere langsamer aß und nur kleine Bissen nahm.
Stella kannte das nur zu gut. Noch vor ein paar Jahren hatte sie selbst so gegessen, denn auf diese Weise konnte man den Genuss weit hinauszögern.
»Willst du noch einen Keks?« Stella hielt die Packung der jüngeren Schwester entgegen. Sie mochte sechs Jahre alt sein, doch vielleicht ließen ihre eingefallenen Wangen sie auch jünger erscheinen, als sie tatsächlich war.
Das Kind nickte und bediente sich jetzt selbst. »Danke.«
»Sie sollten die fremden Gschrappen nicht verwöhnen«, bemerkte die bäuerlich gekleidete Frau mit vollem Mund. Mit dem Handrücken wischte sie sich über die von der Butter glänzenden Lippen.
»Wenn der Magen knurrt, muss er gefüllt werden«, entgegnete Stella. »Das hat nichts mit Verwöhnen zu tun.«
Die Frau mit der Schürze und dem Kopftuch wusste gewiss nicht, was es hieß, Hunger zu haben. Im Unterschied zu den meisten anderen Zugreisenden war sie wohlgenährt.
Auch Stella kannte das flaue Gefühl, wenn der Magen leer war, und den Schwindel, der einen überkam, sobald man zu schnell aufstand. Die tanzenden Punkte vor den Augen und das Rauschen des Blutes in den Ohren.
»Kein Wunder, dass wir den Krieg verloren haben«, raunte Stellas Gegenüber grimmig. »Die verwöhnten jungen Leute kennen keine Disziplin.«
»Hitlerdeutschland hat den Krieg verloren«, konterte Stella. »Für Österreich ist das keine Niederlage, sondern ein Sieg. Sie sollten feiern.«
Empört schnappte die Frau nach Luft. Ihr Gesicht lief dunkelrot an, doch was immer ihr auf der Zunge liegen mochte – sie schluckte es mit ihrem nächsten Bissen Butterbrot hinunter.
Stella gab den Kindern noch je einen Keks, dann verstaute sie die Packung wieder in ihrem Koffer und hievte ihn schwungvoll zurück in die Gepäckablage.
Die ersten Vororte Wiens tauchten auf. Der Zug ratterte durch Hütteldorf, eine Ansammlung zerbombter Häuser, schwarzer Ruinen und verdorrter Bäume. Es waren nicht die ersten Kriegsschäden, die Stella auf ihrer Reise sah, doch die Verwüstung in Wien entsetzte sie ganz besonders. Mit diesem Ausmaß hatte sie nicht gerechnet. Je näher sie dem Westbahnhof kam, desto dramatischer wurden die Bilder. Fassungslos starrte sie auf Baracken mit verkohlten Dachstühlen, eingestürzte Wände, zerschlagene Fensterscheiben.
Wieder musste sie tief ein- und ausatmen, um ihren Puls zu beruhigen. Diesmal raste ihr Herz nicht vor Angst, sondern vor Empörung. Was haben sie dir angetan, geliebtes Wien?, dachte sie und meinte damit nicht die Flugzeuge und Panzer der Alliierten, sondern die Menschen, die für diesen Krieg verantwortlich waren. Die Menschen, wegen derer sie ihre Heimat hatte verlassen müssen.
Als der Zug auf den Bahnsteig des stark beschädigten Westbahnhofs einfuhr, wusste Stella, dass es richtig war, zurückzukehren. Die Neugestaltung der Stadt durfte nicht denen überlassen werden, die sie zerstört hatten. Selten hatte sie ein so starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit gefühlt wie eben jetzt.
Der Zug blieb stehen. Stella war am Ziel angekommen. Nach acht langen Jahren war sie wieder in Wien.
Zwei
Gemeinsam mit den beiden Mädchen verließ Stella den Waggon. Dicht gedrängt standen Wartende am Bahnsteig, Männer und Frauen, auch Kinder. Einige stellten sich auf Zehenspitzen, um über die Köpfe der Ankommenden hinweg die zu finden, nach denen sie Ausschau hielten. Kaum hatte das ältere Mädchen das rote Tuch schüchtern in die Höhe gehalten, kam auch schon eine Frau auf sie zu und nahm sie mit ausgebreiteten Armen in Empfang. Stella war erleichtert. Die Vorstellung, dass die beiden allein am Bahnsteig zurückbleiben könnten, hatte sie beunruhigt. Sie winkte den Kindern zum Abschied zu. Die Kleinere erwiderte ihren Gruß, die Größere war bereits in ein Gespräch mit der Verwandten verwickelt.
Nun sah auch Stella sich um. Nur zu gut erinnerte sie sich an den trüben Nachmittag vor acht Jahren, an dem sie auf dem Bahnsteig des damals noch intakten Westbahnhofs gestanden hatte, umgeben von Männern in hässlichen braunen Uniformen. Knallrote Fahnen mit Hakenkreuzen hatten von der Decke der Bahnhofshalle gehangen. Die Braunhemden und Fahnen waren verschwunden, stattdessen klafften Löcher in den Wänden und der Decke des einstigen kaiserlichen Prestigebaus. Von den bunten Glasmosaiken, die die Bahnhofshalle bei sonnigem Wetter in ein buntes Farbenmeer getaucht hatten, war nichts mehr übrig. Damals hatte sie nicht gewusst, was sie in der Fremde erwartete, doch sie hatte gehofft, ihre Familie nachholen zu können, sobald sie in Sicherheit war. Es war ihr nicht gelungen. Die Engländer hatten bald darauf die Grenzen für jüdische Flüchtlinge verschlossen. Die Traurigkeit schlich sich an und drohte Stella zu überfallen, so wie sie es immer tat, wenn die Erinnerungen an ihre Familie sie unerwartet und heftig trafen.
Plötzlich vernahm sie eine vertraute Stimme, und die Schwermut hatte keine Chance mehr. Ihr wurde bewusst, wie sehr sie diesen Klang vermisst hatte.
»Stella!« Feli lief ihr mit wehenden Locken entgegen. Im Gegensatz zur Umgebung hatte die Freundin sich kaum verändert. Sie strahlte immer noch eine ansteckende Wärme und Lebensfreude aus. Das runde Gesicht war eine Spur schmäler geworden, genau wie die Hüften, was Feli gut stand. Ihre dunkelbraunen Augen leuchteten auch nach sechs Jahren Krieg, und die Locken waren trotz des kinnlangen Schnitts und des Haarbands nicht zu bändigen. Schon immer war Feli das krasse Gegenteil von Stella gewesen, die mit ihrem glatten hellbraunen Haar und den großen blauen Augen vom Aussehen her dem Idealbild einer deutschen Arierin entsprochen hätte.
Feli umarmte Stella so stürmisch, dass beide ins Wanken gerieten. Dann drehten sie sich so lange lachend und hüpfend im Kreis, bis ihnen schwindelig wurde. Völlig außer Atem blieben sie stehen und sahen einander lange an. Stellas und Felis Augen waren feucht, aber anders als am Tag der Trennung waren es diesmal Tränen der Freude.
»Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich diesen Tag herbeigesehnt habe«, meinte Feli ergriffen. Sie musterte Stella. »Gut schaust du aus. Die Engländer haben ordentlich für dich gesorgt. Das ist fein.«
Tatsächlich hatte Stella ein paar Kilos zugelegt, was ihr endlich die weiblichen Rundungen gebracht hatte, die sie sich viele Jahre gewünscht hatte. Während des Studiums in Wien hatte Stella sich oft wie eine Bohnenstange gefühlt, doch wenn sie jetzt durch die Straßen Londons spazierte, spürte sie durchaus bewundernde Blicke. Nach der dramatischen Flucht war es nicht einfach gewesen, in einem fremden Land Fuß zu fassen, in dem sie nur geduldet, aber nicht erwünscht gewesen war. Doch allen Widerständen zum Trotz war es ihr gelungen, sich eine neue Existenz aufzubauen. Diese Erfahrung hatte sie stark gemacht: Sie wusste, dass es kaum etwas gab, was sie nicht überstehen konnte.
Feli wollte nach dem größeren der beiden Koffer greifen, aber Stella hielt sie zurück. »Achtung, der ist schwer. Lass ihn uns gemeinsam tragen.«
»Hast du vergessen, wie kräftig ich bin?«, meinte Feli übermütig und packte zu, ließ den Griff aber sofort wieder los. »Um Himmels willen, hast du Steine eingepackt?« Sie lachte.
»Im Koffer ist mein gesamter Besitz«, meinte Stella entschuldigend. »Außerdem habe ich dir Tee und Zucker und englischen Früchtekuchen mitgebracht.«
»Sag das ja nicht zu laut«, warnte Feli. »Wenn jemand hört, was für Schätze sich in dem Koffer befinden, sind wir ihn los, so schnell können wir gar nicht schauen.«
»Ist die Versorgungslage in Wien wirklich so schlimm?«
»Es kommt ganz darauf an, wo du wohnst«, sagte Feli. »Bei mir im siebten Bezirk ist es ganz erträglich. Er steht unter amerikanischer Aufsicht, und wir profitieren von einer Hilfe, die GARIOA heißt, eine Abkürzung von Government Aid and Relief in Occupied Areas. Diese Hilfe gibt es in den anderen Sektoren nicht. Besonders schlimm ist es in den Stadtteilen, wo die Sowjets das Sagen haben. In Floridsdorf bei meinen Eltern zum Beispiel.«
Stella erinnerte sich an die Szene in Linz auf der Reise hierher. Ihr wurde heiß, wenn sie nur daran dachte. Was hätte sie getan, wenn der Russe sie gezwungen hätte mitzukommen? Hätte sie sich zur Wehr setzen können? Auf dem Weg von Vorarlberg nach Linz hatte sie gehört, wie sich zwei Männer flüsternd über die Willkür der russischen Besatzer ausgetauscht hatten. Angeblich wurden Österreicher ohne jeden Grund verschleppt. Ein Verdacht reichte schon, ein falsch verstandener Name, und wenn man Pech hatte, landete man in einem sibirischen Gefangenenlager.
»Aber du musst dir um meine Eltern keine Sorgen machen«, fuhr Feli fort. »Sie leben auf dem Land und können sich mit ihrem riesigen Garten selbst versorgen. Außerdem haben sie als Winzer reichlich von dem, was die Russen so schätzen: den Wiener Wein.«
Feli lachte, und ihre gute Laune wirkte ansteckend. Wie sehr hatte Stella die Freundin vermisst. Die Flucht aus Wien hatte sie Feli und ihrer Familie zu verdanken, die ihr ein britisches Visum besorgt hatten, als eine Ausreise längst nicht mehr möglich gewesen war. Der Wein und eine großzügige Bestechungssumme hatten Stella den Weg nach London geebnet. Stella selbst war zu diesem Zeitpunkt mittellos gewesen. Die Wohnung ihrer Eltern am Alsergrund und der gesamte Besitz ihrer Familie waren arisiert worden. So bitter der materielle Verlust gewesen war, Stella hatte sich damit abfinden können. Viel schlimmer war die Ernüchterung gewesen, als sie in London feststellen musste, dass sie weder ihre Eltern noch ihre Schwester Judith nachholen konnte. Die Grenzen waren dichtgemacht worden, sobald sie das Zwischenlager auf der Isle of Man erreicht hatte. Mittellose Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich waren in England unerwünscht gewesen. Man hatte Stella bloß geduldet. Die Domestic Permission, die ihr schon in Wien ausgestellt worden war, hatte ihr eine Anstellung als Kindermädchen ermöglicht. Wie viele andere hoch qualifizierte junge Frauen, die zuvor in guten Positionen tätig gewesen waren, hatte auch Stella das Angebot dankbar angenommen. Ihre Eltern hatten es nie auf die Insel geschafft. Die Nazis hatten Stellas Familie nach Auschwitz geschickt. Diese Nachricht war ein entsetzlicher Schock für Stella gewesen. Sie hatte die ersten Monate im Exil wie in einem bösen Albtraum erlebt, in der ständigen Angst, ihre Familie könne im KZ umkommen.
Stella schloss die Augen. All das war längst vorbei. Sie bemühte sich, nach vorne zu schauen.
Gemeinsam trugen die Freundinnen die beiden Koffer zum Bahnhofsvorplatz. Stella blieb stehen, ihre Kehle schnürte sich zu. Der Blick in die Mariahilfer Straße war ernüchternd. Dort, wo es seinerzeit exklusive Kaufhäuser mit geschmückten Schaufenstern, elegante Modesalons, hübsche Kaffeehäuser und bunt beklebte Litfaßsäulen gegeben hatte, standen jetzt schwarze Ruinen. Auf der Straße lagen Schutt und Asche, riesige Löcher klafften im Boden. Die meisten Fensterscheiben waren zersprungen, die Auslagen mit Karton und Zeitungspapier zugehängt.
Feli und Stella schleppten den großen Koffer zusammen an riesigen Ziegelsteinhaufen und Holzbrettern vorbei, hievten ihn über einen Schotterberg und bewahrten ihn davor, in eine Grube zu purzeln.
Auf Höhe der Kaiserstraße, wo Stella Jahre vor dem Krieg stabile Wanderschuhe gekauft hatte, die sie immer noch besaß und die jetzt in ihrem großen Koffer lagen, schaufelten Menschen den Schutt eines Gebäudes auf große Schubkarren. Es waren vor allem Frauen, die Kopftücher und Schürzen trugen. Einige von ihnen hatten kein Werkzeug und griffen mit bloßen Händen nach den zerborstenen Ziegelsteinen. Ihre Gesichter waren so grau wie das Straßenbild, eingefallene Wangen und glanzlose Augen spiegelten das Leid und den Kummer wider. Sie wurden von amerikanischen Soldaten beaufsichtigt. Eine der Frauen kam Stella bekannt vor, sie konnte sie aber nicht mehr einordnen.
»Fast alle, die hier arbeiten, waren Mitglieder der NSDAP«, erklärte Feli. »Die Amerikaner haben sie zum Trümmerräumen eingeteilt.«
Jetzt erinnerte sich Stella wieder an das Gesicht. Sie war eine der Gemüsefrauen am Naschmarkt gewesen. Bei ihr hatte es die besten eingelegten Salzgurken der Stadt gegeben.
»Alle, die hier arbeiten, waren Nazis?«, fragte Stella irritiert. Die Gemüsefrau war stets freundlich zu ihr gewesen. Auch dann noch, als Stella den verhassten gelben Stern am Mantel hatte tragen müssen.
»Fast alle«, erklärte Feli. »Einige Frauen melden sich auch freiwillig, damit sie bessere Lebensmittelkarten erhalten. Besonders für diejenigen, die mehrere Kinder zu versorgen haben, wird es sonst eng. Es gibt aber auch Nazis, die letztes Jahr Aufräumarbeiten geleistet haben und jetzt Kompensationszahlungen fordern. Sie behaupten, sich keinerlei Verbrechen schuldig gemacht zu haben. Eine davon kennst du: Maria Pauli.«
Stella stöhnte. Mit Schrecken erinnerte sie sich an ihre frühere Studienkollegin, die ihren jüdischen Schülern Schilder um den Hals gehängt hatte, auf denen Ich bin ein dreckiger Jude gestanden hatte. Maria Pauli hatte an einer öffentlichen Schule Latein unterrichtet, an der nur eine Handvoll jüdischer Schüler gewesen war. Stella war ihr und den Schülern zufällig auf der Straße begegnet. Wie gerne hätte sie die Kinder von den Schildern befreit, doch als Jüdin hatte Stella schlechte Karten gehabt. Fassungslos und mit Tränen der Wut in den Augen hatte sie zugesehen.
»Wie kann Maria Pauli behaupten, sie wäre unschuldig gewesen? Sie war Parteimitglied, lange bevor Hitler auf den Heldenplatz einmarschiert ist.«
Feli zuckte mit den Schultern. »Offenbar leidet sie an Gedächtnisverlust, wie so viele andere auch. Aber mach dir keine Gedanken, sie arbeitet nicht mehr als Lehrerin. Pauli heißt jetzt Schneider, hat vier Kinder und wohnt irgendwo in Döbling.«
»Womöglich auch noch in einer arisierten Villa?«, fragte Stella finster.
»Sie hat einen reichen Rechtsanwalt geheiratet, der angeblich im ersten Kriegsjahr gestorben ist. Jetzt ist sie eine Witwe mit einem Haufen Kinder. Ich beneide sie nicht um ihr Leben.«
»Ich hoffe, dass ich ihr nie wieder begegnen muss«, sagte Stella. Niemals würde sie das angeekelte Gesicht der Studienkollegin vergessen, als sie ihr auf der Straße mit dem Judenstern am Mantel begegnet war. Maria, die regelmäßig in Prüfungen von ihr abgeschrieben hatte, tat so, als würde sie Stella nicht mehr kennen, und wechselte die Straßenseite, um nicht mit ihr reden oder sie auch nur grüßen zu müssen.
Die Freundinnen hatten die Schottenfeldgasse 47 erreicht, wo Felis kleine Wohnung lag. Ihre Eltern hatten sie ihr gekauft, als sie ihre Anstellung als Sekretärin im Gymnasium in der Lindengasse begonnen hatte. Insbesondere ihr Vater hätte sie weitaus lieber im familieneigenen Weinbetrieb in Stammersdorf, einem Ortsteil von Floridsdorf, gesehen, doch Feli hatte sich nach der Schule für eine Büroausbildung entschieden und war mit ihrer jetzigen Anstellung sehr zufrieden.
Die Scharniere quietschten laut, als Feli das grüne Rundbogentor des Hauses öffnete. Hinter dem Flur mit dem alten Gewölbe befand sich ein begrünter Innenhof. Wie so viele Häuser in Wien verfügte auch dieses über einen Gemeinschaftsgarten mit einem alten Nussbaum und einer Kastanie. Auf dem Platz, der mit Natursteinen ausgelegt war, standen wackelige Holzstühle und Bänke, und neben der Tür, die zu den Wohnungen führte, rankte wilder Wein an der Hausmauer empor. Ein Rosenstock trug letzte dunkelrote Blüten und verströmte einen Duft, der Erinnerungen an unbeschwerte Sommertage wachrief. In einem Gemüsebeet wuchsen Kohlrabi, Karotten, Lauch und Kartoffeln.
»Die Beete bessern unseren Speiseplan auf«, erklärte Feli. »Die Suppe, die ich für uns gekocht habe, ist fast ausschließlich aus eigenem Gemüse.« Sie schien Stellas Gedanken lesen zu können. »Die Amerikaner nehmen uns nichts weg, die haben selbst genug Lebensmittel. Bei meinen Eltern ist das anders. Die Russen sind nicht zimperlich.«
Stella hatte gehört, dass die Besatzer das Land zwar befreit, sich aber auch großzügig an den Wertgegenständen der Besiegten bedient hatten. In manchen Regionen hatte man nicht nur Schmuck und Teppiche, sondern auch die Töchter vor der Willkür der Soldaten versteckt.
Feli öffnete die Tür zum Stiegenhaus. Ihnen schlug ein leicht modriger Geruch entgegen, der sich mit dem Duft von Kernseife und Gemüsesuppe verband. Stella liebte diese Mischung, die noch genauso roch wie früher.
Über eine schmale Wendeltreppe, deren Stufen mit grau-blauen Fliesen ausgelegt waren, stiegen sie nach oben. Im ersten Stock gab es eine schmale Sitzbank, auf der ein Blumentopf mit einem Kaktus stand. Die Pflanze schien dringend ein paar Tropfen Wasser zu benötigen.
»Hat Fräulein Weber das hässliche Ding immer noch nicht entsorgt?«, fragte Stella lächelnd. Es war schön und tröstlich zugleich, dass sich nichts verändert hatte.
»Aus irgendeinem Grund hängt das Fräulein an dem Kaktus«, meinte Feli. »Dabei schimpft sie jede Woche mindestens einmal, dass die Stacheln sie kratzen würden.«
Um kurz zu verschnaufen, stellten sie die beiden Koffer ab. Genau in dem Moment öffnete sich eine der zwei Wohnungstüren. Eine kleine alte Frau mit gebückter Haltung und grauem Haar trat auf den Gang. Ihr dunkles Kleid mit weißem Spitzenkragen, das ihr bis zu den Knöcheln reichte, schien aus der Zeit gefallen zu sein, genau wie seine Trägerin. Es dauerte einen Moment, bis sie Stella erkannte.
»Meiner Seel!« Sie klatschte in die Hände. »Das Fräulein Herzig! Dass ich das noch erleben darf. Sie sind wieder in Wien, wie schön.«
Die Freude von Fräulein Weber war echt. Bei Stellas Flucht aus Wien hatte sie geweint, so sehr hatte sie sie ins Herz geschlossen. Dabei hatte Stella nach ihrer Delogierung nur ein paar Monate bei Feli gewohnt. Gerade so lange, wie es gedauert hatte, das Visum für England zu bekommen. In dieser Zeit war Stella oft von Fräulein Weber zum Kaffee eingeladen worden, während Feli gearbeitet hatte. Entweder hatten sie im Hof oder in Fräulein Webers Wintergarten Kaffee getrunken und geplaudert. Das alte Fräulein war Volksschullehrerin gewesen und hatte wegen des Lehrerinnenzölibats nie eine eigene Familie gegründet.
»Ich hab so oft an Sie gedacht und für Sie gebetet«, fuhr Fräulein Weber fort. »Jeden Abend habe ich den lieben Gott gebeten, dass er gut auf Sie aufpassen soll. Und er hat es gemacht. Ich werde mich heute bei ihm bedanken.« Die alte Dame bekreuzigte sich. In den letzten Jahren war ihr faltiges Gesicht noch zerfurchter und schmäler geworden, an den wachen grauen Augen hatte sich jedoch nichts verändert. »Wenn Sie sich wieder eingelebt haben, kommen Sie zu mir auf einen Kaffee.«
»Sie haben Kaffee?«, fragte Feli belustigt. »Und das sagen Sie mir erst jetzt? Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich Sie längst besucht.«
»Pst!« Fräulein Weber legte den Finger an ihre Lippen. »Es ist nur Malzkaffee, aber immerhin. Wenn die Mizzi davon erfährt, habe ich sie nicht nur einmal, sondern gleich zweimal am Tag hier sitzen.«
Stella musste schmunzeln. Frau Maria Kreidl, genannt Mizzi, und Fräulein Anna Weber waren Nachbarinnen und eigentlich die besten Freundinnen, doch das würden sie niemals zugeben. Was sie trennte, war die politische Ausrichtung: Während Fräulein Weber den Christlichsozialen angehörte, war Frau Kreidl überzeugte Sozialdemokratin. Im Bürgerkriegsjahr 1934 war ein Bruch durch die österreichische Gesellschaft gegangen, der bis heute nicht gekittet war. Damals hatte Dollfuß das Parlament außer Kraft gesetzt und die Sozialdemokraten verboten. Viele von ihnen landeten im Gefängnis, andere wurden erhängt. Einige der klügsten Köpfe hatten das Land verlassen. Fräulein Weber hatte damals den Ehemann von Frau Kreidl vor dem Erschießungskommando bewahrt, was den Grundstein ihrer Freundschaft gelegt hatte. Später hatte der Ekel vor den Nationalsozialisten die beiden Frauen geeint. Ewald Kreidl war gleich im ersten Kriegsmonat einberufen worden und schon nach ein paar Wochen an der Front für Hitler gestorben, dessen Herrschaft er zeit seines Lebens hatte verhindern wollen.
»Ich komme sehr gerne zu Ihnen auf eine Tasse Malzkaffee«, versprach Stella und stieg hinter Feli die Treppe hoch in den zweiten Stock.
»Glaub Fräulein Weber kein Wort«, flüsterte Feli. »Sie und Frau Kreidl verbringen mehr Zeit miteinander denn je, aber sie können immer noch nicht zugeben, dass sie einander mögen.«
Am Ende der Treppe kramte sie einen Schlüssel aus ihrer Handtasche, sperrte auf und ließ Stella den Vortritt. Auch in Felis Wohnung schien sich in den letzten acht Jahren nichts verändert zu haben. Der Spiegel im Flur hing nach wie vor schief.
Stella lachte. »Du hast ihn immer noch nicht gerade ausgerichtet.« Automatisch stellte sie sich etwas schräg.
»Ich habe mich daran gewöhnt«, entschuldigte sich Feli. »Wenn der Spiegel gerade hängen würde, würde ich mich vielleicht gar nicht mehr erkennen.«
Durch das Vorzimmer gelangten sie in eine geräumige Wohnküche. Sie war das Herzstück der Wohnung. In der weißen Kredenz befanden sich dunkelgrüne Teller und Tassen mit goldenem Rand. Auf dem Herd standen der rote Wasserkessel, mit dem Feli morgens ihr Teewasser aufbrühte, und ein großer Emailtopf mit der Suppe, die darauf wartete, aufgewärmt zu werden.
An der Wand hing die alte Kuckucksuhr von Felis Oma. Auf der Eckbank, die wie eh und je zum Verweilen einlud, lagen bunt gemusterte Kissen mit Stoffen aus der Wiener Werkstätte. Durch eine Holztür mit Glasfenster gelangte man auf eine Terrasse, die direkt über Fräulein Webers Wintergarten lag. Sie war im Frühling, Sommer und Herbst Felis Lieblingsort. Stella öffnete die Tür und trat hinaus. Auch hier schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Nur fünf große Tontöpfe waren dazugekommen, in denen ebenfalls Gemüse wuchs.
Eine Wehmut durchströmte sie. Langsam drehte sie sich zu ihrer Freundin um und lehnte sich gegen ihre Schulter. »Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein.«
»Es ist fein, dich hier zu haben.«
Später saßen sie in Decken gewickelt auf der Terrasse. Eine Kerze flackerte in einer alten Laterne. Die Suppenteller waren leer gegessen. In zwei Tassen befand sich noch der Rest von Stellas Tee aus London. Feli tupfte mit dem Zeigefinger die letzten Reste der Haferkekse auf und schleckte sie von der Fingerkuppe.
»So ein gutes Abendessen hatte ich schon lange nicht mehr«, sagte Feli.
»Wenn ich gewusst hätte, dass du Haferkekse magst, hätte ich ein paar der Bücher in London gelassen und lieber noch ein paar Packungen mitgenommen.«
»Du hättest deinen ganzen Koffer damit füllen können.«
Stella zog die Decke enger um die Schultern. »Ich werde Tom schreiben und ihn bitten, dass er mir einen Karton mit Lebensmitteln schickt.«
»Das ist eine gute Idee«, meinte Feli. »Erzähl mir von diesem Tom. Fandest du ihn auch als Mann interessant? In deinen Briefen hast du immer wieder von ihm geschrieben, dich aber nie näher geäußert. Auch dann nicht, wenn ich explizit nach ihm gefragt habe.«
Stella machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ein Arbeitskollege im Heim für schwer erziehbare Kinder.«
»Nur ein Arbeitskollege?« Feli zog die Augenbrauen vielsagend hoch. Es war fast wie früher, als sie sich abends getroffen und von ihren Schwärmereien erzählt hatten.
»Definitiv! Mein Herz gehört nach wie vor Simon. Und das wird auch immer so bleiben.«
Feli langte über den Tisch, ergriff Stellas Hand und drückte sie. »Simon hätte nicht gewollt, dass du dein Leben lang allein bleibst. Er hat dich geliebt.«
»Allein zu sein heißt nicht, dass man einsam ist«, entgegnete Stella. »Ich sitze mit dir auf der gemütlichsten Terrasse Wiens.«
Es war lange her, dass Stella den Namen ihres Verlobten ausgesprochen hatte. In Gedanken war sie oft bei ihm, vermutlich zu oft. Aber wie steuerte man sein Denken und sein Unterbewusstsein?
Feli unterbrach ihre Überlegungen. »So grausam das auch klingen mag, aber du hast wenigstens die Gewissheit, dass er nicht wiederkommen wird. Du kannst um Simon trauern«, meinte sie einfühlsam. »Auf etwas zu hoffen, was vielleicht niemals eintreten wird, ist mindestens genauso schrecklich.« Mit einem Mal legte sich ein Schatten über ihr Gesicht.
»Hast du etwas Neues von Hubert gehört?«, fragte Stella.
Hubert Zechner war der Mann, den Feli heiraten wollte. Bei seinem letzten Heimaturlaub hatten sie sich verlobt. Das war vor vier Jahren gewesen, im Sommer 1942. Die beiden kannten sich seit der frühen Kindheit. Als Feli Stella von ihrer Verlobung geschrieben hatte, hatte diese es zuerst nicht glauben wollen, denn die beiden waren sehr unterschiedlich und hatten nie tiefere Gefühle füreinander empfunden, soweit Stella wusste. Der Krieg und der drohende Tod schienen in dieser Hinsicht etwas verändert zu haben. Vielleicht aber waren es auch Felis Eltern gewesen, die sich einen Schwiegersohn gewünscht hatten, der bereit war, auf dem Winzerhof mitanzupacken.
Einen Monat nach der Verlobung war Hubert in russische Gefangenschaft geraten. Seither saß er in einem Lager irgendwo bei Leningrad. Feli hatte erst nach Ende des Krieges eine Rotkreuzkarte von ihm erhalten, auf der gestanden hatte, dass er am Leben war. Seither kamen hin und wieder kurze Lebenszeichen von ihrem Verlobten.
»Die letzte Karte von ihm ist schon zwei Monate alt«, sagte Feli niedergeschlagen. »Er hat geschrieben, dass seine Wunde langsam verheilt. Angeblich haben die Sowjets ihn zusammengeflickt. Aber ich weiß nicht, wie viel ich von dem glauben soll, was er schreibt. Die Briefe werden alle zensiert. Bestimmt muss er genau aufpassen, wie er seine Nachrichten formuliert.«
»Er ist am Leben, das ist das Allerwichtigste.«
»Du hast recht«, stimmte Feli ihr zu. »Aber ich mache mir Sorgen um ihn.«
»Ehrlich gesagt bin ich immer noch überrascht darüber, dass du dich ausgerechnet mit Hubert verlobt hast«, sagte Stella. In ihrer Erinnerung war er ein farbloser, eher langweiliger Mann, der sich für Technik interessierte, sich aber wegen seiner Familie für eine Bäckerlehre entschieden hatte.
»Da sind mehrere Dinge zusammengekommen«, gab Feli zu.
»Das musst du mir genauer erklären.«
»Nach der Nachricht von Oskars Tod an der französischen Front waren meine Eltern am Boden zerstört. Ich habe mir große Sorgen um sie gemacht, besonders um meine Mutter. Sie fiel regelrecht in ein Loch der Traurigkeit.«
»Was hat der Tod deines Bruders mit Hubert und dir zu tun?«
»Du weißt doch, Hubert war unser Nachbar. Meine Eltern kannten und mochten ihn. Meine Mutter hat schon seit Jahren gemeint, dass er der ideale Schwiegersohn sei.«
»Und deshalb hast du dich mit ihm verlobt?«, fragte Stella ungläubig.
»Hubert hat mir versprochen, dass er den Betrieb übernimmt. Er kann sich vorstellen, Weinbauer zu werden.«
Stella verzog den Mund. »So wie er Bäcker geworden ist. Ohne Leidenschaft, einfach aus einem Pflichtbewusstsein heraus. Willst du wirklich mit so einem Mann dein Leben verbringen?«
Feli zuckte mit den Schultern. »Ich mag Hubert. Er ist nett, und die Verlobung hat meine Eltern glücklich gemacht. Als meine Mutter davon erfahren hat, ist sie regelrecht aufgeblüht.«
»Die Verlobung sollte in erster Linie dich glücklich machen«, sagte Stella ernst.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: