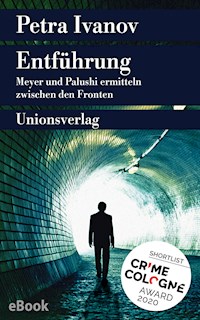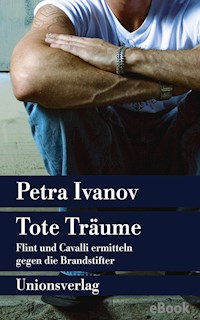Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Appenzeller
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
18 Autorinnen und Autoren verschiedenster Regionen zeigen die idyllische Schweiz von ihrer düsteren Seite: Von Aarau über Gais. Rodels bis Zürich. vom Lac Léman bis zum Bodensee – kriminell. brutal. mörderisch. Es wird gemordet – mit schweizerischer Präzision. Es wird gestorben – von Lausanne über Biel. Basel. Zürich. Kreuzlingen. Gais bis ins Rheintal. 18 bekannte Krimiautorinnen und -autoren aus verschiedenen Regionen der Schweiz schlagen zu: Zwischen Dinosaurier-spuren entdeckt ein Mädchen einen toten Geschäftsmann. ein Wanderer verliert sich im Weiss des alpinen Schneesturms. und der Säli-Mörder versetzt die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Literarisch gemordet haben Karin Bachmann in Biel; Christina Casanova in Rodels GR; Anne Cuneo in Lausanne; Mitra Devi in Luzern; Alice Gabathuler im Rheintal; Peter Hänni in Lommiswil SO; Michael Herzig in Wollerau/ Freienbach SZ; Petra Ivanov in Kreuzlingen; Sam Jaun im Jura; Helmut Maier in Schaff-hausen; Felix Mettler in Gais AR; Milena Moser in Aarau; Jutta Motz in Zug; Philipp Probst in Basel; Susy Schmid in Fribourg; Andrea Weibel in Stans NW; Peter Zeindler an der Zürcher Goldküste und Emil Zopfi in Glarus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mord in Switzerland
MITRA DEVI & PETRA IVANOV (HRSG.)
MORD IN SWITZERLAND
18 KRIMINALGESCHICHTEN
Appenzeller Verlag
Die Herausgeberinnen danken der Fondation Jan Michalski
für die grosszügige Förderung dieses Buches
1. Auflage, 2013
© Appenzeller Verlag, CH-9101 Herisau
Alle Rechte der Verbreitung,
auch durch Film, Radio und Fernsehen,
fotomechanische Wiedergabe,
Tonträger, elektronische Datenträger und
auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Eliane Ottiger
Gesetzt in Janson Text und gedruckt auf
90 g/m2 FSC Mix Munken Premium Cream 1.75
ISBN Buch: 978-3-85882-653-4
ISBN eBook: 978-85882-658-9
www.appenzellerverlag.ch
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
INHALT
Liebe Leserin, lieber Leser
MORD IN SWITZERLAND
Erzählen als Suche und Untersuchung
Edgar Marsch
AARAU
Wie-ein-Mensch
Milena Moser
GAIS
Tod bei Gais
Felix Mettler
LUZERN
Luzern – Chicago
Mitra Devi
SCHAFFHAUSEN
Reinfall am Rheinfall
Helmut Maier
BASEL
Tod im 36er
Philipp Probst
RHEINTAL
Regenbogenwolken
Alice Gabathuler
LAUSANNE
Mord in der Kathedrale
Anne Cuneo
STANS
Helm – in Blau
Andrea Weibel
LOMMISWIL
Dinosauriersteak
Peter Hänni
ZUG
Die Russin
Jutta Motz
JURA
Ferien im Jura
Sam Jaun
WOLLERAU/FREIENBACH
Tschingg
Michael Herzig
BIEL
Fokus
Karin Bachmann
RODELS
Der Flachwichser
Christina Casanova
GLARUS
Tod am Tödi
Emil Zopfi
KREUZLINGEN
Späte Rache
Petra Ivanov
ZÜRCHER GOLDKÜSTE
Königin der Nacht
Peter Zeindler
FRIBOURG
Heute abend in F.
Susy Schmid
Autorinnen und Autoren
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Die Idee zu diesem Buch entstand während einer Zugfahrt. Wir hatten eine Ausstellung über das Verbrechen in der Schweiz besucht. In Gedanken versunken, betrachteten wir die Landschaft, die an uns vorbeizog. Die Schweiz präsentierte sich an diesem Frühlingstag von ihrer friedlichsten Seite. Doch wir wussten: Vordergründiges täuscht. Und so begannen wir, unserer Phantasie freien Lauf zu lassen. Wir fragten uns, wie es im idyllischen Einfamilienhaus am Waldrand wirklich zuging. Ob die alte Dame mit dem Tulpenstrauss tatsächlich Gutes im Sinn hatte. Warum der Bauer reglos auf seinem Traktor sass und auf den Acker starrte.
Wir beschlossen, jene zu fragen, die die Schweiz von ihrer düsteren Seite kennen: einheimische Krimiautorinnen und -autoren. Wir baten sie, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und eine Geschichte zu schreiben. Über das grosse Echo freuten wir uns riesig. Schon bald trafen Krimis aus den verschiedensten Regionen, Dörfern und Städten der Schweiz ein.
Möglicherweise werden Sie nach dem Lesen dieser 18 Geschichten nicht mehr ganz so unbeschwert durch die Städte flanieren. Vielleicht werden Sie in Zukunft beim Wandern öfters mal über die Schulter schauen. Ganz sicher werden Sie die Schweiz mit anderen Augen betrachten. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!
Mitra Devi & Petra Ivanov
ERZÄHLEN ALS SUCHE UND UNTERSUCHUNG
EDGAR MARSCH
«Mord in Switzerland» bietet einen faszinierenden Einblick in die Schweiz und ihre Kriminalliteratur. In jeder Geschichte wird eine Landschaft vorgestellt mit ihren Menschen, deren Mentalität, Problemen und Schwächen, den regionaltypischen Orts- und Eigennamen, den Sitten, den sprachlichen Eigenheiten.
Die hier von Mitra Devi und Petra Ivanov vorgelegte Sammlung zeigt – für den literarischen Werkplatz Schweiz – einen auffallend hohen Pegelstand, in Qualität wie in Zahlen. Die Produktion von Kriminalerzählungen ist vom bescheidenen Rinnsal beinahe zur Flut angeschwollen, ohne dass dieses gewaltige Wachstum der Qualität einen Abbruch getan hätte. Der neuere literarische Kriminalroman der Schweiz setzte in den 1970er-Jahren ein und gewann in den 80er-Jahren an Kraft mit Autoren wie Alexander Heimann, Sam Jaun, Ulrich Knellwolf, Werner Schmidli, Hansjörg Schneider, Martin Suter und Peter Zeindler. Die Gattung boomt heute regelrecht.
Zartbesaitete versus Hartgesottene, schichtenspezifisches Publikum und gattungsspezifische Leserinnen und Leser – solche Sortierungen gelten längst nicht mehr. Es ist bemerkenswert, dass – auch und vor allem in der Schweiz – viele Frauen als Autorinnen in die Fussstapfen von Dorothy L. Sayers und Agatha Christie getreten sind. Dabei steht längst nicht mehr ausschliesslich das Verbrechen im Mittelpunkt. Genauso wichtig sind heute die Frage nach der Gerechtigkeit und das Schicksal von Menschen, die durch Ausbeutung, Misshandlung und Unterdrückung in Bedrängnis oder sonst an den Rand der Gesellschaft geraten sind, wie beispielsweise in den Geschichten von Anne Cuneo oder Jutta Motz.
Das Vorurteil gegenüber Krimis als typisch «männliche Literatur» ist längst widerlegt worden. Genauso ist auch das mit dem einfachen Schema zusammenhängende Vorurteil minderwertiger Unterhaltungsliteratur nicht mehr aktuell, das ungefähr 100 Jahre lang, bis in die Siebzigerjahre des 20. Jahrhunderts, in der Literaturkritik bestimmend war. Längst ist die Kriminalerzählung aus dem löchrigen Mantel eines Clochards der seichten Literatur herausgeschlüpft, hat sich unter den respektierten Gattungen Rang und Ansehen erkämpft und ist seriöser Forschungsgegenstand an den Hochschulen geworden.
Erfahrene Krimileserinnen und -leser werden in Peter Hännis «Dinosauriersteak» das klassische Modell erkennen: Ganz am Anfang ereignet sich der Mord, der Täter ist unbekannt. Ein Detektivduo nimmt die Ermittlungen auf. Die Detektive sammeln Informationen, kombinieren sie und erörtern die Ergebnisse. Leserinnen und Leser werden als Zeugen der Dialoge am Aufklärungsprozess beteiligt. In Karin Bachmanns «Fokus» stehen nicht Detektive, sondern Jugendliche im Mittelpunkt. In Philipp Probsts «Tod im 36er» wird zu Beginn ebenfalls eine Leiche gefunden. Hier ist es eine Journalistin, die Anhaltspunkte sammelt, bis die Tat geklärt ist. Probst nimmt die Geschichte als Anlass, um aktuelle Probleme in der Gesellschaft zu erörtern: Rassismus, Hooliganismus, Bankdatendiebstahl. Genauso ist in Christina Casanovas Geschichte «Der Flachwichser» nicht die Tat selbst das Kernthema; zentral sind die Konflikte, Abgründe und Untiefen im sozialen Beziehungsnetz rund um das Opfer. In Sam Jauns und Alice Gabathulers Erzählungen hingegen spielen die Familienbeziehungen eine wichtige Rolle.
Ein anderes Schema weisen die Geschichten auf, in denen die Täter als Menschen zugänglich werden. In Michael Herzigs «Tschingg» sowie Petra Ivanovs «Späte Rache» kommt die Steuerung der Leser-Sympathie fast einer Umpolung gleich: Die Täter sind nicht mehr die Bösewichte, die von den Guten eliminiert werden, damit die Welt wieder in Ordnung ist. Mitleid entkräftet das Sühnebedürfnis. Am Schluss wird das Opfer verurteilt. Auf ironische Art und Weise wird diese Tendenz zur «Entschuldung» der Täter auch in Susy Schmids «Heute abend in F.» deutlich.
Neuere Kriminalerzählungen setzen zunehmend auf die Frage, was denn Schuld eigentlich sei und wer der oder die eigentlich Schuldige. Dort, wo Täterbiographien im Erzählen berücksichtigt werden, findet eine Art «Humanisierung» der Gattung statt. Auf die «Entmenschlichung» der Täter und Täterinnen wird verzichtet und dafür ihr Schicksal beschrieben. Dabei kann sich die für den klassischen Krimi zentrale Frage «Who dunnit?» (Wer hat die Tat begangen?) völlig verflüchtigen. Emil Zopfis lyrisch-melancholische Erzählung «Tod am Tödi» setzt sogar bei einem Unglücksfall an.
Die wahrscheinlich wichtigste Abweichung gegenüber früheren Kriminalromanen stellt der veränderte Blickwinkel in vielen Geschichten dar: Parallel zur Aufklärungsgeschichte oder mit ihr verwoben findet ein sozialgeschichtlicher oder sozialpolitischer Diskurs statt. Die neueren Autoren und Autorinnen sind bei der Konzeption ihrer Geschichten nicht durch einen engen Tunnelblick bestimmt, sondern öffnen den Blickwinkel und schauen «nach links und nach rechts». Sie loten Umstände, Untiefen, gesellschaftliche Ungereimtheiten, soziale Konflikte, Ungerechtigkeiten, Ausbeutung und Missbrauch aus und befreien so die Verbrechenserzählungen aus der abgeschotteten Laborsituation. Sie stellen sie in einen greifbaren und begreifbaren gesellschaftlichen Rahmen. Die meisten Erzählungen dieser Anthologie folgen diesem neuen Trend, den übrigens Friedrich Glauser schon vorexerziert hat.
Herzigs Pankratius Föhn ist ein abschreckendes Beispiel modernen Unternehmertums. Die Figur ist bestimmt durch ein Übel, das verbreitet auftritt: Ressentiments gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aggressive Fremdenfeindlichkeit, ja Fremdenhass, mit einer Neigung zu sexueller Ausbeutung von Abhängigen. Andrea Weibels berührende Geschichte «Helm – in Blau» handelt von Alma aus Wien, die als Altenpflegerin in der Fremde unterwegs ist und nun in Stans arbeitet. Die ansässige Bevölkerung unterstellt der «kleinen Wienerin», dass sie zu viel trinke, alte Menschen ausnütze, beraube, beerbe und dass diese ihr dann «unter den Händen wegsterben». In Felix Mettlers «Tod bei Gais» wird ein junger Arzt psychisch unter Druck gesetzt.
Einige der Geschichten der Sammlung geben sich verschmitzt, augenzwinkernd. Das kann beim Blick in die Abgründe des Bösen befreiend und entlastend wirken. Wenn die Darstellung dessen, was in der Kriminalerzählung abstösst, ängstigt, erschreckt oder erschüttert, durch die ironische Haltung des Erzählers entkräftet wird, dann gewinnen auch die Leserinnen und Leser gegenüber dem Erzählten befreiende Distanz. Der melodramatische Racheakt, den eine Opernsängerin in Peter Zeindlers «Königin der Nacht» plant, endet ganz anders als erwartet. Auch die Pläne des Täters in Helmut Maiers «Reinfall am Rheinfall» entwickeln sich in eine andere Richtung. In Mitra Devis «Luzern – Chicago» kommt Ironie schon im Gegeneinander der beiden Schauplätze zum Ausdruck. Ironisch wirkt auch der distanziert beobachtende Erzähler. Von Anfang an weiss er alles über das Missgeschick der Hauptfigur. Die Erzählung beginnt mit den Worten: «Zwei Stunden vor dem ersten und letzten Mord, den Julia je in ihrem Leben begehen würde …» In Milena Mosers «Wie-ein-Mensch» setzt die Geschichte mit den überraschenden Worten einer Frau ein, die von ihrem Ehemann daheim in Aarau umgebracht worden sein soll. In Susy Schmids «Heute abend in F.» entlädt sich ironisches Potenzial nicht im Erzählten, sondern in der Beziehung zwischen der Erzählerin und dem Leser. Die Spannung, die in der Geschichte zum Ende hin aufgebaut wird, löst sich in einem befreienden Lachen.
Bei manchen Erzählungen wird sich die Leserin, der Leser die Frage stellen: Ist das noch eine Kriminalerzählung? Sind das noch Kriminalgeschichten? Sie sind es. Sie legen ein Zeugnis dafür ab, wie wandlungsfähig die Gattung ist. Und diese Wandlungsfähigkeit ist auch ein Garant ihrer langen Lebensdauer.
WIE-EIN-MENSCH
MILENA MOSER
Vancouver Island, heute
«Das darf doch nicht wahr sein! Der Idiot hat mich umgebracht!» Amanda liess die Zeitung sinken. Sie war über eine Woche alt. Die Meldung stand auf der Aufschlagseite des Lokalteils: «Fatales Ehedrama in Aarauer Kunstszene».
Aarau, vor über einer Woche
«Was meinst du, was die Häuser hier kosten?» Markovic schaute aus dem Fenster. Das Villenviertel lag im Dunkeln. Gisiger antwortete nicht. Er versuchte, auf dem Bildschirm des neu installierten Navigationssystems die Strasse zu finden, aus der der Notruf gekommen war.
«Meine Frau ist tot!»
Meine leider nicht, hatte Gisiger gedacht, sich aber sofort für diesen Gedanken geschämt. Wer dachte so etwas. Und noch dazu ein Polizist! Gisiger fand es in letzter Zeit immer schwieriger, seine Gedanken zu kontrollieren.
«Ich glaub, ich weiss, wo es ist», sagte Markovic jetzt. «Ich geh hier oben im Wald immer joggen.»
Die Strasse endete in einem Kehrplatz. Gisiger wendete den Wagen und fuhr langsam zurück. Joggen könnte helfen, dachte er. Den Kopf leeren beim Laufen. Manche schwören ja darauf.
«Landhausweg, wenn das kein Euphemismus ist», sagte Markovic, der jeden Tag ein neues Wort lernte. «Protzvillenweg wäre passender!»
Gisiger war nicht sicher, ob «Euphemismus» das richtige Wort dafür war. Doch er wusste auch kein besseres. Und als die Strasse nach der nächsten scharfen Kurve wieder im Nichts endete, fiel ihm dazu nur «Scheisse!» ein.
«Fahr nochmal zurück, die Strasse teilt sich da vorne.» Markovic hatte es irgendwie geschafft, das Display des Navigationssystems zu vergrössern, und fuhr mit dem Finger dem Strassenverlauf nach.
«Scheisse», sagte Gisiger noch einmal.
«Kein Stress. Die Frau ist tot, der Mann läuft nicht davon. Da vorne links, und dann zum Waldrand hoch.»
Ein -ic bei der Kantonspolizei, dachte Gisiger. Das hätte es früher auch nicht gegeben. Wieder ein Gedanke, der nicht zu ihm passte. Gisiger hielt sich für grosszügig, für tolerant. Doch in den letzten Jahren war er bitter geworden. Und er wusste nicht einmal warum.
Markovic war ausserdem der grösste Bünzli, den Gisiger je kennengelernt hatte, schweizerischer als jeder Schweizer. Fleissig, pünktlich, zuverlässig. Dauernd gab er mit seinem Fünfjahresplan an: Beförderung, Heirat, Hausbau, Kinder, in dieser Reihenfolge. Dass man sein Leben planen könnte, wäre Gisiger nie in den Sinn gekommen. Doch er zweifelte nicht daran, dass Markovic seine selbstgesteckten Ziele erreichen würde.
Gisiger war das fremd. Er war eher zufällig zur Polizei gekommen. Eines frühen Morgens nach dem Ausgang war er mit seinen Kollegen vor einem Plakat stehengeblieben, auf dem die Kantonspolizei für Anwärter warb. Die anderen hatten gegrölt: «Hey, Gisi, das wär doch was für dich!» Sie hatten ihn damals schon «Schmieri» genannt, Schmierlappen, Polizist. Er war immer der, der die letzte Runde ablehnte, zum Aufbruch drängte, der die anderen ermahnte, ruhig zu sein, sie daran erinnerte, dass die Nachbarn schon schliefen. Er hatte mit ihnen mitgelacht, aber ein paar Tage später hatte er sich zum nächsten Ausbildungsgang angemeldet. Die Polizeiarbeit gefiel ihm besser, als er erwartet hätte. Sie entsprach seinem Bewusstsein, Teil eines grösseren Ganzen zu sein, Verantwortung zu tragen. Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun … Wann hatte er das verloren?
«Hier ist es.» Markovic stieg aus und drückte einen in der Mauer versteckten Knopf. Ein Tor öffnete sich nach innen, es sah aus, als würde ein Efeuvorhang aufgezogen. Dornröschen, dachte Gisiger. Vielleicht ist die Frau gar nicht tot, vielleicht schläft sie nur einen hundertjährigen Schlaf.
Hundert Jahre schlafen! Das wäre Gisigers Traum. Der einzige, der ihm noch geblieben war. Beförderung? Hausbau? Kinder? Allein die Vorstellung machte ihn müde. Noch müder, als er schon war. Morgens, wenn der Wecker läutete, wünschte er sich, der Tag wäre schon vorüber und er könnte wieder ins Bett gehen.
Letzten Monat hatte er eine Informationsveranstaltung besucht: Burn-out im öffentlichen Dienst. Die Teilnahme war vorgeschrieben, sonst wäre wohl niemand hingegangen. In der Kaffeepause hatten sie noch darüber gewitzelt, doch am Ende der Veranstaltung waren alle Flyer weg gewesen. Gisiger hatte den letzten eingesteckt. Auf der Rückseite stand die Nummer des internen Beratungsdienstes. Er hatte noch nicht angerufen.
«Du bist stehen geblieben», sagte Helen, seine Frau. «Du hast dich aufgegeben.»
Gisiger liess den Wagen die kurze, geschwungene Einfahrt hinaufrollen und hielt dann vor dem Haus. In der offenen Türe stand, wie in einem Bilderrahmen, von hinten beleuchtet, die Arme ausgebreitet, der Hausherr.
«Was wetten wir, dass er es war? Hundert Franken?»
Markovic streckte die flache Hand aus. Gisiger zögerte: «Du schaust zu viel fern.»
«Es ist doch immer dasselbe: Erst töten sie ihre Frauen, dann melden sie sie vermisst, dann finden sie sie.»
«Immer dasselbe, hm? Wie oft hatten wir so einen Fall schon?» Die meisten Tötungsdelikte, die sie bearbeiteten, waren, was Markovic «no-brainer» nannte: Fälle, über die man nicht nachdenken musste. Beziehungsdelikte, Messerstechereien, eine Schlägerei mit tödlichem Ausgang – Markovic hatte recht, der Täter war fast immer ein Mann.
«Ich hab ihn gegoogelt», sagte Markovic. «Ein typischer Loser. Erfolgloser Künstler, der von seiner Frau lebt. So was geht nie lange gut. Es ist gegen die Natur.»
«Soso, gegen die Natur!» Gisiger hatte tatsächlich einmal eine Ausstellung von Jonas Murbach besucht. Video-Installationen. Sie hatten ihn nicht beeindruckt. Vielleicht hatte er sie auch einfach nicht verstanden. Grundsätzlich mochte Gisiger Kunst, die er nicht gleich verstand. Die ihn irritierte, tagelang verfolgte, über die er nachdenken musste. Das war seiner Meinung nach die Aufgabe von Kunst. Aber diese Filmchen hatten ihn nur gelangweilt. Gisiger erinnerte sich an die Kritik der Ausstellung, sie war mit süffisanten Hinweisen auf die Position der Frau des Künstlers gespickt gewesen. Amanda Murbach, die Tote, war eine der reichsten Frauen im Kanton. Erbin und Verwalterin einer grossen Kunstsammlung, Gönnerin des Kunstvereins, Sammlerin, Mäzenin. Keine einfache Konstellation, dachte Gisiger. Wobei, einen typischen Loser hatte ihn Helen neulich auch genannt. Er habe keine Visionen. Keinen Ehrgeiz. Genau das hatte ihr früher an ihm gefallen. «Ein Mann, der sich nicht ständig beweisen muss, ist sexy», hatte sie gesagt. Heute wünschte sie offenbar, er hätte auch einen Fünfjahresplan. Gisiger hatte Markovics Verlobte kennengelernt, eine ehemalige Miss-Schweiz-Kandidatin mit sehr weissen Zähnen. Sie strahlte dieselbe unerschütterliche, beinahe arrogante Zuversicht aus wie Markovic.
Wartet nur, hatte Gisiger gedacht. Wartet nur, ihr kommt auch noch auf die Welt!
Seit wann dachte er so etwas?
«Da sind Sie ja! Endlich!»
Murbachs Hemd stand offen, sein Haar war wirr, er fuhr sich mit beiden Händen über den Kopf. Der Mann musste über vierzig sein, er sah gleichzeitig älter und jünger aus. Älter machten ihn seine Augensäcke, die tiefen Falten in der groben Gesichtshaut, die, so vermutete Gisiger, der Alkohol gezeichnet hatte. Jünger wirkte seine lässige Kleidung, sein drahtiger Körper. Unwillkürlich zog Gisiger den Bauch ein.
«Mein Name ist Gisiger, Herr Murbach, das ist mein Kollege, Herr Markovic. Der Amtsarzt ist unterwegs, er sollte jeden Moment hier eintreffen.»
«Ein Arzt? Haben Sie mir nicht zugehört? Es ist zu spät! Sie ist tot! Meine Frau ist tot!»
«Was hab ich gesagt?», raunte Markovic.
Gisiger zuckte die Schultern. Er hatte tatsächlich schon bessere Aufführungen gesehen. Im Laientheater.
«Können wir hereinkommen?», fragte er freundlich. «Wir müssen auf den Amtsarzt warten, der den Tod Ihrer Frau feststellt.»
Gisiger, der Dicke, Gemütliche, würde Vertrauen aufbauen, Markovic, der Smarte, würde dieses Vertrauen dann mit gezielten Fragen durchlöchern. «Good cop, bad cop» nannte man dieses Vorgehen im Fernsehen. «Lösungsorientiertes Kommunikationsmodell» hatte es in der Weiterbildung geheissen.
Murbach führte sie durch die Eingangshalle und einen breiten Flur entlang in ein geräumiges Wohnzimmer. Markovic murmelte die ganze Zeit etwas vor sich hin, das Gisiger im ersten Moment für ein Gebet hielt. War Markovic nicht katholisch? Dann erkannte er die Markennamen: «DeSede, Eames, Corbusier», murmelte sein Kollege vor sich hin.
Die Sitzgruppe war für mindestens zwanzig Personen konzipiert. Murbach führte sie in die am weitesten von der Tür entfernte Ecke. Im Vorbeigehen hob er ein Magazin auf – ART –, nahm einen bunten Seidenschal von einer Rückenlehne.
«Setzen Sie sich.»
Sie setzten sich. Murbach drehte den Schal in seinen Händen zu einer Kordel, wickelte sie um seine Handgelenke, spannte und entspannte sie. Wusste der Mann, was er da tat? Gisiger konnte seinen Blick nicht abwenden.
«Das ist bestimmt nicht einfach für Sie», murmelte er schliesslich.
Murbach blickte auf seine Hände und liess den Schal fallen.
«Oh Gott, was hab ich getan?», stammelte er. «Oh Gott, oh Gott!» Und dann: «Dabei bin ich nicht mal religiös!»
«Hm», machte Markovic. «Warum erzählen Sie uns nicht einfach, was passiert ist? Und bitte von Anfang an!»
Vancouver Island, heute
«Nun – offensichtlich sind Sie ja nicht tot …»
«Nein …» Amanda lächelte entschuldigend. Der grosse Mann, der sich als Officer Lovechild vom Victoria Police Department vorgestellt hatte, sass ihr an dem schmalen Holztisch gegenüber. Er sah aus, wie Amanda sich als Kind einen Indianer vorgestellt hatte. Im Sitzen überragte er noch Endo Roshi, den Leiter des Zen-Centers, der hinter ihm an der Wand stand, die Hände in der Robe versteckt, die Augen mild.
Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Amanda frühmorgens das Haus verlassen, um den drei Frauen, die zweimal pro Woche bei ihr putzten, nicht im Weg zu sein. Sie war durch die Gassen der Altstadt geschlendert und beinahe gegen den Passantenfänger gestolpert, der am Ende der Rathausgasse für die Yogaschule und das Zendo Aarau warb. Sie nahm sich einen Flyer und las, dass in zehn Minuten eine Meditationsstunde beginnen würde. Obwohl sie nicht mehr über Zen-Buddhismus wusste, als sie in einem Kriminalroman gelesen hatte, klingelte sie an der Tür. Eine freundliche Frau in einer schwarzen Robe bat sie herein. Sie erklärte nicht viel: «Setz dich auf ein Kissen, richte den Blick nach unten, zähl deine Atemzüge.»
Anfangs hatte sich Amanda äusserst unwohl gefühlt. Ihre Knie taten weh, ihre Schultern spannten, ihre Nase juckte, sie wollte sich die Haare aus dem Gesicht streichen. Sie hörte den Atem der anderen, dann ihren eigenen. Nervös schluckte sie mehrmals hintereinander. Es musste im ganzen Raum zu hören sein. Wie lange sass sie schon hier? Doch zwischendurch erinnerte sie sich immer wieder an ihren Atem: eins … zwei …
Und plötzlich war einen Moment lang Ruhe in ihrem Kopf. Einen Moment lang gab es nur noch das. Eins … zwei … Ihr Name fiel von ihr ab, ihr Erbe, ihre Funktion. Die Frage, die sie seit Jahren quälte, ob ihr Leben überhaupt einen Sinn hatte, ob sie ohne ihr Erbe, ohne ihren Namen überhaupt eine Existenzberechtigung hatte, fiel von ihr ab. Der dumpfe, quälende Schmerz der Entfremdung von ihrem Mann, der ihr diese Bestätigung jahrelang gegeben hatte, fiel von ihr ab. Es gab keine andere Berechtigung als diese: Hier sass sie und atmete. Ob Jonas sie noch liebte oder nicht, sie war da. Sie war da, und sie atmete. Das war alles. Das war genug. Überwältigt schloss sie einen Moment lang die Augen. Sechs … siebzehn … was? Ach so: eins … zwei …
Wieder zu Hause, klopfte sie ganz gegen ihre Abmachung im Park an die Tür des Pavillons, der Jonas als Atelier diente. Sie ignorierte die Irritation, mit der er von seinem Computer aufschaute.
«Jonas», sagte sie. «Jonas, ich habe etwas gefunden!» Doch je länger sie ihm zu erklären versuchte, was sie erlebt hatte, desto fader klang es in ihren Ohren. Schliesslich verstummte sie.
«Ziemlich ironisch», sagte Jonas.
«Ironisch?»
«Ja – siehst du das nicht? Du rennst am Morgen aus dem Haus, um dich irgendwo in der Stadt auf ein Kissen zu setzen, während hier ein ganzes Team von Putzfrauen deinen Dreck wegmacht.»
«Und deinen», wollte Amanda sagen. Sie verstand nicht. Was hatte sie jetzt schon wieder falsch gemacht?
Jonas schaute sie mit einem müden Blick an. Es musste anstrengend sein, immer alles dreimal zu erklären. «Wenn du wirklich irgendwas mit Buddhismus am Hut hättest, würdest du der Reinigungsfirma kündigen und dein Haus selber putzen. Achtsamkeit in jeder alltäglichen Handlung, das ist die Essenz der buddhistischen Lehre. Die kannst du nun mal nicht mit deiner Platinkarte abbuchen!»
«Aber es hat doch gar nichts gekostet!», wollte Amanda noch sagen, aber da hatte er die Kopfhörer schon wieder aufgesetzt. Seither ging sie zwei-, dreimal die Woche ins Zendo.
Irgendwann hatte ihre Lehrerin ihr vorgeschlagen, das Inselkloster in Kanada zu besuchen, in dem sie selber jahrelang gelebt und gelernt hatte.
Amanda hatte sich zu einer vierwöchigen Schweigemeditation angemeldet. Bevor sie abgereist war, hatte sie sich mit ihrem Anwalt getroffen, die Scheidung eingereicht und ihr Haus in Aarau dem Zendo überschrieben.
«Ich muss Ihr … äh … Am-Leben-Sein für die Schweizer Behörden bestätigen», sagte Officer Lovechild. «Ihre Papiere kontrollieren, ihren Flugschein sehen … Und wenn Sie mir erklären könnten, was passiert ist?»
«Möchtest du, dass ich bei dem Gespräch dabei bin?», fragte der Roshi jetzt, und Amanda nickte. Seit einer Woche hatte sie nicht gesprochen. Es war ihr überraschend leicht gefallen. Dafür hatte sie jetzt Mühe, die richtigen Worte zu finden.
Gab es überhaupt Worte für das, was passiert war?
«Wie hätte ich ahnen sollen, dass er mich gleich umbringt?»
Aarau, vor über einer Woche
«Also, was haben Sie getan?»
«Ich habe sie ins Bett gelegt!» Murbach unterdrückte ein Schluchzen. «Ich weiss, ich hätte sie nicht anfassen dürfen, aber ich konnte sie doch nicht einfach so hängen lassen …» Er schlug die Hände vors Gesicht. Gisiger meinte, ihn zwischen den Fingern hindurch blinzeln zu sehen.
«Von Anfang an», wiederholte Markovic streng.
«Ja also, ich war ein paar Tage in den Bergen, im Engadin, wir haben dort ein Haus. Und als ich zurückkam … als ich zurückkam … da sah ich sie … und …»
«Hier?»
«Nein, in der Küche – ich ging in die Küche, um mir etwas zu essen zu machen, und da …»
«Zeigen Sie es uns.»
Als sie aufstanden, knackten Gisigers Knie. Ich sollte wirklich, dachte er. Wirklich was? Wirklich etwas ändern. Etwas tun. Murbach führte sie zurück in die Eingangshalle und von da in die Küche. Ein geräumiger, gemütlicher, altmodischer Raum, der seltsam unbenutzt wirkte. Ein Stuhl lag auf dem Boden, von einem schmiedeeisernen Gitter an der Decke, an dem auch ein paar grosse Pfannen hingen, baumelte ein Stück gelbe Wäscheleine. Eine Inszenierung, dachte Gisiger. Eine schludrige dazu. Wie in seinen Filmchen.
«Und dann?»
«Ich habe – ich glaube, ich hab geschrien! Es kam einfach über mich – ich bin ein emotionaler Mensch, verstehen Sie. Dann hab ich den Stuhl aufgestellt, bin draufgestiegen und hab sie gepackt, hab sie hochgehoben, um den Zug der Wäscheleine zu lockern – aber es war zu spät. Ich fühlte es – es war kein Leben mehr in ihr.»
«Sie fühlten es? Haben Sie es ihr nicht in erster Linie angesehen?»
«Angesehen?» Murbach schien ehrlich verwirrt. «Ich hab die Leine durchgeschnitten, sie nach oben getragen … ich weiss, ich hätte das nicht tun sollen … aber ich konnte nicht klar denken, ich bin nun mal …»
« … ein emotionaler Mensch, ich weiss.» Markovics Stimme verriet nichts.
Er konnte ihr nicht ins Gesicht sehen, dachte Gisiger. Er sah es vor sich, wie eine Szene aus einem von Murbachs nicht ganz zu Ende gedachten Videofilmen. Eine Frau sitzt auf dem Sofa, mit dem Rücken zur Tür, blättert in ihrem Magazin, hört ihn nicht hereinkommen. Er packt sie von hinten, erwürgt sie mit ihrem eigenen Schal, wird dann von plötzlicher Reue übermannt. Er trägt sie ins Schlafzimmer, legt sie ins Bett, den Blick von ihrem Gesicht abgewandt, von ihren blutunterlaufenen Augen, der geschwollenen Zunge. Er deckt sie zu, als würde sie schlafen. Dann Panik – er macht eine Flasche auf, im Dusel denkt er sich diese Inszenierung aus, wählt die Nummer des Notrufs. Er muss sich für sehr viel klüger halten, als er ist – oder uns für sehr viel dümmer.
Die gerichtsmedizinische Untersuchung würde eindeutig zeigen, ob ein Seidenschal oder eine Wäscheleine die Kehle der Toten zugeschnürt hatte. Und ob der Zug waagrecht von vorn nach hinten oder schräg nach oben verlaufen war. Fehlte nur noch das Motiv. Doch das würde er ihnen bestimmt auch gleich liefern:
«Und hier, das lag auf dem Tisch!»
Murbach langte in seine Hemdtasche, zog ein zusammengefaltetes Stück Papier heraus. Er hielt es erst Markovic hin, und als dieser nicht danach griff, Gisiger. Gisiger zog betont umständlich ein sauberes Taschentuch hervor, legte es über seine Finger und fasste dann das Stück Papier an einer Ecke an. Er schüttelte es ein paarmal, bis es sich öffnete. Es war kein Brief, sondern eine Seite aus einem Notizbuch, unsorgfältig herausgerissen, mit fliehenden Buchstaben bedeckt. Verzweifelte Worte, an niemanden gerichtet, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Kein Brief.
Ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich Du siehst mich nicht. Ich weiss nicht mehr, wer ich bin.
Es gibt mich nicht mehr
Wo bist du wo bin ich
Bitte bitte bitte
Ich muss hier raus
ich kann nicht mehr
«Sehen Sie, sie war gar nicht mehr sie selbst! Sie konnte sich nicht einmal mehr klar ausdrücken … sie war total verwirrt! Und dann ruft mich ihr Anwalt an und sagt, sie habe die Scheidung eingeleitet, das Haus verschenkt … Das hätte sie nie getan, sie war nicht bei sich … das ist doch eindeutig!»
«Ihr Anwalt hat Sie angerufen? So spät?»
«Nein, das war …»
« … bevor Sie ihre Frau ‹gefunden› haben?» Markovic zeichnete mit den Fingern Anführungsstriche in die Luft. Dann schaute er zu Gisiger hinüber und rieb Daumen und Zeigefinger aneinander, als zählte er Geld. Gisiger griff in seine Hosentasche und holte sein Portemonnaie heraus.
«Meine Herren?» Der Amtsarzt stand in der Tür.
«Wo ist das Schlafzimmer?», fragte Gisiger.
«Ich zeig es Ihnen.»
«Nichts da!» Markovic hielt Murbach zurück. «Wir beide warten hier!»
Murbach nickte. «Die Treppe hoch, die letzte Türe am Ende des Flurs.»
Der Arzt ging voraus, er sagte nichts, hielt den Kopf gesenkt. In Gedanken versunken. Vielleicht war er auch nur müde. Sie waren alle müde.
Vor der Schlafzimmertür blieb er stehen und liess Gisiger den Vortritt. Gisiger öffnete die Tür. Das Zimmer war so gross, dass das Bett in seiner Mitte fast klein wirkte. Es war ein Himmelbett aus dunklem, reich geschnitztem Holz, mit weissem Leinen bezogen. Auf der weissen Überdecke lag sie auf dem Rücken. In einem grün-weiss gemusterten Wickelkleid, die langen braunen Haare auf dem Kissen ausgebreitet, um den Hals ein Stück gelbe Wäscheleine, starrte sie mit offenen Augen an die Decke.
Mit offenen Augen?
Der Arzt machte einen Schritt auf das Bett zu, bückte sich, berührte ihren Hals mit zwei Fingern. Dann richtete er sich wieder auf und schaute Gisiger an. Sein Blick war schwarz.
«Wollt ihr mich verarschen?»
Vancouver Island, heute
«Es bin nicht ich, es ist ein Inukshuk», sagte Amanda. «Ein Wie-ein-Mensch.»
Officer Lovechild nickte. «Wie das Olympia-Maskottchen!» Er zog seinen Schlüsselanhänger aus der Tasche, an dem eine versilberte Version der klobigen, aus Steinblöcken zusammengesetzten, menschenähnlichen Figur baumelte.
«Genau.»
Amanda hatte einen solchen zum erstenmal in einer Ausstellung über die Kunst der Ureinwohner des amerikanischen Nordens, aus Alaska, Grönland, Kanada gesehen. Traditionelle und zeitgenössische Skulpturen und Gefässe wurden gezeigt, die sich erstaunlich ähnlich sahen. Dieselben weichen, klaren Formen, dieselbe Bearbeitung, die den harten, kalten Stein weich, warm, seidig scheinen liess. Plötzlich stand sie vor einem gehörnten, zähnefletschenden Wesen aus glänzendem grauem Stein, das sie an eine Figur aus dem Kinderbuch «Wo die wilden Kerle wohnen» erinnerte. Ein wilder Kerl? Nein, ein Inukshuk. Ein Wie-ein-Mensch. Diese Statuen, las sie, dienten als Wegweiser, wie die Steinmannli in den Schweizer Alpen. Sie wurden bei der Jagd eingesetzt und manchmal auch in leeren Behausungen zurückgelassen. Als Platzhalter. Hüter des kalten Herdes.
«Ich war hier», sagte der Wie-ein-Mensch. «Auch wenn ich jetzt weg bin: Ich war hier.» Lange hatte sie vor dem Glaskasten gestanden und sich vorgestellt, sie könnte dieses zähnefletschende Ding mit nach Hause nehmen und an ihre Stelle setzen. Es würde endlose Sitzungen und Besprechungen für sie aushalten und Jonas zuhören, wenn er sich über die lähmende Wirkung beklagte, die ihre Ehe auf seine Kreativität habe.
Die Idee liess sie nicht mehr los. Plötzlich begegnete sie ihr überall. Sie hing in der Luft.
Gespräche im Freundeskreis drehten sich um die Notwendigkeit und die Unmöglichkeit der modernen Existenz, überall gleichzeitig zu sein, in allen Zeitzonen vertreten, die unterschiedlichsten Rollen gleichzeitig ausfüllend. «Wenn man sich bloss klonen könnte!» Jemand schenkte ihr ein Buch über einen Schriftsteller, der gleich sieben Doppelgänger auf Lesereise schickte. Sie zappte sich durch das Spätabendprogramm und blieb bei einer Anwaltserie hängen, in der die Beziehung eines Mannes zu einer erstaunlich lebensechten Sexpuppe legalisiert wurde, mit der er glücklicher war als mit jeder lebenden Frau. Wenig später las Amanda einen Artikel über die Firma in Japan, die diese qualitativ hochstehenden Sexpuppen herstellte. Puppen, die aus hautähnlichem Material und nach menschlichem Vorbild gestaltet wurden, auf Wunsch und gegen einen Aufpreis nach Fotos und exakten Massen: Wie-ein-Mensch.
Sechs Wochen dauerte es, bis die Puppe geliefert wurde. Sechs Wochen lang beobachtete Amanda ihren Mann. Sie sah noch einmal alles, was sie an Jonas geliebt hatte. Seine Unverschämtheit, sein schiefes Grinsen, seine schmalen Hüften. Die Art, wie er durch Menschen hindurchschaute. Wie er sich bewegte.
Wie wenn man sich zum Haareschneiden anmeldet, dachte sie etwas respektlos. Kaum hat man einen Termin, sitzen die Haare wieder perfekt. Wollte sie das Ende ihrer Ehe wirklich mit dem Kappen ihrer Haarspitzen vergleichen? Sie wartete auf ein Zeichen. Eine Annäherung. Es passierte nichts. Jonas fuhr ohne sie nach Paris und dann direkt in ihr Haus in den Bergen.
Die Puppe wurde in der versprochenen neutralen Verpackung geliefert. Sie war leicht. Viel leichter als ein Mensch. Erst recht einer aus Stein. Aber sie fühlte sich tatsächlich an wie ein Mensch, weich, trocken, warm. Amanda wickelte sie in ihr Lieblingskleid und legte ihr den bunten Seidenschal um, den Jonas ihr vor Jahren geschenkt hatte. Dann setzte sie ihre Stellvertreterin auf ihren Lieblingsplatz auf dem Sofa, legte ein ART-Magazin in ihren Schoss, strich ihre Haare zurück, fuhr ihr mit einem Finger über die Wange.
Plötzlich musste sie lachen. Jonas würde verstehen, was sie gemeint hatte. Er war vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, der diese verrückte Geste nachvollziehen konnte. Er würde richtig reagieren.
Amanda stellte sich vor, wie er mit ihrer Stellvertreterin im Schlepptau nach Kanada reiste – er würde ihr selbstverständlich einen Sitzplatz reservieren und ihr einen Drink bestellen und sich über die Blicke der anderen Passagiere amüsieren. Vielleicht würde er einen Film drehen. Und er würde sie finden. Sie würden sich wieder finden.
«Stattdessen hat er mich umgebracht.»
Aarau, vor über einer Woche
Es dämmerte schon, als Gisiger nach Hause kam. In der Wohnung war es still. Ohne das Licht einzuschalten, ging er in die Küche. Vor dem Fenster der Wald. Zwischen den Bäumen floss die Aare, er konnte sie nicht sehen, aber er wusste, dass sie da war. Er schaute zu, wie sich die letzten Reste der Nacht auflösten. Nebel hing in den Ästen der Bäume. Der Tag war noch nicht so weit.
Das Licht ging an und verwandelte das vorhanglose Küchenfenster in einen wandbreiten Spiegel. Die verschlafene Landschaft verschwand, dafür sah er jetzt sich. Die hängenden Schultern, den Bauch, das Bier. Hinter ihm tauchte Helen auf. Sie trug eines seiner T-Shirts, ein weisses. Es reichte nicht ganz bis zu ihren Oberschenkeln. Gisiger zog automatisch seinen Bauch ein, aber er drehte sich nicht um.
«Siehst du mich?», fragte er. «Helen, siehst du mich?»
TOD BEI GAIS
FELIX METTLER
Schleierwolken bedeckten den Himmel, dennoch hatte Valerie eine dunkle Brille auf. Sie ging der Hauptstrasse entlang – in der rechten Hand fünf weisse Rosen. Mit der linken strich sie immer wieder ihr langes schwarzes Haar zur Seite, das ihr der Fahrtwind der vorbeibrausenden Autos ins Gesicht wehte. Das Ortsschild von Gais hatte sie vor wenigen Minuten passiert, als sie bei der gesuchten Stelle ankam. Diese war nicht zu übersehen: Zwei Laternenmasten waren geknickt, das Geländer der schmalen Brücke, die zu einem Bauernhof führte, teilweise weggerissen. Hinunterschauen zum Rotbach, wo sich der zerschellte Wagen möglicherweise immer noch befand, mochte Valerie nicht. Tränen liefen ihr über die Wangen, als sie ihren Strauss zu den bereits vorbeigebrachten Blumen legte. Auch zwei rote Kerzen standen da. Von wem sie wohl stammen?, fragte sich Valerie. Kennengelernt hatte sie Philipp vor zwei Jahren in Teufen bei einem morgendlichen Kaffee. Da keine Zeitung mehr verfügbar gewesen war, hatten sie sich eine geteilt. Das war der Beginn ihrer Freundschaft gewesen. Obwohl nie eine nähere Beziehung zwischen ihnen entstanden war, hatten sie vertrauensvoll auch über private Dinge gesprochen. Sie waren einfach füreinander dagewesen. Dass dies nun Vergangenheit war, wollte Valerie nicht wahrhaben.
Einem Bericht der Appenzeller Zeitung war zu entnehmen, dass man rätselte, weshalb der Wagen von der Strasse abgekommen sei. Es hatten gute Verhältnisse geherrscht, und nach der Aussage des nachfolgenden Fahrers habe es an jener Stelle keinen entgegenkommenden Verkehr gegeben. Auch soll der Mann – Philipp Angerer – nicht gerast sein, seit Bühler sei der Abstand zwischen ihnen gleich geblieben. So wurde ein technischer Defekt in Betracht gezogen, doch auch eine Fehlmanipulation des Fahrers konnte nicht ausgeschlossen werden. Für unwahrscheinlich hielt man einen Sekundenschlaf, zumal der Unfall am Morgen auf dem Arbeitsweg nach Appenzell – Angerer lebte in Teufen – geschehen war.
Er könnte einer Katze ausgewichen sein, dachte Valerie. Sie wusste um Philipps Tierliebe. Dass er, wie sie in der Zeitung gelesen hatte, nicht angeschnallt war, verwunderte sie nicht. Bei gemeinsamen Fahrten hatte sie ihn gelegentlich auf die Gurten aufmerksam gemacht.
Kurz nachdem sich Valerie auf den Rückweg nach Gais gemacht hatte, fuhr ein Polizeiwagen langsam an der Unglücksstelle vorbei. Wachtmeister Pirmin Köchli, seit zwölf Jahren im Polizeidienst, schüttelte den Kopf. «Unverständlich», murmelte er vor sich hin. Köchli war vor kurzem vierzig geworden. Er hatte einen kantigen Kopf mit kurzem, dunklem Haar und war von sportlicher Gestalt.
«Hast du ihn gekannt?», fragte sein Kollege, Gefreiter Edi Tobler, der neben ihm sass. Er war jünger, rotgesichtig, untersetzt und mit deutlichem Bauchansatz.
«Wir haben uns gelegentlich im Fitness-Center getroffen und auch mal in der Garderobe miteinander geplaudert.» Nach kurzem Schweigen fügte Köchli hinzu: «War ein feiner Kerl.» Es klang wie ein Seufzer.
«Er soll Arzt gewesen sein.»
«Ja! Er hat an der Privatklinik Schönbüchel in Appenzell gearbeitet. Vor drei Jahren ist er aus Afrika zurückgekehrt, wie er mir erzählt hat. War in Äthiopien für die Organisation ‹Ärzte ohne Grenzen› tätig. Kürzlich hat er im Lindensaal einen Vortrag über das Land und seine Arbeit dort gehalten.»
«Ein eigenartiger Unfall. Und keine Gurten. Man muss sich fragen, ob es nicht Absicht gewesen sein könnte.»
«Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn schon, dann gäbe es doch gerade für einen Arzt andere Möglichkeiten. Oder glaubst du, er würde auf diese Art ein Leben im Rollstuhl riskieren?»
«Warum sind denn keine Spuren zu sehen? Er hat gar nicht gebremst», wandte Tobler ein.
«Wahrscheinlich ging alles zu schnell. Es braucht nur Bruchteile einer Sekunde, wenn er …»
«Kennst du die Frau, die da geht?», unterbrach ihn Tobler. «Sie scheint von der Unfallstelle zu kommen.»
«Ich hab sie schon gesehen.» Köchli runzelte die Stirn, kniff die Augen zusammen. «Genau. Im Café neben unserem Posten. Ich glaube gar, dass sie mit Doktor Angerer dort war. Eine attraktive Frau.»
«Sie muss ihn gut gekannt haben, dass sie zur Unfallstelle gekommen ist. Sollen wir sie …?»
«Nein», sagte Köchli schnell, «nicht jetzt. Warten wir mal, was die weiteren Untersuchungen der Gerichtsmedizin und der Kriminaltechnik ergeben. Zudem steht die Besichtigung von Angerers Wohnung noch aus. Man wartet auf seinen Bruder. Soll im Tessin leben.»
«Wohin geht’s nun?», fragte Tobler.
«Zurück zum Posten. Gern würde ich mich am Arbeitsplatz des Toten umsehen, um mir ein besseres Bild von ihm zu machen. Doch das müssen die Innerrhoder übernehmen. Leider. Und für ein Rechtshilfegesuch reicht die Begründung kaum.»
«Das heisst, du schliesst Fremdverschulden nicht aus?» Und auf Köchlis Schulterzucken hin: «Denkst du wirklich, es könnte eine Manipulation vorliegen?»
«Nicht eigentlich. Trotzdem würde ich gern mehr über das Umfeld des Arztes erfahren. Ich kann ja versuchen, einen Kollegen anzuspitzen. Ich denke da an einen Sportsfreund aus Appenzell.»
«Zuletzt wird man das Ganze als Selbstunfall abhaken müssen», sagte Tobler. Mit einer Handbewegung tat er kund, dass ihm das vertiefte Interesse für den Fall fehlte.
«Für jeden Unfall gibt es einen Grund.» Köchli klang bestimmt. «Auch wenn es nur eine Unaufmerksamkeit war, irgendeine. Vielleicht wegen einer Wespe im Wagen. Wer weiss das schon?»
«Und wie will man so etwas je beweisen können?»
«Da hast du recht.»
Drei Tage vergingen, ohne dass der Fall irgendwelche Klärung erfuhr. Am Wagen, einem VW Golf, wurde kein technischer Defekt festgestellt, und im Blut des Verunglückten fanden sich keine verdächtigen Spuren. Zudem meldete Tobias Kaufmann – der Innerrhoder Kollege, den Köchli um Beistand gebeten hatte –, der Verunglückte habe keine Probleme am Arbeitsplatz gehabt. Der Chefarzt der Klinik Schönbüchel habe jegliche fachliche oder persönliche Unstimmigkeit verneint.
Dann aber folgte eine Überraschung. Was ihnen Samuel Angerer übermittelte, entbehrte nicht einer gewissen Brisanz: Eine Immobilien-AG habe den Eingang eines Briefes bestätigt, worin sein Bruder die Kündigung der Wohnung eingereicht habe. Auf den nächstmöglichen Termin. In Philipps Unterlagen habe er zudem die Bestätigung der Post für einen zweiten eingeschriebenen Brief gefunden, berichtete Samuel Angerer weiter. Dieser sei gleichzeitig abgesandt worden und an einen Doktor Rudolf Hiestand in Appenzell gerichtet gewesen.
Pirmin Köchli schluckte leer. So hiess der Chefarzt der Klinik, wie er von Tobias Kaufmann vernommen hatte. Da Köchli zudem von seinem Innerrhoder Kollegen erfahren hatte, dass Doktor Hiestand seit kurzem in Stein wohnte und demnach in seine Zuständigkeit fiel, fühlte er sich geradezu zur Detektivarbeit gedrängt. Was lag näher, als dass es sich auch bei jenem Brief um eine Kündigung handelte? Köchli lächelte bei dem Gedanken, wie er das Gespräch mit dem Arzt beginnen würde, ohne zu einer Lüge Zuflucht suchen zu müssen. Es bliebe diesem nichts anderes übrig, als die Wahrheit zu sagen. Und sollte Köchlis Vermutung zutreffen, hätte Hiestand auch zu erklären, weshalb er Kaufmann gegenüber Angerers Kündigung verschwiegen hatte.
Zur vereinbarten Zeit – es war früher Nachmittag – läutete Wachtmeister Köchli an der Tür des Einfamilienhauses in Stein. Offensichtlich war es gerade erst fertiggestellt worden, die Gartenarbeiten waren noch im Gang. Drinnen begann ein Hund zu bellen, und kurz darauf öffnete Frau Hiestand die Tür, begrüsste Köchli und liess ihn eintreten. Dabei hielt sie den heftig wedelnden Tibet Terrier – Köchli hielt ihn für einen Mischling – am Halsband zurück. Gewiss der Einzige, der hier Freude über mein Kommen zeigt, ging es dem Wachtmeister durch den Kopf. Einen Moment später trat der Hausherr hinzu. Doktor Hiestand, eher kleingewachsen, mit Stirnglatze und Brille – Köchli schätzte ihn auf fünfzig –, bat den Polizeibeamten ins Zimmer, aus dem er gerade gekommen war. Die Bücherwand wies es als Arbeitsraum aus.
«Bring uns doch bitte einen Kaffee», sagte er zu seiner Frau. Und zu Köchli gewandt: «Sie nehmen doch auch einen?»
«Gern.»
«Kommen wir also zur Sache», begann der Arzt, nachdem er dem Gast einen Stuhl angeboten hatte. «Wie ich Sie verstehe, geht es nochmals um den Unfall von Philipp Angerer.»
«Als wir seine Wohnung durchgesehen haben, sind wir auf ein Kündigungsschreiben gestossen.» Das betretene Schweigen seines Gegenübers bestätigte Köchli in seiner Vermutung.
«So ist es.» Nach einer weiteren Pause fügte Doktor Hiestand hinzu: «Dann wissen Sie auch, dass er in dem Brief keinen Grund für die Kündigung genannt hat.»
Köchli überlegte schnell, ob er zugeben sollte, dass er den Inhalt des Briefes nicht kannte. Er verzichtete darauf. «Sie haben doch gewiss mit ihm über den Grund seines Entschlusses gesprochen?»
«Noch nicht.»
«Das wundert mich aber. Er war schliesslich …»