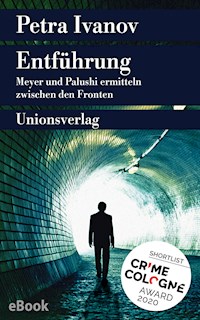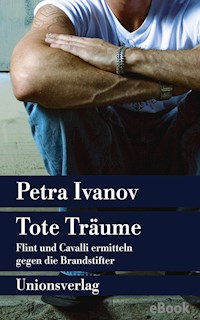12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwischen Umweltschützern und Villenbesitzern tobt eine hitzige Debatte um den freien Zugang zu den Seeufern. Der engagierte Politiker Moritz Kienast setzt sich, allen Anfeindungen zum Trotz, für eine rigorose Lösung ein – bis er plötzlich verschwindet. Kurz darauf wird die Staatsanwältin Regina Flint zu einer abgelegenen Waldhütte gerufen, wo sie eine nicht identifizierbare Leiche vorfindet – verkohlt und aufgespießt. Ob sie den verschwundenen Politiker vor sich hat? An Vermutungen mangelt es nicht, der unnachgiebige »Motz-Moritz« ist im Laufe seiner Karriere mehr als nur einem einflussreichen Gegner auf die Füße getreten. Ihre Nachforschungen führen die Staatsanwältin schon bald an Abgründe, die mit »menschlich« nichts mehr zu tun haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch
Der engagierte Politiker Moritz Kienast kämpft gegen die Villenbesitzer um den freien Zugang zu den Seeufern – bis er plötzlich verschwindet. Kurz darauf wird eine verkohlte und aufgespießte Leiche gefunden. Die Nachforschungen der Staatsanwältin Regina Flint führen sie an Abgründe, die mit »menschlich« nichts mehr zu tun haben.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Petra Ivanov verbrachte ihre Kindheit in New York. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz absolvierte sie die Dolmetscherschule und arbeitete als Übersetzerin, Sprachlehrerin sowie Journalistin. Ihr Werk umfasst Kriminalromane, Thriller, Liebesromane, Jugendbücher, Kurzgeschichten und Kolumnen.
Zur Webseite von Petra Ivanov.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Petra Ivanov
Heiße Eisen
Flint und Cavalli ermitteln in besten Kreisen
Kriminalroman
Ein Fall für Flint und Cavalli (7)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die Erstausgabe erschien 2015 im Appenzeller Verlag, Schwellbrunn.
Für die vorliegende Fassung hat die Autorin den Text 2017 überarbeitet.
© by Petra Ivanov 2015
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Milos Jokic / iStock
Umschlaggestaltung: Heike Ossenkop
ISBN 978-3-293-30973-9
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 10:03h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
HEISSE EISEN
1 – Das Telefon schrillte. Moritz Kienast zuckte zusammen …2 – Staatsanwältin Regina Flint stand auf. Sie reichte dem …3 – Auf dem Lindenhof dämmerte es. Unterhalb des historischen …4 – Juri Pilecki holte sich eine zweite Tasse Kaffee …5 – Die Schmerzen waren nicht das Schlimmste. Sondern die …6 – Jedes Mal, wenn Regina aus dem Aufzug trat …7 – Das Haus der Kienasts erinnerte Pilecki an eine …8 – Eine Hand berührte Moritz am Rücken. Dankbar schmiegte …9 – Regina zog die letzten Kleidungsstücke aus der Waschmaschine …10 – Dass Spazierwege entlang eines Seeufers attraktiv sind …11 – Moritz schämte sich. Obwohl er es sich damals …12 – Werner Imfeld schaffte es, die harten Stühle im …13 – Normalerweise blühte die Eibe früh. Bereits im Februar …14 – Nachdem Claudio Loebell das Protokoll unterschrieben hatte …15 – Eine Tür ging auf. Moritz hörte Stimmen …16 – Der Anruf kam am Sonntag um 9.25 Uhr …17 – Die herzförmigen Blätter der Linden bildeten ein dunkelgrünes …18 – Er war nicht gekommen. Reginas Glieder waren bleischwer …19 – Das Care-Team war gegangen. Dorothee hatte es kaum …20 – Auf dem stählernen Obduktionstisch sah die verbrannte Leiche …21 – Es war 6.10 Uhr, als Irina vor dem …22 – Klemens Kienast zog die Tür hinter sich zu …23 – Regina fragte sich, wann Fahrni schlief. Pünktlich um …24 – Pilecki schob sich auf den Beifahrersitz und zog …25 – Regina starrte auf die kleine Geschenkschachtel in ihrer …26 – Kristian Stanic’ Lider senkten sich über seine dunklen …27 – Klemens Kienast stand in seinem Garten. Eine Brise …28 – Jochen Brandt. Der Kunde hatte einen Namen …29 – Dorothee hörte einen gedämpften Schrei. Sie stützte sich …30 – Als Regina die Kripoleitstelle betrat, glaubte sie …31 – Es verstrichen über zwei Wochen, bis das Resultat …32 – Niemand hatte mit einer raschen Antwort gerechnet …33 – Ich musste es tun!«, rechtfertigte sich Regina34 – Die Uferweg-Befürworter wollten gegen den Beschluss des Kantonsrats …35 – Linas trat rasch vom Fenster zurück, als er …36 – Tobias Fahrni und Paz Rubin heirateten an einem …Mehr über dieses Buch
Über Petra Ivanov
Petra Ivanov: »Meine Figuren sind lebendig. Wenn ich nicht schreibe, verliere ich den Kontakt zu ihnen.«
Petra Ivanov: »Mein Weltbild hat sich zum Besseren verändert, seit ich Krimis schreibe.«
Mitra Devi: Ein ganz und gar subjektives Porträt von Petra Ivanov
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Petra Ivanov
Zum Thema Schweiz
Zum Thema Zürich
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Die Örtlichkeiten, die Debatte um den Seeuferweg und die Überbauungen, die politischen Parteien und Organisationen sind real, Hauptpersonen und Handlung sind frei erfunden.
Für Magdalena
»Tote Menschen sind interessant,weil sie einmal gelebt haben.«
Prof. Dr. med. Michael Thali,Direktor des Instituts für Rechtsmedizinder Universität Zürich
1
Das Telefon schrillte. Moritz Kienast zuckte zusammen. Ohne die Augen vom Bildschirm zu nehmen, griff er zum Hörer.
»Kienast«, brummte er.
Am anderen Ende war es still.
»Hallo?« Moritz sah auf. »Wer ist da?«
Atemzüge waren zu hören.
Verärgert schnalzte Moritz mit der Zunge. Nelly, die Katze der Familie, wölbte den Rücken und streckte den Schwanz in die Höhe. Maunzend stakste sie durch die Mansarde. Moritz wollte die Verbindung schon unterbrechen, da meldete sich eine heisere Stimme.
»Bist du bereit?«
Moritz legte auf. Jetzt wurde er bereits telefonisch belästigt. Früher hatten seine Kritiker ihren Unmut in Leserbriefen kundgetan, heute genügte ihnen das nicht mehr. Sie wollten erleben, wie ihn ihre Pfeile trafen; die Spitze in der Wunde drehen, sich über seinen Schmerz freuen.
Nelly setzte zu einem Sprung an und landete auf seinem Schoß. Vor dem Mansardenfenster bog sich eine Hainbuche in der aufkommenden Brise. Obwohl es fast dunkel war, spürte Moritz die Wolkendecke, die sich laut Wetterbericht von Westen Richtung Mittelland schob. Am Wochenende wollte er eigentlich im Garten die Granitplatten verlegen, erneut machte ihm der Regen einen Strich durch die Rechnung.
Moritz rieb sich die Augen. Wieder dieses Jucken, dazu das pelzige Gefühl auf der Zunge. Der Arzt hatte vorgeschlagen, einige Tests durchzuführen, um eine Pollenallergie auszuschließen. Moritz betrachtete die hängenden Blüten der Hainbuche. Sie erinnerten ihn an den Schwanz der Katze, den er gerade durch seine Finger gleiten ließ, was Nelly zum schnurren brachte. Hinter dem Baum zog sich der Wald den Hang empor; es sah aus wie eine Decke, unter der eine schlafende Gestalt lag. Seit einundzwanzig Jahren wohnte Moritz am Fuß des Uetlibergs, Dorothee und er hatten das Haus gekauft, kurz bevor Anna zur Welt kam. Nie hatte er allergisch reagiert, weder auf die Hainbuche noch auf die Birke oder die Haselnuss im Nachbargarten. Zwar hatte er als Kind unter Heuschnupfen gelitten, doch mit der Pubertät waren die Symptome verschwunden. Der Arzt hatte jedoch gemeint, es komme häufig vor, dass sich eine Allergie erst im Alter entwickle. Im Alter! Moritz war erst vierundfünfzig. Zugegeben, in letzter Zeit spürte er die Jahre. Er fühlte sich müde, oft litt er unter Atemnot. Der Stress, hatte Dorothee gesagt und ihm Ratschläge erteilt. Er solle auf seine Ernährung achten, morgens grünen Tee statt Kaffee trinken, regelmäßig Vitamin B12 einnehmen. Und natürlich weniger arbeiten.
Als sie sich kennengelernt hatten, war sie genauso engagiert gewesen wie er. Gemeinsam hatten sie Unterschriften gesammelt für den Stopp des Atomenergieprogramms, den Schutz der Moore oder die Entfernung von Hundekot auf öffentlichem Grund. Später hatte sie ihn unterstützt, als er zuerst für den Gemeinderat und dann für den Kantonsrat kandidierte und sich in die Kommission für Planung und Bau wählen ließ. Sie befürwortete seinen Einsatz für öffentliche Seewege sowie für den Fachverband »Gebäude Netzwerk Initiative« und las interessiert seine Beiträge für diverse Fachmagazine.
Irgendwann hatte ihr Interesse an Energiepolitik, Raumplanung und Umweltschutz nachgelassen. Moritz konnte nicht genau sagen, wann. Im Nachhinein kam es ihm so vor, als habe die neue Leidenschaft für ihr eigenes Wohlbefinden die Veränderung ausgelöst. Es war, als kehre sie dem Allgemeinwohl den Rücken, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Nach über fünfzehn Jahren trat sie aus der Schulpflege aus und in die Frauenriege ein. Sie füllte ihren Schrank mit neuen Kleidern und färbte sich die grau werdenden Haare. Vergeblich hatte Moritz sie darauf hingewiesen, dass Haarfarben krebsauslösendes Toluylendiam enthielten. Dorothee war es egal. Und Anna fand den neuen Braunton toll.
Moritz betrachtete das Foto seiner Tochter, das an der Wand hinter seinem Schreibtisch hing. Er erinnerte sich gut an den Tag, an dem er es gemacht hatte. Am Vormittag war Anna die Zahnspange entfernt worden, die sie vier Jahre getragen hatte. Obwohl sich viele Kinder die Zähne korrigieren lassen mussten, fühlte sich Anna gehemmt. Selten lachte sie, ohne die Hand vor den Mund zu halten; als sie die Spange los war, grinste sie ohne Scham und führte einen Freudentanz auf. Moritz war es geglückt, den Augenblick mit der Kamera festzuhalten.
Er strich mit dem Zeigefinger über das Bild. Es war noch nicht lange her, da hatte sich Anna gegen ihre Mutter aufgelehnt. Egal, was Dorothee tat, es war falsch. Unverfängliche Worte führten zu heftigem Streit, beiläufige Äußerungen zu langen Diskussionen. Moritz dachte daran, wie er sich bemüht hatte, zwischen Mutter und Tochter zu vermitteln. Er hatte Anna sogar bei der Suche nach einem WG-Zimmer unterstützt, weil er keinen anderen Ausweg aus der verfahrenen Situation sah. Ein Jahr lang hatte sie sich kaum gemeldet. Die Wogen glätteten sich erst, als sie ihr Psychologiestudium aufnahm.
Als er Anna neulich darauf ansprach, sah sie ihn verwundert an. »Das ist nicht wahr! Klar hatten wir manchmal Knatsch, aber das gehört zur Pubertät. In dem Alter sind Mädchen Monster.«
Obwohl sie erst im vierten Semester studierte, trat sie auf wie eine Fachperson.
»Ich finde es super, wie sich Mama weiterentwickelt!«
»Eine neue Haarfarbe würde ich nicht gerade als Entwicklung bezeichnen«, wandte Moritz ein.
Anna verdrehte die Augen. »Dir täte eine Veränderung auch gut. Du steckst in einer Midlife-Crisis. Schau dich mal an! Dieses Hemd hast du schon getragen, als ich klein war!«
»Ich muss mich nicht täglich neu erfinden. Das ist eine moderne Erscheinung, die übrigens ihren Preis hat. Hast du dir je Gedanken über die ökologischen Folgen gemacht?«
»Du hast Angst, gib es zu«, erwiderte Anna ruhig. »Das ist normal. Veränderungen lösen bei vielen Menschen Verunsicherung aus. Das hat mit unserem evolutionär verwurzelten Bedürfnis nach Bindung zu tun. Wir mögen Neues nicht. Sich an etwas klammern liegt in unserer Natur. Das Gehirn belohnt uns sogar, wenn wir an unserer Routine festhalten. Es schüttet Opiate aus. Deshalb hängen wir so an unseren Gewohnheiten.«
Auf einmal war die Müdigkeit wieder da gewesen. Moritz hatte geschwiegen, obwohl es nicht seine Art war, sich schnell geschlagen zu geben. Seine Mutter hatte stets behauptet, er habe das Wort »aber« gelernt, bevor er »Mama« oder »Papa« aussprechen konnte. Zwar neigte sie zu Übertreibungen, doch in ihren Worten steckte ein Körnchen Wahrheit. Noch heute regte sich in Moritz Widerstand, wenn sein Gegenüber eine andere Meinung vertrat.
Die Katze streckte sich. Der Monitor schaltete in den Ruhezustand. Im dunklen Bildschirm sah Moritz sein Spiegelbild. Sein Haaransatz war innerhalb weniger Wochen deutlich zurückgewichen. Erneut juckte es, diesmal über den Augenbrauen. Als Moritz die Hand hob, um sich vorsichtig zu kratzen, fiel ihm eine Unebenheit auf seiner Stirn auf. Er berührte sie. Seine Fingerkuppen fuhren über zahlreiche scharfe Erhebungen. Litt er an einer Hautkrankheit?
Vielleicht hatte Anna doch recht. Vielleicht signalisierte ihm sein Körper, dass es Zeit für eine Veränderung war. Dreißig Jahre hatte er sich ganz und gar der Familie, dem Beruf und der Politik verschrieben. Sein Arbeitstag war nie zu Ende, wenn er abends das Ingenieurbüro verließ, das er mit seinem ehemaligen Studienkollegen Max aufgebaut hatte. Fanden keine Sitzungen oder Versammlungen statt, studierte er politische Dossiers, verfasste Leserbriefe oder erledigte Büroarbeiten, für die er tagsüber keine Zeit fand. Seit Max’ Tod hatte er mehr zu tun denn je. Sein Freund war erst dreiundfünfzig gewesen, als er an Schilddrüsenkrebs erkrankte. Er hatte die Heiserkeit einer verschleppten Erkältung zugeschrieben. Als er die Schwellungen am Hals bemerkte, wollte er einen Arzt aufsuchen, aber es hatte immer ein Sanierungskonzept gegeben, das er zuerst fertigstellen wollte, oder Schadstoffanalysen und Raumluftmessungen, die er noch durchführen musste. Und dann war es zu spät gewesen. Max und Moritz. Die Assoziation hatte den Kunden oft ein Schmunzeln entlockt.
Moritz richtete sich auf. Sich in Selbstmitleid zu suhlen würde seine Stimmung nicht heben. Er bewegte die Maus, und der Bildschirm schaltete sich wieder ein. Moritz las weiter. Von einer Neiddebatte war die Rede, davon, dass die Linken aus Missgunst und Bitterkeit handelten. Sie wurden als Kommunisten beschimpft, als Bekämpfer des Privateigentums, sogar das Wort Klassenkampf fiel. Dabei versuchen wir nur, den Volkswillen durchzusetzen, dachte Moritz. Ohne Enteignungen ist ein durchgehender Uferweg am Zürichsee nicht möglich. Sehen die Kritiker denn nicht, dass wir das Wohl aller im Auge haben? Wir stellen die Interessen der Allgemeinheit vor jene des Einzelnen. Außerdem handelt es sich beim umstrittenen Land ohnehin nicht um privaten Grund, denn genau wie Wald und Weide gehört der See der Öffentlichkeit, von Enteignung kann also kaum die Rede sein. Ginge es um den Ausbau einer Autobahn, fände die Diskussion gar nicht erst statt.
Der Juckreiz verstärkte sich. Moritz schob seine Hand unter den Bauch der Katze, um sie hochzuheben. Als sie ihre Krallen in den Stoff seiner Hose bohrte, zog er die Hand zurück. Er bewunderte Nellys Beharrlichkeit. Sie hätte eine gute Politikerin abgegeben. Ohne Aufsehen zu erregen, setzte sie ihren Willen durch und ließ andere im Glauben, es wäre ihre Entscheidung gewesen. Moritz hätte sich ein Beispiel an seiner Katze nehmen können, doch Subtilität war nie seine Stärke gewesen. Rückschläge nahm er persönlich, vor allem, wenn er überzeugt war, im Interesse der Öffentlichkeit zu handeln. Wenn er statt auf Zustimmung auf Ablehnung stieß, was immer häufiger vorkam. Vielleicht war es Zeit aufzuhören, solange er noch Erfolge vorweisen konnte. Irgendwo hatte er gelesen, dass wiederholte Niederlagen entweder zu Gelassenheit, Gleichgültigkeit oder Bitterkeit führten. Gelassenheit war ihm fremd, gegen die Gleichgültigkeit würde er mit aller Macht ankämpfen. Doch wie verhinderte er, dass er nicht ganz verbitterte? Max’ Tod hatte ihn verändert. Plötzlich hatte Moritz an seinen Werten, am Sinn des Lebens zu zweifeln begonnen. Er sah sich mit beängstigenden Fragen konfrontiert, auf die er keine Antworten wusste. Dieses Gefühl war ihm fremd. Es hatte das Fundament erschüttert, auf dem er seine Existenz aufgebaut hatte. Ein Abgrund tat sich vor ihm auf, und um nicht hinunterblicken zu müssen, stürzte er sich in den nächsten Kampf.
Er setzte Nelly auf den Boden und stand auf. Ihm wurde schwindlig. Er klammerte sich an die Stuhllehne, bis die Mansarde aufhörte, sich zu drehen, dann stieg er die Treppe hinunter. Im ersten Stock befanden sich drei Schlafzimmer und ein Bad. Moritz bückte sich über das Waschbecken und drehte den Hahn auf. Er ließ das Wasser über sein Gesicht laufen und trank einen großen Schluck. Das pelzige Gefühl blieb. Er trocknete sich mit einem Frotteetuch ab, dabei vermied er es, in den Spiegel zu schauen. Stattdessen sah er auf die Uhr. Es war bereits halb zehn. Dorothee käme bald zurück. Moritz versuchte, sich zu erinnern, wohin sie gegangen war. Er wusste nicht mehr, welcher Wochentag heute war. Montag? Nein, montags tagte der Kantonsrat. Oder hatte er die Sitzung am Vormittag verpasst? Ein kurzer Anflug von Panik erfasste ihn. Sein Vater hatte an Alzheimer gelitten, erwartete ihn das gleiche Schicksal? Moritz vergegenwärtigte sich die letzte Ratssitzung. Ja, richtig, die dritte Lesung zur Realisierung des Seeuferwegs stand auf der Tagesordnung. Es ging um die Formulierung eines einzigen Satzes, des berüchtigten Artikels 28c, der Enteignung von privaten Grundstücken ausschloss. Moritz hörte noch deutlich die Argumente der Schweizerischen Volkspartei. »Eigentum bedeutet, über seine legitim erworbenen materiellen und ideellen Güter jederzeit frei verfügen zu können!«, äffte er seinen Ratskollegen nach. Er hob den Blick. »Warum sollten Seeanwohner ein Sonderrecht genießen?«, fragte er sein Spiegelbild. »Die Bestimmung verstößt gegen die Verfassung! Überwiegt nämlich im Einzelfall das öffentliche Interesse, sind Enteignungen durchaus möglich!«
Der Antrag wurde trotzdem angenommen. Noch eine Niederlage.
Das Gesicht im Spiegel verzog sich zu einer Grimasse. Mit meinem Gedächtnis ist alles in Ordnung, dachte Moritz. Auf einmal fiel ihm ein, wo sich Dorothee befand: beim Zumbatanzen. Was sie dort genau tat, wusste er aber immer noch nicht. Sie hatte ihm erklärt, Zumba sei eine Sportart, bei der ohne Partner getanzt werde. Moritz hatte den Seitenhieb verstanden. Nach ihren Haaren hatte Dorothee auch ihre Beziehung auffrischen wollen. Sie schlug vor, einen Tanzkurs zu besuchen. Moritz hatte sich zunächst gesträubt, schließlich aber nachgegeben, weil sie nicht lockerließ. Schon nach der ersten Stunde bereute sie, ihn überredet zu haben. Sie behauptete, er stelle sich absichtlich ungeschickt an. Eine Woche später schrieb sie sich im Zumba ein. Moritz war nicht klar, warum es plötzlich doch möglich sein sollte, ohne Partner zu tanzen. Seine Erleichterung war jedoch so groß gewesen, dass er keine Fragen stellte.
Gähnend verließ er das Badezimmer. In der Küche öffnete er den Kühlschrank in der Hoffnung, Reste zu finden, die er aufwärmen konnte. Er entdeckte einen Behälter mit Spargelrisotto. Zögernd entfernte er den Deckel. Die Spargeln stammten aus Mexiko. Als Dorothee den Risotto aufgetischt hatte, hatte er sich geweigert, davon zu nehmen. Weshalb Gemüse essen, das um die halbe Welt gereist war? Er warf einen Blick in die unterste Schublade, sie enthielt Karotten, Feldsalat, zwei rote Bete und eine Stange Lauch. Alles roh. Ihm fehlte die Energie zu kochen. Seufzend nahm er den Risotto heraus.
Während die Mahlzeit in der Pfanne dampfte, füllte Moritz ein Glas mit Wasser und stellte sich ans Fenster. Die Küche lag zur Straße hin, ununterbrochen floss der Verkehr am Haus vorbei. Ein leichter Geruch von Angebranntem riss Moritz aus seinen Gedanken. Er schaltete die Herdplatte aus und schaufelte den Risotto auf einen Teller. Seine Glieder fühlten sich steif an. Er legte die Gabel hin und schloss die Augen. Kurz erwog er, ins Bett zu gehen, statt auf Dorothee zu warten. Sogar dazu fehlte ihm die Kraft.
Ein Lichtstrahl erhellte die Küche. Moritz hörte, wie ein Fahrzeug in die Einfahrt bog. Dorothee war da! Er stellte seinen Teller in den Geschirrspüler, räumte das Besteck weg und leerte das Wasserglas aus. Aus der Waschküche hörte er das Klappern des Katzentörchens, als sich Nelly hindurchzwängte. Er könnte Dorothee einen Cocktail zubereiten, schoss es ihm durch den Kopf. Bloody Marys zu trinken war eine weitere Gewohnheit, die sie jüngst angenommen hatte. Moritz kam sich mit einem Drink in der Hand zwar genauso lächerlich vor wie auf dem Tanzparkett, ihr zuliebe machte er jedoch mit, auch wenn Alkohol Probleme nicht löste, sondern bloß davon ablenkte.
Bevor er den Tomatensaft holen konnte, klingelte es an der Tür. Hatte er den Schlüssel stecken lassen? Schlagartig kehrte die Unruhe zurück. Moritz versuchte, sich zu erinnern, welche Symptome bei seinem Vater zu Beginn der Alzheimer-Erkrankung aufgetreten waren. Die Vorstellung, dass sein Gehirn im Begriff sein könnte, sich aufzulösen, ließ sein Herz schneller schlagen. Rasch verdrängte er den Gedanken. Anna behauptete, Krankheiten ließen sich durch negative Gedanken heraufbeschwören. Mit wackligen Schritten ging Moritz zur Tür.
Elf Stunden später ging eine Vermisstmeldung bei der Polizei ein.
2
Staatsanwältin Regina Flint stand auf. Sie reichte dem Beschuldigten die Hand und nickte dem Transportdienst zu. Die Einvernahme hatte länger gedauert als erwartet. Trotz der anwesenden Dolmetscherin hatte der Beschuldigte vorgegeben, ihre Fragen nicht zu verstehen. Regina ließ sich nicht täuschen. Der 27-Jährige begriff nicht nur, was sie von ihm wissen wollte, ihm war zum Tatzeitpunkt auch klar gewesen, dass ein Fußtritt gegen den Kopf eines Mannes zu schweren Verletzungen führen konnte. Er hatte den Tod des Opfers vielleicht nicht gewollt, aber zumindest in Kauf genommen, wofür er nach über fünf Stunden endlich eine Erklärung lieferte: Der Mann hatte ihn vor seiner Freundin beleidigt.
Nina Dietz, seit acht Monaten im Vorbüro als Protokollführerin tätig, begleitete den Verteidiger und die Dolmetscherin zum Aufzug. Kaum war Regina allein, riss sie die Fenster auf, rückte die Stühle zurecht und räumte die Wassergläser weg. Sie warf einen Blick in ihren Posteingang und beschloss, dass die Beantwortung der Mails bis morgen warten konnte. Die Kita schloss in zwanzig Minuten. Eigentlich hatte Regina noch einige Lebensmittel einkaufen wollen, doch dazu reichte die Zeit nicht mehr. Sie hoffte, dass sich noch eine Pizza im Tiefkühlfach befand.
Ohne anzuklopfen, platzte Staatsanwältin Theresa Hanisch herein. »Für dich.« Sie klatschte ein Fax auf den Schreibtisch. »Vom Leib/Leben. Das solltest du dir sehr genau ansehen.«
Regina griff nach dem Ausdruck. »Ein neuer Fall? Ich habe keine Brandtour.«
»Als die Vermisstmeldung einging, warst du dran«, widersprach Hanisch. »Außerdem habe ich genug am Hals. In Schwamendingen wurde ein Tankwart von acht Typen niedergestochen. Am helllichten Tag! Früher haben sie damit wenigstens gewartet, bis es dunkel wurde!« Sie wandte sich ab und stapfte aus dem Raum.
Bevor Regina das Fax genauer studieren konnte, stand ihr Vorgesetzter in der Tür. Max Landolt, Leiter der Staatsanwaltschaft IV, trug wie immer Anzug und Krawatte. Der Blick hinter seiner Kunststoffbrille war ruhig, sein Lächeln freundlich, doch seine Finger tippten unentwegt gegen den Türrahmen und verrieten seine Anspannung.
»Du hast schon davon erfahren?« Er deutete auf das Fax.
Regina überflog die erste Seite. »Moritz Kienast? Der Name kommt mir bekannt vor.« Plötzlich fiel es ihr ein. »Ist das nicht dieser Sozialdemokrat? Der sich für Umweltthemen engagiert?« Sie schielte auf die Uhr.
»Parteilos«, antwortete Landolt. »Und ›engagiert‹ ist milde ausgedrückt. Kienast ist bekannt für seine Unnachgiebigkeit. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Seit Freitagabend fehlt jede Spur von ihm.«
Regina wusste, was als Nächstes kommen würde. Sie war froh, dass ihre Brandtour so glimpflich verlaufen war. Nur einmal hatte sie außerhalb der Arbeitszeit ausrücken müssen. Sie wappnete sich gegen Landolts Worte.
»Der Fall kann nicht warten. Die Polizei wird sich heute Abend nach der Tagesschau mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung wenden. Wir können davon ausgehen, dass sich die Medien auf die Geschichte stürzen.«
»Gibt es Hinweise auf ein Verbrechen?«
»Pilecki glaubt jedenfalls nicht, dass sich Kienast bloß eine Auszeit gönnt.«
Juri Pilecki hielt seit zweieinhalb Monaten die Fäden beim Dienst Leib/Leben in der Hand, wie das Kapitalverbrechen nach der Reorganisation der Kriminalpolizei jetzt genannt wurde. Als Stellvertreter von Dienstchef Bruno Cavalli nahm er Führungsaufgaben wahr, leitete wichtige Fälle selbst und fungierte als Ansprechperson für die Staatsanwaltschaft IV, die auf Gewaltdelikte spezialisiert war. Regina mochte den gebürtigen Tschechen. Mit seiner ungezwungenen Art und seinem Humor schaffte er es, ein wenig Leichtigkeit in den manchmal düsteren Alltag zu bringen. Seit er Cavalli vertrat, hatten sie sich oft unterhalten, denn er war der einzige Sachbearbeiter, der wusste, dass sein Vorgesetzter nicht unbezahlten Urlaub genommen hatte, sondern als verdeckter Ermittler im Einsatz war.
Regina schob den Gedanken an ihren Lebenspartner beiseite. Sie durfte der Angst, die in ihr nagte, seit Cavallis wöchentliche Anrufe ausgeblieben waren, keinen Raum geben. Nicht hier. Nicht jetzt. In zehn Minuten musste sie in der Kita sein.
»Es ist wichtig, dass du dich sofort des Falls annimmst«, fuhr Landolt fort. »Ich weiß, du hast morgen frei, aber Theresa ist mit der Messerstecherei beschäftigt. Wenn du möchtest, kann ich mich um die Medien kümmern.«
Regina schüttelte den Kopf. Versteckte sie sich hinter Landolt, stände sie als inkompetent und überfordert da. »Ich bin für den Fall zuständig, also werde ich mich auch mit der Kommunikationsbeauftragten absprechen und wenn nötig den Medien Auskunft geben.« Sie packte die Unterlagen ein. »Ich werde Pileckis Bericht heute Abend lesen. Wir sehen uns morgen.«
Sie fuhr ihren PC herunter, schnappte sich ihre Tasche und eilte aus dem Büro. Als sie das Gebäude verließ, stellte sie fest, dass sie ihren Schirm vergessen hatte. Obwohl es bereits Ende April war, war noch nichts vom Frühling zu spüren. Kalter Regen schlug ihr ins Gesicht. Mit eingezogenem Kopf hastete Regina über den Helvetiaplatz. Auf einmal erinnerte sie sich, in welchem Zusammenhang sie von Moritz Kienast gehört hatte. Anfang der Neunzigerjahre hatte ein Gemeinderat eine Motion zur Neugestaltung des Helvetiaplatzes eingereicht. Ziel war die Aufwertung des Kreises 4 gewesen, der damals noch maßgeblich vom Rotlichtmilieu geprägt war. Die Regierung sollte eine Vorlage ausarbeiten, beantragte aber stattdessen die Umwandlung der Motion in ein weniger verbindliches Postulat, was der Gemeinderat wiederum ablehnte. Es folgte ein jahrelanger Kampf. Immer wieder trat Moritz Kienast in Erscheinung. Soweit Regina wusste, lag das Geschäft nun bei der Spezialkommission Hochbaudepartement, Stadtentwicklung. Von den Gemeinderäten, die die Motion unterstützt hatten, war vermutlich keiner mehr im Amt. Einige hatten sich aus der Politik zurückgezogen, andere saßen heute wie Moritz Kienast im Kantonsrat. Inzwischen war sogar eine Tiefgarage unter dem Helvetiaplatz gebaut worden. Regina hatte dort vorübergehend einen Parkplatz gemietet. Seit Cavalli weg war, benutzte sie seinen Volvo, da Lily nach einem langen Kita-Tag oft müde war und die Fahrt nach Gockhausen mit Tram, S-Bahn und Bus sie zusätzlich anstrengte. Zwar hütete Reginas Mutter ihr Enkelkind regelmäßig, doch da Regina nicht mehr auf Cavallis Unterstützung zählen konnte, musste sie Lily häufiger in die Kita bringen. Ständig hatte sie ein schlechtes Gewissen. Lily war ein kränkliches Kind, brauchte viel Ruhe. Im Gegensatz zu anderen Dreijährigen konnte sie sich stundenlang allein beschäftigen. Menschen überforderten sie rasch. Seit Cavallis Abreise hatte sie sich zudem völlig in sich zurückgezogen, weinte oft und lutschte sogar am Daumen. Regina litt mit ihr. Sie verstand nicht, wie Cavalli seinen Beruf vor die Bedürfnisse der Familie stellen konnte, wenn auch nur für drei Monate. Sie wusste aber, dass sie ihm diesen Freiraum zugestehen musste. Fühlte er sich eingesperrt, ginge er für immer. In dieser Beziehung war er von Anfang an ehrlich zu ihr gewesen. Er hatte nie vorgegeben, ein anderer zu sein, und sie hatte sich darauf eingelassen, wenn auch nur, weil die Alternative – die Beziehung zu beenden – zu schmerzhaft war, um sie ernsthaft in Betracht zu ziehen.
Regina strich sich das nasse Haar aus dem Gesicht und betrat die Kita. Sie war nicht die Einzige, die kurz vor Schluss gekommen war. In der Garderobe kniete eine entnervte Mutter vor ihrem Sohn und versuchte, ihm die Schuhe zu schnüren, während neben ihr ein Vater auf einen Vierjährigen einredete, der sich weigerte, einen Dinosaurier in eine Kiste zurückzulegen. Die Kita-Leiterin hörte einer besorgten jungen Frau zu. Ab und zu nickte sie. Regina hob grüßend die Hand und machte sich auf die Suche nach Lily. Sie fand ihre Tochter in der Puppenecke, wo sie mit einem Stoffadler spielte. Ihre glänzenden schwarzen Haare schimmerten im Licht der Deckenlampe, die blauen Augen fixierten den Adler, mit dessen Schnabel sie sich über den Handrücken strich. Der Anblick schnürte Regina die Kehle zu. Vielleicht maß sie der Symbolik zu viel Gewicht bei, doch sie fragte sich, ob Lily in diesem Vogel ihren Vater sah. Cavallis Großmutter nannte ihn Tsi’skwa, das Wort der Cherokee-Indianer für Vogel. Seit er ins Reservat zurückgekehrt war, um im Auftrag des FBI zu ermitteln, verbrachte Lily Stunden mit dem Stoffadler.
»Hallo, mein Schatz«, sagte Regina sanft, um sie nicht zu erschrecken.
Die meisten Kinder rannten ihren Eltern entgegen, wenn diese die Kita betraten. Lily rührte sich nicht. Regina hatte sich immer wieder gefragt warum, bis sie begriffen hatte, dass Lily Zeit brauchte, um aus ihrer Fantasiewelt in die Wirklichkeit zurückzukehren. Auch jetzt legte sie zuerst den Adler weg und deckte ihn zu, bevor sie in Reginas ausgestreckte Arme fiel.
»Wie geht es dir?«, fragte Regina.
Lily schwieg.
Regina führte sie an der Hand zur Garderobe, wo Lily ohne Aufhebens ihre Tigerfinken abstreifte und ins vorgesehene Fach legte. Sogar inmitten der Kindermöbel sah sie winzig aus. Regina dachte an Cavallis Sohn Chris, der fast 1,90 Meter maß. Ob Lily irgendwann in die Höhe schießen würde? Regina bezweifelte es. Alles an Lily war zierlich, sogar ihre Ohren glichen filigranen Muscheln. Regina half ihr, die Regenjacke anzuziehen, und zog den Reißverschluss hoch. Anschließend verabschiedete sie sich mit einem Winken von der Kita-Leiterin, die immer noch in das Gespräch vertieft war.
Im Volvo setzte Regina Lily in ihren Kindersitz und legte eine CD ein. Cavalli bewahrte über ein Dutzend CDs mit Geschichten im Auto auf. Er war mit Fabeln und Sagen aufgewachsen und liebte sie genauso wie Lily. Als die Stimme der Erzählerin erklang, verlor Lily sofort das Interesse an ihrer Umgebung. Regina blieb neben dem Volvo stehen und zog ihr Handy hervor. Unschlüssig betrachtete sie das Display. Wenn sie ihre Mutter bat, morgen auf Lily aufzupassen, müsste sie Lily jetzt nach Uitikon bringen. Um rechtzeitig in Gockhausen zu sein, musste Marlene schon um halb sechs Uhr aufstehen. Zweimal pro Woche wollte Regina ihr das nicht zumuten. Es genügte, dass sie die lange Fahrt jeden Mittwoch auf sich nahm. Für Lily wäre ein Abend zu Hause jedoch besser, als direkt von der Kita zur Großmutter zu fahren. Ob Chris zufällig freihatte? Lily vergötterte ihren Halbbruder, und seit Cavalli weg war, klammerte sie sich regelrecht an ihn. Regina hatte zu Beginn befürchtet, Chris zu viel Verantwortung aufzubürden, wenn sie ihn bat, Lily zu hüten, doch er schien die gemeinsamen Stunden genauso zu genießen. Sogar ihre Angst vor seiner Unzuverlässigkeit hatte sich als unbegründet erwiesen. Er kam immer pünktlich und nahm seine Aufsichtspflicht ernst. Reginas Wohnung sah danach zwar aus, als habe ein Sturm darin gewütet; damit hatte sie sich aber abgefunden. Leider hatte Chris als Koch lange Arbeitszeiten und selten dann frei, wenn sie ihn brauchte. Trotzdem versuchte sie, ihn zu erreichen. Er nahm sofort ab.
»Ich habe heute und morgen frei«, antwortete er. »Klar hüte ich den Zwerg.«
»Du bist ein Engel!«, sagte Regina. »Ich muss morgen leider früh aus dem Haus. Willst du bei uns übernachten?«
»Einen Moment.«
Regina hörte die Stimme seiner Freundin Debbie im Hintergrund.
»Nö«, sagte Chris schließlich. »Ich komme am Morgen und schlaf dann bei dir weiter.«
»Ich weiß nicht, ob Lily das zulassen wird.«
»Das krieg ich schon hin.«
Regina lächelte, immer noch verblüfft über die Wandlung, die Chris durchgemacht hatte. Sie hatte ihn als unglücklichen, verschlossenen Jungen kennengelernt, der sich zu einem schwierigen Jugendlichen entwickelt hatte. Eine Lehre als Maler hatte er abgebrochen, erst als er mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, ließ er sich überreden, als Hilfskraft in einer Pizzeria zu arbeiten. Zur Überraschung aller absolvierte er anschließend eine Kochlehre. Seit er mit seiner Freundin zusammenlebte, wirkte er ausgeglichen und zufrieden.
»Vielen Dank«, sagte Regina. »Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde.«
Er zögerte. »Hast du etwas von ihm gehört?«
Regina schloss kurz die Augen. »Nein.«
Es war ein Vertrauensbeweis, dass Cavalli seinem Sohn den wahren Grund für seine Abwesenheit verraten hatte. Zwar kannte Chris die Details nicht, er wusste aber, dass Cavalli beruflich unterwegs war. Regina war dankbar, dass sie Chris nicht belügen musste. Ab und zu fragte sie sich, ob es fair war, ihn den Ängsten auszusetzen, die ein verdeckter Ermittlungsauftrag für Angehörige mit sich brachte. Wenn sie aber daran dachte, wie oft Cavalli seinen Sohn als Kind im Stich gelassen hatte, kam sie zum Schluss, dass die Wahrheit für Chris wohl erträglicher war als die Vorstellung, Cavalli habe ihn erneut verlassen.
Sie verabschiedete sich und setzte sich ans Steuer. Lilys Augen waren halb geschlossen, ihr Mund stand offen. Schon bald lullte die weiche Stimme der Erzählerin auch Regina ein und versetzte sie in eine andere Welt. Zwar verstand Regina kein Wort Tsalagi, die Sprache der Cherokees, doch der Singsang war angenehm anzuhören. Als sie eine Dreiviertelstunde später in Gockhausen ankam, wäre sie am liebsten im Wagen sitzen geblieben. Lily war eingeschlafen, nur mit Mühe gelang es Regina, sie zu wecken. Sie machte ihr etwas zu essen und brachte sie anschließend ins Bett. Kaum lag Lilys Kopf auf dem Kissen, war sie hellwach und wollte spielen.
Es war fast zehn, als Regina sich mit Pileckis Fax aufs Sofa setzte. Sie breitete eine Fleecedecke über die Beine und begann, die Unterlagen zu sortieren. Pilecki war ein scharfsinniger Ermittler, doch seine Zusammenstellung ließ klare Strukturen vermissen. Regina brauchte eine Weile, bis sie sich einen Überblick verschafft hatte.
Laut Dorothee Kienast-Sutter verschwand ihr Mann am 19. April zwischen 19.15 Uhr und 22.10 Uhr. Wie jeden Freitag hatte sich Dorothee um 19.15 Uhr auf den Weg zu ihrem Zumba-Kurs gemacht. Moritz Kienast saß angeblich am Laptop in seinem Mansardenbüro. Als sie um 22.10 Uhr nach Hause kam, war die Haustür unverschlossen, in der Küche brannte Licht, und im Geschirrspüler entdeckte sie einen benutzten Teller. Es roch nach geschmolzenem Käse, offenbar hatte sich Kienast eine Portion Risotto aufgewärmt. Von ihm selbst fehlte jede Spur. Sein Handy lag auf dem Schreibtisch, den Laptop hatte er heruntergefahren. Obwohl sich Dorothee Sorgen machte, ging sie eine Stunde später ins Bett. Gegenüber der Stadtpolizei hatte sie erklärt, ihr Mann habe sich in letzter Zeit oft unwohl gefühlt. Dorothee vermutete deshalb, er sei zu einem Spaziergang aufgebrochen.
Als sie um halb sieben am folgenden Morgen aufstand, war seine Seite des Betts immer noch leer. Auch im Gästezimmer war er nicht. Beunruhigt setzte sich Dorothee ans Telefon und rief alle Spitäler in Zürich an. Ohne Erfolg. Daraufhin ging sie zur Stadtpolizei, die eine Vermisstenanzeige entgegennahm und Moritz Kienast im Fahndungssystem Ripol ausschrieb. Hinweise auf ein Gewaltdelikt lagen zum Zeitpunkt keine vor. Das änderte sich jedoch, als die Stadtpolizei mit dem Hausarzt der Familie sprach.
Mit wachsendem Interesse las Regina weiter. Moritz Kienast hatte Dr. Ulrich Schwegler wegen starken Juckreizes, anhaltender Müdigkeit und Kreislaufbeschwerden aufgesucht. Schwegler hatte psychische Gründe hinter den Symptomen vermutet. Um eine Allergie auszuschließen, hatte er aber verschiedene Tests vorgeschlagen. Dazu war es nicht mehr gekommen. Kienast war verschwunden, bevor sie durchgeführt werden konnten. Als ein erfahrener Polizist fragte, ob das Krankheitsbild auf eine Vergiftung hindeuten könnte, bejahte der Arzt. Daraufhin überwies die Stadtpolizei den Fall an den Kanton.
Regina zog ein Foto des Vermissten hervor. Moritz Kienast blickte mit ernsten, tief liegenden Augen in die Kamera. Sein knochiges Gesicht wirkte asketisch, das Lächeln aufgesetzt. Tiefe Furchen hatten sich in sein Gesicht gegraben. Als junger Mann mochte er attraktiv gewesen sein, doch als Mittfünfziger strahlte er eine unübersehbare Bitterkeit aus. Unwillkürlich wich Regina zurück. Sie fragte sich, ob diese Unzufriedenheit in Kienasts Charakter lag oder ob sie im Laufe seines Lebens entstanden war. Hatte er zu viele Niederlagen einstecken müssen? Sie zu persönlich genommen? Oder war er schlicht müde? Er machte auf Regina den Eindruck, als habe er den Moment verpasst, dringend nötige Veränderungen in Angriff zu nehmen.
Oder hatte er genau das getan? Vielleicht hatte er gegessen, war aufgestanden und einfach zur Tür hinausspaziert. Regina erinnerte sich an den Fall eines 46-Jährigen, der wegen geschäftlicher Probleme ohne Erklärung verschwunden war. Nach einigen Wochen kehrte er wieder zu seiner Familie zurück.
Hatte Moritz Kienast genug gehabt und beschlossen, irgendwo neu anzufangen? Oder gar sein Leben zu beenden? Dass er keine Nachricht hinterlassen hatte, schloss einen Suizid nicht aus. Hunderte Menschen nahmen sich in der Schweiz jährlich das Leben. Von den rund zweihundert Personen, die pro Jahr verschwanden, wurden nur wenige Opfer eines Verbrechens.
Regina stand auf, sah kurz nach Lily und brühte sich anschließend einen Tee auf. Als sie sich wieder ins Wohnzimmer setzte, schaltete sie den Fernseher für die Spätnachrichten ein. Sie fragte sich, ob der öffentliche Aufruf sinnvoll gewesen war. Für die Familie war es eine Belastung, wenn das Verschwinden eines Angehörigen publik wurde. Da es in der Schweiz aber keine nationale Plattform zur Ausschreibung von Vermissten gab, war dies der einzige Weg, um Informationen aus der Bevölkerung zu erhalten. Moritz Kienast bekleidete ein politisches Amt, damit nahm er das Interesse der Öffentlichkeit an seiner Person in Kauf.
Regina trank einen Schluck Tee. Ihr Blick kehrte zum Foto des Politikers zurück. Plötzlich glaubte sie, hinter der Bitterkeit ein Grinsen zu sehen. Sie rieb sich die Augen. Zeit fürs Bett, dachte sie. Anstrengende Tage lagen vor ihr. Moritz Kienast war kein beliebter Politiker gewesen, doch das schmälerte das Interesse der Bevölkerung an seinem Verschwinden nicht.
3
Auf dem Lindenhof dämmerte es. Unterhalb des historischen Platzes floss das dunkle Wasser der Limmat träge dahin, als laste der schwere, graue Himmel auf der Oberfläche. Schachfiguren warteten zwischen den Linden auf Spieler, Parkbänke, die an warmen Sommertagen so begehrt waren wie der Schatten der Bäume, auf Spaziergänger. Eine Touristin fotografierte an der Stützmauer die Doppeltürme des Grossmünsters. Sie beachtete die Männer nicht, die sich hinter ihrem Rücken die Hand gaben.
»Danke, dass du gekommen bist, Bruder.«
»Das ist doch selbstverständlich. Wie geht es dir?«
»Den Umständen entsprechend.«
»Kann ich etwas für dich tun?«
»Ich brauche Informationen.«
»Informationen?«
»Ich muss wissen, was geschehen ist.«
»Mir sind Grenzen gesetzt. Das ist dir klar, nicht wahr?«
»Ich erwarte nicht, dass du sie übertrittst. Aber ich muss verstehen, was sich abgespielt hat.«
»Nosce te ipsum. Erkenne dich selbst.«
»Ich weiß nur zu gut, dass meine Möglichkeiten genauso beschränkt sind wie deine. Aber ich halte mich lieber an Platon, der einen optimistischeren Zugang zur Selbsterkenntnis pflegte: Das Wissen um das eigene Nichtwissen ist die Voraussetzung aller Entwicklung.«
»Was wirst du mit diesem Wissen anfangen?«
»Was immer nötig ist.«
»Wenn du schon Platon zitierst, gehe ich noch einen Schritt weiter. Die Neuplatoniker vertraten nämlich die Ansicht, die Wahrheit sei nicht in der Außenwelt, sondern in der Besinnung auf sich selbst zu finden. Ist dir das zu wenig? Was bezweckst du mit der Ausweitung der Suche?«
»Muss alles einen Zweck haben? Reicht es nicht, begreifen zu wollen? Vor allem du müsstest das doch verstehen! Wir sind alle Suchende, du aber hast das Suchen zu deinem Lebensinhalt gemacht.«
»Ja, und mir gefällt nicht immer, was ich finde.«
»Ist das eine Warnung?«
»Nein, eine Erfahrung, die ich dir mitteile. Bist du wirklich sicher, dass du Antworten auf deine Fragen willst?«
»Lass das meine Sorge sein.«
»Gut. Ich schaue, was ich tun kann.«
»Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen.«
»Du würdest das Gleiche für mich tun.«
Das Wasser des Lindenhofbrunnens plätscherte leise. Eine Amsel hüpfte über den Platz, hielt inne, bohrte den Schnabel zwischen zwei Pflastersteine und breitete die Flügel aus, um davonzufliegen. Als die Kirchenglocken um 7.01 Uhr läuteten, fielen die ersten Regentropfen.
4
Juri Pilecki holte sich eine zweite Tasse Kaffee und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. Obwohl es zwischen ihm und seinem Vorgesetzten in den letzten Jahren oft zu Auseinandersetzungen gekommen war, sehnte er Cavallis Rückkehr herbei. Er hatte genug davon, als Erster ins Büro kommen zu müssen, um die Meldungen der vergangenen Nacht vor dem Morgenrapport durchzusehen. Um halb sieben Uhr war er kaum in der Lage, sein Spiegelbild zu erkennen, und erst recht nicht, Informationen zu verarbeiten. Im Korridor hörte er Stimmen. Er sah auf die Uhr und rieb sich die Augen. Es war bereits sieben, in einer halben Stunde würden sich die Sachbearbeiter des Dienstes Leib/Leben in der Kripoleitstelle versammeln, um zu erfahren, was sich seit der letzten Sitzung ereignet hatte und um sich von Pilecki über die außergewöhnlichen Todesfälle ins Bild setzen zu lassen, bevor sie im Personalrestaurant gemeinsam frühstückten.
Pilecki nahm einen großen Schluck Kaffee. Er zuckte zusammen, als er sich die Zunge verbrannte. Leise fluchend stellte er die Tasse hin. Der Kaffee schwappte über den Rand und bekleckerte seine Notizen. Die aufgemalte Sonne lachte ihn aus. Seine Stieftochter hatte ihm die Tasse zu Weihnachten geschenkt mit der Bemerkung, vielleicht werde er so morgens schneller wach. Obwohl Katja erst die vierte Klasse besuchte, hatte sie einen feinen Sinn für Humor. Unwillkürlich musste Pilecki lächeln. Es war nicht einfach gewesen, sich nach achtundvierzig Jahren als Junggeselle von einem Tag auf den anderen auf ein Leben zu dritt einzustellen. Da sich Irina als Kabaretttänzerin illegal in der Schweiz aufgehalten hatte, mussten sie heiraten, bevor sie das Familienleben erproben konnten. Nie hatte Pilecki den Entscheid bereut. Sein Leben war dadurch zwar komplizierter geworden, trotzdem empfand er Irinas und Katjas Anwesenheit als Bereicherung. Wenn er Freiraum brauchte, traf er sich mit Kollegen zu einem Bier oder besuchte mit einem Kumpel von der Sitte, der Pileckis Leidenschaft für Eishockey teilte, die Heimspiele der ZSC Lions. Seit er die Fünfzig überschritten hatte, fiel ihm das Aufstehen am Tag danach deutlich schwerer. Er tupfte mit einem Taschentuch seine Unterlagen ab. Wenn Cavalli zurückkehrte, würde Pilecki gleich Urlaub einreichen.
Das Team war bereits versammelt, als er die Kripoleitstelle betrat. Seit der Umstrukturierung der Kriminalpolizei waren sie nur noch fünfzehn Sachbearbeiter beim Dienst Leib/Leben. Zwei Kollegen hatten zur Kriminalanalyse gewechselt, drei zum neu geschaffenen Dienst Gewaltschutz. Wenigstens war eine Personalverstärkung in Sicht. Dass die Reorganisation, die den Namen »Progress« trug, tatsächlich ein Fortschritt war, bezweifelte Pilecki. Viele Polizisten hatten die Spezialabteilungen zugunsten der neu geschaffenen Abteilung Allgemeine Kriminalität verlassen, und manch einer tat sich schwer, sich in das Aufgabenfeld einzuarbeiten. Die neue Fallplanung war mit zusätzlicher Schreibarbeit verbunden, Sachbearbeiter spotteten, sie verbrächten mehr Stunden damit nachzuweisen, wofür sie ihre Zeit einsetzten, als mit der eigentlichen Fallarbeit. Pilecki ärgerte sich, dass die Betroffenen zu wenig in die Veränderungen miteinbezogen worden waren und dass die Projektleiter inzwischen Offiziersstellen bekleideten, während Polizisten, die sich querstellten, kaltgestellt worden waren.
»Scheint dir im Chefsessel zu gefallen«, begrüßte ihn Heinz Gurtner. »Oder ist es das Alter? Deinen mickrigen Hintern rechtzeitig hierherzubewegen fällt dir offenbar jeden Morgen schwerer.«
»Scharfsinnig«, stellte Pilecki fest. Langsam entfaltete das Koffein seine Wirkung. »Pass nur auf, dass du nicht alle Hirnzellen verschwendest, bevor der Tag richtig losgeht. Du wirst heute noch ein paar brauchen.«
Vera Haas grinste. Die ehemalige Regionalpolizistin gehörte erst seit wenigen Monaten zum Team, bearbeitete dank ihrer schnellen Auffassungsgabe aber bereits eigene Fälle. Da sie nicht zögerte zu fragen, wenn sie Unterstützung brauchte, ließ Pilecki ihr freie Hand.
»Motz-Moritz?«, fragte Gurtner.
»Bingo«, erwiderte Pilecki.
»Motz-Moritz?«, wiederholte Haas.
»Moritz Kienast«, erklärte Tobias Fahrni. »Siebzehn Jahre Gemeinderat, seit 2007 Kantonsrat. Umweltingenieur, Familienvater, Atomenergie-Gegner, Uferweg-Befürworter, Initiant von zahlreichen Postulaten und Anfragen. Verschwunden seit vergangenem Freitag.«
»›Ein Verbrechen kann nicht ausgeschlossen werden‹«, zitierte Pilecki den Sprecher, der den Zeugenaufruf nach der Tagesschau verlesen hatte. Pilecki fasste kurz zusammen, was über das Verschwinden des Politikers bekannt war. »Es ist bereits eine ganze Woche vergangen. Wenn Kienast tatsächlich Opfer eines Verbrechens wurde, müssen wir schnell handeln. Tobias, du hast zwar das Eins«, sagte er und meinte damit die Reihenfolge beim Pikettdienst, »doch bis auf Weiteres übernehme ich die Leitung des Falls. Du wirst mich unterstützen, vorläufig werden auch Heinz und Vera sowie zwei Sachbearbeiter vom Kripo-Pikett Aufgaben übernehmen.« Er hielt kurz inne, bis die drei zustimmend nickten. »Im Anschluss an den Rapport halten wir eine ausführliche Besprechung ab. Es wäre gut, wenn Kristian auch dabei wäre.«
»Klar«, sagte Kristian Stanic. Als Sachbearbeiter bei der Kriminalanalyse war er dem Dienst Leib/Leben zugeteilt. Er bereitete elektronisch erfasste Daten auf und stellte sie grafisch dar. Nur wenige Polizisten besaßen das nötige Fachwissen, um mit dem Programm i2 iBase umzugehen. Die meisten waren froh, einen Spezialisten an ihrer Seite zu haben.
»Ist eine Telefonkontrolle angeordnet worden?«, fragte er.
»Ich gehe davon aus«, erwiderte Pilecki. »Ich habe noch nicht mit der Staatsanwältin telefoniert.« Er sah auf die Uhr. »Ich werde es nach der Pause versuchen. Um acht sollte sie im Büro sein.«
Gurtner stöhnte. »Theresa Hanisch?«
Pilecki grinste. »Ja, aber wir haben Glück. Landolt hat den Fall Regina Flint zugeteilt, weil sie Brandtour hatte, als die Anzeige bei der Stadtpolizei einging.«
Sogar Fahrni, der als Einziger mit Hanischs herrischem Gehabe zurechtkam, wirkte erleichtert.
Pilecki wandte sich den Ereignissen der vergangenen Nacht zu, fasste die Informationen des Dienstchef-Rapports zusammen und gab anschließend seinen Teamkollegen das Wort. Nachdem die Sachbearbeiter erklärt hatten, woran sie arbeiteten, leitete Pilecki eine kurze Befindlichkeitsrunde ein. Cavallis Vorgänger hatte diese Maßnahme eingeführt, um Probleme im Team frühzeitig zu erkennen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Als Cavalli die Stelle antrat, schaffte er die Befindlichkeitsrunde wieder ab, weil er sie für Zeitverschwendung hielt. Obwohl Pilecki nur vorübergehend die Führung innehatte, hatte er als Erstes die Tradition wiederbelebt. Unstimmigkeiten beeinträchtigten nicht nur den Teamgeist, sondern auch den Informationsaustausch und somit die Fallarbeit.
Haas meldete sich. »Kann es sein, dass wir wegen Kienast dieses Wochenende arbeiten müssen? Ich habe einen Auftritt mit der Korpsmusik.«
»Die Arbeitsverteilung müssen wir noch prüfen«, antwortete Pilecki. »Aber der Auftritt lässt sich bestimmt einplanen.« Er wandte sich an Gurtner. »Kommt nicht Brigitte dieses Wochenende?«
»Sonntagmorgen«, antwortete Gurtner.
Pilecki wusste, dass Gurtner ungern vor anderen über seine Familiensituation sprach. Seit seine Frau aufgrund ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung im Rollstuhl saß, war sie auf Hilfe angewiesen. Gurtners Tochter, die in Kanada lebte, wollte in die Schweiz zurückkehren, um sich um ihre Mutter zu kümmern. Bis es so weit war, arbeitete Gurtner reduziert. Pilecki war stets darauf bedacht, dem Team diese Tatsache in Erinnerung zu rufen, damit keine Missgunst aufkam. Allzu schnell wurde vergessen, warum Gurtner morgens später kam oder abends früher aufbrach.
»Sonst noch etwas?«, fragte er in die Runde.
Niemand meldete sich.
»Gut, dann habe ich noch ein Anliegen. Wie ihr wisst, kehrt der Häuptling in zwei Wochen zurück.« Cavalli bei seinem Spitznamen zu nennen fiel Pilecki schwer. Noch mehr Mühe bereiteten ihm die nächsten Worte. »Wir sollten einen Willkommensapéro für ihn organisieren.«
Gurtner schnaubte.
»Ist das dein Ernst?« Haas nahm wie immer kein Blatt vor den Mund. »Ich habe nicht den Eindruck, dass sich jemand auf Cavallis Rückkehr freut.«
»In den vergangenen drei Monaten haben wir viel erreicht«, erklärte Pilecki. »Wir sind wieder zu einer Einheit zusammengewachsen. Wenn wir den Häuptling nicht mit ins Boot holen, war alles umsonst.«
»Ich finde die Idee gut.« Fahrni nickte. »Schließlich war er lange weg.«
»Wie er das bloß hingekriegt hat?«, brummte Gurtner. »Seit wann bewilligt die Kapo drei Monate unbezahlten Urlaub? Jede Wette, Vollenweider steckt dahinter.«
»Claudia Vollenweider? Vergiss es!« Haas schüttelte den Kopf. »Die Kripochefin ist immun gegen seinen Charme.«
»Es muss eine Frau gewesen sein«, beharrte Gurtner. »Was findet ihr eigentlich alle an ihm? Erklär mir das mal, Häschen. Warum fallen euch gleich die Höschen runter, wenn der Häuptling auftaucht? Riecht ihr das Testosteron?«
Fahrni neigte den Kopf zur Seite. »Eine interessante Frage. Ein starker Sexualtrieb und große Durchsetzungskraft sind tatsächlich die Folge eines hohen Testosteronspiegels«, erklärte er. »Beim Häuptling kommt noch das Aussehen dazu. Ich habe gelesen, dass Männer mit flacher Stirn, schmalen Augen, markantem Kinn und hervorstehenden Wangenknochen als besonders maskulin gelten. Ein athletischer Körperbau und ausgeprägte Muskeln kommen auch gut an. Das alles hat der Häuptling. Deshalb finden Frauen ihn attraktiv. Aber ob man Testosteron riechen kann?«
Gurtner hob die Hände. »Die Weiber leben in der Steinzeit!«
Haas schnappte nach Luft.
Pilecki ergriff rasch das Wort. »Das können wir beim Kaffee besprechen. Tobias, hast du die Kapazität, einen Apéro auf die Beine zu stellen?«
»Claro.« Fahrnis Blick wurde glasig. »Ich könnte Chipa organisieren. Oder Empanadas. Vielleicht noch ein paar Schokogipfel?«
Eine Stunde später versammelten sich Gurtner, Haas, Fahrni und Stanic erneut um den Sitzungstisch. Pilecki stellte zwei Sachbearbeiter vom Kripo-Pikett vor, setzte sich und zückte den Notizblock.
»Ich habe soeben mit Regina Flint telefoniert. Sie hat mir den Durchsuchungsbefehl für das Haus und alle elektronischen Geräte bereits gefaxt. Auch um die rückwirkende Telefonkontrolle hat sie sich schon gekümmert. Die Verfügung ist beim UVEK, den Antrag ans Zwangsmaßnahmengericht wird sie heute noch ausstellen, nicht nur für das Telefon von Kienast, sondern auch für das seiner Frau.«
»Gibt es Hinweise, dass sie als Täterin infrage kommt?«, wollte Haas wissen.
»Soviel wir wissen, ist Dorothee Kienast-Sutter die letzte Person, die Moritz Kienast gesehen hat. Das macht sie zwangsläufig verdächtig. Wir müssen überprüfen, ob Kienast wirklich zwischen 19.15 und 22.10 Uhr verschwand oder ob seine Frau sich mit der Aussage bloß ein Alibi verschaffen wollte.«
»Weißt du mehr über die Vergiftungsanzeichen?«, fragte Gurtner.
Pilecki verneinte. »Kannst du dich darum kümmern? Lade den Arzt so schnell wie möglich vor. Sprich dich aber zuerst mit Regina ab. Sie will, dass wir den Ermittlungsschwerpunkt im Moment auf Kienasts gesundheitliche Beschwerden legen. Wenn sich herausstellt, dass jemand versucht hat, ihn zu vergiften, haben wir es möglicherweise mit einem Tötungsdelikt zu tun. Gleichzeitig sollten wir aber auch Kienasts Finanzen überprüfen. Tobias, das möchte ich dir übertragen. Regina will wissen, ob er geschäftliche Probleme hatte. Hat«, korrigierte er und wandte sich an Haas. »Vera, du gehst bitte den eingegangenen Hinweisen nach. Das Kripo-Pikett wird dich unterstützen.« Er schaute in die Runde. »Ich werde die Hausdurchsuchung in die Wege leiten und mit Kienasts Tochter sprechen.«
»Wie alt ist sie?«, fragte Gurtner.
»Zweiundzwanzig. Sie studiert an der Uni Zürich Psychologie. Wohnt nicht mehr zu Hause, besucht die Eltern aber häufig.« Pilecki sah auf die Uhr. »Der Fall hat oberste Priorität. Der Mediendienst will heute um sechzehn Uhr erste Infos rausgeben, um Spekulationen vorzubeugen. Der Zeugenaufruf hat das Interesse der Öffentlichkeit geweckt, der Ansturm der Medien wird groß sein. Bitte haltet mich auf dem Laufenden«, schloss er. »Ich werde mit dem Mediensprecher und der Staatsanwaltschaft in Kontakt bleiben. Gibt es noch Fragen?«
»Was ist mit Dorothee Kienast-Sutter?«, warf Fahrni ein.
»Regina möchte mit der Befragung warten bis nach der Hausdurchsuchung«, antwortete Pilecki. »Sie befürchtet, Kienast-Sutter könnte uns die Arbeit erschweren, wenn sie merkt, dass sie unter Verdacht steht. Die Kollegen von der Stadt haben ihre Aussage bereits aufgenommen. Sie waren ziemlich gründlich. Damit können wir im Moment arbeiten.« Er stand auf. »Gut, die nächste gemeinsame Besprechung halten wir um fünfzehn Uhr ab. Regina Flint wird auch hier sein, wenn sie es zeitlich schafft.«
Als Pilecki gegenüber Anna Kienast Platz nahm, schossen ihm Gurtners Worte durch den Kopf. Die Blondine war eindeutig die Tochter von »Motz-Moritz«. Sie hatte von ihrem Vater nicht nur die tief liegenden Augen geerbt, sondern auch die scharfen Wangenknochen und die provokative Körperhaltung. Herausfordernd reckte sie das Kinn in die Höhe.
»Danke, dass Sie so schnell herkommen konnten«, begann Pilecki. »Ich verstehe, dass die Situation für Sie sehr belastend ist.«
Anna Kienast beugte sich vor. »Ich weiß, dass ihm etwas zugestoßen ist! Mein Vater würde nie einfach so verschwinden!«
Pilecki nickte mitfühlend. »Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen?«
»Am Donnerstagabend. Ich wollte am Sonntag meine Eltern besuchen. Ich rief an, um zu fragen, ob ich einen Freund mitbringen dürfe.«
»Einen Freund?«
»Ich habe vor einigen Wochen einen Medizinstudenten kennengelernt und wollte ihn meinen Eltern vorstellen. Ich bin sicher, mein Vater hätte ihn gemocht!«
»Wie verhielt sich Ihr Vater am Telefon?«
»Sie meinen, ob er anders war als sonst?«
»Ja.«
»Er war wie immer! Er hat mich gefragt, wie es im Studium läuft, wollte mehr über meinen neuen Freund wissen und erzählte, dass er Platten für den Sitzplatz hinter dem Haus gekauft hat. Er will dort einen Wintergarten bauen.« Sie schüttelte den Kopf. »Er hat sich über den Preis beschwert. Ich glaube, es waren Granitplatten oder etwas in der Art. Es ist so typisch für ihn, dass er immer reklamiert!«
»Typisch?«
Anna Kienast setzte einen abgeklärten Blick auf. »Um meinen Vater zu verstehen, müssen Sie wissen, dass er mitten in einer Midlife-Crisis steckt. Ich glaube, es ist ihm bewusst geworden, dass er vieles im Leben nicht mehr erreichen kann. Sie kennen das bestimmt: Mit fünfzig sind die besten Jahre vorbei. Dann geht es bergab, körperlich, gesundheitlich und auch, was das Aussehen betrifft.«
Pilecki blinzelte.
»Es ist eine Umbruchsphase«, dozierte sie. »Männer testen ihren Marktwert, verspüren den Drang, etwas zu verändern. Bei meinem Vater äußert sich das in Unzufriedenheit. Er ist gereizt und müde. Um zu beweisen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört, reißt er neue Projekte an, aber er ist nur mit halbem Herzen dabei. Er hat seine Meinung nie verheimlicht. Jetzt geht es ihm jedoch nicht mehr darum, Diskussionen auszulösen, sondern Frust abzulassen. Verstehen Sie, was ich meine?« Sie seufzte. »Ich nehme es ihm nicht übel. Schließlich kann er nichts dafür. In der Lebensmitte sinkt die Testosteronproduktion, das hat körperliche Veränderungen zur Folge. Die Potenz lässt nach, erste Anzeichen einer Glatze zeigen sich, die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Damit umzugehen, ist nicht einfach.«
Schon wieder das Thema Testosteron, dachte Pilecki, während er sich über seine dünnen Haare strich. Er räusperte sich. »Seit wann fühlt sich Ihr Vater gereizt und müde?«, fragte er.
»Zwei Monate? Vielleicht etwas länger? Ich weiß es nicht mehr so genau. Es begann schleichend und wurde immer stärker. Manchmal ist er fast unerträglich.«
»Wie ist Ihre Beziehung zu ihm?«
»Gut!«, sagte Anna Kienast laut, als habe Pilecki mit seiner Frage andeuten wollen, sie könnte die Ursache für Moritz Kienasts Unzufriedenheit sein. »Wir haben uns immer bestens verstanden. Ich besuche meine Eltern mindestens einmal pro Woche.«
»Worüber reden Sie mit Ihrem Vater?«
»Eigentlich über alles: das Studium, Freunde, die Familie. Was eben läuft.«
»Über Politik?«
»Klar.« Zum ersten Mal lächelte sie. »Bei meinem Vater ist das unumgänglich. Politik ist sein Leben. Ich finde es toll, wie er sich engagiert. Manchmal nimmt er die Dinge aber zu ernst. In die Sache mit dem Seeuferweg hat er sich richtig verbissen. Mal ehrlich, so schlimm ist es auch wieder nicht, wenn der Weg nicht immer genau dem Ufer entlang verläuft. Klar wäre es schön, aber sich deswegen so aufzuregen? In letzter Zeit sprach er über nichts anderes. Er meinte, es gehe um weit mehr als um einen Spazierweg, nämlich darum, wem die Schweiz gehöre. Seit der Bankenkrise ist er total empfindlich. Es stört ihn, dass sich einige wenige auf Kosten vieler bereichern. Er behauptet, heute denke jeder nur noch an sich. Der Seeuferweg ist für ihn zum Symbol geworden.« Ihr Blick schweifte zum Fenster. »Er nimmt alles so persönlich. Er fühlt sich, entschuldigen Sie das Wort, verarscht. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll.«
»Von wem?«
Sie zuckte die Schultern. »Von der Regierung? Der Verwaltung? Keine Ahnung. Es nervt ihn zum Beispiel gewaltig, dass die Seeuferweg-Befürworter ihre Volksinitiative zurückzogen und das Parlament dann den Gegenvorschlag der Regierung abänderte. Er sagt, das verstoße gegen Treu und Glauben, und die Bürgerlichen seien Betrüger.«
»Hat er auch über seine Tätigkeit als Umweltingenieur gesprochen?«
»Selten. Ich weiß nur, dass er viel zu tun hat, seit sein Partner vor einigen Jahren starb. Max’ Tod hat ihn sehr mitgenommen. Uns alle. Max war wie ein Onkel für mich.«
»Sie haben vorhin gesagt, Ihr Vater würde nie einfach so verschwinden. Warum glauben Sie das?«
»Weil er nicht so ist! Er hat keine Geheimnisse. Wenn ihn etwas stört, redet er darüber oder kämpft dagegen. Warum sollte er untertauchen? Auch privat bewegt sich alles im grünen Bereich. Meine Mutter und er sind seit Ewigkeiten verheiratet. Sie hatten nie Probleme. Er hat schlicht keinen Grund zu verschwinden. Ich bin sicher, es ist ihm etwas zugestoßen! Vielleicht ging er spazieren und stürzte unglücklich. Mein Gott«, flüsterte sie. »Wenn er irgendwo liegt? Verletzt ist? Bitte, suchen Sie ihn!«
»Eine letzte Frage habe ich noch«, sagte Pilecki. »Hatte Ihr Vater Feinde?«
Anna Kienast riss die Augen auf. »Sie glauben doch nicht, dass ihm jemand etwas angetan hat?«
»Wir müssen alle Möglichkeiten überprüfen.«
»Natürlich hatte er Feinde. Jede Menge! Immobilienfirmen, Hausbesitzer, Politiker, Verwaltungsangestellte, Juristen – sogar mit unserem Nachbarn ist er zerstritten.«
»Weswegen?«
»Wegen Gertrud. Sie kackt dauernd in unseren Garten.«
Die Befragung hatte länger gedauert, als Pilecki erwartet hatte. Zahlreiche Nachrichten waren für ihn eingegangen. Der Chef der Ermittlungsabteilung Gewaltkriminalität sowie die Medienstelle hatten ihn gesucht, Regina Flint rief an, und das Forensische Institut bat um eine kurze Besprechung wegen der geplanten Hausdurchsuchung. Sein Posteingang quoll über, der Schreibtisch war mit Unterlagen und Berichten übersät. Pilecki ärgerte sich. Er hätte die Befragung nicht selber durchführen, sondern delegieren müssen. Noch immer unterschätzte er die Zeit, die Führungsaufgaben beanspruchten. Obwohl er es als befriedigend empfand, als amtierender Dienstchef taktische und strategische Entscheidungen zu treffen, war er im Herzen Sachbearbeiter. Er war es gewohnt, einzutauchen und zu ermitteln, nicht aber zu dirigieren.
Mit schlechtem Gewissen rief er Irina an und sagte das gemeinsame Abendessen ab. Freitags wurde Katja von einer Studentin betreut, die in der gleichen Genossenschaftssiedlung wohnte. Der Abend gehörte ihm und Irina. Die paar Stunden bedeuteten beiden viel, sie gaben ihnen Gelegenheit, Themen anzusprechen, die im Alltag keinen Platz fanden, und sich ungestört über Dinge zu unterhalten, die sie beschäftigten. Immer wieder hatte Irina angedeutet, sich eine andere Stelle suchen zu wollen. Mit dem neuen Vorgesetzten gefiel ihr die Arbeit als Analystin bei der Schweizerischen Kreditgesellschaft nicht mehr. Pilecki vermutete, dass sie sich selbst Hoffnungen auf die Kaderposition gemacht hatte, auch wenn sie es bestritt. Gestern Abend hatte sie gesagt, sie wolle von der Bankbranche weg. Pilecki hatte nur mit halbem Ohr zugehört. In Gedanken war er bei der Arbeit gewesen. Nun bereute er, sich nicht mehr Zeit für Irina genommen zu haben.
Er fragte sich, wie Cavalli es geschafft hatte, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Von seinen Untergebenen hatte er da wenig Unterstützung bekommen. Zum ersten Mal wurde Pilecki klar, dass er zwar auf dem Papier sein Stellvertreter gewesen, im Alltag jedoch seiner Funktion nicht gerecht geworden war. Er nahm sich vor, Cavallis Rückkehr als Neuanfang zu nutzen. Vielleicht würden sie es schaffen, zu dem entspannten Verhältnis zurückzufinden, das ihre Zusammenarbeit früher geprägt hatte. Bis Cavalli aber wieder da war, dauerte es noch zwei Wochen. Und so, wie die Dinge lagen, würden es zwei sehr lange Wochen werden. Pilecki setzte sich an seinen Schreibtisch und griff nach dem Telefonhörer.
5
Die Schmerzen waren nicht das Schlimmste. Sondern die Angst. Moritz Kienast konnte sich nicht erinnern, jemals solche Angst verspürt zu haben. Sie hatte sich in seinem Innersten festgesetzt wie ein Parasit. Er dachte an den tropischen Wurm, von dem ihm ein Studienkollege vor Jahren erzählt hatte. Der Parasit kreiste in den Adern des Wirts, ab und zu drang er durch die Haut, doch es war fast unmöglich, ihn zu packen und herauszuziehen. Der einzige Weg, den Wurm loszuwerden, war durch eine Operation. Moritz hatte ungläubig gelacht, doch nun wusste er, dass es vieles gab, das sich seinem Vorstellungsvermögen entzog.
Er versuchte, eine bequemere Haltung einzunehmen. Der Käfig war so eng, dass er sich zusammenrollen musste. Wie ein Hund, dachte er und berührte das Eisenband um seinen Hals. Die Haut darunter fühlte sich wund an. Moritz schob zwei Finger unter das Metall, um den Druck auf die aufgescheuerte Stelle zu verringern, und verschaffte sich vorübergehend Linderung. Die Angst jedoch blieb. Sie schärfte seine Sinne, sodass er jeden Luftzug spürte und jedes Knacken wahrnahm. Gleichzeitig lähmte sie ihn. Er traute sich nicht zu schreien, aus Furcht, seine Situation zu verschlimmern. Wimmernd presste er die Faust gegen den Mund. Er schmeckte Blut, dort, wo die Knöchel gegen etwas Hartes geprallt waren. Der metallene Geschmack löste Brechreiz in ihm aus, und sein Magen zog sich zusammen. Um die aufkeimende Panik zu ersticken, versuchte er, sich ein Bild von seiner Umgebung zu machen.