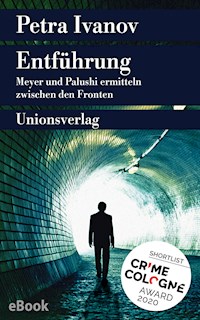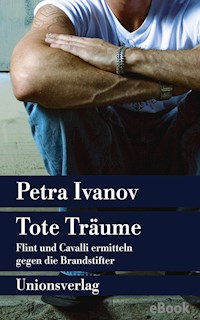9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Die drei Richter starren mich schweigend an, genauso die Zuschauer und die Journalisten. Sie haben genug über meine Person gehört. Sie wissen, wer ich bin. Jetzt wollen sie hören, was ich getan habe.« Sebastians Leben ist eine einzige Abwärtsspirale. Seine Eltern sind von seinen schulischen Leistungen enttäuscht, Freunde hat er kaum. Eine Lehrstelle findet er nur dank der Beziehungen seines Vaters, eines Zahnarztes an der Zürcher Goldküste. Einzig im Billardspielen ist Seb wirklich gut. Als er dabei Isabella kennenlernt, scheint sein Leben eine Wende zu nehmen. Doch es kommt anders als erwartet. Statt auf sicheren Boden, führt ihn diese Beziehung aufs Glatteis. Unfähig, sich aufzufangen, schlittert Seb geradewegs in eine Katastrophe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch
Sebastians Leben ist eine einzige Abwärtsspirale. Die Eltern sind enttäuscht, Freunde hat er kaum. Als er Isabella kennenlernt, scheint sein Leben eine Wende zu nehmen. Doch statt auf sicheren Boden, führt ihn diese Beziehung aufs Glatteis. Unfähig, sich aufzufangen, schlittert Seb geradewegs in eine Katastrophe.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Petra Ivanov verbrachte ihre Kindheit in New York. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz absolvierte sie die Dolmetscherschule und arbeitete als Übersetzerin, Sprachlehrerin sowie Journalistin. Ihr Werk umfasst Kriminalromane, Thriller, Liebesromane, Jugendbücher, Kurzgeschichten und Kolumnen.
Zur Webseite von Petra Ivanov.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Petra Ivanov
Geballte Wut
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die Erstausgabe erschien 2014 im Appenzeller Verlag, Schwellbrunn.
© by Petra Ivanov 2014
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Tiorina
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30960-9
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 06:08h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
GEBALLTE WUT
1 – »Wer vorsätzlich einen Menschen tötet (…), wird mit …2 – »Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung …3 – »Bei der Abklärung der persönlichen Verhältnisse der oder …4 – »Diese Instanzen, Einrichtungen und Personen sind verpflichtet …5 – »Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe …6 – »Als Waffen gelten: (…) Messer, deren Klinge mit …7 – »Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung …8 – »Der Täter soll ›Experte‹ für sein persönliches Deliktverhalten …9 – »Die Diskrepanz zwischen dem Wollen und Können eines …10 – »Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die …11 – »Für die Anwendung dieses Gesetzes sind der Schutz …12 – »Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder …13 – »Die beschuldigte Person muss sich nicht selbst belasten …14 – »Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die …15 – »Wir sind ein Gefängnis, und wir sind aufeinander …16 – »Für Personen, welche zum Zeitpunkt der Tat das …17 – »Im Zentrum des Aufenthaltes stehen die Abklärung der …18 – »Beim Vorstellungsgespräch wird der junge Straftäter darüber informiert …19 – »Die Zahl der Gewaltstraftaten ist (2012) um 4 …20 – »Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör …21 – »Wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt, wer vorsätzlich …22 – »Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung …23 – »Die Begründung enthält bei Urteilen: die tatsächliche und …Mehr über dieses Buch
Über Petra Ivanov
Petra Ivanov: »Meine Figuren sind lebendig. Wenn ich nicht schreibe, verliere ich den Kontakt zu ihnen.«
Petra Ivanov: »Mein Weltbild hat sich zum Besseren verändert, seit ich Krimis schreibe.«
Mitra Devi: Ein ganz und gar subjektives Porträt von Petra Ivanov
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Petra Ivanov
Zum Thema Schweiz
Zum Thema Kriminalroman
Für Regina
1
»Wer vorsätzlich einen Menschen tötet (…), wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.«
Art. 111 Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB)
Die Stimme des Richters ist hart. Sein Blick fixiert mich. Trotzdem habe ich das Gefühl, seine Worte gingen mich nichts an. Ich sitze auf der Anklagebank. Wie eine Billardkugel, die beim Eröffnungsstoß vom Tisch gesprungen ist. Aus dem Spiel gefallen. Aus dem Leben. Nur dass im Billard die Kugel aufgehoben und wieder eingesetzt wird. Ich hingegen bleibe am Boden liegen. Zwischen Zigarettenkippen, Staubflusen und Füßen, die mich am liebsten in den Arsch treten würden.
Wie lange ich nicht mitspiele, hängt von den drei Richtern ab. Ich sitze schon seit zwei Jahren hinter Gittern. Ein Niemand – ohne Handy, ohne Facebookseite, ohne Mädchen. Immerhin gibt es im Jugendknast einen Billardtisch. Wenn ich schlecht drauf bin, versenke ich Kugeln und stelle mir vor, wie sie in einen Tunnel fallen und weiterrollen. Weg von den Betreuern, Gutachtern und Sozialarbeitern. Hinaus ins Freie. Wo ich schweigen darf, wenn ich will.
Als ich vierzehn war, habe ich einmal zwei Tage lang kein Wort gesagt. Ich war sauer, weil ich mit meinem Vater wandern gehen musste. Ich sehe nicht ein, weshalb ich mich einen Berg hochquälen soll, nur um auf der anderen Seite wieder hinunterzulatschen. Außerdem war es der erste Tag der Herbstferien. Ich freute mich aufs Abhängen – zwei Wochen ohne Französischverben und Mengenlehre, ohne Standpauken und enttäuschte Blicke. Ich hatte die Probezeit im Niveau A der siebten Klasse nicht bestanden, trotz Nachhilfe. Nicht dass mich die Blicke störten. Ich wunderte mich einfach, warum meine Eltern nicht begriffen, dass aus ihren Plänen nichts würde. Mein Vater ist Kieferorthopäde. Er war richtig gut drauf, als sich herausstellte, dass ich eine Zahnspange benötigte. Er meinte, es sei von Vorteil, wenn ich verstünde, wie sich eine Zahnkorrektur anfühle. Damals glaubte er noch, ich würde eines Tages in seine Fußstapfen treten, Zahnmedizin studieren und die Praxis übernehmen.
Voll daneben.
Er ist heute nicht hier. Meine Mutter auch nicht. Dafür sitzen im Gerichtssaal eine Menge Journalisten. Ich frage mich, was sie hier suchen. Biete ich eine Freak-Show oder was?
Aber zurück zur Wanderung. Denn da fing alles an. Nur wusste ich es noch nicht. Seltsam irgendwie. Man sollte glauben, ein außerordentlicher Tag fühle sich auch außerordentlich an. Beim Billardspielen zum Beispiel merke ich, ob ein Stoß gelingt, kaum berührt das Queue die Kugel. Spüre ich auch nur das geringste Jucken in den Fingern, versenke ich die Kugel garantiert nicht. Bleibe ich aber ganz ruhig, setzt sie sich fast lautlos in Bewegung. Das satte Plopp, wenn sie in die Tasche fällt, gibt mir jedes Mal einen Kick.
Das Leben ist unberechenbarer als der Lauf einer Billardkugel.
Blitz hatte sich »Drive« heruntergeladen, zusammen wollten wir uns den Film reinziehen und chillen. Ich kannte Blitz noch nicht lange. Einige Monate zuvor war er ins Nachbarhaus gezogen, in einen edlen Glasbau mit Swimmingpool und Dachterrasse. Unsere Hütte war auch nicht schlecht, aber im Vergleich zum Palast der Pfisters wirkte sie irgendwie schäbig. Meine Mutter steht auf Ethnokram, überall starren dich komische Figuren mit riesigen Unterlippen und Haaren aus Stroh an. Die Bilder im Wohnzimmer sehen aus wie meine ersten Versuche mit Fingerfarben, nur dass sie ein Vermögen wert sind. Sie gefallen mir nicht besonders, genauso wenig wie die antiken Tonkrüge auf dem Sideboard. Keiner ist ganz, jedem fehlt ein Stück des Henkels, des Ausgusses oder der Glasur.
Bei Blitz war alles perfekt. Nichts störte das Design. Bei der Einrichtung dominierten klare Linien, weißes Leder und glänzende Oberflächen herrschten vor. Deshalb habe ich zuerst geglaubt, Blitz heiße wirklich Blitz. Irgendwie wäre das richtig gewesen, wenn auch ein bisschen schräg. Blitzsauber. Blitzblank. Blitz Pfister. Aber seine Eltern nannten ihn nur so, weil er blitzschnell war. In seinem Zimmer hingen lauter polierte Goldmedaillen. Dreimal pro Woche trainierte er im Leichtathletikclub.
Trotzdem war er voll in Ordnung. Bevor ich Blitz kennenlernte, hatte ich nie einen richtigen Freund gehabt. Nicht dass ich unbeliebt gewesen wäre, aber die meisten Typen waren entweder bescheuert oder hielten sich für etwas Besonderes. Meine Mutter drängte mich ständig, Klassenkameraden einzuladen. Wegen der sozialen Kontakte, meinte sie. Ich versuchte, ihr klarzumachen, dass ich gut darauf verzichten konnte, mich von anderen fertigmachen zu lassen, doch sie behauptete, für eine gesunde Entwicklung sei der Umgang mit Menschen wichtig. Ich weiß nicht, wie sie heute darüber denkt. Gut möglich, dass sie ihre Meinung geändert hat. Der Psychologe, der über mich ein Gutachten erstellt hat, bezeichnet meine Entwicklung nicht als gesund.
Meine Mutter glaubt, man könne jedes Problem lösen, wenn man darüber rede. Kein Wunder, schließlich ist Probleme besprechen ihr Beruf. Dafür hat sie sogar studiert. Gibt es in einer Firma Knatsch, in einem Team oder einer Abteilung zum Beispiel, tritt sie in Aktion und sahnt dabei groß ab.
Bei mir hat das mit dem Reden nie geklappt.
In der vierten Klasse habe ich es mit Thomas König versucht. Thomas König ist ein Retortenschüler. So nenne ich die Kunstprodukte, die bei Lehrern beliebt sind. Er hatte einen riesigen Kopf und einen schmächtigen Körper – sah aus wie ein Luftballon auf einem Plastikstiel. Sein Blick schoss ständig hin und her, außer wenn er einen Lehrer ansah. Am schlimmsten aber war sein Dauerlächeln. Ein Wunder, dass der Ballon nicht platzte.
Kaum waren wir alleine, legte Thomas König seine Maske ab. In der Pause bestimmte er, wer beim Fußball mitspielen durfte. Ich gehörte nicht dazu. An seinem Geburtstag verteilte er jedem Kuchen, außer dem dicken Danko. Und mir natürlich. Damit hatte ich kein Problem, da ich Kuchen sowieso nicht mag. Als er mir aber die Trainerhose aus dem Turnsack klaute und durch ein Paar glänzende Leggins ersetzte, war das eine andere Sache. Denn Thomas König wusste, ich würde die Leggins anziehen müssen, schließlich kannte er unseren Turnlehrer. Herr Kehl lässt nichts durchgehen. Um nicht mitzuturnen, musste man mindestens mit einem Bein im Grab stehen. Kehl begriff nicht, dass ein Junge, der in Leggins erschien, so gut wie tot war.
Danach habe ich versucht, mit Thomas König zu reden. Du kannst dir vorstellen, was es gebracht hat. Gar nichts. Also habe ich ihm einen Faustschlag verpasst. Vielleicht waren es auch zwei. Da ließ er mich in Ruhe. Und zwar gänzlich. Es war, als existiere ich in seinem Sonnensystem einfach nicht mehr. Das Problem war nur, dass alles um ihn kreiste. Er war sozusagen die Sonne. Deshalb existierte ich von einem Tag auf den anderen für gar niemanden mehr.
Aber zurück zu Blitz. Blitz war anders. Kein Retortenmensch, auch wenn er nahezu perfekt war. An ihm wirkte alles echt. Er war etwas Besonderes, doch er hatte es nicht nötig, andere daran zu erinnern. In seiner Gegenwart fühlte ich mich wohl. Außerdem fuhr er auf Actionfilme ab. Manchmal ahmte er vor dem Bildschirm die Geräusche im Film nach, wie es Kinder tun, wenn sie mit Autos spielen. Total peinlich, aber das war ihm egal. Es lachte ihn auch niemand aus deswegen. Über Blitz machte man sich nicht lustig. Falls jemand allen bei der Geburt Karten ausgeteilt hatte, so hatte Blitz lauter Asse bekommen. Ich hingegen mühte mich mit ein paar Zweiern und vielleicht einer Drei oder einer Vier ab.
Mein Shrink meint, wichtig seien nicht die Karten, sondern wie man sie spiele. Ich bin kein guter Kartenspieler. Außerdem fehlt es mir an Glück. Ernsthaft. In der sechsten Klasse musste ich zur Schulpsychologin, weil ich angeblich aggressiv war. Nach vier Sitzungen rief sie meine Mutter an und bat sie, mich an einer Studie mitmachen zu lassen – über Pechvögel. Ein Kollege schreibe eine Doktorarbeit. Die Schulpsychologin meinte, ich eigne mich hervorragend als Studienobjekt. Verstehst du jetzt, was ich meine?
Ein anderes Beispiel: Hätte mich mein Vater an jenem Wochenende nicht in die Berge mitgeschleppt, sähe mein Leben heute anders aus. Die Wanderung beendete eine meiner seltenen Glückssträhnen. Während ich schweigend hinter meinem Vater herstapfte, suchte sich Blitz jemanden, der mit ihm »Drive« schaute. Und stieß von allen Menschen auf dieser Erde ausgerechnet auf Thomas König.
Blitzʼ Mutter lächelte, als sie die Tür öffnete. »Komm rein, Sebastian«, begrüßte sie mich. »Die Jungs sind oben.«
Die Jungs. Schon da hätten bei mir die Alarmglocken läuten sollen. Abgesehen von mir hatte Blitz nie Besuch. Wir wohnten ziemlich hoch oben am Hang. Wegen der Seesicht, die unsere Eltern so toll finden. Das Problem war, dass niemand, der nicht dort wohnte, freiwillig zur Seeblickstraße hochstieg. Trotzdem dachte ich mir nichts dabei. Ich war einfach froh, den Abend bei Blitz verbringen zu dürfen statt in den Bergen.
Als ich in sein Zimmer trat, lief der Abspann von »Drive«. Da geschah etwas Seltsames. Ich habe einmal gehört, dass man am Äquator ein Ei auf einer Stecknadel balancieren kann. Das hat mit den Kräften zu tun, die dort auf das Ei einwirken. Es kippt weder auf die eine noch auf die andere Seite. Etwas Ähnliches passierte mit mir. Ich konnte mich nicht bewegen. Zwar wollte ich auf Blitz zugehen, doch etwas hielt mich davon ab. Es dauerte einen Moment, bis mir klar wurde, dass dieses etwas von Thomas König ausging.
»Was macht der Idiot hier?«, fragte ich Blitz.
Wenn sich Blitz ärgert, hüpft sein Adamsapfel auf und ab. Vielleicht weil er versucht, seine Wut hinunterzuschlucken. Ich blendete das Warnzeichen aus.
»Ja, auch schön, dich zu sehen, Seb«, antwortete er ironisch.
»Ich hab gefragt, was König hier zu suchen hat!«
Blitz stand auf und schluckte. »Soviel ich weiß, ist das immer noch mein Zimmer!«
An seiner Logik war nichts auszusetzen. Also wandte ich mich an Thomas König, der mit einem trägen Grinsen auf dem Sofa lümmelte. »Verschwinde!«
»Seb!«, stieß Blitz aus. »Hast du sie nicht mehr alle?«
Ich ging einen Schritt auf Thomas König zu. Ich bin kein Schlägertyp, aber in dem Moment hätte ich alles darum gegeben, den selbstgefälligen Ausdruck von seinem Gesicht wischen zu können. Er brauchte kein Wort zu sagen, die Botschaft kam bei mir an: Jetzt bin ich hier. Verpiss dich.
Doch ich ließ mich nicht mehr von Angebern wie Thomas König terrorisieren. Es war Zeit, ihm das klarzumachen. Bevor er merkte, wie ihm geschah, hatte ich sein biederes Poloshirt gepackt und ihn hochgezogen. Seine Lippen formten ein stummes O. Ich hörte Blitz hinter mir, verstand aber nicht, was er sagte. In meinen Ohren rauschte es, als würde ich durch einen Tunnel fahren.
»Mach, dass du wegkommst!«, zischte ich und stieß Thomas König zur Tür.
Eigentlich wollte ich ihm nur die Richtung weisen. Woher hätte ich wissen sollen, dass der Idiot das Gleichgewicht verlieren würde? Er stolperte und fiel rückwärts gegen das Regal, auf dem Blitzʼ Pokale standen. Statt sich aufzurappeln, wie es jeder normale Mensch getan hätte, blieb Thomas König einfach sitzen, die Augen fast so weit aufgerissen wie den Mund. Ich war dermaßen fasziniert von diesem Ausdruck, dass ich gar nicht sah, wie der Siegerpokal der kantonalen Meisterschaften über 100 Meter bedrohlich wankte. Erst als Blitz hinter mir nach Luft schnappte, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Ich schaute auf. Wie in Zeitlupe bewegte sich das schwere Teil auf Thomas König zu.
Jetzt kommt wieder das mit dem Pech. Thomas König hat zwar einen großen Kopf, trotzdem war die Wahrscheinlichkeit, dass ihm der Pokal direkt auf den Schädel fiel, ziemlich klein. Aber natürlich tat der Pokal genau das. Und er traf nicht etwa mit der glatten Fläche auf, sondern mit der Ecke des Sockels. Von einem Moment auf den anderen sah ich nur noch Blut. Ich wartete auf einen Schrei, doch der kam nicht. Die Trophäe hatte Thomas König bewusstlos geschlagen.
Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich nur um eine kleine Wunde handelte. Offenbar bluten Kopfwunden immer stark. Zwar musste sie genäht werden, doch einen Schaden trug Thomas König nicht davon, zumindest keinen neuen.
Seit diesem Abend sind Blitz und Thomas König dicke Freunde. Ich hatte mitten im Spiel die Acht versenkt. Will heißen: verloren. Im Leben gelten die gleichen Regeln wie im Billard. Nur dass die Acht viel schlechter erkennbar ist.
Im Gerichtssaal ist es still. Habe ich etwas verpasst? Ich schiele zu meinem Anwalt. Er heißt Markus Brunschweiler, doch in Gedanken nenne ich ihn den Fuchs. Seine kantigen Gesichtszüge verleihen ihm etwas Hinterlistiges, und er hat immer irgendwelche Tricks auf Lager. Als er mich im Gefängnis besuchte, schmuggelte er einen Brief meiner Mutter hinein. Ich bin froh, steht der Fuchs auf meiner Seite. Ihn als Gegner zu haben, ist eine beängstigende Vorstellung.
Der Fuchs blättert in der Anklageschrift – zwölf Seiten Juristendeutsch, das nur er versteht. Und die Jugendanwältin natürlich, schließlich hat sie das Ganze geschrieben. Sie hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Sie will, dass ich zu einer hohen Strafe verurteilt werde. Dabei wirkt sie eigentlich ganz nett. Der Fuchs meint, sie habe eine Profilierungsneurose. Das bedeutet, sie hat es nötig, die Starke zu spielen. Keine Ahnung. Tatsache ist, sie hätte auch auf schwere Körperverletzung klagen können. Hat sie aber nicht. Sie will den Richter davon überzeugen, dass ich zwei Menschen töten wollte.
2
»Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.«
Art. 22 Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB)
Für mich war Erfolg immer etwas Erstrebenswertes. Deshalb habe ich gestaunt, als mir der Fuchs erklärte, was Juristen darunter verstehen. Das geht so: Du versuchst, jemanden zu töten, aber aus irgendeinem Grund gelingt es dir nicht. Der andere überlebt. Juristen sagen dann, der Erfolg trat nicht ein. Ziemlich schräg, oder?
Als ich das begriffen hatte, begann ich, genauer hinzuhören. Ich stellte fest, dass häufig von erfolgreichen Geschäftsleuten gesprochen wird. Das gab mir zu denken, da mein Vater Geschäftsleute als Verbrecher bezeichnet. Vor allem solche, die viel verdienen, ohne dafür ehrliche Arbeit zu verrichten, wie er es ausdrückt. Von Arbeit hat mein Vater ganz klare Vorstellungen. Ich bekam eine Ahnung davon, als das Thema Berufswahl aktuell wurde.
Dass ich nicht Zahnarzt würde, war inzwischen klar. Nach der verpatzten Probezeit versetzten mich meine Eltern in eine Privatschule. Sie glaubten, in einer kleineren Klasse könnte ich mein Potenzial besser entfalten. Meine Leistungen wurden nicht besser. Ehrlich gesagt, besteht für mich kein Unterschied, ob zehn oder zwanzig Schüler im Zimmer sitzen, wenn der Lehrer eine Algebraformel erklärt. An der Tatsache, dass ich sie nicht verstehe, ändert die Klassengröße nichts. Ich will sie nicht verstehen. Wozu auch?
Ich weiß genau, was mein Shrink jetzt sagen würde: Ich würde mir etwas vormachen, weil ich es nicht ertrüge, meine Eltern zu enttäuschen. Dr. Wagner nimmt nie ein Blatt vor den Mund. Meine Mutter ist der Meinung, Notlügen seien wichtig, um Verletzungen zu vermeiden. Davon hält Dr. Wagner wenig. Er ist knallhart. Aber zu ihm später. Gut möglich, dass ich tatsächlich kein Potenzial habe, das sich entfalten kann. Auf jeden Fall standen mir nicht viele Berufe offen. An der Berufsmesse schleppte mich mein Vater von Stand zu Stand. An jedem stellte er Fragen. Mir kam es vor, als unterzöge er die Metzger, Schreiner, Köche und Maler einer Prüfung. Nicht dass ich Metzger, Schreiner, Koch oder Maler werden wollte. Der Lohn war schlecht und die Arbeit anstrengend. Ich hörte den Ausführungen also nur mit halbem Ohr zu.
»Könntest du dir vorstellen, mitten in der Nacht mit der Arbeit zu beginnen?«, fragte mein Vater.
Ich sah vermutlich wie ein Fragezeichen aus, denn sein Ausdruck verdüsterte sich. Ich schaute mich um. Wir befanden uns am Stand der Bäcker. Das hätte mir auffallen sollen, denn es roch penetrant nach Brot.
»Hör zu, Sebastian«, begann er.
Ich stellte mich auf eine längere Moralpredigt ein.
»Wir sind deinetwegen hier, nicht meinetwegen. Es geht um deine Zukunft. Einem Schulversager stehen nicht viele Wege offen. Also komm herunter von deinem hohen Ross. Irgendein Beruf wird dich wohl interessieren. Brote zu backen, ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin eine ehrliche Arbeit.«
Er seufzte und fuhr sich mit der Hand durch sein spärliches Haar. Vielleicht stellte er sich vor, wie er am nächsten Zahnärztekongress den Kollegen erklärte, sein Sohn sei Bäcker. Um die tiefe Furche zwischen seinen Augenbrauen nicht weiter anschauen zu müssen, studierte ich den Messeplan, den ich in der Hand hielt. Die Bezeichnung »Facility Manager« stach mir ins Auge. Für meinen Vater fielen Manager zwar auch in die Kategorie Verbrecher, vielleicht hätte er aber lieber einen Verbrecher als Sohn als einen Bäcker. Dass ich mich täuschte, sollte ich noch früh genug erfahren.
Ich deutete auf den Eintrag. »Das wär doch was.«
Mein Vater beugte sich über den Prospekt und zog die Stirn kraus. »Facility Manager? Das ist doch nichts anderes als ein Hauswart!«
Ich brauchte dringend eine Verschnaufpause.
»Muss aufs Klo«, sagte ich und verschwand. Draußen lehnte ich mich gegen eine Mauer. Auf dem Messegelände wimmelte es von Menschen. Der Duft von Bratwürsten wehte in meine Richtung und ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Es herrschte Feststimmung, ein krasser Gegensatz zum Thema der Messe: Arbeit. Es wurden sogar Luftballons verkauft. Ich dachte an Thomas König. Der Retortenschüler hatte die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium geschafft, vermutlich würde er irgendwann zu jenen Typen gehören, die ohne ehrliche Arbeit absahnten.
Während ich meinen Gedanken nachhing, schweifte mein Blick zum Sicherheitsangestellten, der neben dem Eingang stand. Er trug Kampfstiefel, an seinem Gürtel hingen verschiedene Holster, ein Funkgerät und ein Pfefferspray. Ich fragte mich, ob er den Spray je eingesetzt hatte. Auf der Berufsmesse kaum. In der Sonne zu stehen, ohne einen Finger zu rühren, erschien mir gar nicht übel. Endlich ein Beruf, der mir gefiel.
»Hey«, sagte ich.
Der Sicherheitsangestellte nickte kurz.
»Cooler Job«, stellte ich fest.
»Kann nicht klagen.«
»Verdient man gut?«
»Je nach Qualifikation.«
»Was für Qualifikationen?«
»Du musst fit sein und gut Deutsch sprechen. Und über einen tadellosen Leumund verfügen.«
Während er sprach, schaute er immer geradeaus, als fürchte er, ein Bombenattentäter könnte sich in die Messehalle einschleichen, wenn er kurz wegsah. Vielleicht hoffte er es sogar. Muss ein gutes Gefühl sein, einen Anschlag zu verhindern. Ich fragte mich, wie häufig das geschah. Darüber wurde selten berichtet. Meist las man über Attentate, die gelangen. Erfolgreiche Attentate.
»Ist das alles?«, bohrte ich weiter.
»Natürlich braucht man eine Ausbildung.«
Meine Hoffnungen sanken. »Eine Schule?«
»Einen Kurs. Nach einer Woche kann man bereits einfachere Aufgaben übernehmen.«
Nur eine Woche! Der Beruf gefiel mir immer besser.
Er wollte noch etwas hinzufügen, da hörte ich plötzlich die Stimme meines Vaters.
»Da bist du ja! Komm, die Messe schließt bald.«
»Das würde mich interessieren«, sagte ich, auf den Sicherheitsangestellten deutend. »Es gibt eine Ausbildung …«
»Lass uns die Mechanikerberufe anschauen«, unterbrach mein Vater. »Darauf könntest du bauen. Mit einem guten Lehrabschluss als Polymechaniker kannst du später die Berufsmatura machen und eine Ingenieurschule besuchen.«
Ich zeigte noch einmal zum Sicherheitsangestellten. »Das ist auch ein Beruf.«
Endlich begriff mein Vater. »Ein Beruf?« Er lachte. »Herumstehen und nichts tun? Das ist keine ehrliche Arbeit.«
Der Sicherheitsangestellte verzog keine Miene.
»Herr Bischof?«
Es dauert einen Moment, bis ich begreife, dass der Richter mich meint. Ich schaue auf.
»Sie sind doch Sebastian Bischof?«
»Ja.«
»Geboren am 5. Juni, von Zürich?«
Ich nicke.
»Bitte antworten Sie mit ›Ja‹ oder ›Nein‹.«
»Ja.«
»Sohn des Paul Bischof, wohnhaft in Zürich, und der Olivia Bischof, wohnhaft in Küsnacht?«
Eine Journalistin beugt sich vor, um mein Gesicht besser zu sehen. Ich möchte ihr sagen, sie solle die Nase in ihre eigenen Angelegenheiten stecken, aber das würde nicht viel nützen. Der Fuchs hat mir erklärt, Journalisten dürften zuschauen. Das hat mit dem öffentlichen Interesse zu tun. Der Bürger soll in der Zeitung lesen können, dass sich der Staat für die Sicherheit einsetzt. Ausnahmen gibt es nur, wenn eine öffentliche Verhandlung für das Opfer unzumutbar wäre oder wenn der Beschuldigte minderjährig ist. Aber das bin ich nicht.
Trotzdem stehe ich vor Jugendgericht. Warum, habe ich bis heute nicht ganz begriffen. Es hat damit zu tun, dass ich für eine Straftat, die ich mit 17 Jahren beging, noch nicht verurteilt wurde. Wenn ein Verfahren gegen einen Minderjährigen offen ist und eine weitere Tat hinzukommt, ist immer noch die Jugendanwaltschaft zuständig. Der Fuchs meint, das sei gut, weil Jugendanwälte nicht so viel drauf hätten wie Staatsanwälte. Zumindest sagte er das, als er mich im Knast besuchte. Ich glaube, er kannte Ursula Kruse-Wiederkehr damals noch nicht. Heute denkt er wahrscheinlich anders darüber.
»Herr Bischof? Sind Sie der Sohn des Paul Bischof und der Olivia Bischof?«
»Ja.«
Vermutlich wünschen sich meine Eltern, ich wäre es nicht. Seit der Scheidung sehe ich meinen Vater kaum. Anfangs hat er mich regelmäßig besucht, in letzter Zeit kommt er nur noch selten. Er hat eine Freundin. Meine Mutter sagt, er versuche, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Damit meint sie mich. Er wohnt jetzt in der Stadt, hat seine Baumwollhose gegen Jeans getauscht und sich die dünnen Haare abrasiert. Echt schwul. Meine Mutter ist im Haus geblieben. Sie lasse sich nicht vom Getratsche vertreiben, sagt sie. Wegrennen sei keine Lösung. Man müsse sich den Schwierigkeiten im Leben stellen.
Dennoch ist sie heute nicht hier. Sie sagt, sie will sich nicht nochmals anhören, was ich getan habe. Ich habe auch keine große Lust, das Ganze erneut durchzugehen, doch genau das werde ich tun müssen. Der Fuchs meint, jede Einzelheit sei für die Richter wichtig, nicht nur der Tatverlauf an sich, sondern auch die Ereignisse davor.
Wie gesagt, begonnen hat alles mit der Wanderung. Nach dem Vorfall mit Thomas König wollte Blitz nichts mehr mit mir zu tun haben. Wenig später beschlossen meine Eltern, mich auf die Privatschule zu schicken, damit ich weiterhin das Niveau A besuchen konnte. Und dort lernte ich Mike Tinner kennen.
3
»Bei der Abklärung der persönlichen Verhältnisse der oder des beschuldigten Jugendlichen arbeitet die Untersuchungsbehörde mit allen Instanzen der Straf- und Zivilrechtspflege, mit den Verwaltungsbehörden, mit öffentlichen und privaten Einrichtungen und mit Personen aus dem medizinischen und sozialen Bereich zusammen; sie holt bei ihnen die nötigen Auskünfte ein.«
Art. 31 Abs. 1 Schweizerische Jugendstrafprozessordnung (JStPO)
Bist du sicher, dass du es findest?«, fragte meine Mutter.
Ich verdrehte die Augen.
»Soll ich dir einen Stadtplan ausdrucken?«
»Ich finde es, okay?«, brummte ich und griff nach meinem Rucksack.
»Die Haltestelle heißt …«
»Ich habe gesagt, ich finde es!«
Meine Mutter trat einen Schritt zurück und setzte eine beleidigte Miene auf. Ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um. Mit zackigen Bewegungen räumte sie das Frühstück weg. Ich schnappte mir ein Brötchen und stand auf.
»Dann geh ich mal.«
»Vergiss nicht, dir die Zähne zu putzen.«
Obschon sie mich ständig beobachtete, entging ihr ziemlich viel. Zum Beispiel, dass ich kein Kind mehr war. Fehlte nur noch, dass sie mir einen Pausenapfel einpackte. Dabei klagte sie immer, sie habe zu wenig Zeit. Trotzdem setzte sie sich jeden Morgen zu mir an den Frühstückstisch. Munter kommentierte sie alles, vom Wetter bis zu den Nachrichten, die im Radio liefen. Über den Hosenanzug, den sie zur Arbeit trug, wickelte sie jeweils eine Schürze, damit die Bluse keine Flecken abkriegte, wenn sie mir die Brötchen strich. Damit du dir kein falsches Bild machst: Ich bin nicht behindert. Dass mir meine Mutter Brötchen strich, lag nicht an mir. Sie muss immer alles selbst in die Hand nehmen.
In der S-Bahn versuchte ich, mir die genaue Lage der Schule in Erinnerung zu rufen. Die dreistöckige Villa befand sich in einem Park am Zürichberg. Ich musste in die Stadt fahren und dort ins Tram umsteigen. Den Namen der Haltestelle hatte ich vergessen, doch ich konnte mich an die Weinhandlung gegenüber erinnern.
Ich staunte, wie voll die Züge um diese Zeit waren. Die meisten Pendler starrten vor sich hin oder blätterten in der Gratiszeitung. Als ich ausstieg, strömten die Menschen zur Tramhaltestelle. Ich ließ mich mitziehen. Nur wenige Minuten später fuhr ich den Berg hinauf. Stadteinwärts stauten sich die Fahrzeuge. Ein Mann am Steuer eines BMW bohrte in der Nase. Eine Mutter tadelte ihr Kind, das den Arm aus dem Fenster streckte. Wir kamen an Lebensmittelläden, Blumengeschäften und einer Post vorbei. Ein Sandsteingebäude kam mir bekannt vor. Ich versuchte, das Schild neben dem Eingang zu lesen, doch das Tram war zu schnell. Kennst du das Gefühl, dich an etwas zu erinnern, ohne zu wissen, woran? Da war so ein Brummen in meinem Hirn, als versuchte mein Gedächtnis, an das Bild anzudocken, das meine Netzhaut soeben gespeichert hatte. Die Verbindung kam nicht zustande.
Die Strecke erschien mir viel länger als beim ersten Mal. Ich hatte am Bahnhof noch einen Energydrink kaufen wollen, es aber vergessen. Als ich die Häuserzeile betrachtete, die vor dem Fenster vorbeizog, stellte ich fest, dass sich kaum mehr Geschäfte in den Gebäuden befanden, sondern fast ausschließlich Wohnungen. Hatte ich die Haltestelle verpasst? Die Weinhandlung war mir nicht aufgefallen.
Plötzlich machte das Tram einen weiten Bogen, stoppte, und die Türen sprangen auf. Endstation. Der Tramführer stieg aus und zündete sich eine Zigarette an. Ich fluchte und holte mein iPhone hervor. Die Internet-Verbindung war schlecht. Bis ich die Homepage der Schule gefunden hatte, fuhren wir bereits wieder den Berg hinunter. Unter dem Stichwort »Lage« fand ich den Namen der Tramhaltestelle. Sie befand sich ziemlich weit von der Endstation entfernt. Als wir dort ankamen, stellte sich heraus, dass man die Weinhandlung vom Tram aus gar nicht sehen konnte.
Die Schulsekretärin blickte mich mit zusammengepressten Lippen und hochgezogenen Augenbrauen an, als ich um halb neun in ihr Zimmer trat. Dazu seufzte sie tief. Kurz erwog ich, ihr eine Lügengeschichte – ein Unfall oder was Ähnliches – aufzutischen, doch ich sparte mir die Mühe. Die Sekretärin führte mich zum Klassenzimmer und setzte ein gezwungenes Lächeln auf, als die Lehrerin zur Tür kam. Damals wusste ich noch nicht, dass die »Futura« um jeden Schüler froh war. Die Schule brauchte das Geld. Meine Eltern ließen sich meinen Niveau-A-Abschluss offenbar einiges kosten. Das hatte Vorteile, wie sich noch herausstellen sollte. Zum Beispiel war es echt schwierig, von der Schule zu fliegen. Ich weiß nicht, ob ich das System so schnell durchschaut hätte. Aber dazu hatte ich Mike.
Er saß in der hintersten Reihe. Ich nahm ihn zuerst nicht wahr, weil ich meine Aufmerksamkeit auf die Lehrerin richtete. Ich glaube nicht, dass sie besonders schön war. Ich kann es aber schlecht beurteilen, denn ich schaute ihr nicht ins Gesicht. Mein Blick blieb unterhalb ihres Halses hängen.
Sie trug keinen Büstenhalter!
Hätte sie wie meine Mutter gestärkte Blusen bevorzugt, wäre mir das kaum aufgefallen. Doch Denise Kalbermatten stand nicht auf Blusen, sondern auf Schlabberklamotten. Weiche, dünne, geschmeidige Kleider, die sich auf jede Kurve legten. Was hätte ich darum gegeben, mit dem Stoff den Platz zu tauschen!
»Sebastian«, begrüßte sie mich. »Willkommen an der ›Futura‹. Wir freuen uns, Sie in der Klasse zu haben.«
Dass sie mich siezte, fand ich schräg. Doch beim Eintrittsgespräch hatte der Schulleiter erklärt, gegenseitiger Respekt sei einer der Grundwerte der Schule. Es gab noch weitere, ich habe sie aber vergessen. Ehrlich gesagt, waren mir die Werte egal. Neben dem Anblick von Denise Kalbermatten verblasste alles. Ich fragte mich, ob sie Sport unterrichtete, und malte mir aus, wie ihre Brüste beim Rennen auf und ab hüpften. Mir wurde schwindlig.
Als es mir gelang, meinen Blick von Denise Kalbermattens Kurven loszureißen, bemerkte ich Mike. Er beobachtete mich mit einem schiefen Grinsen. Eine Haarsträhne fiel ihm über das rechte Auge, so dass er den Kopf leicht schräg halten musste, um etwas zu sehen. Mit einer lockeren Bewegung schob er sie zur Seite. Unterhalb seines Wangenknochens sah ich eine dünne Narbe. Sie verlieh ihm etwas Verwegenes, das nicht zu seinem weichen Kinn passte. Als hätte ein Meerschweinchen Hauer oder ein Goldfisch Krallen.
Mir wurde der Platz neben ihm in der hintersten Reihe zugewiesen. Das hatte den Nachteil, dass Denise Kalbermattens Kurven ziemlich weit weg waren, dafür sah sie aber den Zettel nicht, den mir Mike zuschob, nachdem die Vorstellungsrunde zu Ende war.
»Dreh die Heizung runter«, stand darauf.
Ich schaute mich um. Direkt neben mir war ein Radiator an der Wand befestigt. Schwitzte Mike? Warm war es im Zimmer nicht, was vermutlich an den vorsintflutlichen Fenstern lag. Die Villa war uralt, von Doppelverglasung hatte man beim Bauen wohl noch nichts gehört. Da mich Mike drängte, drehte ich ein wenig am Ventil. Er bedeutete mir, die Heizung ganz auszuschalten. Mit einem Schulterzucken machte ich, was er verlangte. Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis ich begriff, was er vorhatte.
»Es ist schon wieder so kalt«, beschwerte sich Denise Kalbermatten mit einem Frösteln. »Was ist bloß mit dieser Heizung los?«
Sie durchquerte den Raum, um den Radiator zu berühren. Als sie neben mir stand, blieb mir mit einem Schlag die Luft weg. Hast du dich schon mal ahnungslos in einen Psychothriller hineingezappt? Die Hauptdarstellerin steht entspannt am Herd, du beobachtest, wie sie in einem Topf Spaghetti rührt, merkst, dass du Hunger hast. Du fragst dich, ob sie jetzt den Reibkäse aus dem Kühlschrank holen oder die Flasche Wein auf der Ablage öffnen wird, siehst Kinderzeichnungen an der Wand. Die Szene ist friedlich, du entspannst dich. Plötzlich schwillt die Musik an. Bevor du dich auf den Stimmungswechsel einstellen kannst, platzt ein blutüberströmter Zombie in die Küche. Weil du überhaupt nicht damit gerechnet hast – es hätte auch ein langweiliger Familienfilm sein können –, erschrickst du zu Tode. Adrenalin schießt durch deinen Körper, das Blut verlässt deinen Kopf, du kannst nicht mehr denken. Wie gelähmt starrst du auf den Bildschirm.
Genau so ging es mir. Nur dass kein Zombie vor mir stand, sondern Denise Kalbermatten. Und was ich sah, war das pure Gegenteil eines Horrorfilms. Ihre Brüste schaukelten sachte, als sie sich zum Radiator hinunterbeugte. Unter dem Stoff hatten sich ihre Brustwarzen vor Kälte aufgerichtet wie die Spitzen zweier Eisberge. Mir wurde heiß, dann kalt, dann wieder heiß. Ich wusste, dass ich atmen sollte, konnte mich aber nicht daran erinnern, wie das ging.
Alles an Mikes Plan war perfekt – bis auf das Timing. Das ganze Spektakel dauerte nur wenige Sekunden, denn die Pausenglocke läutete. Denise Kalbermatten verließ das Zimmer, um den Hauswart zu suchen.
Ich stieß die angehaltene Luft aus und ließ mich gegen die Stuhllehne fallen. Mike erhob sich träge und machte eine Kopfbewegung Richtung Fenster. Ich folgte ihm nach draußen. Hinter einer großen Eiche holte er ein Päckchen Zigaretten hervor. Eigentlich rauchte ich nicht, aber mein Herz wummerte noch immer wie ein Presslufthammer. Die ersten Züge brannten im Hals, dann breitete sich eine angenehme Mattigkeit in mir aus.
Während der Strafuntersuchung hat eine Sozialarbeiterin mein Umfeld abgeklärt. Im Mittelpunkt stand meine Familie. Die Sozialarbeiterin wollte aber auch wissen, ob ich Freunde hätte, die mir viel bedeuteten. Ich weiß nicht, ob ich Mike heute als Freund bezeichnen würde. Unter einem Freund stelle ich mir jemanden wie Blitz vor. Mike war gerne mit mir zusammen, aber nur, weil er mich brauchte. Alles, was er tat, war Show. Er war wie ein Schauspieler auf der Bühne, klar, dass er Zuschauer benötigte, sonst wäre der Auftritt für ihn öde gewesen. Etwa so, als würdest du auf ein leeres Tor schießen oder auf eine Prüfung lernen, die nicht bewertet wird.
Das hat mir Dr. Wagner erklärt. Keine Ahnung, ob ich irgendwann selbst darauf gekommen wäre. Vielleicht stimmt es auch nicht. An der Tatsache, dass wir viel Zeit zusammen verbrachten, ändert es nichts. Ob mich Mike mochte oder nicht, war mir eigentlich egal. Ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Okay, das stimmt vielleicht nicht ganz. Dr. Wagner würde jetzt wieder behaupten, ich würde mir etwas vormachen, weil ich die Wahrheit nicht ertrage. Die wäre, dass ich außer Mike niemanden hatte, mit dem ich abhängen konnte. Dr. Wagner nennt das einen Abwehrmechanismus. Er behauptet, ich würde die Realität verleugnen, wenn sie schmerzhaft sei. Ich weiß nicht. Ich hätte bestimmt andere Freunde finden können. Es gab schließlich jede Menge Schüler an der »Futura«. Aber keiner hatte Style wie Mike Tinner.
Er wohnte in der Stadt, in einer modernen Siedlung, die trotz der fast hundert Mieter wie ausgestorben wirkte. Ich sah dort nie jemanden, nicht einmal Mikes Mutter. Er lebte alleine mit ihr, sein Vater war irgendwann abgehauen. Vielleicht hatte er sich auch den Kopf rasiert und sich eine Freundin zugelegt.
Mich kümmerte das nicht. Viel wichtiger war, dass wir die Bude für uns hatten. Ich meine, richtig für uns, auch am Abend. Manchmal blieb Mikes Mutter mehrere Tage weg. Das habe ich meinen Eltern nie erzählt. Sie freuten sich über meine Freundschaft mit Mike, schließlich war er ein sozialer Kontakt. Damals haben sie sich noch keine Gedanken darüber gemacht, dass es auch schlechte soziale Kontakte gibt. Nicht dass etwas an Mike falsch gewesen wäre. Er war völlig in Ordnung. Später behauptete meine Mutter dennoch, er habe einen schlechten Einfluss auf mich gehabt.
Von Mike habe ich viel gelernt. Zum Beispiel kochen. Wenn seine Mutter verreiste, hinterließ sie ihm Geld, damit er auswärts essen konnte. Bald merkte Mike, dass eine Mahlzeit in einem Restaurant dreimal so viel kostet wie zu Hause. Er kam auf die Idee, selber zu kochen. Nicht um Geld zu sparen, sondern um sein Taschengeld aufzubessern. Wenn er fürs Essen weniger ausgab, hatte er mehr Kohle für anderes.
Das Erste, was er mir beibrachte, war Pizza à la Mike. Im Supermarkt erklärte er mir das Grundprinzip: Zuerst kam der Teig, und zwar der größte, der im Kühlfach lag. Anschließend folgte die Sauce. Vor dem Regal mit Tomatensaucen blieb er stehen und zeigte auf die Auswahl. Wir entschieden uns für Bolognese.
»Und jetzt wird es spannend«, meinte er grinsend. »Was magst du auf deiner Pizza?«
»Käse?«, schlug ich zögernd vor.
»Komm schon, Mann, ein bisschen mehr Fantasie!«
»Schinken?«