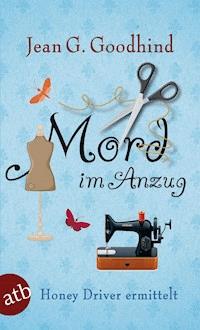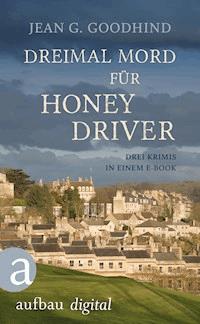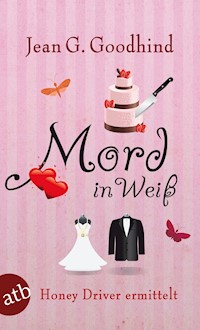
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Honey Driver ermittelt
- Sprache: Deutsch
Bis das der Tod euch scheidet!
Honey Driver und Chief Inspector Steve Doherty stecken mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen. Als sie sich eine kleine, romantische Dorfkirche ansehen, in der sie den Bund fürs Leben schließen wollen, stoßen sie auf die Leiche einer Frau. Mrs. Flynn, eine recht unbeliebte alte Dame, wurde erschlagen. Als wäre dies nicht schon makaber genug, trägt die Tote auch noch ein Hochzeitskleid. Wer steckt hinter dieser Tat? Die Einwohner des Dorfes benehmen sich äußerst merkwürdig, und bald scheint es, als hätte fast jeder ein handfestes Motiv ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jean G. Goodhind
Mord in Weiß
Honey Driver ermittelt
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ulrike Seeberger
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 24
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Über Jean G. Goodhind
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Prolog
Die Braut trug eine Goldrandbrille, hinter der dunkle Augen hervorblitzten. Das schimmernde schwarze Haar ging ihr bis zur Taille.
Zu ihrem blassrosa Outfit hatte sie blaue Wildlederschuhe und eine Handtasche kombiniert, die genug Platz für einen Laib Brot, einen Beutel Kartoffeln und ein Pfund Butter geboten hätte.
Den Hut hatte sie sich kess schräg aufgesetzt, so dass die breite Krempe ihr Gesicht überschattete. Auf den ersten Blick schien das nur eine Modefrage zu sein. Hätte man sich jedoch die Mühe gemacht, die Krempe ein wenig zu lüften und genauer hinzuschauen, so hätte man ein großes bananenförmiges Feuermal gesehen, das längs über ihre ganze Wange verlief.
Der Bräutigam war sehr groß und dünn, seine Haut so braun und glänzend wie eine Kastanie. Er trug eine graue Hose und ein dunkles Sakko, dessen Schultern mit Schuppen gepudert waren. Die Hosenbeine reichten ihm kaum bis zu den Knöcheln, und die Schuhe passten farblich nicht zu seinem Outfit. Der Mann sah genauso aus, wie man sich einen nervösen Bräutigam vorstellt: Er trat unruhig von einem Bein aufs andere, sein Gesicht glänzte vor Schweiß, und das dichte schwarze Haar schimmerte und war mit Gel an den Kopf geklatscht. Jeder halbwegs aufmerksame Beobachter wusste gleich, dass die beiden nicht gerade ein Traumpaar waren.
Die Standesbeamtin, eine Dame mit Brille, hatte die Art von Bluse an, die früher Margaret Thatcher bevorzugt hatte, sogar in derselben Farbe: in konservativem Blau mit einer großen Schleife am Hals.
Vor ihr waren schon alle möglichen und unmöglichen Paare erschienen, um die Ehe miteinander zu schließen. Trotzdem wunderte sie sich immer wieder, was für merkwürdige Kombinationen da zusammenfanden. Diese beiden zum Beispiel. Bei denen hatte sie Zweifel, ob es sich überhaupt um ein echtes Paar handelte. Aber es war ja nicht ihre Aufgabe, hier bohrende Fragen zu stellen. Die beiden hatten alle nötigen Papiere beigebracht und die richtigen Formulare ausgefüllt. Der Rest ging die Beamtin nichts an.
Sie sprach die Worte der gesetzlich vorgeschriebenen Trauformel langsam und mit monotoner Stimme, und ihr Blick wanderte von der selbstbewussten Braut zum nervösen Bräutigam.
»Sprechen Sie mir bitte nach«, sagte sie. Ihr ernster Blick wich nicht, und sie artikulierte sorgfältig, als redete sie mit Kindern an deren erstem Schultag.
Trotz ihrer perfekten Aussprache fiel es dem Bräutigam offensichtlich schwer, die Worte zu wiederholen. Sie vermutete, es lag daran, dass Englisch nicht seine Muttersprache war. Die Braut hakte sich fester bei ihm ein, als könnte sie ihm damit Mut machen oder ihn zumindest daran hindern, es sich anders zu überlegen und doch noch wegzulaufen. Nervös genug sah er aus.
»Komm schon, Schätzchen. Du schaffst das«, drängte sie ihn und stieß ihm den Ellbogen in die Rippen, während ihr verkniffenes Lächeln eine Mischung aus Wärme und Warnung ausstrahlte und ihre Stimme so klebrig war wie Sirup.
Diese Worte ermutigten ihn zumindest dazu, ihr ins Gesicht zu schauen, obwohl sein Blick eher von Furcht als von Liebe zu zeugen schien. Nun noch die letzte Formel.
»Ja, ich will.«
»Ja, ich will.«
»Sie können die Braut jetzt küssen.«
Es war ein flüchtiger Kuss. Der Bräutigam wirkte erleichtert, dass er die Zeremonie – und vielleicht auch den Kuss – hinter sich gebracht hatte.
Schließlich waren die Urkunden unterschrieben, vom Brautpaar und von den beiden Trauzeugen, einer dicken Frau in einem grellroten Mantel, der für das gegenwärtige sonnige Wetter viel zu warm aussah, und einem dünnen schwarzen Mann in zerrissenen Jeans und Bomberjacke. Die dicke Frau hielt eine schwarze Handtasche vor den Bauch gepresst. Der schwarze Mann sah aus, als langweilte ihn die ganze Veranstaltung tödlich. Er schaute auch immer über die Schulter zur Tür, als erwartete er, dass jeden Augenblick jemand hereinkommen könnte.
Sobald sie draußen waren, machte der Bräutigam eine ruckartige Kopfbewegung und richtete ein paar Worte an ein dünnes, etwa dreizehnjähriges Mädchen, das ein schwarzes Kopftuch umgebunden hatte. Das Mädchen warf einen flehenden Blick zu den Frauen, seine Antwort verstanden die beiden jedoch nicht. Der »Bräutigam« packte das Mädchen an der Schulter und schüttelte es. Er sagte etwas in drohendem Tonfall, aber die beiden Frauen, die ihm einen britischen Pass verschafft hatten, konnten es nicht verstehen.
Hätten sie genauer hingeschaut oder hätte es sie auch nur im Geringsten interessiert, so hätten sie die Furcht im Gesicht des Mädchens wahrgenommen. Doch nun folgten der ausländische Bräutigam und seine »Braut« der dicken Frau zu einer Eckkneipe, und das Mädchen mit dem Kopftuch trottete hinterher. Der Mann wies das Mädchen in barschem Ton an, draußen zu warten, während die anderen hineingingen.
»Ich nehme einen Brandy mit Babycham«, sagte die rote Frau ohne jedes Zögern. Die Braut schlängelte sich zur Bar durch, wo sie das Getränk für die Frau und ein Glas Weißwein für sich bestellte.
In der Zwischenzeit zückte der Bräutigam die Brieftasche und blätterte fünfhundert Pfund auf den Tisch, den noch ausstehenden Restbetrag für die Eheschließung und das Recht auf einen britischen Pass.
Der Trauzeuge war gleich gegangen, nachdem er sein Honorar für seine Anwesenheit und Unterschrift eingesackt hatte. Wie schon Dutzende Male zuvor.
Nachdem das Geld überreicht, gezählt und die Anzahl der Scheine für korrekt befunden war, verschwand auch der Bräutigam ohne einen Blick zurück auf die »Braut« oder ein Wort des Dankes an die Frau, die alles in die Wege geleitet hatte.
»So«, sagte die Braut, sobald sie die Drinks und zwei Tütchen gesalzene Erdnüsse zum Tisch gebracht hatte. »Wer ist der Nächste?«
Die Frau im roten Mantel kippte ihren Drink in einem Zug herunter und leckte sich mit ihrer langen rosa Zunge ein paar Tröpfchen von den üppigen Lippen. Die Erdnüsse rührte sie nicht an.
»Es gibt keinen Nächsten. Ich ziehe mich aus dem Geschäft zurück. Aber ich habe nichts dagegen, wenn du es übernehmen möchtest.«
»Was sagst du da? Ich bin das Geschäft.« Die jüngere Frau presste mit dramatischer Geste die Hände an die Brust, als müsste sie ihr Herz festhalten. Ihre Augen strahlten, und das Feuermal auf ihrer Wange war, wenn möglich, noch intensiver rot geworden.
Die Frau im roten Mantel blieb eisern, senkte das Kinn auf die Brust und schaut die junge Frau von oben herab an. »Wer sagt das? Du?«
»Ich bin die Braut.«
»Ja, aber nicht das Hirn.«
Das fand die Braut gar nicht komisch. »Pass bloß auf. Ich sehe gut aus, und ich habe eigene Pläne. Ich denke, ich kann mehr erreichen als immer nur diese Scheinehen gegen Bezahlung zu schließen. Ich habe durchaus andere Möglichkeiten.«
Die dicke Frau zog die gemalten Augenbrauen in die Höhe. »Denkst du etwa an eine echte Heirat?«
»Nein, ich will in der Heiratsszene mein eigenes Geschäft aufbauen.«
»Ich will gar nicht wissen, wie. Das ist deine Sache, aber wenn du mein Geschäft übernehmen willst, dann tu’s. Es wird Zeit, dass ich meine Enkelkinder so richtig verwöhne. Das wird den Partner meiner Tochter richtig ärgern – was mir herzlich egal ist. Der ist ohnehin ein Mistkerl. Bist du wirklich entschlossen, es allein zu versuchen?«
»Wild entschlossen.«
»Dann viel Glück. Ich muss jetzt zum Zug.«
Die Frau im roten Mantel holte am Tresen noch einen Weißwein für ihre Komplizin, ehe sie ging, und meinte, sie überließe ihr gern die Erdnüsse.
»Moment mal, und was ist mit meinem Bonus, meinem Gewinnanteil? Du hast gesagt, am Ende des Jahres bekäme ich fünfundzwanzig Prozent aller Einnahmen plus einen Anteil vom Angesparten. Das haben wir doch noch, oder?«
»Vertraust du mir etwa nicht?«
»Ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Ich habe dir ja gesagt, dass ich mit Geld nicht so gut umgehen kann. Ich freue mich drauf, es auszugeben – und nicht wieder für ein verdammtes Brautkleid! Von denen habe ich echt die Nase voll.«
»Das Geld ist sicher angelegt, und du kriegst, was dir zusteht«, sagte die Frau in Rot und stützte sich mit ihrer molligen Hand auf dem Tisch ab, um leichter auf die Füße zu kommen. »Ich muss bloß noch eben auf die Toilette, ehe wir zur Bank gehen. Es liegt alles sicher auf dem Konto. Wir müssen es nur abheben. Einfacher geht’s nicht.«
Die Braut seufzte vor Wonne, machte beide Erdnusstütchen auf und begann zwischen Schlucken aus dem Weißweinglas die Nüsse zu futtern.
Fünfzehn Minuten vergingen. Ihre »Geschäftspartnerin« war immer noch nicht wieder aufgetaucht. Langsam machte sich ein ungutes Gefühl in ihr breit. Sie war inzwischen mit dem Wein und den Nüssen fertig, aber ihre Komplizin war noch nicht zurück.
Ihre Augen wanderten zum anderen Ende der Bar und suchten nach dem Schild, das zu den Toiletten wies. Schließlich sah sie es hinter all den Tischen und Stühlen über einer Tür rechts vom Dartbrett.
Daneben war das grüne Schild für den Notausgang angebracht.
Da begriff die Frau, die an die zwanzig Mal die Braut gespielt hatte, plötzlich, dass man sie hereingelegt hatte. Sie sprang auf und raste dahin, wo die Frau in Rot verschwunden war.
Die Damentoilette, ein Raum mit widerlich parfümierter Luft und Musikberieselung aus der Bar, war leer. Alle Kabinentüren standen offen. Hier konnte sich niemand verstecken.
In ihrer Verzweiflung rammte die Frau mit dem Feuermal den Kopf an eine Türzarge. Sie kannte ihre Geschäftspartnerin nur als Mrs Fitz. Sie hatten immer sorgfältig darauf geachtet, keine Spuren zu hinterlassen, Mrs Fitz, das begriff sie nun, hatte daran noch weit mehr Interesse gehabt als sie selbst. Sie hatte zwar eine Handynummer, aber noch ehe sie dort anrief, wusste sie, dass der Anschluss abgemeldet sein würde.
Ihr Geld für heute hatte sie bekommen, aber die Tausende von Pfund, die ihr als Bonus noch zustanden, würde sie nie sehen. Sie hatten vereinbart, bei Geschäftsaufgabe das auf der Bank angesparte Geld untereinander aufzuteilen. Dieser Bonus war futsch.
»Ich bring sie um, die verdammte Kuh!«, schwor sie sich. »Verdammt, ich bring sie um!«
Kapitel 1
Eine Melodie vor sich hin pfeifend, die nur ein sehr geübtes Ohr als den Hochzeitsmarsch erkannt hätte, setzte sich Chief Detective Inspector Steve Doherty an seinen Schreibtisch und schlüpfte so aus der Lederjacke, dass die dann umgestülpt über der Rückenlehne seines Stuhls hing, ohne dass er sie noch mal anfassen musste.
Wie immer schaute er zuerst seine E-Mails durch, ehe er sich den Papieren auf dem Schreibtisch zuwandte. Es waren nicht sehr viele. Nicht so viele wie früher. Mit einem dankbaren Seufzer überlegte er, dass zum Glück heutzutage die elektronische Post dafür sorgte, dass der Papierberg, der auf seinem Schreibtisch landete, ein wenig niedriger war. Besser noch: man konnte flunkern und behaupten, eine E-Mail nie bekommen zu haben, ohne dass jemand Einwände dagegen vorbrachte. Die meisten seiner Kollegen waren etwa so alt wie er, einige älter. Genau wie er hatten sie IT-Fortbildungen mitgemacht, waren aber nie sicher, ob sie wirklich auf die richtige Taste getippt hatten, und hatten überhaupt keine Ahnung, was mit einem Computer möglich war und was nicht.
Zwischen dem üblichen Papierkram lagen drei verschlossene Umschläge. Einer enthielt die Bestätigung, dass eine E-Mail verschickt und im Intranet der Polizei zugestellt worden war. Da wollte jemand gar kein Risiko eingehen, Entschuldigungen über im Cyberspace verlorengegangene Mails aufgetischt zu bekommen. Dohertys Augen wanderten nach oben. Er schaute durch die gläserne Trennwand zwischen seinem Zimmer und dem allgemeinen Büro, wo auf Hochtouren gearbeitet wurde: Augen waren auf Monitore gerichtet, Gestalten in Uniform gingen von einem Schreibtisch zum anderen, zur Kaffeemaschine und wieder an ihren Platz zurück.
Er erblickte die Absenderin. Ms Mackenzie war eine Einheit mit ihrem Computer, sie hatte den Kopf über die Tastatur gesenkt, und das flackernde Licht des Monitors beleuchtete ihren blassen Teint. Sie war eine schlaue Polizistin und wild entschlossen, allen zu zeigen, dass sie ein paar Klassen besser war als ihre männlichen Kollegen und keine Angst hatte, sich die Finger schmutzig zu machen, wenn sie es auf die Art ganz nach oben schaffte.
»Da sei Gott vor«, murmelte Doherty. Sie würde sofort die gesamte Polizei mit elektronischen Fußfesseln ausstatten, wenn es nach ihr ginge.
Der zweite Umschlag, den er aufschlitzte, war von einer Frau, die sich darüber beklagte, dass man ihr Porno-Bilder mit der Post geschickt hatte. Sie hatte sich bereits per E-Mail beschwert.
»ICH WILL TATEN!«
Er bemerkte die Großbuchstaben. Er wusste, was das zu bedeuten hatte. Sie brüllte ihn sozusagen per Post an.
Auf dem dritten Umschlag stand »Privat und vertraulich«. Es war ein richtiger Brief in einem mit der Royal Mail verschickten frankierten Umschlag, auf die gute alte Weise zugestellt.
Ihm fiel auf, dass die Oberkante des Papiers nicht gerade war. Keine große Sache. Wohl ein Blatt Papier, das jemand von einem Block abgerissen hatte, wie man ihn in jedem Schreibwarenladen bekam. Die Handschrift war elegant, mit Schnörkeln und extravaganten Unterlängen. Die Nachricht war es nicht.
Doherty las sie noch einmal.
Heirate diese überreife Schlampe, und du stirbst!
Natürlich stand keine Unterschrift drunter.
»Wer zum Teufel …?«
Er rieb sich mit dem Finger über eine hochgezogene Augenbraue. Die Stirn blieb gerunzelt. Drohbriefe zu bekommen, das gehörte zu seinem Berufsalltag; niemand mochte Polizisten besonders, außer vielleicht geduldigen und liebenden Ehefrauen oder Hunden. Die Treue eines Hundes hielt ein Leben lang. Ehefrauen, na ja, er hatte viele Ehen in die Brüche gehen sehen, einschließlich seiner eigenen. Aber damals war er jung gewesen. Der Plan, Honey Driver zu heiraten, stand auf einem festeren Fundament. Er war jetzt älter. Sie waren beide älter.
Jemand hatte also was dagegen, dass er Honey heiratete? Es wussten nur relativ wenige Leute, dass sie so was Ähnliches wie verlobt waren; natürlich nicht offiziell. Ihm war einfach spontan die Idee gekommen, und er hatte sie gefragt. Sie hatten lange miteinander geredet und beschlossen, ernsthaft darüber nachzudenken. Ernsthaft, das hieß, dass sie überlegten, wo die Trauung und die Party stattfinden sollten und ob sie in die Flitterwochen fahren würden.
Warum sollte jemand etwas gegen diese Heirat haben? Seine Exfrau bestimmt nicht. Bei der Trennung waren sie beide verbittert gewesen, das hatte sich jedoch entschieden verbessert, sobald sie richtig geschieden waren und weit von einander entfernt lebten. Inzwischen rief sie nicht mal mehr bei ihm an. Seine Tochter sah er eigentlich auch nicht sonderlich oft. Die lebte ihr eigenes Leben, brauchte ihren eigenen Raum. Manchmal schickte sie ihm eine SMS, zum Vatertag oder zum Geburtstag.
Da Honeys Exehemann tot war, konnte es auch aus dieser Ecke keine Einwände geben, und ihre Tochter Lindsey war sehr dafür, dass sie endlich heirateten. Bei Honeys Mutter lag der Fall schon ganz anders. Gloria Cross hielt nicht sonderlich viel von Dohertys Referenzen. Schlimm genug, dass er Polizist war, obwohl sie vielleicht umdenken würde, wenn er Polizeipräsident wäre. Weitere Argumente gegen ihn als potenziellen Ehemann waren zum einen, dass er kein Geheimkonto bei einer Schweizer Bank hatte, und zum anderen, dass er sich nicht gern rasierte. Gloria Cross stand einfach nicht auf Dreitagebärte. Honey dagegen liebte seine borstigen Stoppeln.
Er strich sich mit der Hand übers Kinn, hörte das raue Rascheln und musste lächeln. Wenn er daran dachte, dass er sich zunächst gar nicht mit ihr hatte treffen wollen … Der Chief Constable hatte Steve Doherty als Honeys Kontaktmann bei der Polizei ausgesucht, als sie gerade ihre Aufgabe als Verbindungsperson des Hotelfachverbands von Bath zur Kripo übernommen hatte. Er war gewieft und beinhart und sah mit und ohne seine Klamotten blendend aus. Er bevorzugte lässige Kleidung: Jeans (teure), schwarzes T-Shirt, schwarze Lederjacke, Schuhe mit weichen Sohlen, auf denen man sich rasch bewegen konnte, wenn es darum ging, einen Verbrecher zu stellen.
Seine Augen waren kobaltblau und wurden noch eine Schattierung dunkler, wenn die Angelegenheit ernst wurde. Sie wurden auch dunkler, wenn er an Honey dachte, geheime Gedanken, die er nur ihr gegenüber aussprechen würde. Sie fuhr ihm gern mit den Fingern durchs Haar, besonders im Nacken. Er zog sich auch bei der Arbeit lässig an und ging nirgends ohne seine Lieblingslederjacke hin, die schon einige Jahre alt war, aber hervorragend zu seinem Körperbau und seinem lässigen Stil passte.
Ursprünglich war er nicht gerade erfreut darüber gewesen, dass er zu irgendeinem Mitglied des Hotelfachverbands Kontakt halten sollte. Er hatte sich den Vertreter dieser Vereinigung als einen aalglatten Hotelmanager mit politisch korrekten Ideen vorgestellt. Diese Sorgen hätte er sich nicht zu machen brauchen.
Stattdessen war Honey Driver aufgetaucht. Eine Frau in den besten Jahren, mit einer griffigen Figur, das heißt gut gepolstert und kurvenreich, und mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Ehe sie sich kennengelernt hatten, hatte er die Idee abgelehnt und sich am Kinn gekratzt. Er hatte dem Chief Constable sehr deutlich mitgeteilt, was er von dieser Neuerung hielt.
»Ich hab was gegen Amateure«, hatte er verkündet. Nachdem er Honey kennengelernt hatte, hatte er seine Meinung schnell geändert.
Sie war auf angenehme Art sexy, hatte einen wachen Verstand und war ziemlich fit. Und sie sah, genau wie er, mit und ohne Kleidung gut aus.
Sie hatte nichts für winzige Tangas übrig. Sie lebte auch nicht nur von Salat-Sandwiches. Und er wusste, dass sie manchmal sogar figurformende Unterwäsche trug. Dann sah sie in hautengen Kleidern sensationell aus.
Erst hatte er sie kennengelernt, dann hatte er sie lieben gelernt, und dann hatte er mit ihr geschlafen. Und jetzt dachten sie über eine Heirat nach. Sie hatten beide ihre Vorgeschichten, Töchter etwa im gleichen Alter. Die letzte Neuigkeit von seiner Tochter war, dass sie mit dem Rucksack durch Europa reiste.
Er hatte sich nie auch nur im Traum vorgestellt, dass es mit der Heirat Probleme geben könnte – bis heute.
Im Augenblick war er eher verärgert als neugierig, faltete das Blatt wieder zusammen und dachte nach. Er schnippte mit dem Finger an das Papier.
»Pappt was an den Fingern, Chef?«
Der Sprecher trug den Spitznamen Wizard. Eigentlich hieß er Harold Potter, und bis J. K. Rowling ihren Riesenerfolg hatte, war er für alle nur Harry oder Potter gewesen. Seit man dem Zauberlehrling an allen Bücherständen und im Kino begegnete, hatte Potter den Spitznamen Wizard weg.
Er war einundfünfzig Jahre alt und hatte nicht nur jahrelange Erfahrung mit der Polizeiarbeit auf dem Buckel, sondern auch dank vieler Besuche in der Kantine und der wirklich ausgezeichneten Cornish Pasties einige Pfunde zu viel auf den Rippen und ähnelte eher dem Riesen Hagrid als Harry Potter, aber die Jungs in Blau hatten sich nun mal entschieden. Also war er Wizard.
Wizard wollte sich wahrscheinlich nicht erkundigen, ob Doherty klebrige Süßigkeiten gegessen hatte, sondern vorsichtig anfragen, ob Doherty ihm vielleicht den Inhalt der Nachricht anvertrauen wollte – aus rein freundschaftlicher Neugier natürlich.
Doherty wollte das nicht. Diese Sache ging nur ihn persönlich an.
»Könnte ich vielleicht 'ne Tasse Tee bekommen?«, fragte er fröhlich.
Sicher doch. Bei Wizard kochte eigentlich immer der Wasserkessel, und gleich daneben stand auch eine Dose mit Schokoladenkeksen.
»Immer noch keinen Zucker für Sie?«, fragte Wizard.
»Ich muss an meine Figur denken.«
Wizard reagierte auf diese knappe Antwort mit einem Lächeln.
»Ich kann mir gar nicht vorstellen, für wen Sie sich so kasteien«, fügte er hinzu, als er sich seitlich durch die Tür quetschte und dabei kaum zwanzig Zentimeter Luft blieben.
Als Doherty wieder allein war, musterte er den Umschlag, in dem der Brief gekommen war, noch einmal genauer. Der Poststempel war ganz schwach zu lesen: Edinburgh. Er spitzte die Lippen. In Edinburgh war er noch nie gewesen, und er konnte sich auch nicht erinnern, dass er dort jemanden kannte.
Der schlichte braune Umschlag war unauffällig und billig, wahrscheinlich irgendwo in einem 1-Pfund-Laden in einem ganzen Päckchen gekauft.
Er war an ihn persönlich adressiert und ging nur ihn was an – ihn und natürlich Honey –, also würde er ihn nicht ins Eingangsbuch einschreiben. Er würde auch niemandem davon erzählen.
Der Umschlag mitsamt dem Brief verschwand in seiner Jackentasche, ehe Wizard mit dem Tee zurückkam.
Doherty bedankte sich für den Tee und die beiden Schokoladenkekse, die auf einer Untertasse mit gelben Punkten lagen. Früher waren es mal vier Schokoladenkekse gewesen, aber inzwischen dachte Wizard erst an sich und dann an alle anderen. Mit dem Leibesumfang war auch sein Appetit gewachsen. Oder war es umgekehrt?
Doherty schaute in seine Teetasse, während er zu dem Schluss kam, dass der Brief ein übler Scherz war. Und doch ärgerte er ihn.
Jemand hatte sich die Mühe gemacht, ihn zu schicken. Er konnte am Umschlag einen DNA-Test vornehmen lassen, aber irgendwie vermutete er, dass dabei nichts rauskommen würde. Wer nicht seit Jahren auf einer einsamen Insel wohnte, die auf keiner Karte verzeichnet war, der wusste einfach, dass sich die DNA zurückverfolgen ließ. Allerdings konnte es sich ohnehin nur um einen Verrückten handeln, der was gegen ihn hatte.
Aber was, wenn es anders war? Wenn der Absender ihn beobachtete oder auf eine Gelegenheit lauerte, nah genug an ihn heranzukommen und seine Drohung wahrzumachen? Oder die Absenderin ihre Drohung?
Er war sich nicht bewusst, dass ihm jemand in letzter Zeit gefolgt war. Honey hatte auch keine Stalker erwähnt, die sich hinter ihr in Ladeneingänge drückten.
Was jetzt? Es saß mit verschränkten Armen da und dachte nach. Die Sache war: Er konnte es nicht über sich bringen, Honey den Brief zu zeigen. Erstens würde sie es bestimmt nicht freuen, dass sie jemand als überreife Schlampe titulierte. Und dann war da die Angst. Er wollte nicht, dass sie sich fürchtete. Er wollte, dass sie lustig und sexy blieb wie immer.
Mach einfach weiter, als wäre nichts geschehen, sagte er sich entschlossen, bis was passiert und du umdenken musst.
Kapitel 2
»Mein Name ist Trevor Templeton. Ich bin zur Hochzeit meiner Enkelin hier.«
Seine Stimme war so dunkel wie seine Haut. Das Haar war kraus, ganz kurz geschnitten und an manchen Stellen schon ein wenig grau. Zum weichen Grau seines Cut trug er eine zartgelbe Weste und ein burgunderrotes Halstuch. Aus den seidigen Falten des Tuchs blitzte eine winzige Diamantnadel in Form eines T, seiner Initiale, hervor. Er hatte einen grauen Zylinder unter den Arm geklemmt.
Honey überlegte, wo sie ihn schon mal gesehen hatte.
Oder gehört? Seine Stimme war so einprägsam wie seine Erscheinung. Er sprach in einer angenehmen Baritonlage und ziemlich leise. Das ist fast wie ein Raunen ganz nah an meinem Ohr, überlegte sie.
Nur mit der Ruhe, Mädel. Du bist vergeben, okay?
Ehe sie auch nur eine Chance hatte, darüber nachzudenken, sprudelten ihr die Worte aus dem Mund: »Sie sind wirklich …«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!