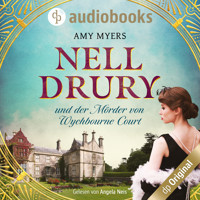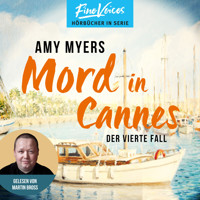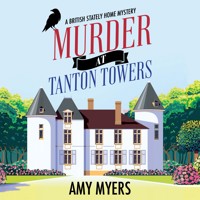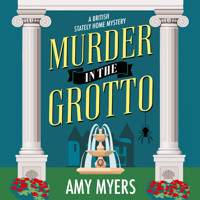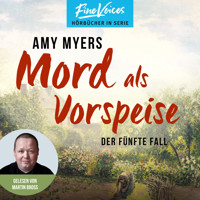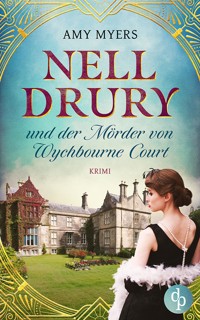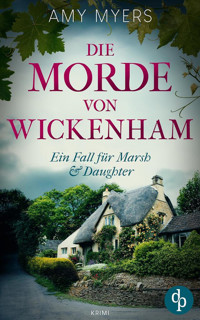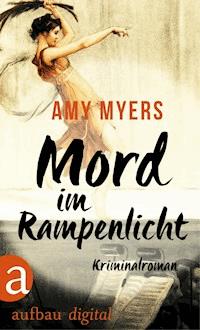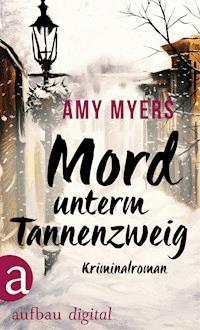
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Didier & Rose ermitteln
- Sprache: Deutsch
Endlich hat Chefkoch Auguste Didier Gelegenheit, sich einen Traum zu erfüllen: Über Weihnachten und Silvester 1900 darf er als Hoteldirektor fungieren. Aber viel Glück hat er in seinem neuen Job offenbar nicht. Seine noble, internationale Gästeschar, die hier die Feiertage verbringt, ist nicht so leicht zufriedenzustellen, und der italienische Koch des vornehmen Hauses erweist sich als Katastrophe. Als Auguste am ersten Weihnachtsfeiertag im Gesellschaftszimmer in einer Truhe auch noch die Leiche eines der Dienstmädchen entdeckt, ist das Chaos fast vollkommen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Amy Myers
Amy Myers wurde 1938 in Kent geboren. Sie studierte an der Reading University englische Literatur, arbeitete als Verlagslektorin und war bis 1988 Direktorin eines Londoner Verlages. Seit 1989 ist sie freischaffende Schriftstellerin. Sie ist mit einem Amerikaner verheiratet und wohnt in Kent. Amy Myers schreibt auch unter dem Namen Harriet Hudson und Laura Daniels.
In ihren ersten Ehejahren arbeitete ihr Mann in Paris, und sie pendelte zwischen London und der französischen Hauptstadt hin und her. Neben vielen anderen Dingen mußte sie nun lernen, sich auf französischen Märkten und den Speisekarten französischer Restaurants zurechtzufinden. Dabei kam ihr die Idee, einen französischen Meisterkoch zum Helden eines klassischen englischen Krimis zu machen: Auguste Didier war geboren. Alle Kriminalromane von Amy Myers erscheinen im Aufbau Taschenbuch Verlag.
Informationen zum Buch
Endlich hat Chefkoch Auguste Didier Gelegenheit, sich einen Traum zu erfüllen: Über Weihnachten und Silvester 1900 darf er als Hoteldirektor fungieren. Aber viel Glück hat er in seinem neuen Job offenbar nicht. Seine noble, internationale Gästeschar, die hier die Feiertage verbringt, ist nicht so leicht zufriedenzustellen, und der italienische Koch des vornehmen Hauses erweist sich als Katastrophe. Als Auguste am ersten Weihnachtsfeiertag im Gesellschaftszimmer in einer Truhe auch noch die Leiche eines der Dienstmädchen entdeckt, ist das Chaos fast vollkommen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Amy Myers
Mord unterm Tannenzweig
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Elga Abramowitz
Inhaltsübersicht
Über Amy Myers
Informationen zum Buch
Newsletter
Anmerkung der Verfasserin
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Epilog
Impressum
Für Natalie in Liebe
Anmerkung der Verfasserin
Dieser Roman spielt um die Jahrhundertwende, und deshalb muß ich erklären, daß das viktorianische England den Beginn des neuen Jahrhunderts am 1. Januar 1901 feierte und nicht 1900, obwohl es darüber Meinungsverschiedenheiten gab.
Um 1900 galt der Portman Square allgemein als einer der schönsten Plätze Londons, doch von seiner einstigen prachtvollen Architektur ist kaum mehr etwas übriggeblieben. Das Hotel Cranton ist reine Erfindung; zur Jahrhundertwende standen dort, wo es im Roman steht, noch die ursprünglichen Adam-Häuser.
Ich danke der Auguste-Escoffier-Stiftung am Musée de l’Art Culinaire in Villeneuve-Loubet für die mir zuteil gewordene Hilfe und meiner literarischen Agentin Dorothy Lumley für ihre fachkundige Betreuung; ich danke Adele Wainwright und allen Abteilungen des Verlages Headline, und ich danke Lionel Leventhal, dem Verleger von Greenhill Books, der mir großzügig Jac Wellers klassisches und lesenswertes Buch »Wellington in Waterloo« schenkte, das er unlängst in seinem Verlag wieder herausgebracht hat.
A. M.
Prolog
Es krallte nach seinem Gesicht. Es nahm ihm den Atem. Keuchend holte er Luft und verschluckte sich, als der Nebel triumphierend an seine Kehle griff. Die feuchte, lastende Decke, die ihn so heimtückisch eingehüllt hatte, entstellte die Wirklichkeit und versuchte seinen Verstand auszuschalten. Eine Londoner Besonderheit, so nannte man das. Besonderheit welcher Art? dachte er aufgebracht. In seinem Kopf drehte sich alles, teils von der Medizin gegen den ständigen Husten, der es offenbar jeden Winter von neuem auf ihn abgesehen hatte, und teils, weil ihm der Nebel jede Orientierung unmöglich machte.
Auguste Didier schluckte; er war schließlich ein praktischer Mensch. Seine französische Logik würde ihm zu Hilfe kommen und die wilden Phantasiegebilde besiegen, die das Erbteil seiner englischen Mutter waren. Er war, überlegte er, noch vor kurzer Zeit in der Albion Street gewesen, also konnte er jetzt kaum weit weg davon sein, auch wenn er sich versehentlich auf den alten St. George-Friedhof verirrt hatte. Hier lag Mrs. Radcliffe begraben, die Verfasserin der »Geheimnisse Udolphos«, eines Romans, an dessen mittelalterliche Schreckensszenen zu denken in diesem Augenblick nicht weise gewesen wäre. Er hatte einige Zeit gebraucht, um den Ausgang zu finden, und die Erleichterung darüber hatte ihn unvorsichtig gemacht – er war um eine Ecke gebogen, aber um welche? Und wo war er jetzt? Seine Logik sagte ihm, daß jeder Sterbliche und jedes intelligente Tier daheim und in Sicherheit war und daß er klug daran täte, so schnell wie möglich ihrem Beispiel zu folgen, doch der Nebel wurde anscheinend immer dichter. Curzon Street und Mayfair waren ihm nie anziehender erschienen als jetzt.
Ich bin ja bereit, Basilikum und Melisse einzunehmen, Katzenminze und Labkraut, ich will Leinsamen und Lakritze schlucken und Monsieur Soyers lait de poule, aber niemals wieder werde ich Armstrongs Schwarze Tropfen gegen meine Erkältung einnehmen, schwor er sich ergrimmt.
Ihm war schwindlig. Sich an einem Laternenpfahl festhaltend, versuchte er noch einmal herauszufinden, wo er war. Connaught Place – das hier war Connaught Place. Natürlich. Erleichterung überkam ihn. Dies war der Platz der Dreibeinigen Mähre, des alten Galgens, an dem so viele Verbrecher öffentlich gehängt worden waren und wo bei Ausschachtungsarbeiten immer noch hin und wieder menschliche Knochen gefunden wurden. Es war noch immer unheimlich hier, selbst in diesem November 1900, an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. In dem dichten Nebel, durch den da und dort das trübe Licht einer Straßenlaterne schimmerte, mußte man unweigerlich an die Mörder denken, die hier gestorben waren. Mord …
Ein Schauder überlief ihn. Seit mehr als einem Jahr hatte er nicht mehr mit einem Mord zu tun gehabt; seine Besuche bei Egbert Rose drehten sich jetzt um anderes als um die Aufgaben von Scotland Yard. Sie beide hatten Zeit gehabt, sich auf die wichtigen Dinge des Lebens zu konzentrieren, das faszinierende Thema der Kochkunst im zwanzigsten Jahrhundert zu erörtern.
Vorsichtig lief er weiter, überquerte mit raschen Schritten Fahrdämme. Hin und wieder näherte sich als riesiges Ungeheuer in der Finsternis eine Kutsche, deren Geräusche vom Nebel verschluckt wurden. Eine tauchte so plötzlich vor ihm auf, daß er rennen mußte. Mühsam wieder Atem schöpfend, stolperte er gegen ein Eisengitter auf der anderen Straßenseite.
Sich an den Stangen festhaltend, arbeitete er sich in Richtung Grosvenor Square vorwärts. Er sollte jetzt wohl nach rechts abbiegen, in die South Audley Street. Aber das ging nicht, und dieses Gitter hatte, wurde ihm plötzlich klar, auch nichts mit den Gittern von Mayfair zu tun. Er versuchte gegen die panische Angst anzukämpfen, die ihn plötzlich erfüllte. Diese Häuser, die da im Nebel über ihm aufragten, waren höher und ähnelten eins dem andern. Er mußte sich noch immer nördlich der Oxford Street befinden, und wieder wußte er nicht, wo.
Er lächelte über diese Ironie des Schicksals. Er, Auguste Didier, geboren in der Sonne der Provence! Was tat er hier, durchnäßt von englischen Nebeln und Regenschauern? Einen Augenblick lang wußte er wirklich nicht, was ihn hier festhielt.
Karamelcrème, erinnerte er sich angestrengt. Quittensauce. Hammelfleisch …
Doch selbst Genüsse wie diese vermochten ihn jetzt nicht zu beruhigen. Er blieb stehen, versuchte sich zu konzentrieren, herauszufinden, wo er sich befand. Wo es Gitter gab, mußte es schließlich auch Stufen geben, die zu einer Tür emporführten.
Er lachte in sich hinein, froh darüber, daß seine detektivischen Fähigkeiten ihn nicht im Stich ließen. Dann kam ihm ein unerfreulicher Gedanke. Konnte man an Nebel sterben?
Meisterkoch auf der Straße tot aufgefunden, nur wenige Meter von seiner Wohnung entfernt! Panik ergriff ihn. Er würde an die nächste Tür klopfen und bitten, daß man ihn einließ. Nein, fordern. Der Hausherr würde den berühmten Auguste Didier willkommen heißen. Sogar Mrs. Marshall, die ihm mit ihrer Kochschule Konkurrenz machte, würde ihm in einer solchen Nacht nicht die Tür weisen. Konkurrenz? Hatte er Konkurrenz gesagt? Unsinn. Man konnte sie beide nicht miteinander vergleichen. Er, Auguste, lehrte in seiner Schule Kochkunst. Mrs. Marshall hingegen …
Er blieb stehen. Jetzt endlich wußte er, wo er sich befand. Er konnte gerade noch den Namen über der Tür erkennen, bevor Nebelschwaden ihn wieder verdeckten. Hotel Cranton. Obwohl es kein Hotel mehr war, denn seine Türen waren seit langem geschlossen; die Räume, die Lord Byron, Robert Browning und Thomas Carlyle gastlich aufgenommen hatten, waren jetzt schäbig und staubig, die berühmte Holztäfelung moderte vor sich hin, seit der letzte Cranton vor Jahren gestorben war. Das Hotel war nur noch eine traurige Erinnerung an vergangene Zeiten. Eines Tages würde auch er ein Hotel besitzen, sagte sich Auguste, ein Hotel, dessen Küche es mit der seines alten Lehrmeisters Auguste Escoffier im Hotel Carlton aufnehmen konnte.
Er zog den Kragen seines Regenmantels fester um den Hals, nachdem ein Nebelschwaden seine feuchte Spur auf Gesicht und Hals hinterlassen hatte. Jetzt wußte er, er stand am Lieferanteneingang an der Rückseite des Hotels, das die Front dem Portman Square zukehrte. Er überlegte, wie viele Lieferanteneingänge er in seinem Leben gesehen hatte. Würde er je das Recht haben, den Vordereingang zu benutzen?
»Hier? Im Cranton? Weihnachten?«
Die Stimme, eine Frauenstimme, heiser und drängend, schien aus dem Nichts zu kommen. Doch in dem Nebel, den die Dunkelheit des späten Nachmittags noch undurchdringlicher machte, konnte er niemand erkennen. Eine undeutliche Antwort. Ebenfalls eine Frau. Sonderbar. Allein hier draußen, und das zu dieser Tageszeit? Die eine Stimme war die einer gebildeten Person, die andere klang rauh und unkultiviert. Die Frauen konnten nur ein paar Meter von ihm entfernt sein. Der Klang ihrer Stimmen wurde durch den Nebel verstärkt und gleichzeitig verzerrt.
Er konnte den beiden seine Begleitung anbieten. Zusammen ging man sicherer.
»Ich komme!« rief er.
Er ließ das Gitter los, das ihm einen sicheren Halt geboten hatte, und rannte dorthin, wo er die beiden Frauen vermutete. In diesem Augenblick durchschnitt ein seltsamer Laut den Nebel, ein Gurgeln, ein ersticktes Röcheln. Dann nichts mehr. Dann wieder ein Gurgeln. Sekundenlang stand er wie angewurzelt da. Jemand brauchte Hilfe. Wohin sich wenden? Was war geschehen? Die Geräusche schienen von allen Seiten gekommen zu sein, und ihm war, als gehe jemand dicht an ihm vorüber. Und dann gab es wieder nichts als wabernde, alles umhüllende Nebelschwaden.
Er lief blind ein paar Meter weiter, stolperte und fiel hin. Mühsam erhob er sich und hinkte noch ein Stück vorwärts. Der Nebel und die Furcht hielten ihn in ihren Fängen; um ihn war nichts als dunkles Grau. Aber nun sickerte eine andere Farbe in das Grau ein.
Rot. Rotes Blut floß über das Pflaster, und vor ihm lag in gekrümmter Haltung eine Frau – nein, ein Mädchen.
Er kniete nieder und drehte ihren Körper ein wenig, bis blicklose Augen ihm die Antwort auf seine angstvolle stumme Frage gaben. Er brauchte nicht mehr nach dem Puls zu fühlen. Sie war tot. Langsam stand er auf und sah, wie sich eine Blutspur zur Fahrbahn hinzog, indes der Nebel sich wieder um ihn schloß.
1. Kapitel
Von widerstreitenden Empfindungen hin und her gerissen, zögerte Auguste an der Tür zur Küche. Wie hatte er bloß etwas so Wichtiges wie die Zubereitung der Entenfüllung einem neuen unerprobten Küchenchef anvertrauen können? Doch wie konnte er andererseits dessen Tätigkeit überwachen, ohne dem Mann die schwerste Kränkung zuzufügen, die zwischen Küchenchef und Küchenchef denkbar war – nämlich mangelndes Vertrauen erkennen zu lassen? Vielleicht ließ sich in diesem Fall ein plausibler Grund dafür anführen: er kannte Signor Fancellis Arbeit nicht …
Nein. Zögernd ließ seine Hand den Türknauf los, weil er sich ins Gedächtnis zurückrief, daß er sowohl maître d’hôtel als auch Gastgeber war. Und ein Gastgeber, sagte er sich reuig, mischte sich nicht in die Einzelheiten des Kochens ein, wie groß die Versuchung auch immer sein mochte. Ein Auge auf die Küche und die Tafel zu haben, das war alles, was verlangt wurde. Er hatte sich lediglich vorbehalten, letzte Hand an den Wildschweinkopf zu legen und beim Weihnachts-Galadiner die feierliche Prozession anzuführen, mit der der Kopf hereingetragen wurde. Das verdiente er schließlich, sagte sich Auguste trotzig, denn welchen Sinn hatte es, Gastgeber zu sein, wenn andere Leute all die aufregenden und Spaß machenden Pflichten übernahmen?
Die Küchentür wurde von innen mit Schwung geöffnet, und Auguste errötete bei dem Gedanken, man könnte meinen, er drücke sich an der Tür herum. Aber Antonio Fancelli schien es gar nicht zu bemerken.
»Monsieur Didier, der Pudding«, sagte er vorwurfsvoll. »Sie wollten ihn rühren. Sie sind nicht gekommen.«
»Ah.« Auguste schwoll die Brust. Das Rühren war nur ein Vorwand, um sich zu vergewissern, daß man dem Pudding auch die nötige Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Vor ein paar Jahren hatte er, Auguste, zusammen mit Maisie den Weihnachtspudding gerührt – ein Ritual zu Ehren der Heiligen Drei Könige, das die Engländer hochhielten. Liebe Maisie. Er lächelte ein wenig schmerzlich. Wie hätte er ihre Bitte ablehnen können? Und schließlich war es ja absolut nicht sicher, ob das Cranton wirklich zum Schauplatz eines schurkischen Verbrechens geworden war. Er vermied es geflissentlich, an Mord zu denken. Von Morden hatte er weiß Gott genug …
Niemand hatte ihm glauben wollen. Nicht einmal Inspektor Egbert Rose von Scotland Yard.
»Aber da lag eine Leiche«, hatte Auguste immer wieder geschrien, und immer wieder hatte er in höflich-ungläubige Gesichter geblickt.
Rose war überzeugt davon, daß er sich das alles nur eingebildet hatte. Augustes »Leiche war bei Scotland Yard fast zum Standardwitz geworden. Twitch, die Nervensäge, oder vielmehr Sergeant Stitch, wie er richtig hieß (was Rose häufig vergaß), hatte dafür gesorgt. Twitch, nicht gerade ein Bewunderer von Auguste Didiers detektivischen Fähigkeiten, war entzückt darüber, daß »der Franzmann einen Dämpfer verpaßt bekam«, wie er es selbstgefällig formulierte. Rose machte Auguste so taktvoll wie möglich begreiflich, daß er sicher überarbeitet gewesen sei. Seine Männer hätten jeden Quadratmeter Straße rings um das Cranton untersucht; es gab keine Leiche, es gab keine Blutspur.
»Natürlich nicht«, hatte Auguste verärgert erwidert. »Die Mörderin hatte doch Zeit genug, beides zu beseitigen.«
Bis er es geschafft hatte, einen Ladenbesitzer davon zu überzeugen, daß er kein Verrückter sei und nichts weiter verlange als einen Anruf bei Scotland Yard, war genug Zeit verstrichen, um zwanzig Leichen verschwinden zu lassen.
»Wie denn?« fragte ihn Rose barsch. »Tote sind schwer. Deine Mörderin konnte doch die Leiche nicht einfach über die Schulter hieven und damit weggehen.«
»Vielleicht wohnt sie ganz in der Nähe«, konterte Auguste unnachgiebig.
»Junge Damen wohnen nicht allein«, knurrte Rose. »Und es hätte möglicherweise kritische Bemerkungen gegeben, wenn sie eine Leiche ins Wohnzimmer der Familie mitgebracht hätte.«
»Dann hat eben jemand anders sie verschwinden lassen«, sagte Auguste mit zornfunkelnden Augen.
»Warum?« fragte Rose betont freundlich.
»Das weiß ich nicht«, schrie Auguste. »Es ist deine Aufgabe, das herauszukriegen.«
»Aber nicht, wenn es keine Leiche gibt«, beschied ihn Rose kurz und wich Augustes vorwurfsvollem Blick aus. »Kein junges Mädchen ist als vermißt gemeldet worden.«
»Das ist doch bestimmt nicht ungewöhnlich in London«, erwiderte Auguste. »Selbst heutzutage laufen viele Mädchen von zu Hause weg und gehen auf die Straße, und keinem fällt es auf, wenn sie verschwinden.«
»Die Mädchenhändler sind daran interessiert, die Mädchen am Leben zu erhalten, nicht sie umzubringen«, erklärte Rose trocken.
Er war müde. Er hatte über eine Woche mit der ergebnislosen Suche nach Augustes Leiche verschwendet – eine Tatsache, auf der Twitch immer wieder herumritt. Und diese Woche fehlte Rose sehr, denn es gab da gewisse sehr ernste Dinge, die, wenn sich herausstellte, daß etwas an ihnen dran war, weitaus wichtiger waren als das Verschwinden eines einzelnen Mädchens – Dinge, die er nicht mit Auguste besprechen konnte.
»Du hattest ein bißchen die Grippe, nehme ich an. Da passieren einem komische Sachen. Man sieht Gespenster.« Rose gab sich Mühe, das unangenehme Schweigen zu beenden.
»Es stimmt, ich hatte ein Medikament eingenommen, in dem Opium enthalten ist. Aber so wenig, daß …«
»Halluzinationen«, verkündete Twitch fröhlich von der Tür her.
»Kann Blut eine Halluzination sein?« fragte Auguste erregt. Am Ärmel seines Mantels war ein Blutfleck gewesen, aber das hatte keinen Eindruck gemacht.
»Rote Grütze macht auch rote Flecken«, schnaubte Twitch und kicherte vor Überraschung darüber, daß ihm ein Witz gelungen war.
Augustes Blick wanderte zu Rose hin. Rose sagte nichts, doch seine Mundwinkel zuckten. Auguste empfahl sich mit aller Würde, die ihm zu Gebote stand. Seitdem hatte er seinen Freund nicht mehr gesehen.
Um so angenehmer wurde er zwei Tage später überrascht. Die liebe Maisie, die ihn und das Galaxy-Theater verlassen hatte, um in die Aristokratie einzuheiraten, hatte ihn zum Tee zu sich eingeladen. Maisie, die rundlichen Formen von einem fließenden blauen Gewand umhüllt, das wie ein Mittelding zwischen einem Lily-Langtry-Jerseykleid und einem Morgenmantel aussah, bewegte sich am Eaton Square ebenso ungezwungen wie im Grünen Zimmer des Galaxy. Seit ihrer Heirat hatte er sie nur sehr selten zu Gesicht bekommen, und die Einladung kam ganz unverhofft. Er schob den Gedanken beiseite, daß Maisies Gatte ihm möglicherweise in Liebesdingen nicht das Wasser reichen konnte, denn er wußte sehr wohl, wenn das wirklich zutraf, würde Maisie nicht zögern, ihm ihre Wünsche zu offenbaren. Seine Hoffnungen, wenn es solche waren, wurden jedoch enttäuscht. Maisie hatte Geschäfte, nicht Liebe im Sinn.
»Das Cranton?« fragte Auguste verblüfft. »Das Cranton?« Er überlegte, ob es sich vielleicht um eine raffiniert ausgeklügelte Verschwörung handeln könnte.
»Im Cranton läßt sich mit Seifenwasser und Farbe alles wieder in Ordnung bringen«, sagte Maisie heiter. »Also was hast du? Ich dachte, du würdest dich freuen, aber du machst ein Gesicht, als hättest du ein faules Ei in den Weihnachtspudding fallen lassen.«
»Ich will nichts vom Cranton wissen«, rief Auguste erregt, »nichts, gar nichts.«
Maisie war überrascht über diese unerwartete Reaktion. Doch sie kannte Auguste. »Also gut.« Ein tiefer Seufzer. »Dann muß ich eben jemand anders bitten. Vielleicht Mrs. Marshall«, sagte sie, nachdenkend. »Oder Nicholas Soyer. Er ist ein Nachkomme von Alexis, nicht wahr? Er hat einen guten Ruf. Vielleicht würde er es gern machen.«
»Nein!« donnerte Auguste, aufgeschreckt durch die verhaßten Namen seiner Konkurrenten.
Sie wechselten einen Blick.
»Erzähl mir mehr über die Sache«, sagte er resigniert.
»Ich betreibe ein Reisebüro, weißt du«, belehrte ihn Maisie voller Stolz. »Ich muß sagen, Auguste, dieser Gewürzkuchen schmeckt gar nicht übel. Das Rezept habe ich vom Ritz stibitzt.«
»Der Küchenchef wäre sicher entzückt über dein Lob«, knurrte Auguste. »Und nun erzähl mir, was es mit dem Cranton auf sich hat und warum du ein Reisebüro betreibst. Sorgt dein Mann nicht für dich? Ah, Maisie, ich hatte dich gewarnt …«
»Sei doch nicht so altmodisch, Auguste.« Maisie leckte sich die Finger ab. »Wenn George hier wäre, dürfte ich das nicht tun«, verkündete sie befriedigt.
»Welche Ehre für mich«, sagte Auguste.
»George und ich haben ein Abkommen«, erklärte ihm Maisie vergnügt. »Das heißt, ich habe ein Abkommen, und er akzeptiert es. Ich habe ihm den Sohn und Erben und eine Tochter geschenkt. Jetzt habe ich ein oder zwei Jahre frei und kann tun, was mir gefällt. Natürlich brauche ich einen Geschäftsführer, weil ich ab und zu meinen gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommen muß, doch ich habe ein Auge auf ihn. Du weißt, wie Männer sind. Sie achten nicht auf die Details.«
»Aber, Maisie, du weißt sehr gut …« Auguste stockte, als sie ihm zuzwinkerte. Ah, wie gut erinnerte er sich an diesen Blick …
»Ich habe so etwas wie Cooks Reisen für gehobene Kreise organisiert«, sagte Maisie frohgemut. »Lady Gincracks Luxusferien für Leute von Stand. Gefällt dir das?«
»Und wer ist diese gräßliche Dame?« fragte er begriffsstutzig.
»Ich natürlich. Es ist einer der Titel von Georges Familie, der nicht viel verwendet wird.«
»Ich kann nicht verstehen, warum du so was tust.«
»Weil es mir Spaß macht«, sagte Maisie begeistert. »Zu dieser Jahreszeit rechne ich besonders auf Leute aus den Kolonien, die sich an ihr englisches Weihnachten erinnern und nach Europa kommen, aber kein Herrenhaus haben, in dem sie wohnen könnten, und auf Leute, die ihren Verwandten für ein paar Tage entkommen und sich in einem anderen Kreis amüsieren wollen. Davon gibt’s eine ganze Menge. Also habe ich das Cranton gemietet, um dort eine zwölftägige Weihnachtsparty zu veranstalten. Ein richtiges altenglisches Weihnachten mit Weihnachtsliedern und Weihnachtsessen und allem Drum und Dran.«
»Im Cranton? Weihnachten?«, hörte er die Stimme sagen.
»Non«, erklärte er mit aller Entschiedenheit. »Absolument pas.«
Dieses Weihnachten mußte er über die Zukunft seiner Kochschule nachdenken. Er würde nirgendwohin gehen, wo auch nur die leiseste Aussicht bestand, mit einem Verbrechen in Berührung zu kommen, ganz zu schweigen von Mord. Das alptraumhafte Erlebnis vom November war ihm noch immer gegenwärtig. »Bis dahin könnte ich nicht das nötige Personal zusammenbekommen«, sagte er, da er ihr nicht erzählen wollte, was sich ereignet hatte, »und ich könnte ihnen nicht mehr beibringen, wie man Füllungen und Puddings in der erforderlichen Qualität herstellt. Und das Diner, und die Pasteten, le réveillon für das neue Jahrhundert … Zuviel Planung für die kurze Zeit, die bis dahin noch bleibt. Aber immerhin«, er war plötzlich Feuer und Flamme, »wir könnten Geflügelbraten anbieten und nicht zu schwere Desserts. Ich wollte immer schon Plumpudding mit Punschsauce ausprobieren. Natürlich würde ich als Küchenchef den Wildschweinkopf hereintragen …«
»Du hast dich überhaupt nicht verändert, Auguste«, rief Maisie amüsiert. »Denkst du denn nie an etwas anderes als an Essen? Ich will dich nicht als Koch haben.«
»Was?« Er erbleichte. »Mich nicht als Koch? Wen dann? Maisie, du hast das mit Soyer doch nicht ernst gemeint? Du willst doch wohl nicht etwa, daß ich unter jemand arbeite?«
»Aber nein«, beruhigte sie ihn. »Du sollst in diesen zwölf Tagen der Gastgeber sein, der Hoteldirektor, der maître d’hôtel. Ich werde mich von Zeit zu Zeit im Cranton sehen lassen. George fährt mit seiner lieben Mama in die Schweiz, und wir haben abgemacht, daß ich nicht dorthin reise, wohin die liebe Mama reist. Ich teile dann meine Zeit zwischen dir und den Kindern.«
Aber Auguste hörte nur mit halbem Ohr hin. Er als Gastgeber? Er dachte an all seine unerfüllbaren Träume von einem eigenen Hotel, denn wie sollte er je genug Geld aufbringen, um sich ein Hotel kaufen zu können? Jetzt bot man ihm eine Gelegenheit, den Hotelier zu spielen.
»Ich beschaffe dir einen erstklassigen Chefkoch«, versprach Maisie heiter, als sie merkte, daß er unentschlossen war.
Er sah sie zweifelnd an. »Der Chefkoch muß sowohl einen Rinderbraten wie die delikatesten Pfefferlinge zubereiten können, er muß sich mit Fleischpasteten wie mit pâté de foie gras auskennen, mit englischen Krebsen und mit …«
»Ja, ja, dafür sorge ich schon«, versprach Maisie hastig. »Du kannst das doch zeitlich einrichten, nicht wahr?«
Auguste zuckte zusammen. Er fühlte sich in seinem Stolz verletzt. »Zufällig ja«, sagte er hochfahrend. Sein jetziger Kochkurs endete in einer Woche, zwei Wochen vor Weihnachten, und bisher hatte er noch keine neuen Schüler. Das Angebot war verlockend, aber … »Ich kann es nicht übernehmen«, verkündete er.
»Und warum nicht?« fragte Maisie ärgerlich.
»Wegen eines Mordes«, stieß er hervor, unfähig, sich noch länger zu verstellen.
»Planst du einen?« erkundigte sie sich interessiert.
»Ich fürchte einen«, sagte er geheimnisvoll. »Ich habe einen gesehen.«
Sie fing an zu lachen. »Wenn du meine Gästeliste kennen würdest, Auguste, wüßtest du, daß du dir keine Sorgen zu machen brauchst. Diese Leute sind so ungefährlich wie ein ausgestopftes Krokodil. Du wirst sehen.«
»Nein, ich werde nicht sehen«, sagte er traurig. »Es fällt mir schwer, dir etwas abzuschlagen, liebe Maisie, aber ich kann das nicht übernehmen.« Er erhob sich würdevoll, doch dann fiel ihm ein, daß er noch nicht von dem verlockend aussehenden Konfekt gekostet hatte, und er setzte sich wieder hin.
»Wie schade!« Maisie lächelte honigsüß. »Und der Besitzer des Cranton ist auch noch ein Freund von Prinzessin Tatjana. Deine Tatjana wird sehr enttäuscht sein.«
Auguste erstarrte. Er hatte keine Ahnung gehabt, daß Maisie Tatjana kannte. Jetzt blieb ihm keine Wahl. Wenn der Besitzer des Cranton ein Freund von Tatjana war, dann mußte er zusagen. Sonst würde Tatjana vielleicht erfahren, wie flegelhaft er sich benommen hatte. Seine Liebe zu ihr mochte hoffnungslos sein, aber sein Ehrenschild mußte für sie blitzblank bleiben. Also mußte er die Arbeit im Cranton annehmen und seine unsinnigen Alpträume von dem ermordeten Mädchen vergessen. Schließlich hatte ihm Egbert versichert, es sei keine Leiche gefunden worden, also gab es auch keine. Es war alles nur in seiner Phantasie geschehen. Und was die Worte anging, die er gehört zu haben glaubte – hatte er nicht kurz davor die Inschrift »Hotel Cranton« über dem Eingang gesehen? Wenn wirklich etwas gesprochen worden war, dann vielleicht etwas ganz anderes? Sicherlich nichts, worüber man sich Sorgen machen mußte.
Auguste stand auf der breiten Treppe in der großen Eingangshalle des Cranton und schnupperte anerkennend. Diesmal roch es nicht nach Essen, sondern nach Bienenwachsmöbelpolitur. Rings um ihn glänzte die reichgeschnitzte Holztäfelung, die lange vor der Jahrhundertwende angebracht worden war, als man die ursprünglichen Adam-Häuser zum Hotel umgebaut hatte. Mit seinen einheitlich hohen Fenstern in drei Stockwerken und der Reihe kleinerer Fenster im Dachgeschoß darüber präsentierte es den Londoner Bürgern eine majestätische Front und eine ebenso majestätische Rückseite. Alte, bequeme Möbel luden dazu ein, sie zu benutzen, neue Sprungfedermatratzen von Heal warteten auf Schläfer, in den Herden brannten bereits Feuer – plötzlich war das Cranton wieder zum Leben erwacht.
Die Gäste würden ein wunderbares Weihnachten erleben! Sie würden das Jahrhundert stilvoll zu Ende gehen sehen. Er hatte Menüs kreiert – soviel hatte Maisie ihm immerhin gestattet –, die der Tafel des Prince of Wales zur Ehre gereicht hätten. Seine Besorgnis hinsichtlich der Qualifikation des Küchenchefs war ein wenig geschwunden, nachdem er dessen jetziger Arbeitsstelle, einem italienischen Restaurant, einen heimlichen Besuch abgestattet hatte. Er war etwas beschämt gewesen, als Maisie mit ihrem Gatten erschien und Auguste als einzigen anderen Gast vorfand, damit beschäftigt, die Qualität eines Soufflés zu testen. Er wäre dem Chefkoch schließlich noch nie begegnet, erklärte er unschuldig.
Die drei Tage, die Auguste im Cranton verbracht hatte, waren eine Zeit angstvoller Spannung und harter Arbeit gewesen. Als Hoteldirektor hatte er natürlich ein persönliches Interesse an der Neueinrichtung der Küche. Egal, wie gut diese neuen Gasherde auch sein mochten, mit ihnen ließ sich der Geschmack von am Spieß gebratenem Fleisch nicht erzielen. Er warf einen wohlgefälligen Blick auf den neuen Kuchenteigrührapparat und auf die Schneidemaschine, die Lovelock-Wurstmaschine und die Puddingformen aus Weißblech. Maître Escoffier hatte ja so recht, wenn er seine Aufmerksamkeit arbeitsparenden Erfindungen zuwandte. Er selber hatte zu Beginn seiner Karriere Zweifel gehabt, hatte Routineverrichtungen als notwendigen Teil der Arbeit eines Kochs angesehen. Aber le maître hatte ihm bewiesen, daß ein Fruchtschneider oder ein mechanischer Spieß es dem Koch ermöglichte, sich wichtigeren Aufgaben zu widmen. Er erinnerte sich an den Tag, an dem le maître ihm einen kleinen Würfel gezeigt und ihm gesagt hatte, in diesem Würfel stecke die Kraft eines ganzen Kochtopfs voll Fleischbrühe. Wenn das stimmte, war es wahrhaftig ein Wunder, hatte er staunend überlegt. Damit konnte man eine soupe in Stunden herstellen und brauchte nicht mehr Tage dazu. Diese Erfindung konnte eine Revolution für la cuisine bedeuten.
Doch so ganz sicher war sich Auguste immer noch nicht, was seinen Küchenchef betraf. Der war schließlich Italiener, und nach Augustes Ansicht bestand italienisches Essen aus Spaghetti, Makkaroni, Tomaten und entbehrte jedes Raffinements. Konnte man einem solchen Menschen eine Gans anvertrauen, geschweige denn einen Plumpudding?
Es hatte ihn etwas beruhigt, als Signor Fancelli, der ganz so aussah, als würde er sich von niemand in seine Arbeit hineinreden lassen, ihm erzählte, er sei in England aufgewachsen; seine Eltern hätten in der Küche des Café Royal gearbeitet, und infolgedessen hätte er eine wahrhaft kosmopolitische Einstellung zu la cuisine. Doch in diesen drei letzten Tagen hatte sich gezeigt, daß er eine ausgesprochene Neigung für Parmesankäse hatte. Von Parmesankäse war er so eingenommen wie Mrs. Marshall von ihrem Korallenpfeffer. Fancelli konnte höchstens Ende Zwanzig sein, dachte Auguste tolerant. Er konnte noch dazulernen – aber nicht mehr vor Weihnachten. Man mußte ein Auge auf ihn haben.
Zunächst war alles gut gegangen. Fancelli hatte sich ihm gegenüber durchaus willig gezeigt. Doch nachdem er Auguste den Wildschweinkopf überlassen hatte, war ein Streit darüber ausgebrochen, womit die Gans gefüllt werden sollte.
»Ich bin hier der Küchenchef, Monsieur Didier«, sagte Fancelli, und sein rundlicher untersetzter Körper zitterte vor Erregung.
»Und ich bin der Hoteldirektor«, erwiderte Auguste.
Signor Fancelli verschränkte die Arme. »Ente«, sagte er kurz.
»Pflaumen«, sagte Auguste ebenso kurz.
»Backpflaumen«, bot Fancelli kompromißbereit an.
»Non«, entgegnete Auguste.
Antonio Fancelli faltete die Arme auseinander, band seine Schürze ab und langte nach seinem Filzhut. »Ich gehe«, verkündete er.
»Es ist Heiliger Abend«, sagte Auguste, seine Stellung behauptend. Er war widerspenstiges Personal gewöhnt.
»Keine Pflaumen«, sagte Fancelli.
»Pflaumen und Ente«, sagte Auguste. »Mit Armagnac.«
Einen Augenblick lang stand Fancelli unentschlossen da. »Also gut«, erklärte er dann widerwillig.
Von da an durfte Fancelli in seiner Küche regieren, aber Auguste wurde alle Stunden eine Ehrenrunde gestattet, ein Vorrecht, das er bisher nicht mißbraucht hatte. Fancelli beobachtete ihn jedesmal argwöhnisch und sang dabei mit provozierend wohltönender Stimme Melodien aus den Opern von Signor Verdi oder Herrn Mozart.
Um zwölf Uhr am Heiligen Abend befand Auguste, jetzt sei alles fertig, und versammelte seine Bediensteten um sich. Er strahlte sie beseligt an, erfüllt von einem rauschhaften Hochgefühl, weil Weihnachten nun endlich gekommen war. Es würde ganz wunderbar werden. Hier in dieser Atmosphäre von Wärme und Gastlichkeit würde sein größter Traum – oder beinahe sein größter – in Erfüllung gehen.
»Eh bien, mes enfants«, sagte er. »Jetzt wird der Mistelkranz feierlich aufgehängt. Folgen Sie mir.« Er schritt voran in das riesige Gesellschaftszimmer, und sein Personal drängte sich hinter ihm. Tannengrün und Lametta schmückten jedes Bild und jeden Winkel. Ein großer, reich dekorierter Tannenbaum stand in einer Ecke, darunter lagen sorgfältig ausgesuchte Geschenke, eins für jeden der vierzehn Gäste und eins für jeden, der zum Personal zählte, einschließlich der Zimmermädchen und Hausdiener. Anerkennend betrachtete Auguste den glitzernden Baum. Dies war nicht die französische Art, Weihnachten zu feiern – man stelle sich so etwas in seiner heimatlichen Provence vor! –, aber für ein englisches Weihnachten war es magnifique.
Er nahm den Mistelkranz aus den Händen eines Hausdieners, stieg die Leiter hinauf und hängte ihn an die Decke, zum Zeichen dafür, daß Weihnachten begonnen hatte. Dann blickte er hinunter in die lächelnden, nach oben gerichteten Gesichter seiner Leute. Das war wirklich ein erhebender Augenblick! Was für ein Symbol! Zwei Holzreifen waren mit Stechpalmen, Mistelzweigen und anderem Grün umwunden, und vom Kranz herab hingen kleine Geschenke und Lametta, in dem sich das Licht spiegelte, als er sich von diesem in dem leichten Zug des Kaminfeuers hin und her drehte. Mistel – die älteste der mystischen Pflanzen, die Zerstörerin, die Heilerin und, wie manche behaupteten, die Friedensstifterin bei Streitigkeiten. Vielleicht würde sie den Bruch zwischen ihm und Egbert heilen, dachte Auguste sehnsüchtig.
»Stechpalme und Efeu«, stimmte ein nicht länger zu zähmender Hausangestellter begeistert ein englisches Weihnachtslied an, während ein anderer zum Klavier eilte, das erst gestern von den Messrs Steinway gestimmt worden war, nachdem man es jahrelang nicht benutzt hatte.
»Und alle Bäume, die’s gibt im Wald …«
Auguste merkte, wie ihm die Augen feucht wurden. Warum hatte er sich solche Sorgen gemacht? Jetzt war Weihnachten, und er konnte sich in der Vorstellung wiegen, er führe sein eigenes Hotel. Die Freuden des Dezember würden ihn die Novembernebel vergessen machen. Ja, er freute sich auf Weihnachten.
»Mes amis«, strahlte er, »jetzt fehlen nur noch unsere Gäste …«
Major Frederick Dalmaine vom Royal West Kent Regiment, dem Leibregiment der Königin, stieg langsam aus dem Eilzug, der soeben auf dem Londoner Bahnhof Paddington eingelaufen war. Er war etwas verärgert darüber, daß er nach einem Gepäckträger suchen mußte. Auf alle anderen Fahrgäste eilten offenbar Gepäckträger zu, doch das, was er für seine natürliche Autorität hielt, schien ihn gänzlich verlassen zu haben. Er hoffte, sein langsamer Gang würde alle sofort auf einen verwundeten Kämpfer des Krieges in Südafrika tippen lassen. Das stimmte ja auch, und er hatte nichts dagegen, daß alle es wußten.
Er war mehr als nur ein wenig gekränkt. Sein Bruder, bei dem er für gewöhnlich das Weihnachtsfest verbrachte, war weit fort. (Der Brief seines Bruders, den er bei der Ankunft in seiner Wohnung in Southampton vorgefunden hatte, brannte immer noch ein Loch in seine Anzugtasche. Was, zum Teufel, sollte er nun anfangen?) Da sein Bruder im Ausland war, hatte er natürlich damit gerechnet, die Festtage bei seiner Schwester Evelyn und ihrer Familie verbringen zu können, doch ein Telegramm hatte ihn darüber unterrichtet, daß Evelyn mit den Ihren nach Schottland fahren werde und deshalb dafür gesorgt habe, daß er in einem Londoner Hotel ein richtiges altmodisches Weihnachten verleben könne. Es werde ihm ganz bestimmt sehr gefallen, stand in dem Telegramm. Dalmaine glaubte nicht, daß es ihm dort gefallen würde. Er hatte sich darauf gefreut, der Mittelpunkt eines Kreises von kleinen Jungen und ihren erwachsenen Ebenbildern zu sein, die bewundernd an seinen Lippen hingen und jede Einzelheit über den Entsatz von Kimberley und Roberts’ siegreichen Vormarsch hören wollten, ganz zu schweigen von seiner eigenen Begegnung mit Jan Smuts.
Statt dessen würde er nur einer in einer Horde von Fremden sein, die sich auch dann nicht im geringsten für seine Beinverwundung interessiert hätten, wenn Feldmarschall Roberts selber erschienen wäre, um darüber zu sprechen. Er verzog den Mund und rief sich ins Gedächtnis zurück, daß er sich verschiedene Ziele gesetzt hatte, die er nach seiner Rückkehr aus Afrika ansteuern wollte. Eins dieser Ziele war es, sich eine Frau zu suchen. Mit fünfunddreißig war es hohe Zeit, und ganz abgesehen von seiner militärischen Karriere hatte er seine Jahre in Afrika nicht verschwendet. Für Zivilisten mit Weitblick gab es dort günstige Gelegenheiten, und die würde er jetzt nutzen, nun, da seine militärische Laufbahn zu Ende war. Selbst wenn das bedeutete, daß er auf diesen Brief reagieren mußte …
»Junge Damen, die in die Gesellschaft eingeführt wurden, legen niemand Springbohnen in die Reitstiefel«, brüllte Sir John Harnet aufgebracht. Keine Spur mehr von der Selbstbeherrschung, die seine Kollegen stets vergeblich zu erschüttern versuchten, denn seine phlegmatische Ruhe war legendär im Kolonialministerium.
»Und warum nicht?« erkundigte sich die Ehrenwerte Evelyn Pembrey, und ihre blauen Augen blickten lebhaft interessiert.
»Weil sie die Gefühle anderer Menschen nicht verletzen wollen«, erwiderte ihr Vormund hochtrabend und fragte sich, warum um Himmels willen er sich als Hüter der Sprößlinge von Clarence und Bertha angeboten hatte und wann man wohl mit Fug und Recht erwarten konnte, daß jene nach England zurückkehren und die Verantwortung für ihre Kinder wieder selber übernehmen würden. Gewiß, vor einundzwanzig Jahren hatte er Bertha voller Inbrunst geschworen, er würde trotz ihres eigensinnigen Festhaltens an dem dickköpfigen Clarence als Ehemann sein Leben ihrem Dienst weihen, aber es gab solchen und solchen Dienst. Und er merkte allmählich, daß die Freude, die Zwillingsschwestern Pembrey in die Gesellschaft eingeführt zu sehen, und seine Versuche, den Eigensinn einer bildhübschen Zwanzigjährigen zu steuern, mehr waren, als er sich zumuten konnte.
»Oh«, sagte die Ehrenwerte Miss Ethel und warf ihrer Zwillingsschwester einen verstohlenen Blick zu, »dann wäre es dir wohl lieb, wenn wir auch den Frosch aus deinem Schal entfernen?«
Sir Johns erstickter Ausruf verhinderte, daß sie dem Butler den Schal abnahmen. Die Augen des Butlers öffneten sich ein wenig mehr als gewöhnlich, und seine Finger zitterten, als er aus dem Zimmer stürzte. Die Worte, mit denen er sich draußen des Tierchens entledigte, bildeten einen sonderbaren Gegensatz zu der Sprache, die oberhalb des Souterrains für gewöhnlich aus seinem Mund kam.
»Wie wollt ihr je einen Mann finden?« fragte Sir John streng. »Wer sollte es mit euch Ungeheuern aushalten?«
»Ich dachte, die Männer sollten uns finden«, erwiderte Evelyn unschuldig. »In Ouidas Romanen ist das immer so.«
Ihre Schwester kicherte. »Mrs. Toombs sagt, es ist nicht damenhaft, Männern schöne Augen zu machen.« Mrs. Toombs war die leidgeprüfte Anstandsdame der drei.
»Es ist an der Zeit, daß ihr Mädchen eins begreift: ihr habt Pflichten gegenüber der Gesellschaft, nachdem ihr bei Hof empfangen wurdet. Die Kindheit ist vorbei; ihr müßt euch jetzt darauf vorbereiten, eure Rolle als künftige Ehefrauen und Mütter in dieser unserer großen Nation zu spielen, und eure albernen Liebeleien vergessen. Auf der edlen Tradition der britischen Frau ist ein großes Empire errichtet worden, in dem auch ihr euren Part übernehmen müßt, nun, da ihr in die Gesellschaft eingeführt worden seid.«
»Ich glaube, ich will da lieber wieder raus«, erklärte Evelyn feierlich.
»Ich auch«, stimmte ihr Ethel zu.
»Aber das geht nicht«, schrie Sir John und vergaß seinen Vorsatz, die beiden durch ruhigen Ernst zu beeindrucken. »Macht euch nicht lächerlich. Ihr seid von Ihrer Majestät empfangen worden.«
Das war in der Tat ein Erlebnis gewesen. Mrs. Toombs hatte zwar die Hauptlast getragen, doch er hatte als Vormund der Zwillinge in England dabei anwesend sein müssen und zugesehen, wie ihre Straußenfedern den Prince of Wales beinahe am Kinn kitzelten. Der Prinz schien nichts dagegen zu haben; letzte Woche hatte er sogar auf dem Ball der Westminsters mit Ethel getanzt. Ethel hatte diese Ehre nicht gebührend zu schätzen gewußt, wie man ihren unehrbietigen Bemerkungen über den Bauch und den steifen Gang des Prinzen entnehmen konnte.
Was hatte ihn nur bewogen, diesen Weihnachtsaufenthalt in dem Hotel zu buchen? Mangel an anderen Möglichkeiten, überlegte er finster. Mrs. Toombs hatte energisch erklärt, daß sie Weihnachten nicht zur Verfügung stehe. Seine Schwester hatte es nach dem Fiasko des Debütantinnenballs rundweg abgelehnt, sie alle in Scheveningen bei sich aufzunehmen – was also sollte er, ein Junggeselle, tun? Und selbst wenn er noch anderes erwogen hätte – seine Vorgesetzten hatten ihm mit Nachdruck klar gemacht, daß sie alle speziell mit diesem Plan für die Festtage voll und ganz einverstanden seien, und er hatte sich ihre Argumente angehört und ihnen zustimmen müssen. Also würde er Weihnachten mit den Mädchen im Cranton verbringen. Schließlich war das Ganze von einer Gräfin arrangiert worden, wenn auch ihre Herkunft etwas zweifelhaft war. Er konnte nur darauf hoffen, daß die Mädchen in ihrer freudigen Aufregung darüber, in London zu sein, keine Zeit finden würden, die anderen Gäste zu terrorisieren. Im Augenblick hatte er im Kolonialministerium genug Ärger, auch ohne daß er den Kerkermeister der Ehrenwerten Misses Pembrey spielte. Bertha hatte eine Menge wiedergutzumachen.
»Onkel Brummbär!«
Das brachte das Faß zum Überlaufen. Sir John blickte zu dem goldhaarigen Traumbild hoch, das in einem blauen Samtkleid die Treppe herunterschwebte.
»Ich glaube doch, ich habe dir befohlen, mich nie wieder mit diesem lächerlichen Namen zu rufen, Rosanna«, donnerte er.
»Aber Onkel«, Rosanna sah ihn gepeinigt an, »ärgere dich doch nicht. Schließlich ist Weihnachten.« Sie lächelte gewinnend, als sie den blauen Filzhut zurechtrückte, der auf ihren Locken thronte. Für dieses Weihnachten hatte sie ihre eigenen Pläne.
Im Zug nach London machte es sich Bella im Erste-Klasse-Abteil bequem. Sie trug ihr praktisches Reisekostüm und einen ganz entschieden unpraktischen Hut. Bewußt ignorierte sie die möglicherweise strapaziöse bevorstehende Überfahrt über den Kanal, indem sie ihre Gedanken auf das Weihnachtsfest im Cranton richtete. Ein englisches Weihnachten nach all diesen Jahren – das Angebot ihrer Freundin, die Weihnachtsferien auf ihre Kosten im Cranton zu verbringen, war nur zu gern akzeptiert worden. Sogar Gaston war beinahe begeistert gewesen. Die Güter verschlangen sehr viel Geld.
Sie warf einen verstohlenen Blick auf ihren kerzengerade dasitzenden Gatten Gaston, Marquis de Castillon. Wenn er bloß nicht immer so voller steifer Würde wäre, stets eingedenk seiner Stellung in der französischen Gesellschaft und im französischen Kolonialministerium! Sie vermutete, daß er dort sehr gute Arbeit leistete, doch er trug die Nase so hoch, daß er gar nicht bemerkte, was unter dieser seiner Nase zu Hause vorging. In gewisser Hinsicht mochte sie ihn sehr … Er war immer da, eine Säule der Wohlanständigkeit. Darum hatte er sie auch geheiratet, sie, die Tochter eines ungarischen Barons. Falls er seitdem entdeckt haben sollte, daß Stammbäume keine Garantie für Übereinstimmung bildeten, so ließ er sich das nie anmerken, und Bella bewegte sich ungehindert fröhlich in der Pariser Gesellschaft.
Sie war zwar ein wenig überrascht gewesen, daß sich Gaston ohne weiteres mit dieser Reise einverstanden erklärt hatte, doch sie nahm an, daß ihn die Aussicht auf einen unbeschwerten Urlaub lockte, weit weg von einer Tätigkeit, bei der er in letzter Zeit öfter als sonst die Stirn gerunzelt hatte.
Colonel Arthur Carruthers, früher East Kent Regiment, war in ausgezeichneter Stimmung. Oder jedenfalls in so guter Stimmung, wie er es nach seinem schweren Verlust sein konnte. Kurz nach seinem Abschied aus der Armee war seine Frau gestorben. Ehefrauen hatten nicht das Recht, zu sterben und ihre Männer unversorgt zurückzulassen, und er grollte ihr deswegen. Ohne sie wirkte Carruthers Hall wie eine große leere Muschel, und die Aussicht auf ein einsames Weihnachten im West Country war auch nicht gerade erheiternd. Eine zufällige Begegnung hatte ihn auf eine kühne Idee gebracht. Warum sollte er sich nicht ein richtiges altmodisches englisches Christfest gönnen, nachdem er um so viele Weihnachtsfeste gekommen war in all den Jahren, in denen er in derart abgelegenen Teilen der Welt wie Zululand, den Perak-Dschungeln und Chitral Dienst getan hatte, wo man nichts von gebratenem Truthahn verstand. Wie es einem Mann der Tat zukam, entschloß er sich schnell und empfand Genugtuung darüber, daß er das unfreundliche Schicksal irgendwie überlistet hatte. Nur jetzt, auf der Fahrt zum Cranton in einer Hansom-Droschke, hatte er eine böse Vorahnung, da ihm zu spät klar wurde, daß man etwas von ihm erwartete. Er würde mit einem Rudel fremder Leute Süßholz raspeln müssen. Mürrisch befahl er dem Kutscher, anzuhalten. Da er sein Gepäck bereits vorausgeschickt hatte, konnte er den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen. Grimmig setzte er sich in Richtung Hotel Cranton in Bewegung, marschierte gegen den Winterwind, hocherhobenen Hauptes jedem Mißgeschick trotzend.
Auch Miss Gladys Guessings kam sich sehr unternehmungslustig vor. Müde der freundlichen Einladungen, die Nichten und Schwägerinnen ihr pflichtschuldigst zukommen ließen, hatte sie sich für die Unabhängigkeit entschieden.
»Nein, vielen Dank, May«, sagte sie zu der Verwandten, die dieses Jahr nach einigem Zögern bereit gewesen war, sich zu opfern, »ich habe schon etwas vor.«
Mays Gesicht hellte sich auf. »Ach, das tut mir aber leid, Tante Gladys«, sagte sie erfreut. »Wohin fährst du denn?«
»Nach London«, erwiderte Gladys wahrheitsgemäß, ohne die schmähliche Tatsache zu erwähnen, daß es sich um ein Hotel handelte. Sie sprach das Wort »London« geradezu ehrfürchtig aus, denn dies war eine weit entfernt liegende Stadt, die in ihrer Phantasie mit den Jahren zu einem Feenreich geworden war, obwohl zwei kurze Abstecher dorthin eher das Gegenteil bewiesen hatten, und ihr Ton war so, daß May auf alle weiteren Fragen verzichtete.
Das war Gladys nur recht, denn so erhielt die Vermutung Nahrung, daß sie einen Verehrer hatte. Wie lächerlich, dachte sie und errötete leicht. Der bloße Gedanke daran bewirkte, daß sie sich wie ein Dienstmädchen vorkam. Dabei konnte es sehr wohl geschehen, daß sie im Cranton passende männliche Gesellschaft fand. Schließlich war sie mit fünfundvierzig noch jung genug, um einen älteren Witwer an Land zu ziehen, der eine vernünftige Gefährtin brauchte und nichts über ihr Leben in Much Wallop wußte. Sie konnte ein neues Leben beginnen. Ja, beschloß sie frohgemut, sie wollte das Weihnachtsfest im Cranton genießen.
Die elegante Droschke, die Thérèse, Baronin von Bechlein, gemietet hatte, rollte dem Hotel Cranton entgegen. »Marie-Paul«, sagte die Baronin zu ihrer Begleiterin und beendete damit ein langes Schweigen, »glaubst du, daß uns dieses englische Weihnachten Spaß machen wird?«
Ein dünnes Lächeln umspielte Mademoiselle Marie-Paul Gonnets Lippen. »Aber ganz sicher doch, Madame.«
Das markante, humorvolle Gesicht der Baronin spiegelte Zuversicht. »Ich habe gehört, der Koch soll sehr gut sein«, sagte sie. »Auguste Didier.«
»Dann kommen wir bestimmt auf unsere Kosten«, versicherte Marie-Paul tapfer.
»Ich wollte immer schon mal Weihnachten in England verbringen«, flüsterte die Baronin geistesabwesend.
»Und was werden Sie über Ihren Mann sagen?« fragte Marie-Paul.
»Daß er sich woanders aufhält«, antwortete die Baronin nach einem Augenblick des Nachdenkens. »Das ist das Beste, findest du nicht auch? In meinem Alter darf man einen abwesenden Ehemann haben.«
»Madame bleibt immer jung«, versicherte ihr ihre Gefährtin voller Inbrunst.
Alfred Bowman lehnte sich bequem in seiner Privatkutsche zurück und betrachtete liebevoll seinen Bauch, der friedlich und erwartungsvoll unter der goldenen Uhrkette ruhte. Dieser Bauch erinnerte ihn an den Status, den er im Leben erreicht und dem selbst der Prince of Wales Ehre erwiesen hatte. Der Prinz war nicht zu stolz, die Leistungen von Industriellen anzuerkennen; man mußte ihm das hoch anrechnen. Alfred griente. Wenn die Gerüchte über den Gesundheitszustand der Königin zutrafen, machte sich Bertie jetzt bereit, ihre Nachfolge anzutreten. Armer Teufel. Bowman empfand fast so etwas wie Mitleid mit Bertie.
Alfred Bowman, Selfmademan und stolz darauf: so sollte ihn seine Umwelt sehen. Er hatte verdammt schwer gearbeitet und arbeitete noch immer verdammt schwer. Keine Frau mehr, die Kinder versorgt. Er konnte tun und lassen, was ihm gefiel, und dieses Weihnachten würde er das mit großem Behagen auskosten. Er war ein Mann mit einer Aufgabe im Leben. Und er würde dafür sorgen, daß sein Magen hier all die guten Dinge bekam, die er verdiente. Die ganzen zwölf Tage lang. »Zwölf Weihnachtstage im Hotel Cranton« hatte die Anzeige gelautet. Alle Freuden Londons zur Weihnachtszeit – und dazu ein erstklassiger Küchenchef. Er hatte von Auguste Didier gehört. Sein Gesicht verfinsterte sich. Er hatte in mehr als einer Hinsicht von ihm gehört. Na, machte nichts, vielleicht hatte er im Augenblick für nichts anderes Sinn als fürs Kochen.
Mr. und Mrs. Thomas Harbottle saßen schweigend in dem Hansom, der dem Portman Square entgegenratterte.
»Glaubst du, mir wird ein englisches Christfest gefallen?« fragte Eva. Sie sprach fast ohne deutschen Akzent, obwohl sie erst so kurze Zeit verheiratet war. Klein, rundlich und braunhaarig, sah sie in ihrem neuen Reisekleid und ihrem Mantel aus braunem Serge wie ein Zaunkönig aus, so hatte ihr Thomas liebevoll versichert. Eva nahm das Leben von der ernsten Seite, was Thomas durchaus billigte. Bankiers, selbst junge, hatten die Pflicht, ernst zu sein.
»Aber ganz bestimmt.« Thomas tätschelte seiner Frau zuversichtlich die Hand, zuversichtlicher, als er gestimmt war. »Es ist unser erstes Weihnachten zusammen, egal, was danach geschieht.«
»Aber …«
»Mach dir keine Sorgen«, befahl er in etwas schärferem Ton.
Er räusperte sich in der unbehaglichen Stille, die plötzlich eingetreten war. »Weißt du übrigens«, sagte er rasch, »daß der einzige einbeinige Bürgermeister, den London jemals hatte, sein Amt 1796 angetreten hat?« Wie die junge Mrs. Harbottle allmählich feststellte, war ihr Mann stolz darauf, daß er sich so gut in der englischen Geschichte auskannte.
Eva gab keine Antwort. Die englische Vergangenheit interessierte sie nicht im geringsten. Es war die Gegenwart, die sie anging.
Unter den übrigen Gästen, die zum Hotel Cranton unterwegs waren, befand sich einer, der nicht eingeladen war. Seine Gedanken kreisten um Dinge, die nichts mit dem Fest zu tun hatten. Daniel Nash, ein eifriger Reporter, wollte sich vorübergehend in einem der unbenutzten Räume des Souterrains einquartieren, von wo aus er sowohl seine dienstlichen Erkundungen wie seine privaten romantischen Bestrebungen fortsetzen konnte.
Egbert Rose starrte aus seinem Bürofenster auf die Themse hinunter. Er war nicht glücklich. Zum Teil rührte das daher, daß es fast schon Weihnachten war und er vor der unangenehmen Wahl stand, entweder mit Ediths Weihnachtsbraten zufrieden zu sein – es sollte Pute geben – oder aber die Gastfreundschaft ihrer Schwester Ermyntrude anzunehmen, die zwar etwas besser, jedoch auch entschieden einfallslos kochte und deren Kinder einfach schlimm waren. Er seufzte.
Er hatte stets geglaubt, es gehöre zu den Annehmlichkeiten des Verreistseins, den Kindern anderer Leute zuzusehen, ohne Verantwortung für sie tragen zu müssen. Das traf nicht immer zu, hatte er gemerkt. Zusehen mochte noch angehen, doch mit ihnen eine Zeitlang eng zusammengepfercht zu sein, war ganz bestimmt keine angenehme Aussicht.
»Ein Weihnachten ohne Kinder ist kein Weihnachten, Egbert«, hatte Edith vorwurfsvoll gesagt, als er versucht hatte, seine Einwände vorzubringen.
In diesem Fall kein Verlust, war seine spontane geheime Reaktion, doch um Ediths willen sagte er: »Du hast recht, mein Liebes, natürlich fahren wir wieder zu Ermyntrude.« Also würden sie heute abend zwischen Leuten, die ihre letzten Einkäufe erledigten, und mit Paketen aller Art beladenen Büroangestellten, die schnellstens nach Hause wollten, den Bahnhof Bayswater ansteuern.
Aber er war auch noch aus einem zweiten Grund unglücklich: wegen Auguste Didier. Als Auguste ihn wegen einer verschwundenen Leiche flehentlich um Hilfe gebeten hatte, war er nicht besonders hilfsbereit gewesen, das wußte er, einfach weil er verschiedene andere Dinge auf dem Hals gehabt hatte. Die Sache war ihm unangenehm, und obwohl er sich erfolgreich eingeredet hatte, daß Auguste eine zu große Dosis von Armstrongs Schwarzen Tropfen genommen hatte, beunruhigte ihn die Erinnerung an das traurige und entrüstete Gesicht seines Freundes noch immer. Doch Freunde waren das eine und Scotland Yard war das andere, und wenn auch Auguste dem Yard in der Vergangenheit verschiedentlich sehr nützlich bei der Aufklärung von Morden gewesen war, um es bescheiden auszudrücken, so bedeutete das doch nicht, daß Rose beides nicht auseinanderhalten konnte.
In diesem Fall hatte der Polizist in ihm eindeutig den Sieg davongetragen. Dabei hatte er sich wie ein Verräter gefühlt, als er Twitchs triumphierenden Blick sah, obwohl er genau wußte, daß er richtig handelte. Nachdem er sich das noch einmal vorgehalten hatte, überflog er zum letzten Mal die Listen der nach England einreisenden Personen. Die Zeit wurde knapp …
Auguste war viel wohler zumute, denn der Mord beschäftigte ihn nicht mehr. So war das also, wenn man sein eigenes Hotel hatte: es erfüllte einen ein wunderbares warmes Gefühl von Macht, das Bewußtsein, daß man für das Wohlergehen einer ganzen Gruppe von Menschen verantwortlich war. O ja, dies war vielleicht wirklich besser, als nur Koch zu sein, sogar ein Meisterkoch, denn allzu oft wurden selbst die erlesensten Kreationen, mit Liebe und in angstvoller Spannung, mit Einfallsreichtum und hoher Kunst zubereitet, ohne jeden Kommentar verzehrt. Eine Timbale mit püriertem Moorhuhn oder ein mit den feinsten Trüffeln von Kent gefüllter Kapaun fanden unter Umständen keine Beachtung, wenn zwischen den Speisenden eine Fehde tobte.
Als Hoteldirektor hingegen empfing man elegante und charmante Gäste, die alle darauf erpicht waren, eine angenehme Zeit zu verbringen; man ließ den Tee in einem schön eingerichteten Gesellschaftszimmer servieren, sah, daß solche kulinarischen Köstlichkeiten wie die fanchonettes und der Koburg-Kuchen ehrlich gewürdigt wurden, statt daß man über heiße Herde gebeugt stand oder wie wild herumraste, um unbotmäßige Hilfsköche zurechtzuweisen. Ah ja, das war das richtige Leben für ihn.
Er erstarrte, als sein Blick auf die Gurkensandwiches fiel. Hatte Fancelli denn keine Ahnung, wie man ein Sandwich servieren mußte? Er sah, daß an einem noch etwas Kruste hing, doch im Interesse guter Beziehungen enthielt er sich jeder Kritik. Er nahm sich nur vor, bei seiner Ehrenrunde vor dem Essen auf Einzelheiten zu achten.
Als er eine Stunde vor dem Dinner die Küche betrat, trug er eine heitere Gelassenheit zur Schau, die er nicht empfand. Er bedachte Fancelli mit einem gewinnenden Lächeln. »Alles in Ordnung?« fragte er scheinbar beiläufig, und seine Augen glitten argwöhnisch vom Rindfleisch zum bavarois, von den Austern zu den Ortolanen.
Fancelli ließ sich nicht täuschen. »Ja«, sagte er mit fester Stimme und bewachte seine Schöpfungen wie Zerberus sein Reich, doch selbst sein korpulenter Körper konnte die ganze Skala der Speisen nicht verdecken, die für das Abendessen der vierzehn Gäste vorgesehen waren.
»Ich sehe, Sie passieren Ihre mirepoix«, begann Auguste, bemüht, taktvoll zu sein.
»Ja«, erwiderte Antonio argwöhnisch und ging in Kampfstellung.
»Interessant, interessant«, sagte Auguste hastig. »Und so zeitsparend«, konnte er sich nicht enthalten, hinzuzufügen.
Vielleicht würde es eines Tages zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und Signor Fancelli kommen, heute aber war nicht der richtige Moment dafür. Er rief sich energisch ins Gedächtnis, wie glücklich er sich schätzen konnte. Dies war das erste englische Weihnachtsfest, daß er aus nächster Nähe miterleben durfte. Normalerweise hätte er wie Fancelli in der Küche schuften müssen; diesmal jedoch konnte er ein wenig an den anderen Festfreuden teilhaben.
Vielleicht sollte er Fancelli vorschlagen, einen seiner Kochkurse zu besuchen? Selbst wenn Fancelli in England aufgewachsen war – seine Eltern waren eben Italiener. Von der französischen Küche mit ihrer Sorgfalt in bezug auf Details und ihrer jahrhundertealten Tradition konnte er ganz gewiß eine Menge lernen.
»Monsieur Didier?«