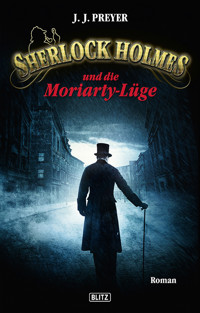4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ein fesselnder Hamburg-Thriller von J. J. Preyer um einen Schriftsteller und seine Dämonen, in dem Vergangenheit und Gegenwart auf brutale Weise vermischt werden. Seit der Schriftsteller Lars Faber nach Hamburg zurückgekehrt ist und an einem Krimi über Serienmorde schreibt, glaubt er das Flüstern seiner verstorbenen Mutter zu hören. Das gleiche Flüstern wie damals, als er noch ein Kind war, und sie über Morde fantasierte – Morde an selbstherrlichen Männern, die Frauen schlecht behandeln. Nach der Veröffentlichung seines Romans ist es, als würde diese grausame Fantasie zur Realität: Brutale Machos werden mit einem Rasiermesser getötet. Der Mörder, so ist sich Faber sicher, wird offenbar durch die Lektüre seines Buches zum Mörder. Faber versucht sich und sein menschliches Umfeld zu schützen, doch zu spät: Sein Onkel wird entführt. Der Täter schickt mit dem Erpresserbrief ein abgetrenntes Ohr. Lars Faber sieht nur noch einen Ausweg aus diesem Albtraum, den er herbeigeführt hat. Er begibt sich in Psychotherapie, in der Hoffnung, das Flüstern der Mutter zum Schweigen zu bringen. Kann er so die Serienmorde stoppen? »Mordflüstern« von J. J. Preyer ist ein eBook von Topkrimi – exciting eBooks. Das Zuhause für spannende, aufregende, nervenzerreißende Krimis und Thriller. Mehr eBooks findest du auf Facebook. Werde Teil unserer Community und entdecke jede Woche neue Fälle, Crime und Nervenkitzel zum Top-Preis!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Ähnliche
J. J. Preyer
Mordflüstern
Hamburg-Krimi
Knaur e-books
Über dieses Buch
Seit der Schriftsteller Lars Faber nach Hamburg zurückgekehrt ist und an einem Krimi über Serienmorde schreibt, glaubt er das Flüstern seiner verstorbenen Mutter zu hören. Das gleiche Flüstern wie damals, als er noch ein Kind war und sie über Morde fantasierte – Morde an selbstherrlichen Männern, die Frauen schlecht behandeln.
Nach der Veröffentlichung seines Romans ist es, als würde diese grausame Fantasie zur Realität: Brutale Machos werden mit einem Rasiermesser getötet. Der Mörder, so ist sich Faber sicher, wird offenbar durch die Lektüre seines Buches zum Mörder. Faber versucht sich und sein menschliches Umfeld zu schützen, doch zu spät: Sein Onkel wird entführt. Der Täter schickt mit dem Erpresserbrief ein abgetrenntes Ohr. Lars Faber sieht nur noch einen Ausweg aus diesem Albtraum, den er herbeigeführt hat. Er begibt sich in Psychotherapie, in der Hoffnung, das Flüstern der Mutter zum Schweigen zu bringen. Kann er so die Serienmorde stoppen?
Inhaltsübersicht
Es geht um Vorspiel, Spannung, Höhepunkt, Entspannung. Ja, ich erlebe manches Mal einen Orgasmus, wenn ich die Welt von einem dieser Männer erlöse. Nicht immer, aber immer öfter. Ich weiß nun, wie ich es anstellen muss, den Gipfel der Lust zu erreichen.
TEIL 1
VORSPIEL
Prolog
Nach langer, allzu langer Zeit höre ich wieder das Flüstern, das meinem Leben Kraft und Fülle verleiht, das ihm ein Ziel gibt. Ein Ziel, endlich wieder ein Ziel neben all den überflüssigen Tätigkeiten tagein, tagaus.
Kein Du-Sollst, Du-Musst, sondern ein Du-Wirst. Du wirst etwas tun, um deinem Leben Sinn zu geben.
Das, so verheißt mir das Flüstern, geschieht in zwei Schritten. Zunächst wird das Hindernis beseitigt, anschließend wird das umgesetzt, was ich mir wünsche.
Logisch, klar.
Das Hindernis sind die verwöhnten Jungs, Mamas Lieblinge, die zu stinkigen alten Böcken werden, zu sogenannten Männern, die sich überall breitmachen, im wahrsten Sinne des Wortes, die in der U-Bahn ihre Beine spreizen, als hätten sie ein Straußenei liegen, wo sich letztendlich gar nicht so viel Großartiges befindet.
Doch damit will ich mich nicht einmal in Gedanken beschäftigen. Das ist überflüssig, lenkt nur vom Ziel ab, von der Beseitigung dessen, was hindert, was hemmt. Bis ich meine Vorstellungen umsetzen kann.
Doch fehlt mir dazu die Kraft. Das Flüstern ist zu leise.
Noch.
Kapitel 1
Das Flüstern der Mutter
Die Uhr schlägt viermal und dann zweimal. Zwei Uhr. Irgendwo in dieser verfluchten Gegend muss es eine Kirche geben. Und ich kann nicht schlafen.
In Wien war alles besser. Keine Turmuhr, Georg an meiner Seite, bis er nicht mehr an meiner Seite war.
Hamburg ist anders. Weniger Wind, ehrlicher. Gnadenlos.
Fremde Heimat. Ich bin zu lange in Wien gewesen, um wieder heimisch zu werden.
Aushäusig war ich, wie das eine dieser überspannten jungen Schnepfen formulieren würde, die sich jetzt im Literaturbetrieb tummeln. Obwohl … die konkrete Autorin ist älter als ich. Ich darf nicht ungerecht werden, mir nicht die Realität zurechtbiegen, keine Entschuldigungsgründe dafür suchen, was ich mir selbst eingebrockt habe.
Eingebrockt! Ein Hamburger würde dieses Wort nicht verwenden. Was würde er sagen? Egal. Es gibt Wichtigeres. Es gilt, zur Ruhe zu kommen.
Ruhe, nachdem ich Georg und Wien verlassen habe. Es gibt ausreichend Gründe dafür, nicht einzuschlafen.
Und doch … ein neuer Tag lauert vor den noch vorhanglosen Mansardenfenstern. Die Wohnung soll eingerichtet werden, der Roman soll, nein, muss weitergeschrieben werden. Ich habe einen Vorschuss dafür erhalten.
Ich muss darauf achten, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen.
Auf die Reihe bekommen. Da ist er wieder, der Hamburger Jargon. In Wien hätte ich mein Leben in Ordnung gebracht – wenn es mir gelungen wäre.
Es geht darum, neue Themen für die Krimis zu finden. Das Thema Lokalkrimis hat sich erschöpft, die Verkaufszahlen und damit die Honorare sinken.
Zu viele andere schreiben Krimis, die in Wien spielen. Soll ich auch literarisch nach Hamburg wechseln?
Dieser eine Krimi muss noch fertiggestellt werden. Dann gilt es, ein neues Thema zu finden.
Lokalkrimis haben den Zenit überschritten.
So wie ich. Einunddreißig. Nicht mehr jung, noch nicht alt. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Und ohne Freund. Ein Schwuler ohne Freund. Auf sich selbst, das heißt auf seine rechte Hand angewiesen, um Lust zu verspüren.
Nicht einmal dazu kann ich mich aufraffen.
Die Uhr schlägt einmal. Viertel nach zwei.
Auf das Schlafmittel verzichte ich. Zum letzten Mal verschreibt er es mir, hat er gesagt, der Doktor mit dem berühmten Namen: Albers. Nicht Hans, sondern Jürgen. Jürgen Albers rät mir, die Psychotherapie fortzusetzen, die ich in Wien begonnen habe. Man kann das nicht einfach mittendrin abbrechen, meint er, und empfiehlt mir Salm. Das ist kein Fisch, sondern ein Therapeut. Hans Salm in der Steinstraße. Und Nüsse essen, das sei gut für die Nerven. Salm und Nüsse.
Den Wiener Therapeuten habe ich bereits vergessen. Ah ja, er hatte einen weißen Bart wie Freud, eine Couch wie Freud und hieß Josef. Ein langweiliger Mensch, der alle Zeit der Welt zu haben schien, während ich zahlte und zahlte und keinen Fortschritt sah.
Nein, das ist ungerecht. Ich bin fortgeschritten, weg von Schorsch, nachdem er mich betrogen hat, weg von Wien. Schorsch, der Arsch. Pars pro toto. Der Teil für das Ganze …
Müßige Gedanken. Dazu hat mir Josef Langensteiner geraten, und ich habe es getan, folgsames Kind, das sich nach einem Vater sehnt.
Egal. Ich bin gesund, hab ein Dach über dem Kopf und für die nächsten Monate ausreichend Geld auf dem Konto. Ich werde es schaffen. Mit oder ohne Salm.
Mit oder ohne Schlaf?
Schlaf wäre schon gut. Aber woher nehmen und nicht stehlen?
Heißt es nicht: Das raubt mir den Schlaf?
Was raubt mir den Schlaf?
Der Umzug von Wien nach Hamburg, das Ende der Beziehung, der Wandel. Der Wandel im Allgemeinen.
Das Leben an sich, denn Leben ist Wandel.
Um die Veränderungen bewältigen zu können, brauche ich Heimat, eine innere Heimat.
Zu Hause sein.
Zu Hause im eigenen Inneren.
Zu Hause.
Das bedeutet … nein, das will ich nicht. Nicht schon wieder. Das ist pervers, unerträglich.
Der Stimme der Mutter lauschen.
Warum nicht? Wenn es hilft.
Lars, flüstert sie – ja, auch mein Name hat mit Arsch zu tun, wenn man schlecht sitzende Zähne hat. Aber die hatte Mutter nicht. Sie war noch jung, damals, jünger, als ich jetzt bin.
Lars, wir halten zusammen, du und ich. Wir brauchen ihn nicht. Er ist überflüssig wie Großmutters Kropf. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Er ist einer der Schlechten, der Überflüssigen. Es war ein Fehler, ihn zu heiraten.
Jetzt schläft er den Schlaf der Dummen, der Ahnungslosen, während ich … ich kann nicht schlafen, und du kannst es auch nicht. Darum erzähl ich dir die Geschichte, wie ich … wie wir ihm das geben, was ihm zusteht. Den Tod, den ewigen Schlaf.
Und weißt du, wie wir das machen?
Nein, dafür bist du zu klein, zu unschuldig. Das muss Mama für dich tun.
Er bekommt etwas ins Bier am Abend. Bier ist bitter, da fällt die Tablette nicht auf. Das hat zwei Vorteile. Erstens wird er dann nicht übergriffig, zweitens … Zweitens wehrt er sich nicht, wenn wir ihm das Kopfkissen gegen den Mund drücken. So lange, bis er … bis er nicht mehr atmet.
Weißt du, was für eine Erlösung das für mich bedeutet? Nein? Doch. Ja, du weißt es. Du willst, dass es Mama gut geht.
Er bedeutet dir nichts. Er berührt dich kaum, er nährt dich nicht. Er ist nie zu Hause.
Er röchelt noch, verkrampft Arme und Beine und entspannt sich. Für immer.
Es ist vorbei.
Jetzt erst beginnt die Arbeit für Mama. Ihn an der Türklinke aufhängen, den Abschiedsbrief auf die Couch legen.
Schreien, weinen, die Ambulanz rufen.
Obwohl das alles langweilig ist. Weißt du, was Mama wirklich tun möchte? Ah, du lächelst, natürlich weißt du es.
Mama möchte ihm den Hals durchschneiden, mit seinem verdammten Rasiermesser. Aber das geht nicht. Larschen braucht Mama. Mama darf nicht ins Gefängnis.
Ich bin Witwe, du Halbwaise. Die lustige Witwe, der glückliche Waisenjunge. Und dann leben wir zufrieden immerdar.
Ja, Mama erzählt mir die Geschichte, die ich niederschreiben, mit der ich meinen Lebensunterhalt verdienen werde. Morde an Männern. Serienmorde.
Gute Nacht, Mama.
Gute Nacht, Larschen.
Es ist halb acht. Höchste Zeit, aufzustehen und die ersten fünf Seiten zu schreiben. Die tägliche Dosis, ganz gleich, wie ich mich fühle.
Und wie fühle ich mich heute, am Montag, dem 14. Januar 2019, dem Tag, an dem es zu schneien begonnen hat, obwohl es in Hamburg selten schneit, im Gegensatz zu Wien?
Hamburg ist freundlicher als Wien?
Ob das stimmt, entscheide ich nach dem Kaffee. Frisch gemahlen, aus der Siebträgermaschine mit einer dichten hellbraunen Crema, nach Schokolade und Kirschen schmeckend.
Ohne Milch, ohne Zucker.
Kaffee pur aus der Speicherstadt-Rösterei.
Wobei … wobei auch der Kaffee, den Georg gemacht hat, nicht zu verachten war. Das konnte er. Und das andere auch. Der Sex mit ihm war ein Erlebnis.
Aber Sex ist nicht alles. Eine Beziehung besteht aus mehr als Sex. Vor allem ist mir Treue wichtig.
Verlässlichkeit.
Die Mutter war verlässlich in all ihrer Labilität. Verlässlich labil, verlässlich vorhanden. Die Großmutter war erwachsen, die Mutter war Kind geblieben.
Und Kinder sind sie alle, die Mörder in meinen mittlerweile sieben Romanen. Das heißt sechs Romanen. Wienmord I, II, III, IV, V, VI. Mit römischen Ziffern versehen, auf Vorschlag der Lektorin.
Der siebte sollte bis Ende Februar 2020 fertig werden – obwohl weder der Verlag noch ich das wirklich wollen.
Ich lass das vorderhand liegen und schlag ihnen den Serienmörder-Roman vor.
Ich hab es satt, willenlos zu gehorchen. Ich bin zu brav.
Ein Depp, wie man in Wien sagt. Ein braver Depp, ein Musterschüler, der es allen recht machen will.
Um gerecht zu sein: Ich bin mir nicht sicher, ob Georg wirklich untreu war. Die Indizien deuteten in diese Richtung. Keine Lust zur Lust, immer weniger Treffen …
Und ich bin mir nicht sicher, ob Mutter tatsächlich den Tod meines Vaters herbeifantasiert hat.
Josef Langensteiner, mein Wiener Therapeut, war der Meinung, dass ich das auf die Mutter verschoben, nein, projiziert habe, was ich bei mir nicht akzeptieren konnte. Ödipuskomplex. Der Sohn, der den Vater auslöscht.
Auf meinen Einwand, dass die ödipale Phase im Leben eines Kindes wohl nicht im Kinderwagen beginne, schwieg er. Vielsagend. Seine Methode, mich zum Denken zu bringen.
Egal. Die Fantasien der Mutter werden in diesem neuen Roman eine Rolle spielen, sind Grundlage dieses Krimis, an dem ich sofort und ohne jeglichen Aufschub zu schreiben beginne. Wienmorde VII lege ich vorderhand auf Eis. Im Herbst sehen wir weiter.
Wir?
Ich.
Also:
»Der Eintritt in die Spiegelwelt ist nicht immer möglich. Oft – eigentlich meistens – ist der Spiegel nur Spiegel, mit dem Bild ihres Gesichts, ihres Körpers. Ein Bild, das noch Spuren der Kindheit erkennen lässt und Spuren der Taten, die sie von den meisten Menschen unterscheiden. Denn die meisten Menschen töten keine anderen Menschen. Außer Mücken, Käfer oder im Krieg oder …
Wenn man genauer hinsieht, verschwimmen die Grenzen, die Taten verlieren ihre Einzigartigkeit. In der Generation der Großväter haben viele getötet, im Zweiten Weltkrieg, und sind nach Hause zurückgekehrt und haben ihr Leben zu Ende geführt.
Heute und jetzt ist es möglich, die Spiegelwelt zu betreten. Die Augen verraten es. Wissende, klare, tiefe Augen. Braun, dunkel, tief.
Der Körper der eines Panthers, eines schwarzen Panthers. Mit Reißzähnen, tödlichen Krallen.
Es ist nicht wichtig, einen Grund zu finden, um die Zähne und die Krallen einzusetzen. Es gehört zum Leben eines Panthers, das zu tun. Zu töten und zu fressen. Zu verschlingen, Blut zu lecken.
Und wie ist das beim Menschen? Es liegt in uns, in unserer Entwicklung, zeigt sich bei den einen stärker als bei den anderen.
Bei der Person, die sich entschlossen hatte, zu töten, war es stärker ausgeprägt als beim Durchschnitt. Und doch musste sie danach suchen. Der Zugang war nicht leicht. Sie wollte sich von diesen Lügen befreien, zum Kern der Dinge vordringen, zur Reinheit ihres Daseins … oder welche Phrasen man auch immer dafür verwenden konnte.
Die Person wollte töten, ohne es zu reflektieren.«
Okay. Der Anfang ist gemacht. Keine fünf Seiten. Dennoch genug für heute. Das Schreiben ist eine harte, unerquickliche Tätigkeit. Das bin nicht ich. Die Person deckt sich nicht mit meiner Persönlichkeit, obwohl ich sie gut kenne.
Ich sollte die Therapie fortsetzen.
Das Handy läutet. Ob es Georg ist, der mich vermisst, wie ich ihn nicht vermisse?
Nein, Onkel Frank ruft aus dem Büro an, ob es mir gut geht. Er hat mitbekommen, dass ich nicht viel geschlafen habe.
Ich entschuldige mich für die Unruhe, die ich in sein Haus bringe.
Er meint, das sei kein Problem, ich könne in meiner Wohnung machen, was ich wolle.
Ob ich Zeit hätte, mit ihm eine Tasse Kaffee zu trinken?
Ich kleide mich an, verlasse meine Mansardenwohnung in Onkel Franks Villa, begebe mich nach unten, ins Erdgeschoss, in seine Steuerberaterpraxis, in der es nach Kaffee duftet. Kaffee, den Frau Honsig, seine Sekretärin, die er Honig nennt, zubereitet hat. Mit Schnittchen.
Schnittchen. In Wien heißt das Sandwiches. Ach nein, natürlich nicht. Belegte Brötchen.
»Alles in Ordnung?«, fragt der Bruder meiner Mutter.
»Ich bin noch nicht ganz in Hamburg angekommen«, antworte ich und denke, dass das gut klingt.
»Verstehe.«
»Entschuldige, dass ich dich durch mein nächtliches Auf und Ab gestört habe.«
»Du hast mich nicht gestört. Auch ich schlafe schlecht«, antwortet der Mann, der so aussieht, wie ich in dreißig Jahren aussehen könnte.
Das Haar grau geworden, die Augenbrauen buschig, die Augen nicht mehr ganz so braun, wie sie gewesen sind. Tiefe Falten durchfurchen die Wangen. Falten, die das Rasieren erschweren; in ihnen wachsen einige graue Barthaare. Haare auch an den Ohren.
Soll ich den Onkel darauf aufmerksam machen?
Einen Teufel werde ich tun. Ich kümmere mich um mein Leben, er sich um seines.
Und das sage ich ihm, als er mir vorschlägt, mir eine Frau zu suchen.
»Du weißt, dass ich schwul bin.«
»Ich weiß, dass du dir das einbildest, weil du den bequemen Weg gehen willst.«
»Den du verlassen hast?«, frage ich.
»Den ich verlassen hatte.«
»Das heißt …«
»Nein, heißt es nicht. Ich war und bin nicht schwul. Es geht um anderes.«
»Gut.«
»Ich möchte, dass du glücklich bist.«
»Es genügt, dass du mich bei dir wohnen lässt, bis ich … bis ich …«
»Du bist sehr willkommen. Vergiss nicht auf die Schnittchen!«
Nun warte ich darauf, was er eigentlich will, abgesehen davon, dass er wieder einmal klarmacht, dass er nicht will, dass ich schwul bin.
Seine Finger verraten ihn; er steht unter Druck. Sie sind unruhig, umklammern die Tasse, drehen sie, spielen mit dem Henkel.
Das Rauchen hat er sich abgewöhnt, doch riecht er eindeutig nach Zigaretten.
»Du rauchst wieder?«, frage ich, um von meiner Person abzulenken.
»Kaum. Ich bemühe mich, es nicht zu tun.«
»Was willst du mir sagen?«, frage ich.
Er lächelt und wirkt mit einem Mal jünger. Der Mutter schaut er nicht ähnlich. Sie war fülliger, blond, hatte blaue Augen. Wie die Großmutter.
Anna. Beide.
»Brauchst du Hilfe?«, fragt er.
»Du hilfst mir mit der Wohnung. Wie gesagt.«
»Und sonst?«
»Ich werde meine Therapie fortsetzen.«
»Ah ja.«
»Der Rest wird sich ergeben.«
»Du kannst dir das leisten?«
»Noch.«
»Kann ich …«
»Nein danke. Wenn mich die Schriftstellerei nicht ernährt, muss ich …«
»Was?«
»Muss ich mir etwas anderes suchen. Aber sie ernährt mich.«
»Gut. Du weißt, du bist nicht allein«, sagt er und überlegt, was er mir noch mitteilen möchte. Es scheint etwas Freundliches zu sein, denn er kämpft gegen ein Lächeln an und streichelt mit den Fingern der linken Hand die Kaffeetasse, die er in der Rechten hält.
Ein freundlicher, hilfsbereiter Mensch, zumindest mir gegenüber. Als Steuerberater, hört man, kann er ziemlich zielstrebig sein, was seine eigenen und die Interessen seiner Klienten betrifft.
Ob er wirklich nicht schwul ist? Seine Finger sind viel gepflegter als meine, die Fingernägel mit farblosem Lack überzogen. Dezent, doch alles viel zu viel, wie das Parfüm oder Rasierwasser, das beinahe den Zigarettengeruch übertönt.
Mag ich ihn? Schwer zu sagen. Es ist nicht Zuneigung auf den ersten Blick, war es nie, obwohl er sich immer um mich bemüht hat und jetzt glücklich ist, mir helfen zu können.
Egal. Ich bin froh, dass er …
Was hat er gesagt?
»Entschuldige. Ich war in Gedanken. Könntest du das bitte wiederholen?«
»Lars, der Träumer.« Der Onkel lächelt jetzt tatsächlich. »Ich sagte, dass es mir wichtig ist, dass du in deiner Arbeit weiterhin erfolgreich bist. Nein, nicht, damit du für deine Wohnung bezahlst. Du bist und bleibst mein Gast …«
»Das ist sehr großzügig, aber …«
»Sie wäre teuer.«
»Gut. Danke. Ich zahle fünfhundert Euro. Mehr ist im Moment einfach nicht drin.«
»Nein. Du bist, wie gesagt, mein Gast und schreibst deine großartigen Krimis. Und was ich eben gesagt habe, betrifft deine Romane.«
»Ja?«
»Du hast es wirklich nicht gehört?«
»Entschuldige.«
»Ich habe einen Klienten, der auch Krimis veröffentlicht. Nein, kein Autorenkollege. Ein Verleger. Ich weiß nicht, ob du vom Orbis-Verlag gehört hast.«
»Natürlich. Das ist einer der wichtigsten Krimi-Verlage.«
»Niko Görz wäre an dir als Autor interessiert.«
»Oh.«
»Lässt sich da etwas machen?«
»Im Moment schreibe ich noch für Noah. Aber …«
»Denk darüber nach! Ich kann ein Treffen arrangieren.«
»Vielen Dank.«
In diesem Moment öffnet sich die Tür zum Arbeitszimmer meines Onkels, und ein mir sehr alt erscheinender Mann tritt ein, ohne anzuklopfen. Ich weiß, dass er für den Onkel arbeitet, und höre nun, dass Dr. Haberlander der Büroleiter der Kanzlei Amsinck ist.
»Ich brauche dringend deine Meinung im Fall Kollich«, sagt er und nickt mir freundlich zu.
»Alles klar. Ich bin dann weg«, sage ich.
Der Onkel wünscht mir einen schönen Tag und fragt mich, ob ich heute schon gemordet habe.
»Ich habe schon geschrieben, brauch aber Anregung, um weiterzumachen.«
»Wirst du über Hamburg schreiben?«
»Ich habe vor, Hamburg auf mich wirken zu lassen«, bejahe ich. »Zu Fuß.«
Er ist mir zu nahe. Ich muss weg von ihm. Er nimmt mir die Luft, die ich zum Leben, zum Denken brauche. Er erdrückt mich mit seinen Ideen und Vorschlägen und dem Wunsch, dass ich weiterschreiben soll.
Natürlich will ich das, ich kann ja sonst nichts. Aber ohne Drängen von außen. Obwohl natürlich auch das hilft. Wenn ich mir vorstelle, wie er nahe, immer näher, zu nahe kommt, wie er in meine Haut eindringt, als heiße, brennend heiße Flüssigkeit, sich in mir verteilt, in meinem Körper verteilt, als Welle, die Angst und Schrecken – und Lust – bereitet. Eine Art Orgasmus. Und dann … Wohlbefinden. Ich bin nicht mehr ich selbst. Ich bin ich und er. Und habe nun die Kraft, ihn wie eine Nadel … wie eine Injektionsnadel, die …
Heroin.
Ein einziges Mal. Dasselbe Gefühl. Orgasmus und dann die große Ruhe, die es mir ermöglicht, alles zu tun.
Ich entferne ihn. Ich töte ihn. Es darf kein zweites Mal passieren. Ich töte den Eindringling in meine Seele und gehe heim, das aufzuschreiben.
Dann. Später.
Noch sitze ich auf der feuchten Bank an der Binnenalster, blicke auf die Fontäne des Springbrunnens, die gegen den grauen Himmel hell, sehr hell, beinahe weiß wirkt. Es riecht nach Meer, obwohl das Meer weit weg ist. Die Möwen verstärken das Meergefühl.
So weit weg ist das Meer nun auch wieder nicht, finde ich und denke, dass es schön wäre, wirklich am Meer zu sein.
Ich beschließe, nach Cuxhaven zu fahren. Dort war ich mit Großmutter und … und Erich.
Nordseeheilbad Cuxhaven. Im Winter? Im Winter. Um neues Altes zu sehen, wegzukommen vom Schreiben, vom Onkel. An Großmutter denken und an Erich.
Der Navigator meint, dass ich in zwei Stunden dort bin. Wenn ich mich wie die Elbe Richtung Nordwesten bewege. Wenn ich meinen geleasten Mercedes – das kleinste Modell – Richtung Nordwesten bewege und der Stimme des Navigators folge, einer männlichen Stimme, denn von Frauen lasse ich mir nichts vorschreiben. Und von Männern nur in Notlagen. Ich kann Frank ja umbringen. Am Notebook. Ja, ein Mann wie er wird das nächste Opfer des Serienmörders, der ausschließlich Männer tötet.
Cuxhaven im Winter. Ohne Schnee. Die Sonne hat die Düsternis durchdrungen. Das Wasser der Elbe und der Nordsee hat sich zurückgezogen, benetzt nur den dunklen Boden, der im Sonnenlicht spiegelt, blendet.
Eine Reiterin und ihr wattbodenbrauner Gaul bringen Leben in die verlassene Landschaft, die beim zweiten Blick so verlassen nicht ist.
Möwen kreischen hysterisch; ein in Decken gehüllter Mann sitzt in einem Strandkorb im Schutz der weiß gestrichenen Mole und liest. Nein, kein Buch. Er liest von einem elektronischen Gerät, das ebenfalls in der Sonne spiegelt.
Ich will hier nicht lesen, nicht schreiben. Ich will die Sonne spüren, das Meer sehen, die salzige Luft riechen.
In Wien gibt es kein Meer. Nur den Neusiedler See in einiger Entfernung. Den rundum verbauten See, an dessen Wasser man so schwer herankommt.
Im Gegensatz zu hier. Hier liegt alles am Wasser.
Aber der Reihe nach …
Es ist schön hier. Hier war ich mit Großmutter und Erich. Ich bleibe vorerst im Haus des Onkels, weise ihn aber zurück, wenn er sich zu sehr in mein Leben einmischt. Den Verleger werde ich aufsuchen. Vielleicht interessiert er sich für den neuen Roman.
Und die Therapie. Darum kümmere ich mich morgen.
Nein. Gleich jetzt. Hier und jetzt setze ich den ersten Schritt und rufe den Therapeuten an.
Die Nummer hat mir Dr. Albers auf seine Visitenkarte geschrieben. Salm und die Nummer.
Ich tippe sie in mein Smartphone und warte, schaue auf das Meer und atme tief durch, bis ich auf Anrufen drücke.
»Hier ist die Praxis Doktor Salm. Sie erreichen mich direkt wochentags von zehn bis neunzehn Uhr, immer fünf Minuten zur vollen Stunde. Gerne rufen wir zurück. Hinterlassen Sie Ihre Nummer!«
Es ist halb zwölf. Drei Minuten nach halb zwölf. Ob ich ihn um fünf vor zwölf anrufen soll? Oder soll ich seine Nichterreichbarkeit als Zeichen von oben deuten, dass ich darauf verzichte …
»Salm. Was kann ich für Sie tun?«
Die Stimme klingt angenehm.
Kapitel 2
Die Stimme des Therapeuten
Salms Stimme ähnelt der meines Vaters, wie ich sie in Erinnerung habe. Neben jugendlich hellen Obertönen ein angenehmer Bass. Ich spüre das Vibrieren von Papas Körper, während er redet und mich an sich drückt. Ich kann mich an ihn erinnern. Ich war elf, als er starb.
Ich möchte … muss den Mann kennenlernen, der mir gerade erklärt, dass er am Dienstag Zeit für mich hat, und zwar von 14 bis 14 Uhr 50. Eine Therapiesitzung dauert fünfzig Minuten und kostet 120 Euro. Seine Methode ist die Psychoanalyse in der traditionellen Form.
»Sie müssen sich also auf eine längere Behandlungszeit einstellen, dafür erreichen wir dabei das Zentrum Ihrer Persönlichkeit.«
Ich sage, dass ich mir das vorstellen kann, und spüre eine beinahe erotische Anziehung. Eine Nähe, wie ich sie bei Langensteiner in Wien nie gespürt habe.
Das kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Der Mann ist mir nicht gleichgültig, und ich könnte einen Narren aus mir, mich lächerlich machen, wenn er merkt, was mit mir los ist.
Also erkläre ich ihm, dass ich homosexuell bin und davon nicht geheilt werden will.
»Das überlassen wir dem Verlauf der Therapie. Wir sehen einander.«
Dann legt er auf, und ich stehe da, in der Sonne, an der Nordsee und atme tief durch. Das Abenteuer kann beginnen. Ich habe einen ersten Schritt getan, in Hamburg wieder heimisch zu werden.
Der nächste Schritt: Ich trinke weder Bier noch Wein noch Kaffee, sondern, der Jahreszeit und dem frischen Wind entsprechend, einen steifen Grog. Obwohl ich mit dem Auto unterwegs bin. So schlimm wird es schon nicht werden.
Also nichts wie hinein in die gute Stube, hinein in Metschers Stube, die in Form einer Schiffskajüte in einem neu gebauten Haus untergebracht ist.
Dazu die Roastbeefplatte und ein Gespräch mit der Kellnerin, die ungeniert mit mir flirtet.
Ich gebe ihr das, was man Frauen so gibt. Aufmerksamkeit, ein Lächeln, freundliche Worte.
Sie fragt mich, ob ich auf Urlaub hier bin.
»Nein. Nur ein Abstecher. Ein Nachmittag am Meer. Aus Sehnsucht nach dem Meer, als Versuch, hier wieder heimisch zu werden.«
»Sie sind Bayer?«, fragt sie. Ich sehe mich in den Spiegeln der Bar den Kopf schütteln, rucke und rüttle ihn hin und her – wie ein Vogel, ein übereifriger Vogel.
Eine schlanke Amsel. Kein Adler, nicht einmal eine Taube.
Zu brav, zu folgsam.
Egal. Die Kellnerin ist nett zu mir, also bin ich nett zu ihr und frage: »Und Sie? Ist Cuxhaven Ihr Heimatort?«
»Seit drei Jahren. Ich komme aus dem Osten.«
Damit meint sie die ehemalige DDR.
»Ostsee«, erklärt sie noch. »Ich bin mit dem Meer vertraut, könnte nicht ohne Meer leben.«
»Ich habe lange Zeit in Wien gelebt, in Österreich«, füge ich überflüssigerweise hinzu. »Aber ich stamme aus Hamburg und bin zurückgekehrt.«
»Hamburg, ja Hamburg«, meint die Dunkelhaarige mit der offenbar vom Rauchen dunklen Stimme. »Nicht meine Stadt. Ohne Höhepunkte«, sagt sie und errötet.
Ich stelle sie mir vor, wie sie mit einem Seemann im Bett liegt, wie sie vor Lust schreit, die hellblauen Augen – ja, sie hat hellblaue Augen –, wie sie die Augen aufreißt, verstummt und …
Zum Glück betreten zwei Männer die Gaststube. Sie wendet sich den beiden zu, fragt, was sie bringen darf, und ich warte auf den Grog. In die Spiegel blicke ich nicht mehr.
Ich sitze in Salms Wartezimmer, einem engen Raum mit ausrangierten Möbeln, die an eine Studentenbude erinnern. Altes IKEA-Gerümpel, das seine Schuldigkeit getan hat. Hans Salm scheint beruflich noch nicht im Erwachsenenalter angekommen zu sein.
Während ich warte, dass sich die Tür zum Therapieraum öffnet, stelle ich ihn mir als einen etwas dicklichen Mann mit blondem Haar und blauen Augen vor. Blondem Haar, das an der Stirn schütter wird. Er kämmt es nach vorne und verdeckt damit die beginnende Glatze. Er trägt eine getönte Brille, um seine Augen, seine Gefühlsregungen zu verbergen, denn ganz hat er sich noch nicht im Griff, hat er sich noch nicht an seine Rolle als Therapeut gewöhnt, der er seit … seit dem Jahr 2016 ist, wie die Urkunde an der Wand verrät.
Dr. Hans Salm. Psychoanalytiker.
Anal. In der Berufsbezeichnung verbirgt sich das Wort »anal«, denke ich und schäme mich. Und erröte.
Die Tür öffnet sich. Dr. Salm schüttelt meine rechte Hand und bittet mich in seinen Arbeitsraum.
Der Mann sieht genau so aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe, aber das ist egal. Seine Stimme … seine Stimme elektrisiert mich. Er hat zwei Sessel aufgestellt und sitzt mir gegenüber.
»Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich lese Ihre Krimis und schätze diese sehr«, sagt er.
»Dann wissen Sie ja schon eine Menge über mich.«
»Vermutlich. Doch gehe ich davon aus, dass Sie mit keiner Ihrer Figuren völlig ident sind.«
»Das stimmt.«
»Ich denke, wir gehen den direkten Weg. Den Weg außerhalb der Fiktion. Erzählen Sie von sich, wenn das für Sie passt.«
»Es passt. Deshalb bin ich ja gekommen.«
Er schweigt und blickt mich durch die getönte Brille an.
»Der Grund, warum ich komme, ist der Rat meines Arztes. Ich leide an Schlafstörungen, und Doktor Albers meint …«
»Ja?«
»Doktor Albers meint, ich solle meine in Wien begonnene Therapie fortsetzen. Und ich meine das auch.«
»Wollen Sie mir erzählen, was die Therapie in Wien gebracht hat?«
»Ist nicht der Kern jeder Therapie die Einsicht, dass die Mutter an allem schuld ist?«, sage ich und lächle.
»Erzählen Sie von Ihrem Vater!«, entgegnet er und lächelt auch.
»Oh«, sage ich und schnappe nach Luft.
Der Therapeut schweigt.
»Sagen Sie etwas!«, fordere ich ihn auf.
»Warum?«
»Ihre Stimme …«
»Ja?«
»Ihre Stimme erinnert mich an die meines Vaters.«
»Was sagt Ihr Vater? Was sagt die Stimme?«, fragt er.
»Sie sagt nichts Bestimmtes. Sie ist da. Einfach da.«
»Und Ihr Vater ist nicht mehr da?«
»Er hat mich verlassen«, sage ich, und meine Stimme klingt wie die eines kleinen Kindes.
»Das ist traurig«, sagt Salm. »Und Sie haben, wie ich das verstehe, Wien verlassen und Ihren dortigen Therapeuten.«
»Und meinen dortigen Partner. Er war mir untreu.«
Hans Salm nickt und schweigt.
»Ich möchte meine Therapie fortsetzen, weil … weil ich an Schlafstörungen leide.«
Salm nickt erneut, schreibt etwas auf einen Block, den er in der linken Hand hält, und meint dann: »Sie wissen ja, dass die Psychoanalyse eine Angelegenheit ist, für die man Geduld aufbringen muss.«
Nun nicke ich, und er fährt fort: »Daher ist es wichtig, rasch etwas gegen Ihre Schlaflosigkeit zu unternehmen. Ich bin kein Arzt, arbeite aber mit einem Psychiater zusammen …«
»Ich gehe zu keinem Psychiater.«
»Lassen Sie mich ausreden!«
Oh, der Herr gibt sich streng, seine blauen Augen funkeln.
»Es gibt Medikamente, die wunderbar wirken, ohne süchtig zu machen. Und die soll Ihnen mein Kollege verschreiben. Ob Sie hingehen oder nicht, ist Ihre Sache. Nur möchte ich, dass das Thema Schlaflosigkeit nicht im Vordergrund steht.«
»Alles klar.«
»Okay. Ich kann es mir vorstellen, mit Ihnen zu arbeiten. Hier und außerhalb dieser Praxis.«
Ich blicke ihn verwundert an.
»Ich werde Ihnen Hausaufgaben geben. Sie sind Schriftsteller und schreiben zwischen den Sitzungen auf, was Sie seelisch bewegt. Das übermitteln Sie mir entweder per Mail, oder Sie bringen mir den Ausdruck mit.«
»Ich weiß nicht …«
»Meine Bedingung für die gemeinsame Arbeit.«
»Oh.«
»Und jetzt die Frage an Sie: Möchten Sie mit mir arbeiten?«
Ich denke einen Moment nach, dann sage ich: »Vereinbaren wir eine Probezeit!«
»Das kann ich mir gut vorstellen«, sagt Salm, und seine Augen wirken mit einem Mal freundlich, sehr freundlich. »Das lässt sich machen. Ich schlage eine Frist von zwei Monaten vor.«
»Gut.«
»Am Anfang werden wir ein Ziel der Analyse vereinbaren. Was wollen Sie erreichen?«
»Ich will …«
»Lassen Sie sich Zeit«, unterbricht er mich. »Das sollte gründlich überlegt werden.«
»Und Sie? Haben Sie ein Ziel? Ich meine, was unsere künftige Arbeit betrifft«, frage ich ihn.
»Die Aufgabe des Analytikers besteht darin, den Klienten auf seinem Weg zu begleiten, zu verhindern, dass er sich in Nebensächlichkeiten verzettelt, ihn sanft auf Kurs zu halten. Und Geduld zu haben.«
Und dabei zu kassieren, denke ich, verschweige das jedoch. Immerhin bin ich freiwillig gekommen.
Dann erwähnt er die Regeln, die ich schon von Langensteiner her kenne, versäumte Therapiestunden und die Verschwiegenheitspflicht des Therapeuten betreffend.
Minuten später stehe ich, von der Sonne geblendet, im Freien und bedauere, mit dem Wagen gekommen zu sein. Ich brauche Zeit, bevor ich ein Fahrzeug lenke, so sehr beschäftigt mich das, was wir besprochen haben.
Also entschließe ich mich dazu, in Zukunft zu Fuß zu kommen, es sei denn, es regnet, was in dieser Stadt leider meist der Fall ist. Bis auf jetzt. Jetzt scheint die Sonne. Und das freut mich. Es freut mich auch, dass Bewegung in mein neues Leben gekommen ist, und ich wandere die Straße entlang auf eine Art Park zu, der sich als Wildnis inmitten der Vorstadt erweist, als angenehm ungeregelte Fläche, auf der Menschen spazieren gehen. Mit Hunden und allein.
Ob ich mir einen Hund zulegen soll?
Nichts überstürzen. Es gilt, Prioritäten zu setzen.
Ja, ich werde zwischen den Therapiestunden schreiben und verbinde das mit meiner beruflichen Tätigkeit. Ich schreibe den besten Krimi, der mir je gelungen ist. Mit mir als Erzähler, in der Ich-Form, im Präsens. Serienmorde.
Und ich … ich muss mich endlich darum bemühen, mein Notebook hier in Gang zu bringen, das heißt, das Netzwerk oder was auch immer. Weder das Internet noch der Mailverkehr funktionieren, obwohl Onkel Frank WLAN im Haus hat. Ich darf das nicht länger anstehen lassen, allein schon, um wieder Kontakt zum Verlag zu haben, der sich, seit ich in Hamburg bin, auf Telefongespräche beschränkt hat.
Frank kennt sich bei diesen Computersachen selbst nicht aus, kennt aber einen Fachmann. Der soll sich um mein Notebook kümmern.
Als der junge Mann mich mit Moin, Moin begrüßt, fühle ich mich in die Vergangenheit zurückversetzt, als ich mich als Hamburger fühlte, in jene Zeit, in der …
Ja, Mick Goldmann, der etwas pummelige IT-Techniker, der mein Notebook mit dem Netzwerk des Onkels verbindet, erinnert mich an Erich, meinen ersten richtigen Freund.
Wir waren zwölf, dreizehn, vierzehn, rauchten heimlich und …
Okay. Das ist jetzt nicht das Thema. Goldmann ist hier, um zu arbeiten, nicht um …
»Trinken Sie mit mir eine Tasse Kaffee?«, frage ich.
»Sehr gerne.«
Ich bereite Kaffee und suche nach Essbarem, finde aber nur eine Packung – Prinzenrolle. Nicht ganz unpassend. Der pummelige Prinz an meinem Notebook gefällt mir.
Er trägt einen leuchtend roten Stein im linken Ohr und nimmt viel Zucker und Milch und gleich zwei Stück Keks auf einmal. Mit der rosaroten Zunge eines Kätzchens leckt er sich über die Lippen, während er sich weiter auf mein Notebook konzentriert.
»So, das Internet funktioniert«, sagt er. »Ich mag auch die Filme von Pornhub.«
»Oh, Sie haben …«
»Ihr Browser verrät das. Aber es bleibt unter uns. Broke Straight Boys.«
»Das ist mir jetzt aber peinlich«, sage ich.
»Kein Problem. Ich bin auch schwul.«
Ich beschließe zu schweigen.
»Das Mailprogramm läuft auch wieder. Da schau ich lieber nicht hinein.«
»Da gibt es nichts zu sehen.«
»In keiner Beziehung?«
»Derzeit nicht. Was mir aber wichtig ist. Sie müssen mein Netzwerk von dem meines Onkels trennen.«
»Natürlich. Sie bekommen Ihr eigenes Kennwort und kennen seines nicht.«
»Sie schon?«
»Er hat es sicher verändert. Darf ich etwas vorschlagen? Sie können es jederzeit ändern.«
»Nur zu!«
»Wolf54.«
»Gut. Wie kommen Sie darauf?«
»Der Name und das Alter Ihres Ermittlers.«
»Sie kennen meine Krimis?«
»Ich liebe sie.«
»Danke.«