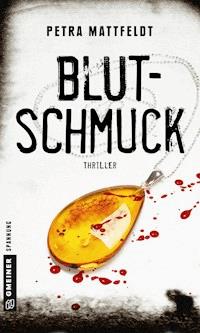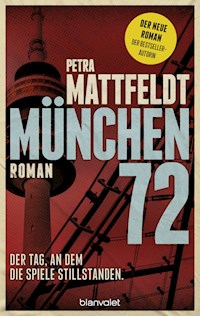
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
München 72 - es sollen die heiteren Spiele werden, doch sie enden in einer Tragödie. Spannend, eindringlich, fiktiv - der Roman, der die Ereignisse greifbar macht.
München, 1972: Die „heiteren Spiele“ beginnen mit Jubel und Freude in der bayrischen Landeshauptstadt. Die Stimmung ist ausgelassen, Frieden und Fröhlichkeit überall spürbar. Angelika Nowak könnte kaum glücklicher sein. Sie wurde als einzige Bogenschützin ausgewählt, die DDR bei den olympischen Spielen zu vertreten. Schnell freundet sie sich mit Roman an, einem Ringer der israelischen Mannschaft. Doch dann passiert etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Am Morgen des 5. Septembers verändert ein Terroranschlag alles, und Roman ist einer der Geiseln …
Petra Mattfeldt erzählt aus der Sicht von fünf fiktiven Figuren, die auf realen Personen beruhen, die Ereignisse um das Olympiaattentat. Sie beschreibt ihre Gefühle, Ängste, Träume und Wünsche während der olympischen Spiele und zeichnet ein spannendes, faszinierendes und erschütterndes Porträt des schwärzesten Tages der Olympiageschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Ähnliche
Buch
München, 1972: Die »heiteren Spiele« beginnen mit Jubel und Freude in der bayrischen Landeshauptstadt. Die Stimmung ist ausgelassen, Frieden und Fröhlichkeit überall spürbar. Angelika Nowak könnte kaum glücklicher sein. Sie wurde als einzige Bogenschützin ausgewählt, die DDR bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Schnell freundet sie sich mit Roman an, einem Ringer der israelischen Mannschaft. Doch dann passiert etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Am Morgen des 5. Septembers verändert ein Terroranschlag alles, und Roman ist eine der Geiseln …
Petra Mattfeldt erzählt aus der Sicht von fünf fiktiven Figuren, die auf realen Personen beruhen, die Ereignisse um das Olympia-Attentat. Sie beschreibt ihre Gefühle, Ängste, Träume und Wünsche während der Olympischen Spiele und zeichnet ein spannendes, faszinierendes und erschütterndes Porträt des schwärzesten Tages der Olympiageschichte.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
PETRA MATTFELDT
MÜNCHEN72
ROMAN
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
© 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Kristina Lake-Zapp
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com (Simon Hamacher, aerial333, Piman Khrutmuang)
NG · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN978-3-6412-9587-5V001
www.blanvalet.de
Ich widme dieses Buch den Teilnehmern des israelischen Teams der Olympischen Spiele 1972 und ihren Angehörigen.
Geleitwort
Es gibt viele Bücher, die die Ereignisse um die Olympischen Spiele von 1972 in München beleuchten. Manche reißerisch, mit einer Ausschlachtung à la Hollywood, andere nah an der Realität oder eben als Sachbuch mit einer chronologischen Auflistung der Ereignisse.
Warum also dieses Buch?
Die Antwort ist einfach: Egal, was ich lese, mir fehlen die verschiedenen Perspektiven. Ich maße mir nicht an, nachvollziehen oder gar nachfühlen zu können, was wer empfunden hat. Ich glaube, die Wahrnehmung eines jeden Einzelnen – ganz gleich, ob er unmittelbar dabei war oder die Ereignisse nur über den Fernseher verfolgte –, veränderte sich vom ersten Moment an und war schon einen Tag später nicht mehr dieselbe.
Aus diesem Grund sind die in diesem Roman handelnden Personen frei erfunden, basieren jedoch auf den Erzählungen und Berichten derer, die dabei waren und denen ich am Ende dieses Buches meinen Dank ausspreche.
Ich habe versucht, die Ereignisse realitätsgetreu wiederzugeben, und hoffe, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst und auch deren Angehörigen gerecht zu werden. Es ist meine persönliche Sichtweise auf etwas, was Deutschland verändert haben sollte – einzig bleibt die Frage, ob es genug verändert hat.
MÜNCHENSamstag, 26. August 1972, 14.58 Uhr
So lange habe ich auf diesen Tag hingefiebert. Und nun, da er endlich gekommen ist, fühlt er sich unwirklich an.
ANGELIKANOWAK
Sie war in Versuchung, die schweißnassen Hände an ihrer grünen Hose abzuwischen. Doch Angelika riss sich zusammen. Noch zwei Minuten, dann würden die Ersten sich in Bewegung setzen und in das Stadion Einzug halten. Allein bei dem Gedanken bekam sie eine Gänsehaut.
»Wird schon«, sagte Monika Klinger aufmunternd, eine der Leichtathletinnen, die auch schon an den Olympischen Spielen vor vier Jahren in Mexiko teilgenommen hatte.
Angelikas Hals war zu trocken, als dass sie auch nur einen Ton hätte hervorbringen können. Also nickte sie stumm.
Die Leichtigkeit, die sie in den letzten Tagen gespürt hatte, war wie weggeblasen. Jetzt wurde es ernst. Es würde wirklich losgehen, die Spiele würden beginnen. Seit fünfzig Jahren wäre das Bogenschießen erstmals wieder olympische Disziplin und sie die Einzige, die für das Team der DDR antrat. Die Hoffnungen – oder besser die Erwartungen, die auf ihr lasteten – waren gewaltig.
Sie würden an zweiundzwanzigster Stelle in das Olympiastadion einlaufen. Die Männer in schwarzen Hosen, blauen Sakkos und mit orangefarbenen Krawatten, die Frauen in verschiedenen bunten Tönen, wobei Bluse und Hose die gleiche Farbe hatten. Angelika wäre ein schönes Gelb, Orange oder sogar Rosa lieber gewesen. Doch sie hatte nicht selber wählen dürfen und musste nun in einem knalligen Grün den Einzug der Nationen begehen.
Sie reckte den Hals. Die dänische Fraktion hatte sich soeben in Bewegung gesetzt, danach folgte die wesentlich kleinere Abordnung aus Dahomey, dann würden sie an der Reihe sein. Angelika atmete tief durch. Von hinten wurde ein wenig geschoben. Offenbar drängten die Wartenden. Der Lärm der applaudierenden Zuschauer auf den Rängen schwoll mehr und mehr an. Hier unten zu stehen, unmittelbar vor dem Zugang zum Stadion und mit den Zuschauern über sich, hatte etwas Bedrohliches an sich. Sie zuckte zusammen, als die junge blonde Frau mit dem weißen Schild, auf dem in Großbuchstaben DDR stand, sich kurz umdrehte und ihnen ein Zeichen gab. Die Frau setzte sich in Bewegung, und alle folgten ihr. Angelika klopfte das Herz bis zum Hals. Schritt für Schritt gingen sie durch den dunklen Zugang dem Licht entgegen und betraten das Stadion. Jubel brandete auf. Als sie den Tunnel hinter sich ließen, atmete Angelika erleichtert aus. Die Menschen auf den Rängen boten ein buntes Bild, ihre Mienen verrieten Vorfreude und Begeisterung. Ein Orchester spielte, aus den Lautsprechern schallte die Stimme Joachim Fuchsbergers, den sie aus den Edgar-Wallace-Streifen kannte. Ihre Eltern hatten fast jeden der Filme, die im Westfernsehen ausgestrahlt wurden, gesehen, und ihre Mutter schwärmte für den Schauspieler. Nun sagte ausgerechnet er das Team der DDR an, von dem auch sie ein Teil war. Wenn auch nur ein kleiner. Angelika überlief eine Gänsehaut. Die Sportler marschierten im Takt der Musik und winkten den applaudierenden Zuschauern ebenfalls begeistert zu. Angelika sah nach oben, während sie wie alle anderen Athleten ohne Unterlass winkte. Das Dach des Stadions sah von hier unten wie ein aufgeschnittener Ball aus, der in mehreren Lagen an Drähten befestigt war. Sie hatte nie zuvor etwas Vergleichbares gesehen, und schon die Konstruktion dieses Bauwerks machte deutlich, dass sie sich hier in einer fremden, für sie ganz neuen Welt befand.
Als sie erfahren hatte, dass sie sich für die Olympischen Spiele qualifizieren durfte, hatte sie ihr Glück kaum fassen können. Und dann, als sie es tatsächlich geschafft hatte, erst recht nicht. Nun war sie schon seit Tagen im olympischen Dorf, und irgendwie fühlte sich alles ganz anders an, als sie es sich vorgestellt hatte. Dabei wusste sie nicht einmal, was genau sie erwartet hatte. Vor allem aber, da war sie sich sicher, hatte sie nicht mit einer solchen Freundlichkeit gerechnet. Diese Olympischen Sommerspiele wurden nicht nur »heitere Spiele« genannt, nein, sie waren es wirklich. Nationale Grenzen schien es unter den Sportlern fast nicht zu geben. In München waren sie eins, eine große Gruppe, die sich ab heute in verschiedenen Disziplinen miteinander messen würde. Angelika konnte es kaum noch erwarten, obwohl das Bogenschießen erst am 7. September beginnen würde. Sie würde alles in diesen Wettkampf legen, wollte zeigen, wie gut sie war. Sie war glücklich, es geschafft zu haben und für die DDR antreten zu dürfen. Vor allem aber hoffte sie, nach diesen Olympischen Spielen den Stolz ihrer Regierung zu genießen und so womöglich die Lebenssituation für sich und ihre Familie zu verbessern. Dabei ging es ihr nicht darum, in eine schönere Wohnung zu ziehen. Für sie war die Plattenbausiedlung in Leipzig vollkommen in Ordnung, und auch ihre Eltern, die beide für die volkseigenen Betriebe arbeiteten, der Vater im Bereich Schwermaschinenbau und die Mutter im Kombinat Verpackung, waren mit dem Leben, das sie führten, zufrieden. Doch Angelika störte sich an den Einschränkungen, die sie genau wie alle anderen, die sie kannte, zu erdulden hatte. Planwirtschaft war das eine. Doch so viele Dinge, die sie im Westfernsehen sah, nicht erwerben zu können und gar nicht erst Zugang zu bekommen widerstrebte ihr. Sie war gerade neunzehn geworden und wollte leben und etwas erleben. Sie wollte schöne Kleidung tragen, wollte Musik hören dürfen, die ihnen verboten war. Sich stets zurücknehmen zu müssen passte ihr einfach nicht. Und mit den Jahren war ihr Widerwille noch gewachsen, auch wenn ihre Eltern sie immer wieder zurechtgewiesen hatten, sie solle nicht so rebellisch sein.
Nach außen hin hatte Angelika sich angepasst, doch was sie wirklich dachte, behielt sie für sich. Denn auch wenn von Seiten der DDR gern so getan wurde, als würde dort ein perfektes System herrschen und die Zeit, da Deutschland noch nicht geteilt gewesen war, vergessen und aus dem Gedächtnis der Menschen gestrichen sein, war dem nicht so. Angelika war acht Jahre alt gewesen, als die Mauer gebaut worden war. Ihre Mutter behauptete stets, die Zeit davor sei auch nicht besser gewesen, doch das bezweifelte Angelika, genau wie viele andere ihres Jahrgangs. Außerdem ging es nicht darum, ob es vor 1961 besser oder schlechter gewesen war, es ging um das Hier und Jetzt. Für Angelika stand fest, dass die DDR sich im Gegensatz zur BRD auf der anderen Seite nicht wirklich entwickelt hatte. Bestimmt war auch dort nicht alles Gold, was glänzte, doch die Menschen »drüben« schienen ein weit weniger reglementiertes Leben zu führen als die in der DDR. Während es im Westen offenbar ein reichhaltiges Angebot an Waren aller Art gab und die Menschen sehen und hören durften, was sie wollten, gab es in der DDR so viele Verbote. Vor allem war es wenig ratsam, eigene Ansichten zu vertreten, die womöglich nicht mit denen der Parteiführung übereinstimmten. Tat man es doch, geriet man schnell unter Beobachtung oder wurde in ein Netz von Befragungen und Maßregelungen verstrickt. Zum Glück hatte Angelika so etwas noch nicht direkt erlebt. Allerdings hatte man den Vater ihrer Freundin Hanna zum Verhör abgeholt, weil der Verdacht bestand, dass dieser sich kritisch zur Parteiführung geäußert hatte. Doch entgegen vieler Schreckensgeschichten war er nach nur zwei Tagen scheinbar unverletzt wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Hanna hatte sich seitdem verändert. Davor hatte Angelika offen über alles mit ihr reden können, nun aber wirkte die Freundin zurückhaltend, ja sogar ein wenig misstrauisch. Als Angelika sie einmal darauf angesprochen hatte, hatte Hanna ihr nur einen prüfenden Blick zugeworfen und war ihr eine direkte Antwort schuldig geblieben. Sie standen zwar noch in Kontakt, doch dieser war deutlich weniger geworden. Angelika würde es nicht wundern, wenn er über kurz oder lang komplett abriss, so wie Hanna sich verhielt. Hier, bei den Olympischen Spielen in München, merkte Angelika nun selbst, wie es sich anfühlte, unter Beobachtung zu stehen, und zwar von einer Seite, von der sie es nie vermutet hätte. Viktor Kramann, ihr Co-Trainer, der für sie eher so etwas wie ein großer Bruder war, hatte sie in einem Gespräch unter vier Augen eindringlich ermahnt, ihren »engen Kontakt zum israelischen Team« einzustellen. Angelika war überrascht gewesen, schließlich konnte man kaum von engem Kontakt zum israelischen Team sprechen, nur weil sie sich mit Roman Gagarin, einem israelischen Ringer, angefreundet hatte. Sie hatte Gagarin gleich am Tag ihrer Ankunft in der Kantine kennengelernt, als ihr ein Apfel vom Tablett gerollt war. Roman hatte ihn in der Luft aufgefangen und neben ihren Teller zurückgelegt.
»Danke«, hatte sie mit einem Lächeln gesagt und überrascht festgestellt, dass er Deutsch konnte. Die meisten hier sprachen Englisch miteinander, was Angelika zwar einigermaßen verstand, doch für eine Unterhaltung reichte es nicht. Anders als die westlichen Sportler hatte sie von klein auf Russisch gelernt, wie die meisten in der DDR.
»Gern geschehen«, hatte Roman erwidert und sie gefragt, woher sie kam. So waren sie ins Gespräch gekommen. Sie hatten sich zusammen an einen Tisch gesetzt, und Angelika hatte erfahren, dass Roman deshalb so gut Deutsch konnte, weil seine Mutter deutsche Wurzeln hatte und während des Krieges nach Russland geflohen war. Seine Mutter hatte darauf bestanden, dass er beide Sprachen lernte. Einige Jahre darauf war seine Familie nach Israel gegangen, und nun trat er als Athlet für das israelische Team an. Angelika hatte Roman auch von sich erzählt, obwohl es ihrer Meinung nach eigentlich gar nichts zu erzählen gab. Sie hatten sich so gut verstanden, dass sie sich für später verabredeten, um gemeinsam das olympische Dorf zu erkunden, von dessen ausgefallener Bauweise Roman geradezu schwärmte. Es war ein schöner Abend gewesen, und so hatten sie sich in den letzten Tagen öfter getroffen.
Allerdings war es keineswegs so, dass Angelika auf Roman stand. Schließlich war er mit seinen achtzehn Jahren ein Jahr jünger als sie selbst, und kleiner als sie war er auch, höchstens eins fünfundsechzig. Aufgrund seines kräftigen Körperbaus wirkte er leicht untersetzt, während sie selbst hochgewachsen und schlank war. Sie mussten schon ein eigenartiges Bild abgeben, wenn man sie zusammen sah, doch sie mochte ihn einfach, und es gefiel ihr, Zeit mit ihm zu verbringen. Zum Glück waren ihre Eltern nicht mit nach München gereist, hatten die beiden sie doch eindringlich vor den Athleten aus anderen Ländern gewarnt. Angelika hatte ihre mahnenden Worte als Gerede abgetan, und nun, da sie Roman kennengelernt hatte, konnte sie deren Vorbehalte noch weniger verstehen. Roman war ein durch und durch netter Mensch, nicht mehr und nicht weniger.
Genau deshalb hatte sie sich auch ziemlich geärgert, als Viktor Kramann sie gerade eben, als die DDR-Athleten sich zum gemeinsamen Einzug ins Stadion aufstellten, zur Seite genommen und ihr deutlich zu verstehen gegeben hatte, sie solle ihre Treffen mit Roman Gagarin sofort einstellen, sonst würde sie es womöglich bereuen. Ob seine Warnung von vorgestern denn nicht genügt habe.
Sie hatte ihn angesehen, erstaunt und erschrocken zugleich, und er hatte ihren Blick kalt und hart erwidert. Nein, Viktor Kramann scherzte nicht, seine Warnung war ernst gemeint. Was war nur mit ihm los? Seit sie das olympische Dorf betreten hatten, benahm er sich so eigenartig wie nie zuvor. Sonst hatten sie doch immer gemeinsam über Angelikas Trainer Wolfgang gelacht, der mit hochrotem Kopf Befehle brüllte und wütend wurde, wenn Angelika sie nicht sogleich umsetzen konnte, und jetzt begann Viktor auf einmal damit, ihr Vorschriften zu machen? Was ging es ihn überhaupt an, mit wem sie sich traf? Er hatte doch auch nichts dagegen, wenn sie sich zu Hause mit ihren Freunden verabredete. Ja, er war sogar häufig dabei, weil sie ihn gern in ihrer Nähe hatte, doch auf einmal fühlte sie sich von ihm eingeengt.
Wie aus weiter Ferne hörte sie Joachim Fuchsbergers Stimme, der nun laut das französische Team ankündigte, während die Athleten der DDR von der Tartanbahn in Richtung Rasen abbogen und neben den anderen Sportlern Aufstellung nahmen. Wie lange es wohl dauern würde, bis alle Einzug ins Olympiastadion gehalten hatten und sich nach und nach auf dem Rasen aufreihten? Immerhin waren es einhunderteinundzwanzig Nationen, die gegeneinander antraten. Wieder sah sie sich um, wollte alles in sich aufnehmen, was sie an diesem Tag erlebte. Joachim Fuchsberger kündigte die Sportler von Israel an, und wie schon bei den anderen Mannschaften spielte die Kapelle etwas, was den Klängen nach dem Land zuzuordnen war. Angelika reckte den Hals. Als das israelische Team an ihnen vorbeizog, begegnete sie Romans Blick und hob die Hand, um ihm fröhlich zuzuwinken. Er erwiderte die Geste, strahlend, glücklich und offenbar genauso beeindruckt von alldem, was um sie herum geschah, wie Angelika selbst. Sie lachten einander an, dann war er auch schon wieder aus ihrem Blickfeld verschwunden, und die italienischen Sportler zogen an ihnen vorbei.
»Unglaublich, das alles hier, oder?«, fragte Monika, die genau wie Angelika breit lächelte.
Angelika nickte. »Ich hätte nicht gedacht, dass es so beeindruckend ist.«
»Und das Beste kommt erst noch«, stellte Monika fest und lachte laut auf, als sie Angelikas fragenden Gesichtsausdruck sah. »Na, die Wettkämpfe«, erklärte sie und lachte noch lauter.
Angelika stimmte in ihr Lachen mit ein. »Stimmt!«, sagte sie kichernd. »Das hatte ich fast vergessen.«
MÜNCHENSamstag, 26. August 1972, 15.37 Uhr
Ich bin froh, in Deutschland zu sein und es selbst zu erleben. Nichts hier ist wie in den Geschichten meiner Familie, die die schlimmsten Erinnerungen an dieses Land hat.
ROMANGAGARIN
Roman kam aus dem Strahlen nicht mehr heraus. Es erfüllte ihn mit Stolz, das blaue Sakko und die braune Hose des israelischen Teams zu tragen und wie bei einer Parade dem Verlauf der Tartanbahn zu folgen. Er fühlte sich als Teil von etwas Großem, etwas Bedeutsamem, und er wusste, dass er später einmal seinen Kindern, Enkeln und womöglich auch Urenkeln von dem erzählen würde, was er während dieser Tage in München erleben durfte. Begierig saugte er alles in sich auf, was um ihn herum geschah. Für ihn fühlte es sich an, als würden diese Olympischen Spiele seinem Leben eine neue Richtung geben, hatte er doch in den Tagen, die er nun in München war, ein vollkommen anderes Bild von Deutschland bekommen als das, das ihm seine Familie vermittelt hatte. Die Menschen hier waren offen und freundlich, von dem Antisemitismus, vor dem man ihn gewarnt hatte, spürte er nicht das Geringste. Ganz im Gegenteil: Die Feindseligkeiten, die in der Welt tobten, fanden hier, im olympischen Dorf, offenbar keinen Platz. Und das gab Roman Mut. Womöglich würden es genau diese Olympischen Spiele sein, über die man eines Tages sagte, sie hätten die Haltung der Menschen verändert und jahrzehntelang bestehende Feindschaften durchbrochen. Er selbst wünschte sich genau das. Es musste Frieden geben, endlich. Frieden war die Botschaft dieser Zeit, Frieden war es, wovon die Menschen träumten. Gäbe es Frieden, würde vielleicht auch seine Mutter eines Tages die Schrecken der Vergangenheit hinter sich lassen können, sie und so viele andere auch.
Als er noch ein kleiner Junge war, waren es nur Andeutungen gewesen oder eine bestimmte Art, auf die seine Mutter ihn angesehen hatte, wenn sie von ihrer früheren Heimat sprach. Oft hatte sie auch gar kein Wort darüber verlieren wollen. Einmal – er war acht gewesen, vielleicht auch neun – hatte er sie zornig gefragt, warum er eigentlich Deutsch lernen müsse, wenn sie das Land doch offenbar so sehr verabscheute. Er sah noch genau vor sich, wie seine Mutter abrupt in der Bewegung innehielt, einen Stuhl heranzog und sich zu ihm an den Tisch setzte. Sie hatte seine Hände in ihre genommen und ihm erklärt, dass er die Sprache deshalb lernen sollte, weil es ihre Muttersprache war. Sie war Deutsche, genau wie ihre Eltern. Ihre Großeltern waren damals aus Polen nach Deutschland übergesiedelt, in der Hoffnung, dort ein besseres, ein schöneres Leben für sich, vor allem aber für ihre Kinder aufbauen zu können. Und das hatten sie getan. Sie waren fleißige Menschen gewesen, die hart geschuftet hatten für das, was sie besaßen. Sie hatten einen Stoffhandel betrieben, später dann sogar eine angeschlossene Schneiderei. In der Dienerstraße in München hatten sie ein kleines Geschäft betrieben, bevor sie einige Jahre danach in die Theatinerstraße umgezogen waren. Hier hatten sie ihre Umsätze fast verdreifachen und sich weit mehr erlauben können als all die Jahre zuvor. Doch dann war das Geschäft der Familie in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 von den Nazis in Brand gesteckt worden. Romans Großeltern hatten gerade noch rechtzeitig mit ihrer Familie fliehen können. Sie waren nach Russland gegangen, ein Glück, wenn man überlegte, was in den Jahren bis 1945 in Deutschland geschehen war und wie viele Juden in den Konzentrationslagern ermordet worden waren. Er selbst war in Russland geboren, doch auch dort hatte er die antisemitischen und antijudaistischen Anfeindungen zu spüren bekommen. Heute hatte er das Gefühl, dass ihn genau das auf eine besondere Art geprägt hatte, hatte er doch nur deshalb mit dem Kampfsport begonnen, um sich gegen die Gleichaltrigen verteidigen zu können, die ihn stets spüren ließen, dass er nicht zu ihnen gehörte. Nach Israel waren Roman und seine Familie erst vor knapp drei Jahren übergesiedelt, weil es, wie seine Mutter sagte, an der Zeit war, eine endgültige Heimat zu finden. Heute hatte Roman das Gefühl, es wäre an ihm, die Versöhnung seiner Familie mit den Deutschen einzuläuten. Wenn er wieder nach Hause kam, würde er seiner Mutter von der Herzlichkeit und der Freude berichten, die man ihm hier entgegenbrachte. Er spürte weder Feindseligkeit noch Hass, Angst oder Gewalt. Die Menschen, die seine Familie 1938 vertrieben hatten, waren tot und begraben, und er hoffte, dass auch über die Vergangenheit eine so feste Schicht Erde geschüttet werden konnte, dass man nicht einmal mehr erahnen konnte, was sich darunter befand.
Roman sah hoch und winkte ohne Unterlass den Zuschauern auf den Rängen zu, die applaudierten und so jede einzelne Nation aufs Freundlichste begrüßten. Als er nach links zu den Sportlern blickte, die ihren Einzug bereits beendet und auf dem Rasen ihre Warteposition bezogen hatten, entdeckte er Angelika, die Bogenschützin der DDR-Mannschaft, die er hier kennengelernt hatte. Eine tolle junge Frau, mit der er sich wirklich gut verstand. Hoffentlich bekamen sie in den nächsten Tagen noch die Gelegenheit, weitere gemeinsame Unternehmungen zu starten, denn auch ihre Wettkämpfe würden erst später beginnen. Er selbst durfte ab dem 5. September zeigen, was in ihm steckte, und er war fest entschlossen, überall sein Bestes zu geben und sich die Goldmedaille zu erkämpfen. Roman wusste, dass Israel große Hoffnungen in ihn setzte. Er war jung, stark und ehrgeizig. Und er war ein guter Sportler.
Angelika und er winkten sich fröhlich zu, bis sie aus seinem Blickfeld verschwunden war. Roman sah, wie Henry Herscovici stolz die Flagge ihres Landes schwenkte. Henry hatte Roman erzählt, dass er durchaus mit gemischten Gefühlen nach Deutschland gereist war. Nun jedoch, da ein Jude mit erhobenem Haupt die israelische Fahne durch ein deutsches Stadion tragen durfte, gewann wohl nicht nur Roman den Eindruck, dass ein echter Wandel eingetreten war. Die Nazis hatten alles getan, um die Juden auszurotten, und nun schritten die Kinder ebendieser Juden hier entlang und lieferten damit den Beweis, dass die Nazis ihre Seelen trotz aller Grausamkeit nicht hatten zerstören können. Dieser Gedanke ließ Roman ein Lächeln auf die Lippen treten. Womöglich würde eines Tages auch ihm die Ehre zuteilwerden, die Fahne seines Volkes zu tragen. Und dann würde er den Jüngeren erzählen, dass er schon bei den Olympischen Spielen von München dabei gewesen war, den ersten Spielen nach dem Krieg, die so viele Wunden hatten heilen können. Allein die Vorstellung bewegte ihn tief.
Roman hob abermals den Arm und winkte den Zuschauern zu. Er machte Robert Goldmann aus, den Journalisten, der das israelische Team schon seit dessen Einzug ins olympische Dorf betreute. In den letzten Tagen hatten sie viel miteinander unternommen. Goldmann, der selbst Jude war und genau wie seine Eltern in München lebte, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ihnen so viel wie nur möglich von der Stadt und der Gegend zu zeigen. Neben den üblichen Sehenswürdigkeiten, die sie besichtigt hatten, war Goldmann auch bei der Gedenkfeier im KZ Dachau dabei gewesen, kein fröhlicher Termin wie die anderen, aber ein sehr wichtiger. Roman, der die Schreckensgeschichten über die Taten der Deutschen nur aus den Erzählungen seiner Mutter kannte, war an diesem Tag in Gedanken bei ihr gewesen. Sobald er wieder nach Hause kam, würde er ihr von dem feierlichen Rahmen und dem neuen Deutschland, das er hier kennenlernen durfte, berichten. Auch wenn er wusste, dass Rachel Gagarin die Gräueltaten der Nazis niemals verzeihen konnte, so hoffte er doch, ihr mit seinen Eindrücken das heutige Deutschland näherbringen zu können, das sich hier präsentieren wollte. Es war regelrecht spürbar, wie bemüht die Veranstalter waren, die Erinnerungen an die Olympiade von 1936 in Berlin vergessen zu machen. Deutschland zeigte sich weltoffen und bunt. Hier war kein Platz für Ideologien und Hass, nur für ein fröhliches Miteinander verschiedener Nationen, die einander respektierten und sich einzig auf sportlicher Ebene miteinander messen wollten.
Roman hob den Arm und winkte Goldmann zu, der jedoch in diesem Moment zur Seite sah, um sich mit einem befreundeten Polizisten zu unterhalten, dessen Name Roman gerade nicht einfiel. Wie alle Sicherheitsleute trug er einen hellblauen Anzug und war so direkt zu erkennen. Roman ließ den Arm sinken. Er würde Goldmann nachher treffen, wenn dieser sich wieder dem israelischen Team anschloss. Sie kannten sich zwar erst kurz, aber Roman hoffte, dass der Kontakt zu dem Journalisten auch nach den Olympischen Spielen weiterbestehen würde.
Nun rief der Stadionsprecher die Abordnung aus Lesotho auf. Roman hatte sie vorhin gesehen und schmunzeln müssen, weil das Team nur aus dem Fahnenträger und zwei weiteren Männern bestand. Da war das israelische Team weit besser aufgestellt, obwohl es auch eher zu den kleineren gehörte. Für Roman bedeutete dies, dass er noch mehr geben würde, um sein Land und sich zu repräsentieren.
MÜNCHENSamstag, 26. August 1972, 15.55 Uhr
Ich habe gemischte Gefühle. Was, wenn die Sorglosigkeit trügerisch ist?
ROBERTGOLDMANN
Manfred Hofmanns Gesichtsausdruck verriet nichts Gutes, als er auf ihn zukam.
»Und?«, fragte Robert nur.
Der Polizist schüttelte den Kopf. »Sieber ist wieder mit seinen kompletten Vorschlägen abgeprallt. Noch mal wird er’s nicht versuchen. Aber das weißt du nicht von mir«, fügte er eilig hinzu, obwohl das nicht nötig gewesen wäre.
Die beiden kannten sich nun wirklich lange genug. Manfred konnte darauf vertrauen, dass Robert, Journalist hin oder her, Informationen wie diese niemals zu seinem Schaden einsetzen würde.
»Natürlich nicht«, versicherte Robert dennoch. Er wusste nicht, was er von dem Vorgehen der Polizei halten sollte. Alles um die Olympischen Spiele herum war bis ins Kleinste geplant, doch was das Thema Sicherheit anging, war sein Freund Manfred, ein Polizist mit jahrelanger Erfahrung, nicht der Einzige, der erhebliche Bedenken hegte.
Der Polizeipsychologe Georg Sieber hatte während einer Sitzung insgesamt sechsundzwanzig Szenarien möglicher Anschläge aufgezeigt, wofür er allerdings nur ausgelacht worden war. Nun hatte er vorhin noch einmal das Gespräch mit der Polizeispitze gesucht und war offenbar erneut gescheitert. Dabei schienen die Bedrohungen, die Sieber aufgezeigt hatte, in Roberts Augen längst nicht so weit hergeholt, wie der Polizeipräsident meinte. Ein Anschlag »anarchistischer Gewalttäter«, wie die gerade erst verhafteten Baader, Meinhof und Konsorten auf den Fahndungsplakaten genannt wurden, war keineswegs ausgeschlossen, das hatten die vielfachen Überfälle der RAF bewiesen. Die Gewaltbereitschaft war gewachsen, ob man es nun wahrhaben wollte oder nicht. Und ein Zusammentreffen so vieler Nationen bot Terroristen eine geradezu einmalige Gelegenheit. Allerdings ging es nicht nur um die Bedrohung durch linke Kräfte, auch ein Überfall der Araber, wie Sieber ihn unter anderem aufgezeigt hatte, war durchaus denkbar. Bei Großveranstaltungen wie den Olympischen Sommerspielen waren Attacken, ganz gleich welcher Art, nun mal nicht auszuschließen.
Robert hoffte inständig, dass Sieber und Manfred mit ihrer Schwarzmalerei übertrieben und die gelebte Sorglosigkeit am Ende siegen würde. Oder war eine solche Sorglosigkeit naiv, wenn nicht gar überheblich, und würde am Ende womöglich bestraft werden?
»So schön das hier alles sein mag«, holte Manfred ihn aus seinen Gedanken und deutete mit dem Arm auf die Menschenmenge auf den Rängen. »Ich bin froh, wenn es vorbei und ohne Schwierigkeiten über die Bühne gegangen ist.«
»Damit bist du vermutlich nicht allein«, stimmte Robert ihm zu, wenngleich er sich auf die weitere Zeit im olympischen Dorf und mit den Mitgliedern des israelischen Teams freute.
Manfred beugte sich weiter vor und senkte die Stimme. »Ich bin wirklich keiner, der die Hand schnell am Holster hat, aber keine Waffe tragen zu dürfen, weil es nicht ins Bild dieser Veranstaltung passt, ist doch Irrsinn. Genau wie diese lächerlichen Handzeichen, damit wir nur ja kein Aufsehen erregen. Stell dir vor, man bezeichnet uns hier als ›Olys‹, nicht als Polizisten, als wären wir gottverdammte Platzanweiser!«
»Ist das nur deine Meinung oder auch die deiner Kollegen?«
»Das ist etwa fifty-fifty, würde ich sagen. Die jüngeren freuen sich über das gute Wetter und die vielen netten Leute, die sie kennenlernen, die älteren sehen die Sache meist nicht ganz so gelassen.« Manfred lehnte sich noch weiter zu Robert. »Wenn dir irgendwas auffallen sollte, dann sag mir bloß sofort Bescheid, ja?«
»Klar, mach ich. Du müsstest mir allerdings sagen, worauf genau ich achten soll.«
Manfred zuckte die Achseln. »Sieber hat bei den vorgestellten Einsatzlagen auch vor einem möglichen Anschlag auf das israelische Team gewarnt. Ich weiß nicht, ob es konkrete Drohungen gegeben hat, doch Sieber saugt sich so was ja nicht aus den Fingern, auch wenn unser Polizeipräsident genau das zu glauben scheint. Ich hab selbst keine Ahnung, worauf wir achten sollen – vielleicht einfach auf alles, was uns verdächtig erscheint, Leute, die sich seltsam benehmen oder so aussehen, als hätten sie auf dem Gelände nichts zu suchen …«
»Bisher war alles sehr harmonisch«, stellte Robert fest. »Und auch wenn du es vielleicht nicht hören willst: Olympische Spiele in dieser Form sind wichtig. Sie werden ja nicht umsonst ›Fest des Friedens‹ genannt. Nimm nur den Gedenkgottesdienst in Dachau, als die israelische Abordnung einen Kranz niedergelegt hat. Yakov Springer hat mir erzählt, wie schwer es für ihn war, daran teilzunehmen. Seine ganze Familie wurde damals im besetzten Polen von Deutschen überfallen und im Ghetto Litzmannstadt umgebracht. Springer selbst war gerade achtzehn, als er in die Sowjetunion floh. Er hat den Holocaust als Einziger überlebt. Nun in einem ehemaligen deutschen Konzentrationslager zu stehen und verzeihen zu wollen muss schrecklich für ihn gewesen sein.«
»Das ist mir schon klar«, sagte Manfred leise. »Wirklich, Robert, mir ist durchaus bewusst, dass es auch für dich eine Auseinandersetzung mit alldem ist, was Nazi-Deutschland dir und deiner Familie angetan hat.« Er schüttelte den Kopf. »Glaub mir, ich will auch nicht, dass die Deutschen mit Sturmgewehren im Anschlag hierstehen und dieses Bild in die Welt getragen wird. Aber was, wenn die Befürchtungen, die manche haben, doch keine Hirngespinste sind?«
Robert nickte. »Daran darf ich nicht einmal denken.«
Manfred sah auf die Uhr. »Ich muss dann mal wieder. Tu mir den Gefallen und gib mir Bescheid, wenn dir auch nur das Geringste auffallen sollte, egal, was.«
»Ich versprech’s dir«, versicherte ihm Robert, dann verabschiedeten sie sich voneinander. Der Journalist sah dem befreundeten Polizisten noch kurz nach, dann betrachtete er die Sportler, die auf der Tartanbahn paradierten und fröhlich winkten. Gerade kam die Abordnung aus Mexiko vorbei, in grünen Anzügen mit weißen Überwürfen, die unter dem Applaus des Publikums ihre Sombreros lüftete. Ein schöner Anblick, doch Manfreds Sorge verhinderte, dass Robert das Spektakel genoss. Würden die »heiteren Spiele« wirklich halten, was sie versprachen?
Sein Blick schweifte zu den israelischen Athleten, die er in den letzten Tagen kennengelernt hatte. Mit manchen hatte sich bereits eine Art Freundschaft entwickelt. Er war froh, dass man seine Bewerbung angenommen und ihn als Sportlerbetreuer für das israelische Team ausgewählt hatte, vielleicht weil er selbst Jude und zudem in München geboren war. Seine Eltern waren weit gläubiger als er, doch seine Zugehörigkeit zum Judentum hatte stets einen wichtigen Teil seines Lebens ausgemacht. Wie so viele Juden war auch seine Familie damals aus Nazi-Deutschland geflohen, aber anders als viele andere waren seine Eltern kurz nach dem Krieg zurückgekehrt. Ein Jahr später war er zur Welt gekommen. Wie tief die Erinnerung an das Grauen jedoch noch immer saß, war auch bei seinen Eltern zu spüren.
Er selbst hatte in Deutschland, seiner Heimat, eine gute Kindheit gehabt. Echte Feindseligkeit war ihm nicht begegnet, eher unterschwellig antisemitisches Verhalten. Einmal hatte ihn beispielsweise eine Mitschülerin in der vierten Klasse gefragt, ob er wirklich ein richtiger Jude sei. Als er wissen wollte, wie sie das meinte, hatte sie erwidert: »Ich dachte ja bloß, weil du doch ganz normal aussiehst.« Selbst damals, mit gerade einmal zehn Jahren, hatte er gewusst, dass es besser war, nicht weiter nachzuhaken. Es hatte keinen Sinn, das Gespräch fortzuführen und sie beispielsweise zu fragen, was sie unter »normal« verstand und wie sie sich einen »richtigen Juden« vorstellte. Er hatte oft mitbekommen, wie andere ein absurdes Bild von den Juden zeichneten, insbesondere dann, wenn niemand in der Runde wusste, dass er selbst jüdischen Glaubens war. Deutschland war für ihn in dieser Hinsicht bis heute ein gespaltenes Land, das nur schwer mit seiner eigenen Verunsicherung in Bezug auf die Vergangenheit umzugehen wusste. Deshalb war es ihm so wichtig gewesen, bei diesen Olympischen Spielen dabei sein zu können, dabei zu sein, wenn Deutschland sich als ein demokratisches und weltoffenes Land präsentierte, das sich deutlich von der Vergangenheit abzugrenzen versuchte. So wie alles in diesem Moment auf ihn wirkte, könnte es tatsächlich ein neuer Anfang sein, der die Olympischen Spiele von 1936 in Vergessenheit geraten ließ. Und er war ein Teil davon, war ganz nah dran und konnte in seiner Funktion als Betreuer dem israelischen Team das Deutschland zeigen, das er kannte und das seine Heimat war. Dass sich die Spiele womöglich anders entwickelten, als er es sich erhoffte, dass etwas dran war an Manfreds Befürchtungen, konnte und wollte er sich in diesem Moment einfach nicht vorstellen.
MÜNCHENSamstag, 26. August 1972, 16.33 Uhr
Wenn alles gut läuft, könnte das der beste September meines Lebens werden.
MANFREDHOFMANN
»Auch eine?« Volker hielt ihm ein Päckchen HB entgegen, als Manfred auf das Polizeigebäude zuging, vor dem Volker und Claus, zwei seiner Kollegen, standen und sich bei einer Zigarette unterhielten.
»Nein danke, ich habe aufgehört«, lehnte Manfred ab.
»Sterben wirst du sowieso«, sagte Volker zwischen zwei Zügen und lachte.
»Wir reden gerade über den Schwarzseher«, setzte Claus ihn nun ins Bild. »Du bist ja auch lange genug dabei. Was hältst du denn von dem?«
»Wen meinst du?«, fragte Manfred.
»Na, diesen Sieber. Ich wusste nicht mal, dass es Polizeipsychologen gibt, die die da oben beraten sollen. Für mich waren das immer die Heinis, zu denen wir geschickt werden, wenn wir im Dienst jemanden erschossen haben«, bemerkte Volker. »Zum Glück ist mir das bisher erspart geblieben.«
Manfred wiegte den Kopf. »Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Aber ich finde es unsinnig, jemanden einzustellen, damit er uns berät, nur um dann alles als Gerede abzutun, was er vorschlägt.«
»Ach, komm, Manni. Hast du dir mal angehört, was für Szenarien der sich ausmalt? Wenn du mich fragst, ist das völliger Humbug. Wie soll man so etwas denn schon voraussehen können?«, fragte Claus.
»Da kannst du genauso gut dein Horoskop lesen und deinen Job kündigen, weil da steht, dass du morgen reich wirst. Ich sage dir, der will sich nur aufspielen.« Volker ließ die Zigarette fallen und trat sie aus.
Manfred ließ die beiden stehen, betrat das Gebäude und ging hinauf in den ersten Stock. Oben angekommen, hielt er lächelnd auf den Schreibtisch von Susanne Lerbs zu, eine attraktive, fröhliche Mittdreißigerin, die am liebsten Pullunder in ebenfalls fröhlichen Farben trug. Als Sekretärin wusste sie stets über alles Bescheid, was sich im Präsidium oder jetzt eben hier, bei der Einsatzleitung im Olympiadorf, tat.
»Hallo, Susanne«, sagte Manfred und blieb stehen.
»Manfred, grüß dich!« Sie erwiderte sein Lächeln und strich sich die dunklen Haare aus dem Gesicht. »Na, hast du deine Runde gedreht? Wie ist die Eröffnungsfeier denn so? Man kriegt hier ja leider so gut wie gar nichts davon mit.«
»Die Stimmung ist gut, wirklich. Einigen Leuten werden heute Abend bestimmt vom vielen Klatschen die Hände wund sein.« Er sah sie bedauernd an. »Tut mir leid für dich, dass du hier drinnen sitzen musst.«
Sie zuckte die Schultern. »Immerhin kann ich irgendwann behaupten, dass ich bei den Olympischen Spielen 1972 in München dabei war, mitten im Geschehen.« Sie verzog das Gesicht. »Dass ich überhaupt nichts mitbekommen habe, weil ich die ganze Zeit Berichte und Protokolle getippt habe, muss ich ja nicht erwähnen.«
Manfred nickte zustimmend. »Wo du es gerade ansprichst: Kann ich mal einen Blick in das Protokoll werfen, in dem Georg Sieber die möglichen Einsatzlagen vorgestellt hat?«
»Das ist vertraulich, Manni. Das weißt du doch.«
»Ja, schon. Aber wäre es nicht besser, wenn wir da draußen Bescheid wüssten, worauf wir achten sollen?«
Susanne sah kurz zu der Tür, die in den Besprechungsraum führte, und anschließend in die andere Richtung den Flur entlang, von dem die Großraumbüros abgingen. Dann stieß sie sich vom Schreibtisch ab und rollte mit ihrem Stuhl zu dem halbhohen, abschließbaren Stahlschrank, dessen Schlüssel im Schloss steckte. Sie öffnete ihn und zog eine Hängemappe heraus, die sie Manfred reichte.
»Hier. Aber mach schnell.«
»Danke!« Eilig überflog Manfred die aufgeführten Szenarien. Sieber hatte die Möglichkeit von Anschlägen diverser Terrorgruppen erörtert und warnte beispielsweise davor, dass die IRA britische oder die ETA spanische Olympioniken angreifen könnte. Außerdem warnte er davor, dass es Überfälle der PLO oder kleinerer Splittergruppen auf das israelische Team geben könnte. Aus diesem Grund und zum besseren Schutz der Sportler schlug Sieber vor, diese nicht nach Nationen, sondern nach Sportarten unterzubringen. Seinem Vorschlag war nicht Folge geleistet worden.
Manfred blätterte um. Der Polizeipsychologe hatte akribisch ganze sechsundzwanzig verschiedene Szenarien ausgearbeitet, diverse Angriffsmöglichkeiten zu Ende durchgespielt und Vermeidungsstrategien entwickelt, die das Risiko derartiger Anschläge minimieren könnten. Soweit Manfred wusste, war jedoch keine einzige dieser Vermeidungsstrategien in die Tat umgesetzt worden, obwohl dies seiner Meinung nach kein großes Problem dargestellt hätte. Er klappte die Mappe zu und reichte sie Susanne zurück.
»Danke.«
Sie nahm die Unterlagen und sortierte sie sogleich wieder in die Registratur. »Und? Was meinst du?«, fragte sie, als sie den Stahlschrank schloss und mit ihrem Stuhl zurück an den Schreibtisch rollte.
Manfred wiegte nachdenklich den Kopf. »Es ist schon wirklich konkret zu Ende gedacht«, urteilte er. »Wenn man das liest, bekommt man schnell das Gefühl, dass außerhalb von München nichts als Hass und Gewalt herrschen.«
Susanne nahm ihre Kaffeetasse und trank einen Schluck. »Möchtest du auch einen?«
Manfred zögerte, entschied dann jedoch, dass ein kleiner Moment für einen Plausch mit Susanne drin war.
»Gern.«
Die Polizeisekretärin stand auf, während Manfred sich auf einen der beiden Besucherstühle vor ihrem Schreibtisch setzte.
»Schwarz, wie immer?«, fragte Susanne, die bereits an die Kaffeemaschine trat, eine frische Tasse umdrehte und die Kanne herauszog.
»Klar. Schwarzer Kaffee soll doch schön machen, und die Hoffnung stirbt zuletzt.«
Susanne schenkte schmunzelnd ein, dann kam sie mit der gefüllten Tasse zurück an den Schreibtisch und stellte sie vor Manfred ab.
»Danke. Das ist nett von dir.« Er trank einen Schluck, während Susanne wieder Platz nahm. Der Kaffee schmeckte bitter. Vermutlich stand er schon eine ganze Weile auf der Heizplatte.
»Denkst du, an dem, was Sieber da vorgestellt hat, könnte etwas dran sein?«, nahm Susanne den Faden wieder auf. »Ich meine, du bist ja auch schon lange genug dabei.«
»Na ja«, begann Manfred und trank einen weiteren Schluck. »Hättest du mich vor einigen Jahren gefragt, hätte ich wohl auch behauptet, er wolle sich nur wichtigmachen. Wenn ich allerdings daran denke, was im Mai in Frankfurt passiert ist, glaube ich, dass wir die Entschlossenheit, mit der manche Irre vorgehen, nicht unterschätzen dürfen.« Er stellte die Tasse ab und fuhr sich gedankenversonnen mit den Fingern durch die dünner werdenden Haare.
»Du meinst den Bombenanschlag auf das Hauptquartier der US-Armee?«, fragte Susanne.
»Ganz genau. Dass die RAF auch Tote in Kauf nimmt, wissen wir spätestens, seit sie Hans Eckhardt ermordet haben. Doch der war Leiter der Sonderkommission Hamburg und Polizist und damit eines der Hassobjekte dieser Leute. Aber ein Bombenanschlag, bei dem ein Haufen Unbeteiligter mit reingezogen wird, ist eine ganz andere Sache. Egal, ob RAF, IRA, PLO, ETA oder was weiß ich wer – für mich sind das alles Fanatiker, die stets einen Finger am Abzug haben. Und nur weil wir hier ›heitere, friedliche‹ Spiele feiern wollen, werden solche Leute nicht weniger gefährlich.«
»Aber Schreiber sieht das anders, und der hat nun mal das Sagen«, stellte Susanne mit einem resignierten Seufzer fest.
»Tja, so sieht’s aus. Am Ende wird wahrscheinlich ohnehin nichts passieren, und dann kann der Alte sich feiern lassen, weil er’s ja gleich gewusst hat.«
»Aber wenn doch was passiert, sehen wir alt aus, und zwar alle miteinander.«
»Allerdings. Ausrichten können wir trotzdem so gut wie nichts. Ich habe eben mit meinem Freund Robert gesprochen.«
»Dem Journalisten?«
Manfred nickte. Susannes Miene war anzusehen, dass sie es für keine gute Idee hielt, ausgerechnet mit einem Pressevertreter über derartige Dinge zu reden.
»Robert ist in Ordnung«, stellte Manfred klar, als er ihren Blick bemerkte. »Er hat sich als Betreuer für das israelische Team gemeldet und verbringt viel Zeit mit den Athleten. Ich habe ihn gebeten, die Augen offen zu halten und Bescheid zu geben, sollte ihm irgendwas Verdächtiges auffallen, obwohl ich ihm auch nicht sagen konnte, worauf genau er achten soll. Wenn sich jemand mit einem Gewehr nähert, dürfte es zu spät sein, findest du nicht?«
»Fräulein Lerbs? Könnten Sie kurz herkommen?«
Manfred zuckte zusammen, als sich plötzlich eine der Türen öffnete und der Polizeipräsident höchstselbst heraustrat.
»Natürlich.« Susanne sprang auf, schnappte sich Block und Stift und rief Manfred ein eiliges »Tschüss!« zu.
»Tschüss«, erwiderte Manfred, trank den bitteren Kaffee aus, stand auf und verließ das Gebäude.
Im Dorf herrschte weniger Trubel als in den vergangenen Tagen, ganz einfach, weil alle bei der Eröffnungsfeier im Stadion waren. Manfred ließ sich Zeit, dorthin zurückzukehren. Alle Sicherheitskräfte hatten Weisung, bis zum Ende der Eröffnungsfeier zu bleiben und danach für den sicheren Ausgang der Menschen aus dem Stadion Sorge zu tragen. Er sah auf die Uhr. Kurz nach fünf. Mit allem Drum und Dran würde sich die Feier mit Sicherheit noch eine Stunde, vermutlich sogar länger hinziehen. Es bestand also überhaupt kein Grund zur Eile.
MÜNCHENSamstag, 02. September 1972, 14.10 Uhr
Das erste Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein.
DJAMALRAHMAN
Er wäre lieber zu einem der Fußballspiele gegangen, hatte er doch als Kind und Jugendlicher selbst mit Leidenschaft gekickt. Doch das Treffen, zu dem er zusammen mit Luttif und Ahmed gekommen war, fand nun einmal hier beim Volleyball statt.
Er selbst war erst gestern zusammen mit Afif und Adnan in München eingetroffen und hatte in dem Hotel, in dem sie untergebracht waren, eine weitere Dreiergruppe getroffen. Weshalb er und die anderen nach Deutschland gebracht worden waren, wusste Djamal nicht. Niemand hatte ihnen bisher etwas über das Ziel der Operation gesagt. Nur dass sie Teil von etwas Großem sein würden, hatte Luttif erklärt, als er ihnen gestern die Pässe abgenommen hatte.
Nun saß er hier zusammen mit Luttif und Ahmed und wartete. Auf wen, wusste er ebenfalls nicht. Doch es störte ihn nicht, noch im Ungewissen zu sein. Vielmehr erfüllte es ihn mit Stolz, dass man ihn für eine besondere Aufgabe auserwählt hatte und er endlich etwas von dem zum Einsatz bringen konnte, wofür er ausgebildet worden war.
Er war jetzt neunzehn Jahre alt und kannte die Geschichten nur aus den Erzählungen seiner Eltern, Großeltern und all derer, die fünf Jahre vor seiner Geburt dabei gewesen waren, als die Zionisten sie aus Galiläa vertrieben hatten. Wie Hunde hatte man sie fortgejagt und die Palästinenser zu einem Dasein als Flüchtlinge verurteilt. Jeder seines Volkes kannte die Geschichten der Vertreibung, jeder wusste, was geschehen war und was die eigenen Familien zu erleiden hatten. Und jeder von ihnen spürte den Hass auf die Juden in sich züngeln wie Flammen, die immer höher und höher schlugen und schließlich so heiß brannten, dass sie alle anderen Gefühle verglühen ließen.
Schon als Jugendlichem war Djamal klar gewesen, dass es keine Zukunft für ihn gab, wenn sein Volk und er nicht nach Palästina, in ihre Heimat, zurückkehren konnten. Auch wenn er es nie anders gekannt hatte, fühlte sich sein Leben in den Hütten mit den Wellblechdächern, die in Reih und Glied nebeneinanderstanden und in denen es in den Sommermonaten so heiß wie in einem Backofen wurde, einfach falsch an. Er hatte nie hinterfragt, ob es an den Geschichten lag, die die Alten ihm und den anderen Jungs im Lager erzählt hatten, doch sie alle waren in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass man ihnen ihre Häuser, ihr Land und ihre Heimat gestohlen hatte und die ganze Welt diesem Unrecht zusah, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Es schien einfach niemanden zu kümmern, was ihnen geschah.
Als eine Hilfsorganisation seinem Bruder Farud und ihm vor einigen Jahren angeboten hatte, nach Westdeutschland zu gehen, hatte Djamal nicht lange überlegen müssen. Er wollte nur weg aus dieser Welt, der Armut, dem Leid, das er täglich sah. Doch die zwei Jahre in Deutschland hatten ihm die Augen geöffnet und ihm gezeigt, dass auch dort ein Leben, wie er es sich vorstellte, nicht möglich war. Niemanden scherte es, was sein Bruder und er taten. Oder wie sein Volk im Exil litt. Die Menschen dort waren einzig damit beschäftigt, ihrer Arbeit nachzugehen, ihre Familien zu versorgen, sich abends die Nachrichten anzusehen und zu glauben, sie würden wissen, was in der Welt geschah. Djamal hatte ihre Sprache gelernt und sich in ihre Kultur eingefunden, doch verstehen konnte er sie bis heute nicht. Also hatten Farud und er irgendwann ihre Sachen gepackt und waren aus der betreuten Unterkunft, die man ihnen zur Verfügung gestellt hatte, verschwunden und in das Flüchtlingscamp in Südbeirut, in dem auch ihre Familie lebte, zurückgekehrt. Der Funken Hoffnung auf ein besseres, ein würdiges Leben war nach der Zeit in Deutschland endgültig erloschen.
Deshalb hatte sich Djamal, als er gerade mal sechzehn war, der Befreiungsbewegung angeschlossen. Alles war ganz einfach gewesen. In seiner Erinnerung hatte man ihm ein Gewehr in die Hand gedrückt und ihm gezeigt, wie man damit umging. Das war alles. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er sich nicht machtlos fühlte, dass er mehr war als der wertlose Flüchtling, der zusammen mit seiner Familie von den Almosen der Hilfsorganisationen lebte, die sich um die palästinensischen Flüchtlinge im Nahen Osten kümmerten. Selbst sie, die Helfer, hatte er im Laufe der Jahre hassen gelernt. Für Djamal waren ihre freundlichen Gesichter, wenn sie ihm zulächelten, während sie das Essen verteilten, nichts als verstellte bösartige Fratzen, die insgeheim über ihn und seinesgleichen lachten. Vermutlich dachten sie, sie hätten es verdient, ein so trauriges, hoffnungsloses Dasein zu führen.
Nun, vielleicht täuschte er sich auch, ergab es doch keinen Sinn, dass Menschen ihre Zeit damit verbrachten, andere zu versorgen, die sie in Wirklichkeit verachteten. Dennoch waren die lächelnden Helfer für ihn zu einem Sinnbild des eigenen Versagens geworden. Warum nur hatte niemand gegen die Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat aufbegehrt? Warum hatte der Rest der Welt nichts gegen das zum Himmel schreiende Unrecht getan? Und vor allem: Warum hatten sie sich nicht selbst ausreichend gewehrt?