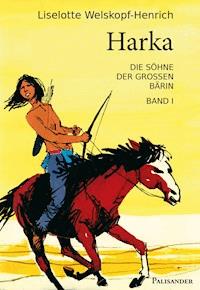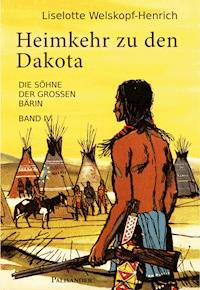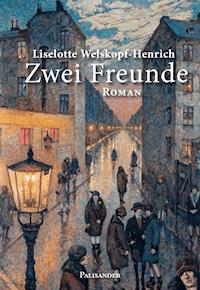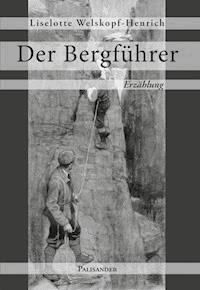Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palisander Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Blut des Adlers
- Sprache: Deutsch
Eine Reservation in South Dakota Mitte der 1960er Jahre. Die weiße Verwaltung regiert unumschränkt über die größtenteils in tiefer Armut lebenden Reservationsindianer. Viele von ihnen haben ihre Selbstachtung längst verloren und sind dem Alkohol verfallen. Ein junger Indianer, Joe Inya-he-yukan King, der mit 16 Jahren wegen angeblichen Diebstahls ins Gefängnis gekommen war und anschließend Mitglied einer Gang wurde, bricht mit den Gangstern und kehrt zurück auf die Reservation. Er will eine Ranch aufbauen. Der Bruch mit den Gangs bringt ihn immer wieder in Gefahr; er muss töten, um zu überleben. Sein indianisch-selbstbewusstes Auftreten gegenüber den weißen Behörden und seinen Stammesgenossen trägt ihm Hass, aber auch Achtung ein. Eine junge, hochbegabte Künstlerin des Stammes, Queenie Tashina, wird seine Frau. Dank seiner Erfolge als Rancher und spektakulärer Rodeosiege gewinnt Joe King Verbündete für den Kampf gegen die erstarrten Verhältnisse. Ein hoffnungsvoller Neubeginn, der jedoch immer wieder von tödlichen Gefahren überschattet ist.
Mit einem Nachwort von Erik Lorenz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 860
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liselotte Welskopf-Henrich
Nacht über der Prärie
Roman
Mit einem Nachwort von Erik Lorenz
Palisander
Überarbeitete und ergänzte Neuausgabe
1.Auflage März 2013
© 2013 by Palisander Verlag, Chemnitz
Erstmals erschienen 1966 im Mitteldeutschen Verlag, Leipzig
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Schutzumschlaggestaltung: Claudia Lieb
Einbandgestaltung: Claudia Lieb
Lektorat: Palisander Verlag
Redaktion & Layout: Palisander Verlag
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014
ISBN 9783938305607
www.palisander-verlag.de
Das Blut des Adlers
Pentalogie
1.Band: Nacht über der Prärie
2.Band: Licht über weißen Felsen
3.Band: Stein mit Hörnern
4.Band: Der siebenstufige Berg
5.Band: Das helle Gesicht
Rot ist das Blut des Adlers.
Rot ist das Blut des braunen Mannes.
Rot ist das Blut des weißen Mannes.
Rot ist das Blut des schwarzen Mannes.
Wir sind alle Brüder.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Vorspiel
Queenie
Begegnungen
Nacht in der Prärie
Ein schwarzes Korn geht auf
Rancher
Rodeo
Newt Beats
Sonntagnachmittag
Ungewissheit
Ein neues Kapitel
Feuer
Schule
Der Brunnen
Nachbarn
Der alte Indianer
Zeugen
Scout
Besuche
Lebensweisen
Prärieweihnachten
Die Büffel kommen wieder
Calgary
Das Durchschnittsgesicht
Zurück auf der King-Ranch
Nachwort
Weitere Bücher
Vorspiel
»Joe King ist wieder gesehen worden.«
»Stonehorn?«
»Ja.«
»Bei uns hier?«
»In New City.«
»Die Stammespolizei ist unterrichtet?«
»Ja.«
»Sonst noch etwas?«
»Die Schulferien beginnen. Der Stammesrat schlägt vor, den Schülern, die jetzt für drei Monate aus den Internaten nach Hause kommen, eine Gelegenheit zu nützlicher Arbeit und etwas Verdienst zu verschaffen. Wenn sie zu lange herumlungern, kommen sie auf Abwege.«
»An das Dezernat für Ökonomie. – Ich danke.«
Der Superintendent verabschiedete seinen Stellvertreter mit einem Blick. Dieser ging, die Akten unter dem Arm, zur Tür, klinkte sie leise auf und drückte sie ebenso leise wieder hinter sich zu. Etwas straffer aufgerichtet, als es sonst in Büros üblich war, wies er die Sekretärin an, die Vorlage des Stammesrates Mr.Haverman, dem Dezernenten für Ökonomie, zu bringen, und zwar sogleich, da die Schulen in wenigen Tagen schlössen. Das Mädchen zwang sich, die Augen nicht auf den Sprecher zu richten. Sie hatte die Lider gesenkt, erhob sich gehorsam, nahm die Mappe in Empfang und trippelte auf ihren weißen Schuhen mit den hohen Hacken zur Tür. Die Büros der einzelnen Dezernate befanden sich im Nebenhaus.
Nick Shaw sah ihr einen Augenblick nach. Das Bild des künstlich gelockten schwarzen Haares, des braunen Nackens nahm er nur unbewusst in sich auf. Er fragte sich im stillen, ob das Mädchen schon etwas Neues über Joe King erfahren habe. Während er dem Superintendenten berichtet hatte, war ihm so gewesen, als ob im Sekretariat ein Besucher vorgesprochen habe. Die Polstertür ließ kaum einen Laut durch, aber in dem einstöckigen Holzhaus erzeugte jeder Schritt in dem Dielenboden Schwingungen, die Nick Shaw bis hinauf in die Knie zu fühlen meinte. Er war an diesem Tage sehr nervös.
Aber er unterdrückte jede Frage, so wie das Mädchen jeden Blick unterdrückt hatte. Nick hatte die Erfahrung gemacht, dass Indianer ihn stets täuschten, wenn er sie ausforschen wollte. Man musste warten, bis sie selbst sprachen und über eine Reihe unwichtig erscheinender Bemerkungen endlich zum Wichtigen kamen. Eine solche Wartezeit dehnte sich im Ablauf eines geordneten Verwaltungsmechanismus, wie Shaw ihn rings um sich in Gang zu halten liebte, oft übermäßig lang. Der Beamte seufzte leicht und begab sich in sein benachbartes, an der Rückseite des Hauses gelegenes Dienstzimmer, das zweckmäßig, wenn auch mit einem Polstersessel weniger als das des Superintendenten ausgestattet war. Er nahm an seinem Schreibtisch Platz und vertiefte sich in die Akten.
Als es klopfte und auf sein »Bitte« niemand eintrat, stand er auf und ging zur Tür. Aber er fand niemanden davor. Die Sekretärin war noch nicht zurück. Auf einem der Warteplätze hatte sich eine Indianerin niedergelassen. Nick Shaw hielt es für ausgeschlossen, dass sie geklopft hatte. Seine Nerven hatten ihm einen Streich gespielt. Er fragte die Frau, was sie herführe. Sie wollte einen Brief für den blinden indianischen Richter abgeben, für Ed Crazy Eagle.
»Warten Sie, die Sekretärin wird das erledigen.«
Die Frau verfiel wieder in eine teilnahmslos wirkende Haltung. Shaw kehrte an seinen Schreibtisch zurück und steckte sich eine Zigarette an, obgleich er es nicht liebte, im Dienst zu rauchen. Es gehörte sich nicht. Er drückte die Zigarette wieder aus. Irgendwo in dieser Prärie musste es einen Punkt völliger Korrektheit geben, und dieser Punkt war das Dienstzimmer Nick Shaws.
Er hörte das Geräusch eines Wagens, der eben auf der Straße vorbeifuhr. Der Motor war alt, etwas zu laut.
Shaw unterzeichnete eine Vorlage für den Superintendenten.
Der Wagen, den Shaw gehört hatte, hielt vor einem der gleichförmigen einstöckigen Holzhäuser, die die Agenturstraße hinter Vorgärten säumten. Das Haus stand am Ende der Straße. Es war das kleine, einfache Gebäude des Stammesgerichts. Der Blinde stieg aus und fand ohne Mühe den ihm bekannten Weg in das Haus. Im letzten Raum linker Hand traf er den alten indianischen Richter, der den Rang eines »Gerichtspräsidenten« an dem bescheidenen Stammesgericht einnahm. Die Stimmen hatten ihm schon verraten, dass vor dem alten Richter zwei Polizisten standen. Sie hatten in ihrer Stammessprache gesprochen, aber als der Blinde eintrat, der die Stammessprache nicht kannte, gingen sie dazu über, englisch zu sprechen.
»In New City«, sagte der eine, ein starker und großer Mensch, dessen Stimme von oben herunter tönte.
»In den Slums, wahrscheinlich bei der Schwester«, ergänzte der kleinere, aber nicht weniger stämmige Mann.
»Harold Booth hat ihn gesehen.«
Der Blinde hatte sich auf einen der schäbigen Stühle gesetzt. »Wir können nichts tun als warten«, hörte er den alten Richter sagen.
»Die Polizei in New City ist informiert.« Der lange Polizist sprach überlaut, weil er sich bewusst war, nicht gefragt zu sein. Der Blinde legte die Hand zusammengeballt auf den Tisch.
»Wird Stonehorn gesucht?«
»Ja und nein.« Der alte Richter hatte sich dem jungen Mann zugewandt. »Noch hat er kein neues Verbrechen begangen, aber wenn er zurückkommt, geschieht der nächste Mord. Wir sind verantwortlich.«
»Hat er Eltern?«
»Es ist eine Verbrecherfamilie.«
Der Blinde horchte auf. Er hörte den alten Richter zum ersten Mal mit scharfer Stimme sprechen.
»Wer ist Harold Booth?« fragte Crazy Eagle nach einer Pause.
»Der Jüngste der Booth-Familie. Von der großen Ranch vor den Badlands. Fünfundzwanzig Jahre.«
»Hat er mit Stonehorn schon zu tun gehabt?«
»Sie hassen sich.«
»Was hatte Harold in New City zu suchen?«
»Viehkauf. Der Vater hat ihn hingeschickt.«
Der Blinde glaubte die missbilligenden Blicke der beiden Polizisten körperlich zu fühlen. Eben darum stellte er noch eine Frage, aber er gab auch eine Erklärung dazu.
»Ich gehöre erst seit einem Vierteljahr zu eurem Stamm und eurer Reservation. Drei Monate sind nicht genug, um euch kennenzulernen. Sagt, wie alt ist dieser Joe King, den ihr Stonehorn nennt?«
»Dreiundzwanzig. Aber ich sage dir mehr als das. Seine Mutter hat den Vater ihres Mannes erschlagen. Ihr Mann war im Gefängnis; ein Trinker und Gewalttäter. Die Schwester ist in den Slums von New City verheiratet. Stonehorn selbst war aufsässig und faul als Schüler. Er kam ins Gefängnis, weil er gestohlen, weil er einen weißen Lehrer bedroht und eine Bande gebildet hatte. Als er freigelassen wurde, ist er ein Tramp und ein Gangster geworden. Er hat wegen versuchter Beihilfe zu schwerem Raub gesessen. Schon in einem zweiten Falle steht er unter Mordverdacht. Nur aus Mangel an Beweisen musste ihn das Gericht der weißen Männer vor kurzem erneut freisprechen.«
»Hat irgend jemand bei uns hier persönlich Angst vor ihm?«
»Ja, Harold Booth. Die beiden haben sich schon in der Schule geschlagen. Harold ist ein großer, kräftiger Mann in den Zwanzigern, ein richtiger Indian-Cowboy auf der Ranch und gut im Football. Aber Stonehorn ist heimtückisch und gewandt wie ein Raubtier. Harold hat Angst.«
»Kann jemand nach New City fahren und mit Stonehorn sprechen, ehe ein Unglück geschieht? Gibt es irgend jemand, der Einfluss auf ihn hat?«
»Er lässt sich für keinen von uns blicken. Er hasst uns alle. Es war nur ein Zufall, dass er gesehen wurde. Vergiss auch nicht, was ich dir gesagt habe: Er hat nicht nur irgendwelche Verbrechen auf eigene Faust begangen. Er ist ein Gangster geworden, und die Gangs geben ihre Mitglieder nie mehr frei. Er ist ein verlorener Mensch.«
»Lebt die Mutter noch?«
»Sie ist in den Slums von New City bei ihrer Tochter gestorben. Unsere Familien hier dulden keine Mörderin unter sich.«
»Sie war nicht zum Tode verurteilt?«
»Nach dem Gesetz habe ich sie freigesprochen, ich, verstehst du? Notwehr. Aber für unsere Familien hier ist nach uralter Überlieferung ein Mord ein Mord. Ein Vatermord. Da gibt es kein Erbarmen. Auch der Ehemann wollte sie nicht mehr bei sich dulden.«
»Ihr Sohn Joe King hat die Reservationsrechte?«
»Wir haben sie ihm noch nicht abgesprochen. Sein Vater, der alte King, lebt hier, und er hatte seinen Sohn wieder zu sich genommen, als er selbst aus dem Gefängnis kam.«
Der Blinde fragte nicht weiter. Er stand auf. Ohne Hilfe zu beanspruchen, ging er in die kahle Kammer, die sein Arbeitsraum war. Dort hatte sich schon ein Helfer und Betreuer eingefunden, ein runzliger Mann von etwa sechzig Jahren. Er las dem Blinden das Schreiben der Indianerin vor, das die Sekretärin auf Anweisung von Nick Shaw unterdessen gebracht hatte. Eliza Bighorn, so hieß die Frau, sollte mit Gefängnis bestraft werden, weil ihr achtjähriger Sohn drei Tage unentschuldigt von der Schule ferngeblieben war. Eliza verteidigte sich.
Irgend jemand hatte ihr den Brief geschrieben. Sie wohnte weitab, der Schulbus kam nicht bis zu ihrem Haus. Sie besaß weder Pferd noch Auto. Der Junge hatte wieder einen epileptischen Anfall gehabt. Es gab keine Nachbarn, und Eliza selbst musste auf die zwei kleineren Kinder achtgeben. Sie konnte ihr Haus nicht verlassen, nur um nach einem langen Marsch eine Entschuldigung bei der Schule vorzubringen. Wegen drei Tagen!
»Den Brief an das Hospital«, entschied der Blinde. »Die Schwestern sollen sich um die Frau und um den epileptischen Jungen kümmern, auch wenn keine Autostraße dorthin führt.« Er sprach entschieden, aber doch nicht mit soviel eindringlicher Aufmerksamkeit, wie man sie selbst in geringfügigen Angelegenheiten bei ihm gewohnt war.
Nach einigem Schweigen zeigte es sich, wohin seine Gedanken abgeirrt waren. »Runzelmann, warum nennt ihr Joe King auch Stonehorn?«
Der Helfer ließ sich zu einer Auskunft herbei. »Die Mutter seiner Mutter war eine aus dem Geschlecht des Inya-he-yukan, des Steins mit Hörnern, von dem wir nur Gerüchte und Sagen kennen. Wir wissen nicht, ob es ihn je gegeben hat. Aber sie nannte ihren Sohn nach ihm, als er die Schläge des Großvaters überlebte.«
»Der Großvater hasste diesen Enkel?«
»Der Großvater liebte den Brandy, und Stonehorn ist schon mit zwei Jahren wild und böse wie eine Raubkatze gewesen.«
»Wir müssen arbeiten. Ist weitere Post da?«
Auf diese Weise hätte Ed Crazy Eagle nicht abschließen dürfen. Er wusste es selbst, kaum dass er die Worte gesprochen hatte. Nun würde Runzelmann nicht so leicht wieder den Mund öffnen, vielleicht in dieser Sache nie wieder.
»Es ist keine weitere Post da. In einer halben Stunde beginnt der erste Termin.«
Die halbe Stunde verlief ungenutzt.
Aus dem Zimmer des alten Richters kamen die beiden indianischen Polizisten heraus. Crazy Eagle hörte sie durch den schmalen Korridor gehen und das Haus verlassen. Draußen sprang der Motor des Jeep an. Die Polizei benutzte dieses Fahrzeug, um in der Prärie auch ohne Weg und Steg vorwärts kommen zu können.
Als es hoher Mittag wurde und die Beamten auf die Uhr schauten, waren auch die Vormittagstermine auf dem Gericht erledigt. Crazy Eagle entschloss sich, noch zu den Fachdezernaten hinüberzugehen. Das Wohlfahrtswesen verwaltete eine blondierte Frau. Sie machte einen intelligenten Eindruck, war angenehm gerundet und so mit dem nötigen Schwergewicht versehen, um viele Leute mit wenig Geld zu versorgen. Eine magere alte Indianerin verließ eben das Wohlfahrtsbüro. Kate Carson freute sich, als der Blinde – ohne Begleiter – eintrat.
»Ed«, sagte sie hinter der Barriere, die den Raum teilte, »hier spielen sie alle verrückt, weil Joe King gesehen worden ist. Gestern war der Vater bei mir und hat sich seine Rente geholt. Er wird sie versaufen, und es kann wieder Schlägereien geben. Das kenne ich seit fünfzehn Jahren, es ändert sich nichts. Überhaupt ändert sich noch viel zu wenig. Aber deshalb wollte ich nicht zu Ihnen hinüberkommen. Es geht um unsere Teenager, die jetzt in den Ferien zu Hause sein werden. Stonehorn kann sich unter ihnen aussuchen, wen er will. Viele bewundern ihn im stillen – fürchte ich.«
Ed hatte sich einen Stuhl vor die Barriere gerückt.
»Es gäbe schon Beschäftigung für die Jungen und Mädchen. Aber Haverman«–er deutete mit einer Kopfbewegung in Richtung des Nebenzimmers–, »Haverman ist zu schwerfällig, und er sieht sich nicht genug auf anderen Reservationen um, was dort gemacht wird. Er kann auch nicht mit unseren Leuten zusammenarbeiten, scheint mir. Er regiert immerzu.«
Die füllige Blondine erhob sich auf eine höchst eigenartige Weise, als ob sie an ihrem Schopf in die Höhe gezogen würde. Sie starrte aus dem Fenster. Das konnte der Blinde nicht sehen, aber an der Richtung eines Lautes, den sie ausstieß, erkannte er, wohin sie blickte.
»Was gibt es da draußen?«
Kate Carson wandte sich verblüfft um. »Woher wissen Sie denn… Himmel… er kommt zu uns. Tatsächlich… Das muss sofort ausgenutzt werden.«
Kate Carson puderte sich schnell die Nase. Es war ein glutheißer Tag, in ihrem Zimmer gab es keine Klimaanlage, und obgleich sie sich keinen Augenblick vom Stuhl gerührt hatte, war ihre Gesichtshaut nass von Schweiß.
Der Blinde lauschte, er hatte ein feineres Gehör als andere. Die Haustür wurde auf- und zugemacht, leiser noch, als Nick Shaw das vermochte. Kaum hörbare Schritte gingen durch den Korridor. Entweder trug jemand Mokassins, oder die Schuhe waren von weichem, bestem Leder. Die Schritte waren raumgreifend, wie ein großer und sehniger Mensch sie mühelos macht. Jemand trat in das Nebenzimmer ein, ohne anzuklopfen.
»Allmächtiger«, flüsterte Kate Carson, »er ist es! Und wie er sich herausgeputzt hat! Wie ein Spanier. Schwarze Jeans, das Hemd glänzt weiß, ein schwarzer Cowboyhut… der Bursche ist erst vor zwei Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen worden… wo und wie er sich das Geld schon wieder organisiert hat… weiß der Teufel!« Sie versuchte zu lauschen, aber es war nichts zu hören.
»Gehen wir hinüber, Ed?«
»Das wäre falsch.«
»Wollen Sie die Polizei verständigen?«
»Wozu?«
Kate Carson atmete tief und unruhig. Ihr ganzer Körper geriet in Bewegung. »Wir müssen den Augenblick doch nutzen, Ed. Mit ihm sprechen…«
»Sieht er gut aus?«
Kate Carson begriff die Ironie nicht. »Ja.«
»Wir müssen abwarten, mit wem er sprechen will. Soll ich ihn verhaften lassen, weil er wieder heimgekommen ist?«
»Heim! Zum besoffenen Vater, und im Hause nichts zu essen… Übrigens ist er nach seiner Entlassung schon wieder rumgelungert, und also haben Sie als Richter das Recht… oder die Pflicht…«
»Jedenfalls nicht die Pflicht, schon im ersten Augenblick alles zu verderben.«
»Ihre Ruhe, Ed, möchte ich auch einmal haben.«
Der Blinde lächelte, zum ersten Mal an diesem Tag. »Ich bin ein Indianer, MrsCarson.«
Das Gespräch nebenan dauerte länger, als es zwischen Beamten und Indianern üblich war. Erst nach zehn Minuten wurde die Tür wieder geöffnet und geschlossen, genauso leise wie beim Eintreten des Besuchers. Die Schritte gingen in dem Tempo, in dem sie gekommen waren, wieder aus dem Haus hinaus. Diese Schritte hatten mit ihrer Gleichmäßigkeit und Leichtigkeit etwas durchaus Unpersönliches an sich. Ed Crazy Eagle hatte tatsächlich mehr die Vorstellung, dass sich diese Schritte selbständig bewegten, als dass hier ein Mensch ging, der hätte zögern oder sich beeilen können.
Kate Carson konnte durch das Fenster nichts mehr beobachten, denn der Besucher hatte jetzt die andere Richtung eingeschlagen.
Frau Kate, verwitwete Carson, öffnete die kleine Tür der Barriere, fest entschlossen, nun zu Haverman hinüberzugehen. Da stürzte Haverman schon herein. Er hatte noch genug Fassung, um den Richter Crazy Eagle höflich zu begrüßen, dann ließ er sich auf einen Stuhl fallen und faltete die Hände vor dem Gürtel, ein Zeichen, dass er sich selbst beruhigen wollte. Sein weißes Hemd war unter den Armen verschwitzt.
»Frech, was?«
»Wer?« fragte der Blinde.
»Joe King war bei mir.«
»Was hat er Ihnen vorgetragen?«
Die etwas in Unordnung geratenen Gedanken und Gefühle Mr.Havermans ordneten sich im Nu zu einem amtlichen Bild. »Ein Arbeitsbeschaffungsprogramm.« Haverman netzte die Lippen mit der Zunge. »Ausgerechnet Joe King. Er kann in der Angelhakenfabrik anfangen, habe ich ihm gesagt, morgen schon, wenn er will. Aber es geht ihm nicht darum zu arbeiten; es geht ihm nur darum, uns Scherereien zu machen. Er ist sozusagen ein professioneller Prärie-Indianer.«
»Was hat er denn für Vorstellungen?«
Mr.Haverman stierte den Blinden verblüfft, wenn auch keineswegs unfreundlich, an. »Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Ich habe sozusagen jeden Moment darauf gewartet, dass er einen Colt oder ein Messer oder einen anderen unangebrachten Gegenstand hervorholt. Er hat von Pferdezucht gesprochen, von Rodeo-Pferden… Also bitte, sein Vater hat den Boden für eine Ranch, er kann ja anfangen… wenn er arbeiten will.«
»Kaufen Sie die Zuchtpferde?«
»Für den? Nein. Die Familie Booth haben wir unterstützt, der Erfolg ist da… nicht gerade die teuren Rodeo-Pferde, aber brauchbares und verkäufliches Rindvieh, neuerdings auch schwarzes Vieh, das ist zäher.– Übrigens sollte man den Burschen einmal ins Hospital einliefern und auf seinen Geisteszustand untersuchen lassen. Diese Augen! Ganz normal ist der nicht. Ihre Frau ist doch im Hospital angestellt, MrCrazy Eagle. Kann sie nicht mit den Ärzten sprechen?«
»Der Gesundheitsdienst arbeitet nicht mehr mit Polizeimethoden.«
»In diesem Falle beinahe schade.«
»Kommt Joe King noch einmal, MrHaverman?«
»Zu mir kaum. Aber ich habe ihm empfohlen, es mit Kaninchen zu versuchen, wenn er durchaus züchten will. Die Angelhakenfabrik wäre allerdings besser. Mitten unter anderen hat man ihn unter Kontrolle. Wenigstens tagsüber.«
Kate Carson schaute auf die Uhr.
»Wir müssen essen gehen, es ist schon zwölf Uhr dreißig. Kommen Sie mit, Ed?«
»Danke.«
Der Blinde fand mit den beiden anderen zusammen den Weg in den Vorgarten zu der Bank, die hier aufgestellt war. Er verabschiedete sich und ließ sich im Schatten eines Baumes nieder. Der indianische Gärtnerbursche hatte den Rasen gesprengt. Für die Agenturstraße gab es aus Tiefbrunnen noch immer Wasser, obgleich das Land unter dem blauen Himmel wie in einer Bleikammer ausdörrte. Der Gärtnerbursche hatte auch Mittagspause machen wollen, doch als er sah, wie der Blinde sich niederließ, fing er an, Unkraut zu jäten. Ed Crazy Eagle kaute an einem Stück trockenen Brots, das war sein liebster Lunch. In der Baumkrone über der Bank putzte ein Vogel seine Federn.
Der junge Bursche stand neben einem Häufchen Unkraut.
»Was gibt es denn Neues?« fragte ihn Crazy Eagle.
»Ni-ichts.«
Es gab also etwas. Natürlich gab es etwas. Der Bursche hatte Joe King gesehen. Vielleicht beneidete er ihn um das weiße Hemd und den schwarzen Cowboyhut, vielleicht auch darum, dass er die richtige Figur für Jeans hatte. Der Gärtner war kleiner, unscheinbar und fleißig. Ed wusste das.
»Wann wird geheiratet?« fragte er ihn.
»Der Vater sagt nicht ja. Er meint, ich sei viel zu jung, mit der Schule nicht fertig, mit der Lehre nicht fertig, und Laura habe bessere Aussichten. Seitdem sie hier Sekretärin geworden ist.«
»Was sagt sie denn selbst?«
»Wie die Mädchen eben sind.«
»Geht ihr morgen tanzen?«
»Sie will twisten, aber ich mag das nicht. Morgen gehe ich sowieso nicht…«
»Warum nicht?«
»Joe King ist wieder da.«
»Dann gibt es Streit?«
»Das ist sicher.«
»Seid ihr nicht Manns genug, wenn ihr euch zu fünft oder zu zehnt gegen ihn zusammentut?«
»Er hat auch seine Freunde. Und mit fünf nimmt er es allein auf. Er schämt sich auch nicht, das Messer zu ziehen.«
Der Vogel in der Baumkrone hielt seine Mittagsruhe. Die Straße lag leer. Nur die parkenden Autos erinnerten daran, dass in den Häusern Menschen wohnten.
»War Stonehorn mit dem Wagen hier?«
»Er kam zu Fuß. Wie er den Weg von New City hierher gemacht hat, wer will das wissen? Wenn er einen Wagen oder ein Pferd hat, wird er es uns nicht zeigen.«
»Warum nicht?«
»Weil er vielleicht nicht mehr gefunden werden will… morgen oder übermorgen.«
»Warum nicht?«
»Fragen Sie Harold Booth, Mr.Crazy Eagle. Der kann Ihnen sagen… wovor er Angst hat.«
Auf der Straße rührte es sich. Die Beamten kamen zu ihren Wagen, um von ihren Privathäusern die wenigen Meter zurück zu den Büros zu fahren. Manche Wagen wechselten nur die Straßenseite.
Der Gärtnerlehrling schaute zu und verbarg seine Gedanken.
Für den Freitagnachmittag waren keine Gerichtstermine mehr angesetzt, aber Ed wollte sich für die Verhandlungen in der nächsten Woche schon vorbereiten. Mit der vorsichtigen, tastenden Gangart des Blinden machte er sich auf den Weg zu dem kleinen Gerichtshaus.
Haverman lief ihm nach.
»Darf ich Sie fahren, Mr.Crazy Eagle? Haben Sie Ihren Wagen nicht da?«
»Danke, der Wagen ist da, aber ich laufe die paar Schritte.«
Haverman schüttelte den Kopf und begab sich in sein Dienstzimmer.
In der schmalen Kammer, die sich Crazy Eagle selbst als Arbeitsraum ausgewählt hatte, fand er Runzelmann und, wie er dem Geräusch des Aufstehens von einem Stuhl entnahm, noch einen zweiten Besucher.
»Harold Booth«, stellte sich dieser vor.
»Ah, gut.«
Der Blinde setzte sich. Harold wollte nicht wieder Platz nehmen.
»Was gibt’s?«
»Nichts von Belang.«
Harold war einen Meter fünfundachtzig groß. Er hatte nicht nur eine breitschultrige Figur, sondern auch eine dementsprechende Stimme. Der Blinde konnte sich leicht ein Bild von ihm machen. Er roch nach Pferden und Rindern und nach Leder.
»Aber es gibt etwas, weswegen du zu mir kommst.«
»Ja.« Das Ja klang verlegen. Harold knautschte den Cowboyhut in der Hand. »Vielleicht haben sie Sie nicht damit belästigt, Chief Crazy Eagle, aber wenn…«
»… dann…?«
»Ich habe keine Angst. Das ist dummes Geschwätz.«
»Wovor sollte auch ein Bursche wie du Angst haben!?«
»Eben.« Harold atmete auf. »Mir kann das egal sein, wer sich auf der Reservation herumtreibt. Ich möchte nur nicht, dass er Queenie belästigt. Dann schlage ich zu.«
»Queenie? Die Queen unter euren Teenagern?«
Harold lachte kurz, freundlich, aufgeschlossen. »So ist’s.«
Der Blinde hörte, dass Harold an seiner Lederweste herumknöpfte, aufknöpfte, zuknöpfte, aufknöpfte, tastete. Er konnte nicht sehen, dass Harold in einem Anhänger an silbernem Kettchen ein Bild mit sich trug.
»Und was soll ich tun, Harold?«
»Nichts. Deswegen komme ich. Sie brauchen nichts zu unternehmen. Ich gehe nicht zum Tanz und nicht zum Trinken. Ich bleibe auf unserer Ranch, dort wird er sich nicht wieder sehen lassen. Oder ich besuche die Eltern von Queenie. Sie kommt jetzt in den Ferien heim.«
»Und bei den Eltern von Queenie stoßt ihr dann zusammen?«
»Kaum. Der Vater würde ihn nicht ins Haus lassen.«
»Woher kennt ihr drei euch?«
»Wir waren einmal in der gleichen Schule… damals war Queenie noch ein kleines Mädchen, ja.«
»Lernt sie nicht jetzt auf der Kunstschule?«
»Ganz recht. Aber in den Ferien kommt sie heim. Nächstes Jahr macht sie den Abschluss. Endlich.« Das »Endlich« klang unzufrieden.
»Ist es nicht gut, dass sie so lange lernt?«
»Es kommt darauf an, was. Sie hätte bei ihren Eltern lernen können, was eine Frau auf einer Ranch wissen und können muss.«
Das verborgene Lächeln legte sich um die Mundwinkel des Blinden. »Sie ist auf der Ranch des Vaters aufgewachsen. Es wird nicht schwer halten, dass sie sich einmal auf einer größeren zurechtfindet.«
»Das denke ich mir eben auch. Aber man hört, dass die auf der Kunstschule…«
»Was?«
»Dass sie dort nicht gut erzogen werden können. So viele Künstler auf einen Haufen, Chief Crazy Eagle, wie soll das gutgehen? Das ganze Jahr über hat sie mir nie geschrieben. In der Schule herrscht keine Ordnung. Wie soll es Ordnung geben, wenn Dakota und Siksikau und Hopi und Navajo und Apachen und Pima und wer weiß was noch alles in einem Haus durcheinanderwirbeln? Da gibt es keine anständigen Grundsätze.« Harold hatte immer schneller und eifriger gesprochen. »Also bin ich gekommen, um Sie zu bitten, Chief Crazy Eagle…«
»Ich bin aus Fleisch und Blut, und ich bin kein Chief. Ich kann auch nicht als Schutzgeist über Queenie schweben. Sie muss sich schon selbst behaupten.«
»Schließlich ist sie auch nur ein Mädchen. Können Sie nicht mit dem Vater reden, dass er Queenie nun hierbehält, und wir machen Hochzeit? Auf Sie würde der Vater hören.«
»Nein, Harold, ich rede nicht mit ihm. Ich bin nicht dafür, dass ein Indianermädchen ein Jahr vor dem Abschluss von der Schule abgeht. Queenies Name ist bis zu mir gedrungen, weil sie eine sehr gute Schülerin und eine begabte junge Künstlerin ist. Wir können stolz auf sie sein. Sie soll ein Vorbild für die anderen Indianermädchen werden.«
»Es kommt ja immer darauf an, worin man Vorbild ist.«
»Traust du ihr so wenig?«
»Den jungen Burschen traue ich nicht… überhaupt… hat sie sich auch einmal…« Harold brach ab und spuckte aus.
»Gespuckt wird hier nicht, Harold Booth. Das kannst du auf deiner Ranch machen, aber nicht hier auf dem Gericht.«
»Entschuldigung«, murmelte der Bursche. »Ich meine aber, es wird für mich selbst jetzt Zeit zu heiraten. Ich bin fünfundzwanzig. Es kommt ja nicht nur auf das Mädchen an und was die will. Ich kann auch andre haben. Aber die Arbeit auf der Ranch wird zuviel für uns, und der Vater drängt.«
»Das ist deine Sache, Harold Booth. Wollt ihr euch nicht jemanden zur Hilfe nehmen? Viele suchen Arbeit.«
»Fremde Hände können wir nicht bezahlen; das trägt die Ranch auf dem schlechten Boden hier nicht. Die Familie muss arbeiten. Aber das ist meine Sache, Chief Crazy Eagle, Sie haben recht.«
Harold sprach wieder ruhig und zuversichtlich. »Queenie kommt heim, dann wird man sehen, und es wird sich alles regeln. Sie kann mich hören, den Vater hören und nachdenken. – Ich danke, Chief Crazy Eagle.«
»Guten Tag, Harold.«
Als Harold Booth das Zimmer verlassen hatte, ließ sich der blinde Richter das Gespräch noch einmal durch den Kopf gehen.
»Runzelmann«, fragte er schließlich, »rechnet Harold immer so nüchtern?«
»Er hat noch nie gerechnet, Ed. Seine Mutter hat etwas Geld mit in die Ehe gebracht; die Booths haben eine große Ranch gepachtet. Harold ist der Jüngste und der Liebling der Eltern. Er war einer der besten Schüler, die Lehrer mochten ihn gut leiden, und er ist ein fröhlicher Cowboy und ein ansehnlicher Bursche geworden. Er ist daran gewöhnt, dass ihm nichts im Leben schiefgeht. Die Mädchen haben ihn gern.«
»Queenie ist schon lange seine Liebe?«
»Man sagt es.«
»Was hat er unter seiner Weste gesucht?«
»Er trägt ein Medaillon an einem silbernen Kettchen. Vielleicht ihr Bild.«
»Was gefällt dir denn nicht an ihm?«
»Ich weiß nicht. Aber was er gesagt hat und wie er es gesagt hat, das passt nicht zu ihm. Ich glaube, dass ihm das jemand anders eingegeben hat.«
»Wer?«
»Das weiß ich nicht.«
»Vermutest du etwas?«
Queenie
Die Klimaanlagen waren in Betrieb, und es herrschte in den Räumen der Kunstschule jene gemäßigte, immer gleichbleibende Kühle, an deren Unnatürlichkeit Queenie sich erst hatte gewöhnen müssen.
Sie war erwacht, aber draußen war es noch dunkel. Der Brunnen, auf den sie vom Bett aus schauen konnte, war abgestellt. In den Bäumen rauschte der Nachtwind. Queenie hörte es, obgleich die Fenster geschlossen bleiben mussten. Sie hatte die Augen offen, und ihre Gedanken spielten zwischen Traum und klarem Bewusstsein.
Am vergangenen Abend hatte die Abschlussklasse das bestandene Examen gefeiert. Die Schüler und Schülerinnen der elften Klasse waren dabeigewesen. In Queenies Erinnerung zogen die Vorgänge noch einmal vorüber. Im kommenden Sommer wollte sie selbst unter denjenigen sein, die das Examen bestanden hatten und die Schule verließen. Dann würde auch sie den weiten Talar und die Kappe mit den vier Ecken tragen, die an das alte Zauberzeichen der vier Weltecken erinnerte.
»Unsere Vorfahren«, hatte der Sprecher der Klasse gesagt, »sahen den Mond und die Sonne, das Wasser und die Erde. Von ihnen lernten sie ihre Geheimnisse und ihre Kunst. Wir haben Lehrer. Wir haben gelernt. Wir werden weiterlernen. Wenn wir aber vergessen sollten, dass wir Indianer sind, so wird unsere Kunst leer werden, unsere Hände werden fahrig sein, unsere Augen trüb. Darum vergesst eure Väter und Mütter nicht, und nicht den Mond noch den Wind, nicht die Erde und nicht die Quellen. Ihr müsst wissen, woher ihr eure Kraft zieht. Ich habe gesprochen.«
Draußen rauschte es in den Wipfeln. Es war drückend heiß, selbst in der Nacht, und Wirbelstürme standen bevor.
Bis Mitternacht war Unruhe gewesen. Die Schüler und Schülerinnen hatten getanzt. Die Verwandten und Freunde, die zu der Abschlussfeier gekommen waren, hatten geplaudert. Hin und wieder hatte ein kleines Kind geweint, ehe es einschlief. Die Familien brachten alles mit, Kind und Kegel; wer sollte sich daheim auch ihrer annehmen, und auf die Mutter wollte keiner der Schüler an diesem Festtag verzichten. Aber jetzt, kurz vor Anbruch der Morgendämmerung, war es still rings um die großen Anlagen und die Gebäude der Kunstschule. Die meisten Gäste hatten mit ihren Wagen oder mit dem Bus die kleine Stadt im Süden schon wieder verlassen. Queenie träumte mit offenen Augen.
Sie hatte am Abend zwei Entscheidungen gefällt, und beide erschienen ihr richtig, je mehr sie darüber nachdachte. Sie verkaufte das Bild nicht. Dieses Bild verkaufte sie nicht. Der Mann, der es hatte haben wollen, war ein Interessent. Aber ein Mann der Geheimnisse war er nicht. Sie konnte ihm das Bild nicht geben. Nie.
Mochte er zufrieden sein mit dem Gemälde, auf dem der Schild auf rotem Grund dem Betrachter in die Augen sprang. Er hatte es teuer bezahlt. Indianische Künstler waren in Ausdruck und Technik ungewöhnlich früh reif. Wahrscheinlich hegte der Käufer auch die Hoffnung, sich mit dem hohen Preis für das erste ein moralisches Anrecht auf das zweite Bild zu erwerben.
Nein. Tashina hatte gesprochen.
Vielleicht hätte Queenie nachgegeben. Aber dieses zweite Bild hatte nicht Queenie gemalt, die den weißen Männern und Frauen von der Schönheit altindianischer Kunst neu erzählen wollte. Dieses zweite Bild war das Bild Tashinas, die in Queenie verborgen war und von der die Lehrer nichts wussten. »Ich befehle meinem Gesicht, eine Maske zu werden. Meine Gefühle sind verwundbar. Sie müssen bedeckt bleiben…« Dieser Zweizeiler war gedruckt, aber Queenie hatte nie gestanden, dass er aus ihren Gedanken geboren war. Sie hatte ihn auf einen Zettel mit Druckbuchstaben aufgeklebt, und diesen Zettel hatte sie Conny finden lassen. Conny glaubte zu wissen, was er zu tun habe. Er hatte sich bereit gefunden, ein solches Gedicht auf seinen Namen zu nehmen, obgleich die Lehrer nun Geheimnisse in seinem vordergründigen Empfinden vermuteten, zu denen er nie Zugang hatte. Queenie lächelte.
Waren Männer dumm?
Waren Künstler eitel?
Das Bild mit den offenen Händen verkaufte sie nicht. Der Lehrer meinte, dass es eine Studie sei, eine Skizze. Sie hatte dazu genickt und hatte nicht nur den Schleier ihres Schweigens über diese Hände gebreitet. Sie hatte den Geheimnisschleier geknüpft, der nach den Mythen, in denen sie erzogen war, alles schützte und barg, was mit dem Heiligen Geheimnis in Berührung stand. Der Lehrer hatte seine Überraschung gezeigt. »Originell«–sie hörte seine Stimme noch–, »höchst eigenartig, die Verbindung von zwei ganz verschiedenen Techniken: Öl… und Stoff.«
Schleier über die offenen Hände. Tashina wollte ihre Hand offen hinhalten. Aber das sollten nur die sehen, die es verstehen konnten.
Für das Gemälde mit dem Schild hatte sie soviel Geld erhalten, dass ihr fast schwindelte. Soviel Geld auf einmal sahen Vater und Mutter und die Geschwister für ihre harte Arbeit nie. Sie freute sich darauf, ihnen die Hand zu öffnen. Aber das würde nur die einfache Bewegung dieser einfachen Hand sein, die sie zuerst gemalt hatte. Die anderen Hände hatten anderes und noch viel mehr zu geben. Die anderen Hände waren größer. Diese, die das Geld geben konnte, war die kleine.
Queenie wechselte den Wachtraum und lachte auf einmal vor sich hin. Walt hatte eine Wette verloren. Er war ein hübscher Bursche, eben so frech, dass er reizvoll wirkte, und so schüchtern, dass man ihn liebhaben musste. Er konnte Spaß machen, und er konnte sentimental sein, je nachdem, ob ein Mädchen sich das wünschte. Viele Mädchen hatten sich an ihn geschmiegt und sich von ihm umarmen lassen; er war auch ein gewandter Tänzer. Mit großer Liebe und allen Wirrnissen, die dadurch entstehen konnten, hatte er nie etwas zu tun gehabt. Am hübschesten sah er aus, wenn er den Twist tanzte oder wenn er mit ernster Miene, die Zungenspitze ein wenig aus den Lippen hervorgedrängt, vor dem Bild stand, das nie der ganz große Wurf werden wollte… Walt hatte gewettet, dass es ihm gelänge, Queenie in die Arme zu nehmen. Sie hatte das nicht gewusst. Queenie war unbefangen gewesen. Walt holte sie zum Tanz, Walt plauderte mit ihr, Walt machte sie heimwehkrank und wieder fröhlich. Auf einmal waren sie allein im Garten. Der Wind rauschte noch nicht in den Bäumen, die Wagen parkten noch, aus dem Saal klang Musik, alte indianische Musik mit neuen Instrumenten. Walt wollte Queenie an sich ziehen… Sie packte sein Kinn und stieß ihn mit gestrecktem Arm zurück, mit einem so kräftigen Schwung, wie es der Tochter eines Ranchers zukam. Walt wirkte komisch mit dem nach hinten gebogenen Kopf. Queenie hatte lachen müssen. Ella, Queenies Freundin, und zwei Schüler, die an der großen Glastür des Gebäudes standen, hatten mitgelacht. Walt war abgezogen.
Ella war zu Queenie gelaufen und hatte ihr die Sache mit der Wette gestanden.
»Du bist merkwürdig«, hatte Ella dann wie nebenbei gesagt. »Ich habe gewusst, dass du dich nicht umarmen lässt. Warum eigentlich nicht?«
Queenie hatte nicht geantwortet. Sie war nur vom Lachen zum Lächeln übergegangen. Jetzt, im Wachtraum, erlebte sie das Ganze noch einmal. Sie spürte noch einmal das Vergnügen, mit dem sie Walt den Kopf zurückgebogen hatte, was ihn so komisch aussehen ließ.
Queenie streckte sich. Sie wusste, dass sie einen ebenmäßigen Körper hatte, glatte, weiche Glieder und eine Haut, so braun wie die Nuss, wenn sie eben reif wird. Sie hatte die schwarzglänzenden Haare nicht gelockt, und sie legte kein Rouge auf die Lippen. Aber sie hatte sich einen rohseidenen japanischen Schlafanzug gekauft, weil sie schön sein wollte, schön wie der Teufel, wenn er achtzehn wird.
Ella wurde jetzt auch wach. Die beiden Mädchen bewohnten zusammen ein Zimmer. Sie schliefen auf weichen Betten unter leichten Decken, der Boden war mit einem hellen Teppich belegt, die Wände mit einer stillen, schweigsamen Farbe abgeschattet, auf der die Bilder sprechen konnten. Durch die Fenster und die durchlässigen Gardinen drang der erste Morgenschimmer. Ella betrachtete ihre Freundin Queenie lange und eindringlich, und Queenie hielt den Blick mit freundlicher Miene aus, denn sie war von einer allgemeinen, unbestimmten wohltuenden Erwartung erfüllt. Heute war der erste Ferienmorgen… heute durfte sie packen… heute würde sie beginnen, nach Hause zu fahren, den weiten Weg aus dem Süden in die nördliche Prärie… fort von den spanischen Häusern mit den flachen Dächern und den schwer duftenden, bunten Gärten, hin zu den Holzhütten und graugrüner, endloser Weite.
Ella vermochte die Natur dieser Freude nicht ganz zu verstehen. Ella war im Süden daheim, und ihr Elternhaus war ein Lehmbau auf den kahlen Felsen, von denen man über Mais, Schafe und Wüste blicken konnte. Aber in Queenies Heimat gab es nicht Schafe, sondern ungesattelte Pferde und schwarze Rinder, nicht Mais, sondern ein paar Kartoffeln oder Korn, und die Hütten waren nicht aus Lehm, sondern aus Holz; sie standen auf den Hügeln oder in den Tälern, die das harte Büschelgras bewuchs. Die Freundschaft der beiden Mädchen war etwas Neues; sie wussten es und freuten sich daran. Ihre Stämme, Büffeljäger und Maisbauern, wohnten weit voneinander entfernt, und dennoch beschimpften sie einander auch jetzt noch, wie es vor Jahrtausenden die Nomaden und die Ackerbauern taten, obgleich die Büffeljagd längst der Vergangenheit angehörte und von Kriegen nicht mehr die Rede war.
Ella hatte ein eigentümlich flaches Gesicht, als ob Stirn, Mund, Augen, Nase ein Einziges bildeten. In Queenies Zügen unterschied sich alles deutlicher.
»Das Merkwürdige bleibt«, sagte Ella, ihre Gedanken abschließend, »dass bei dir alles so verschieden ist und doch in Harmonie.«
Die Mädchen verständigten sich auf englisch, denn keine kannte die Stammessprache der anderen.
Queenie hatte die Decke beiseite geschoben und sich zusammengekuschelt wie eine junge Katze. »Du siehst es nicht richtig, Ella. Bei mir ist nichts verschieden. Es ist alles eine Einheit, weil es alles in der Mitte ist… durchschnittlich, würde MrLazy Eye sagen, weil er nicht weiß, was das ist, eine Mitte. Ich bin ein mittleres Mädchen, mittelgroß, unauffällig, weil mein Körper und meine Glieder und meine Augen eben so sind, wie sie nach den Maßen sein sollen – mittelbegabt, weil ich das sehe, was ein Mädchen der Prärie seit vielen hundert Sommern und Wintern eben zu sehen und zu erkennen pflegt, und weil ich imstande bin, die genaue Hälfte von dem zu begreifen, was die weißen Männer und Frauen uns erzählen. Vielleicht kommt es auch daher, dass mein Vater eine mittlere Ranch hat, in der sich alles die Waage hält, das Vieh, die Pferde, die Kartoffeln, das Gärtchen, die Mutter und die Kinder. Ich habe nicht viel und auch nicht wenig gelernt. Ich bin nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste Tänzerin.«
»Aber du bist wie eine Kugel, rund, in sich geschlossen, deshalb bist du vollkommen, und das macht uns alle verrückt.«
Queenie lachte wieder. Sie hatte das volle Lachen der Jugend, nicht mehr und nicht weniger. »Wenn ihr keinen triftigeren Grund habt, verrückt zu werden–!«
»Die Burschen träumen von dir, Queenie. Ich bewundere dich, dass du so standhaft bleibst.«
»Ich bin nicht tugendhaft, Ella. Es hat nur der noch nicht zu mir gefunden, der mich verführen kann. Und was das Runde betrifft… du bist viel runder als ich.«
»Weiche mir nicht aus. Ich will zufällig einmal ernsthaft sein. Ich bin rund, ja, von Natur, ganz und gar, und es geht bei mir alles zusammen, das Alte und das Neue, die Geheimnisse und das Wissen, die guten Katchina, unsere Ahnen und Geister, die aus der Erde kommen, und Christus, der aus dem Grabe steigt, der Mais und die Kunst. Es ist alles ein großes buntes Spiel. Aber das ist es bei dir nicht. Du hast irgendeinen starken Reifen, mit dem du das, was nicht zusammengehört, zusammenzwingst… aber wiederum zwingst du es so leicht, als ob keine besondere Kraft dazu gehörte, oder deine Kraft ist so stark, dass das Schwere ein Spiel wird…«
»Hör auf, Ella, du spinnst.«
»Und du fängst dich in den feinen Fäden. Was ist das?«
Ella hielt einen kleinen vertrockneten Kaktus in die Höhe. Queenie glitt aus dem Bett, und ehe Ella es sich versah, war ihr der Kaktus aus den Fingern gewunden. Queenie zuckte vor Zorn. Es lagen ihr Worte auf den Lippen, die die Freundschaft für immer zerstören würden. Aber sie sprach sie nicht aus.
Sie verwahrte den Kaktus in einem kleinen Lederbeutel, dann lief sie hinüber in den Baderaum und ließ sich die Brause eiskalt über den Rücken rinnen. Sie musste etwas wegwaschen. Hatte Ella spioniert? Oder hatte sie etwa selbst diesen Kaktus achtlos liegengelassen, nachdem sie die Stachelspitzen in ihre Haut gedrückt hatte? Sie spürte ihren eigenen Körper auf einmal auf eine neue Art. Sie musste Abschied nehmen von der Zeit, in der sie noch ein Kind gewesen war oder noch das Kind gespielt hatte.
Als Queenie in das Zimmer zurückkam, ging Ella in das Bad. Danach war von dem Kaktus und von dem, was sich darum abgespielt hatte, nicht mehr die Rede.
Begegnungen
Für die letzte Strecke ihrer Reise hatte Queenie sich zum ersten Mal in ihrem Leben eine Flugkarte gekauft. Zwar hatte sie ursprünglich alles Geld des »Interessenten« ihren Eltern bringen wollen, aber dann war sie der Versuchung erlegen und hatte einige Dollars abgezweigt. Sie hatte ihre Flugkarte schon von der Kunstschule aus vorbestellt und den Eltern geschrieben, dass sie einen Tag früher in New City eintreffen werde. Zur elterlichen Ranch ging zwar keine Post, aber Queenie hoffte, dass ihr Bruder Henry in diesen Tagen, in denen Post von ihr erwartet werden konnte, zur Agentursiedlung ritt und auf dem Postamt nachfragte.
Nun saß sie in der Propellermaschine der Frontier Airlines, die in ihrem Namen die Erinnerung daran bewahrten, dass die Orte, die sie anflogen, vor noch nicht langer Zeit Grenzgebiet zwischen Wildnis und Zivilisation gewesen waren und in blutigen Jahren zum Wilden Westen gezählt worden waren.
Queenie hatte einen Fensterplatz. Tief unter ihr dehnte sich schon heimatliches Land, endlose Prärie unter dem Nachthimmel; nur hin und wieder erschien für das Auge der Zaun einer Ranch, noch seltener eines der einsamen Häuser. Die Sandfurchen an den Präriehügeln, in denen im Frühling und nach Gewittern das Wasser herunterschoss, lagen ausgetrocknet und gaben dieser Prärie, die schon seit Tausenden und Abertausenden von Jahren bestand, etwas Aufgerissenes, Bloßes und Wildes. Nur zweimal erkannte Queenie Gruppen schwarzer Punkte, das war schwarzes Vieh, und es waren Büffel, die wieder gezüchtet wurden, weil sie die Unbilden von Witterung, Sturm, Schnee, Hitze am besten überstanden, das karge, harte Gras, wenn nicht mit Lust, so doch ohne Widerwillen weideten und neben dem Fleisch das wertvolle Fell lieferten.
Queenie schloss die Augen, und für einen flüchtigen Augenblick wurde sie ganz Tashina. Sie träumte davon, wie Hunderttausende von Büffeln über die Hügel und Täler gezogen waren und Tausende von braunhäutigen Jägern das heilige Tier erlegt hatten, um Nahrung, Kleidung, Zelte zu gewinnen. Dann waren die Watschitschun gekommen, diese Geister in Menschengestalt, die sich Weiße nannten, und sie hatten mehr Wild erlegt, als sie brauchten. Mit ihren Repetiergewehren hatten sie die Büffelherden nicht gejagt, sie hatten gemetzelt. Tashinas Großväter hatten um ihr Land gekämpft, aber sie waren besiegt worden. Die weißen Männer hatten die Prärie, die Wälder, Berge und Flüsse geraubt. Sie hatten New City gebaut und der Erde das Gold aus dem Leibe gerissen. Die großen Häuptlinge waren gefallen, ermordet worden, gestorben, und von manchen kannten ihre Kinder und Kindeskinder nicht einmal das Grab. Die Nachkommen lebten nun auf dürrem Land, das man ihnen als Reservation übriggelassen und immer wieder beschnitten hatte. In allem mussten sie den weißen Männern, dem Superintendenten und seinen Beamten, gehorchen; für jeden Schritt brauchten sie die Erlaubnis und das Geld der weißen Männer; arm waren sie trotz aller Renten und verbrieften Verträge, und sie wurden gehalten wie Unmündige.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!