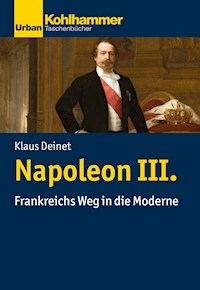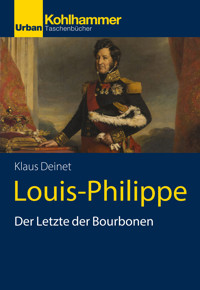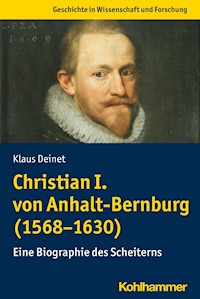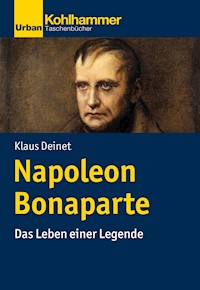
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Napoleon I is still a polarizing figure even today and is usually presented either as an outstanding saviour or as an abysmal monster who was merely driven on by fast-moving events. In this concise and methodologically well-considered biography, Klaus Deinet now outlines Napoleon=s career & from his meteoric rise to his precipitous fall & as a sequence of decisions that built on each other and were essentially made by Napoleon himself. He contrasts the military victories with the excessive strain on France=s resources, and political successes with glaring diplomatic mistakes. Deinet succeeds in presenting Napoleon=s personality as a consistent whole, although one that underwent massive changes. This results in a manageable, balanced and exciting biography, which also takes the turbulence of the era into account.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
PD Dr. Klaus Deinet war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Duisburg-Essen. Er ist Autor verschiedener Bücher zur deutsch-französischen Geschichte, u. a. einer Biografie Napoleons III. in dieser Reihe.
Klaus Deinet
Napoleon Bonaparte
Das Leben einer Legende
Verlag W. Kohlhammer
Für Ulrich, Jan-Christoph, Anja und Marlene
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Titelbild: Kolorierte Lithografie nach einem Gemälde von James Sant (1820–1916), »St Helena: the Last Phase«, um 1900, in der Glasgow Gallery of Modern Art, vermutlich als Illustration zu dem gleichnamigen Roman von Archibald Philip Primrose, London 1900; Foto: Getty Images.
1. Auflage 2021
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-037486-7
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-037487-4
epub: ISBN 978-3-17-037488-1
mobi: ISBN 978-3-17-037489-8
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
I. Bonaparte
Historischer Abriss
Eine Karriere (1769–1796)
Machteroberung (1796–1799)
Erster Konsul der Republik (1799–1802)
Autoritäre Wende und verspielter Friede (1802–1804)
II. Das Empire
Historischer Abriss
Das Verhängnis des Erfolgs (1805–1807)
Fünf Jahre der Illusionen (1807–1812)
Niedergang und Fall (1812–1821)
Schlussbetrachtung: Napoleon nach 200 Jahren
Anmerkungen
Literatur- und Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Register
Einführung
Im Jahr 1855, mitten im Krimkrieg, besuchte die britische Monarchin Queen Victoria mit ihrem Gemahl Prinz Albert und deren Sohn Edward die französische Hauptstadt. Es war der erste Staatsbesuch eines britischen Throninhabers seit der Französischen Revolution. Zu den Feierlichkeiten, mit denen Napoleon III. und seine Gemahlin Eugénie die Besucher beeindrucken wollten, gehörte neben den gewaltigen Abriss- und Neubaumaßnahmen, die der Präfekt Georges-Eugène Haussmann durchführte, der Besuch des Invalidendoms. Dorthin hatte der Sohn Louis Philippes die Gebeine des Korsen von der Insel Sankt Helena im Herbst 1840 gebracht. Vor dem Sarkophag Napoleons I. verharrten die Monarchen in Schweigen; Queen Victoria hatte im Vorfeld sogar dafür gesorgt, dass ihr Sohn, der Prinz von Wales, das Knie vor dem großen Gegner beugte, den sein Urgroßvater auf eine abgelegene Atlantikinsel verbannt und ohne ausreichende ärztliche Hilfe hatte sterben lassen.
Seitdem wurde der Napoleon-Sarg im Invalidendom zu einem internationalen Wallfahrtsort, einem notwendigen Bestandteil einer jeden Parisreise. »Paris […], wo tief in seinem Sarkophage / In Deinem Schoß von seinen Adlern überwacht / Der Kaiser schläft […]« dichtete der expressionistische deutsche Dichter Georg Heym in einem »Sehnsucht nach Paris« betitelten Gedicht, das im Jahr 1913 entstand. Auch heute umkreisen Besucher aus aller Welt den erstaunlich kurzen Marmorsarg, der an zentraler Stelle unter der Kuppel des Invalidendoms auf einem Podest steht, und lesen die dort eingetragenen Namen der siegreichen Schlachten »Austerlitz«, »Iéna«, »Wagram«, »La Moskawa«. Diese letztere, die Schlacht von Borodino, war ein grausames Ringen, bei dem beide Seiten an die 70 000 Mann verloren und an deren Ende die Grande Armée der Weg nach Moskau offenstand. In Moskau hielt Napoleon bis zum Oktober 1812 aus, um dann seinen fatalen Rückzug aus Russland anzutreten.
Was zeigt dieser kurze Blick auf sein Nachleben? Wie bei Alexander dem Großen und wenigen anderen großen Gestalten der Geschichte hat sich der Gegenstand der Verehrung so sehr von seiner historischen Realität gelöst. Napoleons tatsächliche historische Hinterlassenschaft wird in dem Maße überschätzt, wie die seines Neffen unterbewertet wird. Von seinen Zeitgenossen und den nachfolgenden Historikern wurde er zur Überfigur verzeichnet, oft im Bösen, dann im Guten, manchmal in beidem. Das mag daran liegen, dass er – anders als andere große Gewaltmenschen der Geschichte – noch die Möglichkeit hatte, sein Leben zur Legende zu verklären und damit den künftigen Biografen die Feder zu führen. Viele sind ihm darin gefolgt, einige haben sich an seinen Erinnerungen gerieben und liefen Gefahr, ihn zum Vorläufer der Diktatoren des 20. Jahrhunderts zu verzeichnen. Beides war er nicht. Sein Regime beruhte nicht auf Angst, sondern auf Konsens; er wusste sich mit einer aus der Revolution hervorgegangenen Elite zu umgeben, die aus jugendlichen Heerführern und Verwaltungsfachleuten bestand; und er besaß eine gewinnende Persönlichkeit, die auch Widerspruch zuließ. Hans-Ulrich Thamer hat das Rätsel seiner Wirkung zuletzt mit dem Weber’schen Begriff des Charismas einzufangen versucht.1 Ob er das Rätsel damit gelöst hat, muss allerdings dahingestellt bleiben.
Auf jeden Fall erfreut sich die Gestalt des Korsen einer ungebrochenen Attraktivität bei den Historikern. Allein in den letzten Jahren erschienen, um die Jahrestage seiner Geburt und seiner markantesten Siege und Niederlagen herum gruppiert, mehrere neue Biografien. Adam Zamoyski und Günter Müchler beschreiben ihn als eine Art ›stupor mundi‹, dessen Lebensleistung nicht an ihrem politischen Ergebnis gemessen, sondern als Erlebnis seiner schieren Außergewöhnlichkeit goutiert werden sollte. Volker Hunecke und Patrice Gueniffey versuchen ihm dadurch gerecht zu werden, dass sie sein Leben in eine ›gute‹ und eine ›schlechte‹ Hälfte teilen (mit der Kaiserkrönung als Wasserscheide), wobei letzterer sich auf die erste Lebenshälfte beschränkt, die er dafür umso ausführlicher schildert. Alle vermeiden eindeutige Verurteilungen oder Glorifizierungen, laufen aber dabei Gefahr, dass ihnen die Einheit der Persönlichkeit entgleitet.
Wenn wir dieser stolzen Reihe eine neue, relativ schlanke Biografie hinzufügen, so gilt es vorab, sich vor mehreren Fehlern zu hüten.
1. Napoleon ist nicht en bloc zu fassen, wie es früher häufig geschehen ist. Man wird ihm weder als ›Retter‹ noch als ›Verderber‹ der Französischen Revolution gerecht. Er war nicht der Schlachtengott, dessen militärisches Genie ihn vor jeder politischen Bewertung feit, weil er sich menschlichen Maßstäben entzieht. Und umgekehrt – wie ihn Freiherr vom Stein sah – war er auch nicht die Verkörperung des Bösen, dem beizukommen es der größten Kraftanstrengung bedurfte, die Europa sich je auferlegt hat.
2. Die 15 (bzw. rechnet man die Direktorialzeit mit: 20) Jahre seines politischen Wirkens sollten aber auch nicht in Schubladen zerlegt werden (wie ›das militärische Genie‹, ›der Bändiger der Revolution‹, der ›Neuordner Europas‹ usw.), so als stünden sie unverbunden nebeneinander. Das Phänomen Napoleon ist vielmehr als Prozess zu begreifen. Ein Prozess, der von kometenhaftem Aufstieg über einige wenige Jahre der Mäßigung und des Wiederaufbaus einer von der Revolution erschütterten Nation bis hin zum Übermaß, zur Überdehnung der menschlichen Ressourcen und zu einem ebenso jähen Abstieg führt. Daraus ergibt sich für unsere Erzählung ein chronologisches Fortschreiten, wobei sich das Augenmerk auf die Frage richtet, ob es in diesem Ablauf Punkte gab, wo ein rechtzeitiger Verzicht auf eine weitergehende Expansion alternative Verläufe zugelassen und Frankreich und Europa weitere Opfer erspart hätte.
3. Die Konstante in allen Verästelungen dieses Entwicklungsbogens, dessen schiere Dramatik die Zeitgenossen ebenso in ihren Bann schlug wie die Nachwelt, ist Napoleons Persönlichkeit. Die in seinem Charakter angelegten Impulse erklären nicht nur den frühen Aufstieg, sondern auch das maßlose Weiterschreiten und die Verbohrtheit beim Abstieg. Insofern sind die genannten Versuche, seine Karriere in die erste Hälfte eines ›guten‹ und die andere eines ›schlechten‹ Diktators zu teilen, ebenso wenig überzeugend, wie die Entscheidung Gueniffeys, seine Lebenserzählung einfach im Jahre 1804 abzubrechen und der Biografie den Titel Bonaparte zu geben – gerade so, als hätte der spätere Kaiser Napoleon I. den Bonaparte in sich betrogen und aus dem Revolutionsvollender den Gewaltherrscher gemacht, dessen Leben und Wirken zu erzählen sich nicht mehr lohnte.
Aus dem Genannten ergibt sich: Napoleon Bonaparte ist nur in seiner gesamten Entwicklung, also chronologisch, zu begreifen und in seiner Person als eine Einheit aufzufassen. Deshalb wird Wert auf die frühen Jahre gelegt, in denen sich bestimmte Züge seines Charakters ausgebildet haben, die auch in den Zeiten des Ruhms, als an seinen Entscheidungen das Leben Zehntausender hing, zum Zuge kamen. Wichtig ist angesichts des Übermaßes der zeitgenössischen Zeugnisse, die teilweise in extenso und ohne allzu viele Bedenken ausgebeutet wurden, eine Beschränkung auf verlässliche Quellen. Dabei haben die Selbstzeugnisse, die nunmehr in einer mustergültigen Form vorliegen, keineswegs einen geringeren Aussagewert als die Beobachtungen derer, die mit ihm zu tun hatten und sich dabei oft selbst in ein entsprechendes Licht rücken wollten.2
Eine wenig beachtete, aber nicht zu vernachlässigende Quelle bilden die Zeugnisse deutscher Zeitzeugen, die den jungen Bonaparte aus der Nähe beobachteten – so vor allem Konrad Engelbert Oelsner und Gustav von Schlabrendorf, die beide das Egomanische seines Wesens früh erkannt haben. Für die spätere Zeit ist Armand de Caulaincourt ein Hauptzeuge, dessen von Gabriel Hanotaux edierte Memoiren dem Menschen Napoleon Bonaparte in seiner psychischen Unmittelbarkeit sehr nahekommen. Caulaincourt war nämlich bei der mehrtägigen Rückreise aus Russland im Dezember 1812 der einzige Gesprächspartner Napoleons. Der französische Aristokrat war ein kritischer Verehrer Napoleons und ein glühender Patriot, der bis zur Preisgabe des eigenen Lebensglücks die Interessen Frankreichs und die Charaktereigentümlichkeiten Napoleons miteinander zu versöhnen trachtete: ein hoffnungsloses Unterfangen, bei dem er von Metternich ebenso manipuliert wurde, wie er an Napoleons Starrsinn scheiterte.
Methodisch muss eine kurze Biografie auf viele Details verzichten, die sich in den umfangreichen Werken (von Thiers über Kircheisen bis zu Madelin) in oft langatmiger Fülle ausgebreitet finden. Es geht vielmehr darum, die Scharnierstellen herauszuarbeiten, die zeigen, dass die skizzierte Linie von Auf- und Abstieg kein zwangsläufiges Geschehen war, sondern auf Entscheidungen beruhte, die vielfach – nicht immer – Napoleon selbst traf. Es sollte deutlich werden, dass ihm bis 1813 Handlungsräume zur Verfügung standen, aus denen er Alternativen hätte auswählen können. Der Aspekt ›Deutschland und Napoleon‹, der um das Jubiläumsjahr 2004 herum sehr breit behandelt wurde, wird dagegen im Rahmen des chronologischen Fortschreitens der Erzählung nur gestreift. Ebenso können die zahlreichen Schlachtverläufe, die bis heute das gesteigerte Interesse der Geschichtsschreibung finden, nur kursorisch verfolgt werden, auch wenn sich gerade hier das vielgepriesene Genie des Korsen ebenso zeigte wie die Schattenseiten seines Charakters. Von einzelnen Skizzen wie im Falle von Austerlitz, Aspern-Essling und Waterloo abgesehen, verzichten wir auf detaillierte Schlachtbeschreibungen, verweisen aber auf die akribischen Studien vor allem angelsächsischer Historiker. Nicht durch Detailfülle, sondern durch kritische Akzentuierung soll die vorliegende Biografie die Verzeichnungen und Defizite, die zumal das Bild Napoleons in Frankreich immer noch prägen, aufzeigen und geraderücken.
I. Bonaparte
Historischer Abriss
Ob man ihn nun als ihren Vollender oder als ihren Bezwinger ansieht: In jedem Fall konnte Napoleon Bonaparte später zu Recht von sich behaupten, ein ›Sohn‹ der Französischen Revolution zu sein. Denn ohne diese Revolution ist seine Karriere als Militär wie auch sein Aufstieg an die Spitze der politischen Macht nicht denkbar. Als 1769 Geborener gehörte er zur jüngeren Alterskohorte einer um die Mitte des 18. Jahrhunderts geborenen Generation, die wie keine andere die Geschichte Frankreichs geprägt hat und deren Einfluss noch bis weit in das 19. Jahrhundert hineinreichte.
Diese Verbindung war nicht von Anfang an vorgezeichnet. Als Abkömmling der gerade erst Frankreich einverleibten Insel Korsika verfolgte der junge Offizier die Anfänge der Revolution ab 1789 vornehmlich unter dem Gesichtspunkt, wie er ihre Impulse für seine Heimat nutzbar machen konnte. Erst 1793 plädierte er rückhaltlos für Frankreich, in einem Moment, als nach der Hinrichtung des Königs Ludwig XVI. und der Kriegserklärung der meisten europäischen Monarchen an die junge Republik das Überleben des revolutionären Frankreich an einem seidenen Faden hing. Der tödliche Konflikt innerhalb der Volksvertretung zwischen Girondisten und Jakobinern war zugleich ein Konflikt zwischen der Hauptstadt und der Provinz, nämlich zwischen den hinter den Jakobinern stehenden Pariser Massen und einigen mächtigen Städten des Südens und Westens. Der Konvent, also die 1792 nach allgemeinem Männerwahlrecht gewählte Nationalversammlung der neuen Republik setzte eine provisorische Exekutive in Form des zwölfköpfigen Wohlfahrtsausschusses ein. Dieser mit außerordentlichen administrativen und jurisdiktionellen Befugnissen ausstatteten Notstandsregierung gelang es, das demografische Gewicht der loyal gebliebenen Landesteile und der übergroßen Hauptstadt in die Waagschale des Krieges zu werfen und so der ausländischen Invasion ebenso Herr zu werden wie der separatistischen Tendenzen in Lyon, Marseille und Bordeaux. Bevollmächtigte des Konvents, darunter Bonapartes späterer Protektor Barras, gingen dabei mit äußerster Brutalität vor und ließen Hunderte von Todesurteilen vollstrecken. Mit gleicher Härte verfuhren Sondergesandte des Wohlfahrtsausschusses gegen Armeeführer, die keine Erfolge vorzuweisen hatten. Der erste Gatte von Napoleons späterer Frau Joséphine de Beauharnais endete auf diese Weise 1794 auf dem Schafott.
Zum Symbol der militärischen Wende wurde im September 1793 die wichtige Hafenstadt Toulon, die sich der englischen Flotte ausgeliefert hatte. Indem der junge Artilleriehauptmann Bonaparte Toulon für den Konvent zurückeroberte, verhinderte er ein Zusammenwachsen von Bürgerkrieg und Invasion von außen. Von nun an gingen Revolution und Krieg Hand in Hand, was paradoxerweise zur Folge hatte, dass nach den großen militärischen Erfolgen des Jahres 1794, der Eroberung Belgiens und des linken Rheinufers der Druck auf die Notstandsregierung nachließ und die gemäßigte Mehrheit der Konventsabgeordneten sich der Quasi-Diktatur des Wohlfahrtsausschusses entledigte. Auf die Hinrichtung des Revolutionärs Maximilien Robespierre und seiner Clique, die den Ausschuss und den Konvent über ein Jahr lang unter ihrer Fuchtel gehalten hatten, folgte eine Säuberungswelle, der die meisten der vom Wohlfahrtsausschuss eingesetzten Funktionäre und Armeevertreter zum Opfer fielen. Als Protegé von Robespierres Bruder Augustin wäre die Karriere (und das Leben!) des Artilleriehauptmanns Bonaparte hier fast schon zu Ende gewesen, doch kam es ihm zugute, dass er der politischen Macht noch nicht so nahegekommen war, dass er zum engeren Kreis der Männer um Robespierre gezählt wurde.
Im Nachgang zur ›Gegenrevolution‹ vom 27. Juli 1794 (9. Thermidor) schlug das Pendel weit nach rechts aus, bis hin zu einer Entwicklung, die auf eine Rückkehr der gestürzten Königsfamilie der Bourbonen hinauslief, ähnlich wie es im England des 17. Jahrhunderts nach der Diktatur Cromwells der Fall gewesen war. Eine solche Aussicht konnte nicht im Interesse der führenden Politiker liegen, die fast alle im Januar 1793 für den Tod Ludwigs XVI. gestimmt hatten und im Falle einer Rückkehr der Königsfamilie mit ihrer eigenen Hinrichtung, hätten rechnen müssen. So besannen sich die ›Thermidorianer‹ (so nannten sich die tonangebenden Politiker, eine Mischung aus ehemaligen Handlangern des Terrors wie Barras und von Robespierre ausgebremsten Gemäßigten und Ex-Girondisten wie Reubell) darauf, was die ursprüngliche Aufgabe des Konvents war: Frankreich eine neue Verfassung zu geben. Die neue Republik sollte ein auf dem Zensuswahlrecht fußender Staat sein, mit einer aus zwei Kammern bestehenden Legislative und einer auf fünf Männer aufgeteilten Exekutive, dem sogenannten Direktorium. Die Arbeiter und Kleinhandwerker besaßen in dieser bürgerlichen Republik kein Wahlrecht, ebenso Tagelöhner und solche Bauern, die wenig oder kein eigenes Land besaßen.
Was viele Franzosen empörte, war jedoch nicht der soziale Rückschritt, den die Verfassung von 1795 bedeutete, sondern die Einschränkung, dass per Dekret zwei Drittel der vorhandenen Konventsabgeordneten automatisch den neuen Vertretungskörperschaften angehören sollten. Diese kaum verhüllte Diktatur der ›Immerwährenden‹ führte zum Erbitterungsaufstand des 5. Oktober 1795 (13. Vendémiaire), den die Thermidorianer erbarmungslos niederschlagen ließen, wobei sie sich des arbeitslos gewordenen Bonaparte bedienten.
Von nun an war dessen Aufstieg eng an den weiteren Fortgang der Revolution gekoppelt. Barras machte ihn zum Chef der Inlandsarmee, doch der Ehrgeiz des jungen Korsen ging weit darüber hinaus. Kaum dem drohenden sozialen Absturz entronnen und mit einer Dame aus der Lebewelt der Neureichen und Revolutionsüberlebenden liiert, hätte er es sich in der neuen Pariser Schickeria bequem machen können, wie es seine Brüder und Schwestern taten. Doch er strebte nach Höherem, lechzte nach militärischem Ruhm. Toulon und Vendémiaire genügten ihm nicht. Auf einem Nebenkriegsschauplatz, in Italien, gelang es ihm, das in ihm schlummernde militärische Genie zum ersten Mal erstrahlen zu lassen. Seine Erfolge waren so eklatant, dass sie nicht nur die der anderen Generäle in den Schatten stellten, sondern auch das Direktorium der Republik nötigten, die Ergebnisse seiner Eroberungszüge, die ihre Zielvorgaben weit hinter sich ließen, als vollendete Tatsachen zu akzeptieren, ja ihm letztlich die Entscheidung über Krieg und Frieden zu überlassen.
Von jetzt an gestaltete sich sein Verhältnis zur politischen Macht als mal offener, mal verdeckter Wettkampf. Was Bonaparte hinderte, 1797 bereits nach der Macht im Staat zu greifen, war weniger die Stärke der Regierung als die Konkurrenz seiner Altersgenossen. Denn nicht nur er, sondern eine Handvoll weiterer, wenig älterer Armeeführer waren im Schatten der Siege, die die französischen Armeen außer in Italien auch in Holland und Deutschland und bei einem letzten gescheiterten Invasionsversuch der Engländer auf der Halbinsel Quiberon errangen, zu Hoffnungsträgern aufgestiegen. Dies umso mehr, als die Politiker in diesem zweiten Jahrfünft der Revolution keine glückliche Figur machten. Dabei waren es keineswegs politische Nullen, die jetzt in Paris die Republik führten. Zwar waren keine enigmatischen Führerpersönlichkeiten mehr unter ihnen – die waren fast alle der Guillotine zum Opfer gefallen –, aber die Direktoren waren Routiniers der Revolution, auf Machterhalt geeichte Taktiker oder überlebende Idealisten von 1789.
Doch wurde ihnen nun die von ihnen selbst geschaffene Verfassung mehr und mehr zum Verhängnis. Die jährlichen Wahlen zur Erneuerung von jeweils einem Drittel der Vertretungskörperschaften beförderten Vertreter einer unzufriedenen und von der Revolution enttäuschten Wählerschaft in die Kammern, die sich mal als verkappte Monarchisten, dann wieder als Nostalgiker der Jakobinerherrschaft entpuppten. Die Direktoren wussten sich dieser Bedrohung nur dadurch zu erwehren, dass sie die Wahlen annullieren und die führenden Oppositionellen verhaften ließen; mit dem Ergebnis, dass sie so ihren ohnehin geringen Rückhalt in der Bevölkerung weiter verspielten und die Politikverdrossenheit im Land stieg.
Besonders verhängnisvoll war, dass die Exekutive auf fünf Männer aufgeteilt war, von denen jedes Jahr einer durch das Los ausschied und durch einen von den Kammern gewählten Nachfolger ersetzt wurde. Eine kohärente Politik war so kaum möglich, schwebte doch das Damoklesschwert der Abwahl über jedem von ihnen. Der Fähigste, Reubell, schied so 1799 in einem entscheidenden Moment aus, während nur Barras, der 1795 ins Direktorium gelangt war, die von der Verfassung gewährte volle Amtszeit von fünf Jahren erreichte.
Hinzu kam die ungeklärte Frage von Krieg und Frieden. Während ein Teil der Direktoren, ähnlich wie viele der Abgeordneten, einen baldigen Friedensschluss herbeiwünschten, der Frankreichs Grenzen immerhin bis an die Alpen, die Maas und die Schelde vorgetrieben hätte, also sich im Wesentlichen auf die französischsprachige Bevölkerung der Randgebiete beschränkte, sahen andere, zumal Angehörige der siegreichen Armeen, darin einen Verrat an der Revolution. Für sie kam nur die Rheingrenze in Frage, getreu der von den Girondisten ausgegebenen Parole der ›natürlichen Grenzen‹ Galliens und ungeachtet der Tatsache, dass die linksrheinische Bevölkerung deutschsprachig war und keineswegs einem Anschluss an Frankreich entgegenfieberte. Als zusätzliches Problem erwies sich, dass Bonaparte in Italien bereits einen Satellitenstaat in Form der Cisalpinischen Republik gegründet hatte, was zwar dem ursprünglichen Modell der Girondisten von 1792/1793 entsprach, aber dem vom Direktorium verfolgten Konzept widersprach. Es stand 1796/1797 noch nicht fest, ob ein solcher Friede von den noch im Krieg befindlichen Gegnern Großbritannien und Österreich zu haben war.
Die Spannung zwischen Friedensbefürwortern und Anhängern der Maximallösung verquickte sich mit der inneren Problematik der Republik. Die Protagonisten der ›kleinen Lösung‹ wie Lazare Carnot, immerhin der Organisator der Abwehrsiege von 1793/1794, standen, oft zu Unrecht, im Verdacht, an einer schleichenden Rückkehr zur Monarchie zu arbeiten. Von den Generälen stand ihnen Pichegru nahe, während andere, Jourdan, Hoche und Augereau, vehement für eine Fortsetzung des Krieges eintraten. Bonaparte hielt sich bedeckt, solange der Machtkampf nicht entschieden war. Der Konflikt eskalierte am 5. September 1797 (18. Fructidor) in einer kurzen Kraftprobe zwischen den beiden Lagern, bei der die Gruppe um Carnot unterlag und Hunderte seiner Anhänger in die Verbannung nach Guyana, die ›trockene Guillotine‹, geschickt wurden.
Währenddessen präsentierte der Sieger von Italien sein eigenes Konzept: Er zwang die Österreicher durch seinen Vormarsch auf Wien dazu, die Rheingrenze zu akzeptieren; ein Opfer, das ihnen umso leichter fiel, als er ihnen das von ihm okkupierte Venedig zum Ersatz dafür anbot. Einzig England blieb nun noch im Krieg, das nach einem Jahr mit Russland die sogenannte »Zweite Koalition« einging gegen Frankreich. Währenddessen kamen in Rastatt die vertriebenen linksrheinischen Fürsten zusammen, um unter den spöttischen Augen des Siegers Bonaparte um ihre Entschädigung aus dem verbliebenen Rumpf des geschrumpften Deutschen Reiches zu feilschen. Die nötige Ersatzmasse mussten, wie man wusste, die Bistümer und Abteien des Alten Reiches abgeben.
Bonaparte traf Ende 1797 wieder in Paris ein, sehr zum Unbehagen des Direktoriums, das bestrebt war, ihn rasch wieder loszuwerden. Ein Unternehmen zur Invasion Englands erwies sich als schon in den Voraussetzungen aussichtslos. So kam man, angeregt vom neuen Außenminister Talleyrand, auf den Plan einer Expedition nach Ägypten, eine der – wie ein bekannter Historiker angemerkt hat – überflüssigsten Unternehmungen der revolutionären Epoche. Das stimmt allerdings nicht ganz. Vom militärischen Standpunkt aus gesehen war der Ägyptenfeldzug zwar ein gigantischer Fehlschlag, ähnlich wie fünf Jahre später die Haiti-Expedition. Doch enthielt er für Bonaparte zwei wichtige Lehren für seine weitere Laufbahn: Die Erkenntnis, dass England zur See unbesiegbar war (der britische Admiral Nelson zerstörte wenige Tage nach der Ankunft in Ägypten Bonapartes Flotte und schnitt der französischen Armee damit die Möglichkeit zur Rückkehr ab); und die Erfahrung der Unbeherrschbarkeit der Natur, die er auf dem Rückweg durch die Wüste nach dem fehlgeschlagenen Syrienfeldzug machte. Beide Lehren blieben aber für ihn folgenlos.
Schon 1797 war er der populärste Mann Frankreichs, zumal sein Rivale Hoche kurz zuvor gestorben war. Doch erst das Ausscheiden Reubells aus dem Direktorium und die sich bedrohlich zuspitzende militärische Situation im Sommer 1799, die eine neue alliierte Invasion fürchten ließ, schuf die Voraussetzung für einen erfolgversprechenden Griff nach der Macht. Auf Reubell folgte als Nachfolger im Fünfergremium Emmanuel Joseph Sieyès, der 1789 als Mann der ersten Stunde die Revolution entscheidend auf den Weg gebracht hatte. Von ihm erhofften sich viele eine Überwindung der sich als unbrauchbar erweisenden Verfassung. Sieyès suchte angesichts der äußeren Bedrohung nach einer Verstetigung der Exekutive, um der neojakobinischen Agitation, die nach einer neuen Terreur wie 1792/1793 rief, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das römische Beispiel vor Augen, spekulierte er mit einem Verfassungsmodell, das zwei oder drei Konsuln vorsah. Dabei hielt er nach einem General Ausschau, der nach außen und auf dem Schlachtfeld genug Autorität besaß, ohne dass von ihm zu befürchten war, dass er die Alleinherrschaft anstrebte oder, wie Cromwells früherer Gefolgsmann Monk im England des Jahres 1660, die alte Monarchie zurückholen würde. Bonaparte kam genau im richtigen Moment aus Ägypten zurück, um in diese Leerstelle einzutreten. Wie er dann in den Wochen nach dem Staatsstreich des 9. November 1799 (18. Brumaire) seine Helfer ausmanövrierte und die Macht durch informelle Manöver an sich riss, ging allerdings weit über das hinaus, was Sieyès vorausgesehen und angestrebt hatte.
Die folgenden vier Jahre des Konsulats bilden, im historischen Rückblick gesehen, eine Übergangszeit zum Empire, mit dem Napoleon bis heute identifiziert wird. Aber das konnten die Zeitgenossen noch nicht wissen. Für sie war das Konsulat, das Bonaparte schrittweise in Richtung auf eine Alleinherrschaft ausbaute, der so lange herbeigesehnte Abschluss der Französischen Revolution, nach innen mit den großen Gesetzen wie dem Konkordat und dem Code civil, nach außen mit den Friedensschlüssen von Lunéville und Amiens. Manche Historiker, vor allem die republikanisch Gesinnten, abstrahieren gerne von der Fortsetzung seiner Herrschaft als Kaiser und betrachten die Konsulatsjahre bis heute als Vollendung der Französischen Revolution. Sie können sich dabei auf Napoleons späteres Wort berufen, er habe damit »Granitmassen« in den Boden Frankreichs versenkt, die mehr wögen als seine gewonnenen Schlachten. Tatsächlich hat die administrative Struktur, die damals in erstaunlich kurzer Zeit geschaffen wurde, lange – vielfach bis heute – gehalten.
Aber eine solche Geschichtserzählung lässt den Faktor Napoleon Bonaparte außer Acht. Er hat sich nie mit diesem Ende der Revolution abgefunden, weder mit einem Frankreich in den Grenzen Galliens noch mit einem halb republikanischen, halb monarchischen Zwitterstatus als Erster Konsul auf Lebenszeit. Was er wollte, war das, was alle Gründerväter der Geschichte wollten: Dauer. Und so ließ er sich 1804 zum Kaiser proklamieren und versuchte, aus seinem korsischen Familienclan eine neue europäische Dynastie zu formen, der er fünf Jahre später durch die Heirat mit der Tochter des Habsburgerkaisers die historische Weihe zu geben meinte. Tatsächlich wählte er so den Weg in seinen eigenen Untergang.
Eine Karriere (1769–1796)
Vergleicht man Napoleons frühe Jahre mit denen seiner gleichaltrigen Kameraden wie Hoche, Jourdan, Augereau, Joubert, aber auch den später erbitterten Feinden wie Pichegru und Moreau, so wird schnell klar: Die Armee war der große Katalysator, der talentierten jungen Männern außergewöhnliche Aufstiegschancen bot. In einer Zeit, in der überkommene Schranken wegfielen und jahrhundertealte Strukturen einer hierarchisch gegliederten Ständepyramide wegbrachen, konnten Menschen von ›ganz unten‹ in kurzer Zeit in Spitzenpositionen gelangen. Zunächst noch allmächtiger Diener, ja Retter der Nation unter der Rute des Wohlfahrtsausschusses, entwickelte sich die Armee nach dem Sturz Robespierres rasch zur eigentlichen Macht im Staate. Und spätestens nach dem Fructidorputsch im Jahr 1797, den das Direktorium nur mit Hilfe der Armee inszenieren konnte, war klar, dass die politische Macht jederzeit von der Herrschaft eines siegreichen Generals abgelöst werden konnte. Die Frage war nur noch, wer dieser General sein würde.
Für Napoleon galt es daher, in den Kreis jener Kandidaten zu gelangen, aus dem der künftige »Retter« Frankreichs ausgewählt werden würde. Dieser Aufstieg gestaltete sich keineswegs geradlinig und fand zudem mit einer gewissen Verzögerung statt. Anders als bei Jourdan oder Pichegru hing Napoleons Avancement nicht von einer spektakulär gewonnenen Schlacht oder einem siegreichen Feldzug ab, sondern verlief in Etappen. Diese waren von Wartezeiten unterbrochen, die sehr wohl auch zu seinem vorzeitigen Verschwinden von der politisch-militärischen Bühne hätten führen können und die ihn einmal fast das Leben gekostet hätten. Dass er es dennoch nach ›ganz oben‹ schaffte, verdankte er außer dem Zufall und einigen glücklichen Beziehungen nicht zuletzt seiner stupenden militärischen Begabung.
Der Junge aus Ajaccio (1769–1788)
Franzose – Italiener – Korse
War Napoleon Franzose? Über diese Frage ist viel gestritten worden. Zumal von französischen Historikern wurde sie vehement bejaht. Es sei »noch niemals dagewesen, daß die Franzosen sich einem Manne hingaben, der nicht wenigstens von irgendeiner Seite her zu ihrem eigenen Lande gehört hätte«, erklärte kategorisch Jacques Bainville.1 Nüchterner, aber mit der gleichen Schlussfolgerung, liest es sich bei einem seiner jüngsten britischen Biografen, Andrew Roberts, für den er ein »Korse mit italienischen Wurzeln« war, aus dem »die Erziehung in Frankreich einen Franzosen gemacht hat.«2 Gegen das Hauptargument der Gegenseite, dass er nach Sprache und Herkunft ein Fremder war, wetterte Louis Madelin mit den Worten:
»Ob der Mann, so wie er sich der Welt präsentierte, an den Ufern der Loire, der Seine, des Rheins, der Donau oder der Elbe geboren wurde: wir nennen ihn einen ›Römer‹ durch seinen Charakter, das sagt alles.«3
Damit zielte er auf die spezifisch französische Definition von Nationalität, die jeden, der der ›citoyenneté‹ angehört oder diese aus freien Stücken angenommen hat, unabhängig von seiner Herkunft, Sprache und Hautfarbe als Franzosen ansieht.
Doch es bleibt ein leiser Vorbehalt. Auch wenn Napoleons Vita das Musterbeispiel einer gelungenen Assimilation darstellte, ist es zweifelhaft, dass das Franzose-Sein ihm jemals zur selbstverständlichen Natur geworden ist. Bainvilles Bemerkung, dass die Eindrücke an der Militärakademie in Brienne ihn befähigt hätten, »Frankreich zu verstehen und zu ihm zu sprechen«,4 bestätigt ungewollt diesen Verdacht. Denn um ein Land zu verstehen und »zu ihm zu sprechen«, muss man außerhalb desselben stehen. Selbst in der Art und Weise, wie Napoleon später, zuletzt in seinem Testament, von dem »französischen Volk« gesprochen hat, das er »so sehr geliebt« habe und inmitten dessen er begraben sein wollte, kommt die Distanz desjenigen zum Ausdruck, der von außen gekommen war und der Frankreich als einem Gegenüber begegnete, dem er sich anverwandelte.5
Was aber, wenn nicht Franzose, war er dann? Auch diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Im Jahr von Napoleons Geburt gehörte Korsika gerade seit zwei Jahren zu Frankreich, das die Insel offiziell noch im Namen Genuas verwaltete. Doch hatte die administrative und kulturelle Inbesitznahme schon begonnen und die französische Regierung ließ erkennen, dass sie nicht daran dachte, Korsika jemals wieder den hochverschuldeten Genuesen zurückzugeben. Alles, die militärische Inbesitznahme und die Umwandlung in ein pays d’état – also eine halbautonome Ständeprovinz nach dem Vorbild der Guyenne oder der Bretagne – deutete vielmehr auf eine entschlossene, wenn auch bedachtsame Inkorporierung Korsikas in den französischen Staatskörper hin.
War Napoleon also Italiener? Seine Vorfahren fühlten sich lange Zeit als solche. Sie hatten sich von der Seerepublik Genua, zu der ihre ursprüngliche Heimat Sarzana gehörte, durch Steuervergünstigungen und Aufstiegschancen auf die Insel locken lassen. Hier haben sie es zu einem beachtlichen Wohlstand gebracht, der mit einem Adelstitel einherging. Die vom Festland stammenden Familien bildeten eine schmale Elite in den von Genua kontrollierten Hafenstädten, während das Inselinnere weitgehend sich selbst und seinen archaischen Normen überlassen blieb. Die Angehörigen dieser Familien – die Pozzo di Borgo, Paravicini, Saliceti, Ramolino – heirateten untereinander, solange sie an Ansehen einander ähnelten. Napoleons Vater hatte das Glück gehabt, eine Tochter aus dem Clan der Ramolino, die erst vierzehnjährige Laetitia, zu ehelichen, obwohl der Stern der Buona Parte zu dieser Zeit wegen misslungener Bodenspekulationen schon im Sinken begriffen war.
Aber Napoleon als Italiener zu bezeichnen, wäre ebenso falsch, wie ihn wie selbstverständlich zum Franzosen zu erklären. Gewiss, die Intellektuellen unter seinen Verwandten studierten zumeist auf dem Festland, in Florenz, Pisa oder Neapel, und bedienten sich des Italienischen als einer dem eigenen Idiom nahen Lehnsprache. Aber Napoleon kam erst 1797 als General einer französischen Armee nach Italien und sah sich durchaus nicht als Italiener – auch nicht 1805, als er sich im Dom von Mailand die langobardische Krone aufsetzte. Seine Familie mochte sich im Verlauf seiner Eroberungen und auch noch nach seiner Abdankung allmählich wieder der ursprünglichen Heimat assimilieren. Er selbst tat dies nicht. Kaum etwas brachte ihn später so sehr in Rage, als wenn sein Name italienisch – Buonaparte – buchstabiert wurde. Geschah dies noch dazu mit französischer Aussprache des »u« als »ü«, wie es Chateaubriands berühmtes Pamphlet von 1814 suggerierte, kochte er vor Wut.6
Kindheit in Korsika
Napoleon war also Korse. Aber was besagte das? Die Spezialisten sind sich bis heute uneins, ob man von einer korsischen Nation sprechen kann.7 Im Grunde zerfiel die Inselbevölkerung in die Bauern auf dem Lande und die Bewohner der wenigen Hafenstädte. Mit der Zeit war eine Symbiose zwischen den beiden Zivilisationen entstanden, aber es ist höchst zweifelhaft, ob sich im 18. Jahrhundert bereits eine korsische Identität im eigentlichen Sinne ausgebildet hatte. Gerade deshalb faszinierte Korsika die aufgeklärten Europäer des 18. Jahrhunderts. Die Insel, die seit dem 13. Jahrhundert unter der Herrschaft Genuas stand, versprach ihnen gewissermaßen ein Abbild des ›authentischen Wilden‹, den man eigentlich in Amerika oder im Stillen Ozean verortete, quasi vor den eigenen Toren. Der Schotte James Boswell, der die Insel im Jahr 1764 bereiste, trug mit seinen Publikationen, die am ehesten der Reiseliteratur zugerechnet werden können, wesentlich dazu bei.
Im Licht solcher Reiseliteratur waren die Bauernaufstände, die es seit 1729 gegen die Herrschaft Genuas gab, Vorboten einer künftigen großen Revolution. Das gilt umso mehr, als sich prominente Männer des Festlandes auf die Seite der Aufständischen stellten. Der österreichische Baron von Neuhaus ließ sich von einer ›consultà‹ zum König von Korsika proklamieren und hoffte (vergeblich) auf englischen Beistand. Der Neapolitaner Pasquale Paoli errichtete in der Stadt Corte im Inselinneren eine Art Hof, gründete die noch heute bestehende Universität und ließ sich von Jean-Jacques Rousseau eine eigens für die Insel entworfene Verfassung im Geiste des Contrat social schreiben. Auch versuchte er, die von den Genuesen zu Hilfe gerufenen Franzosen aus den Hafenstädten zu vertreiben.
An seiner Seite befand sich Napoleons Vater, Carlo Buona Parte. Als aber auch dieser Befreiungsversuch 1769 scheiterte und Paoli eine britische Fregatte betrat, um sich nach London ins Exil zu begeben, blieb der einheimischen Elite nur die Wahl, entweder den Weg in den Untergrund zu beschreiten oder sich mit den neuen Herren aus Frankreich zu arrangieren. Die Buona Parte wählten den zweiten Weg. Carlo, der gerade noch Paoli assistiert hatte, wurde als »Charles Bonaparte« die rechte Hand des mächtigen Mannes, den die neue Staatsmacht als ihren Vertreter und Verwalter auf die Insel schickte: Baron Marbeuf.
Abb. 1: Die Eltern Napoleons – links der Vater Carlo Maria Bonaparte (1746–1785) in einem Gemälde aus der Zeit 1766–1779 von Anton Raphael Mengs; rechts die Mutter Laetitia Ramolino (1750–1836) in einem Gemälde (um 1802) von François Gérard.
Die Gestalt Marbeufs, der selbst aus der armen Bretagne stammte und ein Gespür für die Kluft besaß, die sich zwischen der hochzivilisierten Pariser Gesellschaft und den entlegenen und sich selbst überlassenen Provinzen auftat, muss dem Knaben Napoleon zum ersten Mal eine Ahnung von dem vermittelt haben, was »Frankreich« bedeutete. Sein Name stand für Macht, Luxus und Aufstiegschancen. Carlo schaffte es, seine beiden ältesten Söhne in Positionen unterzubringen, die das neue Regime für die ihm Wohlgesonnenen unter dem heimischen Adel bereithielt: einen Platz im Priesterseminar für den erstgeborenen Joseph, die Aufnahme in eines der dem Adel vorbehaltenen Militärinternate für den zweitgeborenen Sohn Napoleon. Ob mit solchem Entgegenkommen ein Preis für anderweitige Dienste entrichtet wurde, die Laetitia dem als Frauenheld verschrienen Gouverneur geleistet hatte, wurde gelegentlich vermutet, blieb aber unbewiesen. Sicher ist, dass die schöne Korsin ihrem umtriebigen Ehemann in vielfacher Hinsicht zur Hand ging. Auf jeden Fall war sie, die manche ihrer 13 Kinder überlebte und erst als 85-jährige Matriarchin im Februar 1836 in Rom starb, die treibende Kraft in der Familie. Eine Notwendigkeit, die sich nicht zuletzt daraus ergab, dass sie den Ehemann schon früh ersetzen musste, der kaum 39-jährig 1785 in Montpellier an Magenkrebs starb.
Wie muss man sich also das erste Lebensjahrzehnt des am 15. August 1769 geborenen Napoleon vorstellen? Dass der Knabe, anders als sein Bruder Joseph, zum »Bestimmer« taugte, hat Laetitia früh an ihm bemerkt. Er sei das schwierigste ihrer Kinder gewesen, hat sie später gesagt, und mehr als einmal habe sie zu Ohrfeigen, einmal auch zu einer Tracht Prügel als Erziehungshilfe greifen müssen, zumal der geschäftige Vater die meiste Zeit abwesend war.8 Auch zeigte sich bald, dass die Anlagen des Jungen über ein bescheidenes Dasein als Advokat oder Notar hinausstrebten und nach mehr verlangten, als es die Insel mit ihren nur rudimentären Bildungschancen bieten konnte. Die Unterrichtsstunden, die ihm der Abbé Recco erteilte, hatten in ihm die Liebe zur Mathematik geweckt. Zu mehr aber, zum Erlernen der französischen Sprache, zu geregeltem Wissenserwerb über die paar Brocken Latein hinaus, die ihm der Kirchenmann beibrachte, war der Aufenthalt auf dem Kontinent erforderlich.
Stationen einer Militärlaufbahn
So teilte Napoleon schon früh die zwiespältige Erfahrung dessen, der aus einem armen Land in eine höherentwickelte Zivilisation wechselt. Denn das starke und spendable Frankreich, das ihm in Bastia, dem Sitz des Gouverneurs, und auf dessen Privatanwesen in Gestalt Marbeufs entgegentrat, hatte auch eine andere, weniger sympathische Seite. Diese lernte er kennen, als der Vater die beiden Ältesten auf eine Reise mitnahm, die ihn als Vertreter der korsischen Stände zum König nach Versailles führte. Die beiden Söhne begleiteten ihn allerdings nicht bis in die französische Hauptstadt. Der Vater ließ die Kinder in Autun zurück, wo sie im Priesterseminar des Bischofs, eines Verwandten Marbeufs, binnen drei Monaten die französische Sprache und Schrift erlernen sollten. Von hier nahm ein anderer Bekannter Marbeufs den Neunjährigen mit nach Brienne-le-Château, wo dem Jungen die dortige Militärakademie zur Ausbildung zugewiesen worden war.
Hier in der Champagne lernte der junge Napoleon die andere Seite der in Aussicht gestellten Assimilation an die französische Kultur kennen. An der Akademie in Brienne, einem der Orte, wo der verarmte, aber umso mehr auf seinen Ruf bedachte französische Adel seine Söhne ausbilden ließ, war er von vornherein der Außenseiter, dem die Rolle des Sonderlings mit einer Selbstverständlichkeit zufiel, als wäre sie ihm angeboren gewesen. Zwar sind die weitschweifigen Memoiren seines Zimmergenossen und späteren Freundes Bourrienne nachweislich nicht immer wahrheitsgetreu, doch sie vermitteln eine gute Impression von der allgemeinen Lage, in der sich Napoleon im Internat befand.9 Daraus ergibt sich das Bild eines stolzen Knaben mit dem unüberhörbaren fremden Akzent, über den sich die Kameraden lustig machten und der seine Rolle als Außenseiter durch trotzige Selbstbehauptung kompensierte. Das lebenslange Ressentiment Napoleons gegenüber dem französischen Adel hat seinen Ursprung in eben jenen Erfahrungen im Internat.
Dennoch waren die Jahre in Brienne (1779–1784) und an der Offiziersschule in Paris (1764/65) sowie die anschließenden Garnisonsaufenthalte in Valence (1785–1788) und Auxonne (1788/89) für Napoleon mehr als eine Diaspora. Hier entdeckte er sein eigentliches Terrain, das Militär, und hier fand er seine neue Heimat, die Armee. Die Militärakademie in der Champagne, die Ecole militaire in der fremden Hauptstadt und das Artillerieregiment La Fère in Valence und Auxonne waren bei aller Härte und Reglementierung des Lebensalltags für den Heranwachsenden Stationen der Wissensaneignung und der Charakterschulung, aber auch der Muße und des Rückzugs in Lektüre und Träumerei. So bildete die Karriere beim Militär für den Jungen aus Korsika nicht nur das geeignete Sprungbrett für eine angesehene und gesicherte Existenz im neuen Vaterland; in der Armee fand auch sein diffuser Ehrgeiz ein angemessenes Betätigungsfeld. Hier verwuchs die angeborene Liebe zum rustikalen Leben mit seiner Lust am Abenteuer, hier konnte er seinen ihm eigenen Drang zum Befehlen und Organisieren ausleben. Das Leben dort, schrieb er seinem Onkel, verlange »genug Beherztheit, um den Gefahren einer Schlacht zu trotzen«, und setze »eine entschiedene Neigung für den Beruf voraus, den schwierigsten übrigens, den es gibt […]«, und den man nicht allein »vom Standpunkt der Garnison aus« beurteilen dürfe.10
Vorbilder und Träume
Zu dem Abenteuer, das das Militär verhieß und das die schlummernden Sehnsüchte in ihm anfachte, kam ein weiterer Anreiz, den ihm vor allem der Aufenthalt in Auxonne vermittelte. Es war die neue Militärstrategie, die seiner Entschlussfreudigkeit und seiner Intelligenz schmeichelte. Er las neben anderen den Essai de stratégie moderne von Jacques Antoine Hippolyte Guibert, eines Bewunderers Friedrichs des Großen, der aus den Schlachten des Preußenkönigs eine neue Strategie des Angriffs destillierte, die auf die vollständige Überwältigung des Gegners abzielte – nicht bloß auf dessen Zurückdrängung oder Schwächung.
Tatsächlich galt unter den neueren Theoretikern die Artillerie als Pionierwaffe. Sie hatte sich seit dem 16. Jahrhundert enorm weiterentwickelt. Die neuen Möglichkeiten der Artillerie beruhten auf einer so noch nicht dagewesenen Manövrierfähigkeit der Kanonen. Diese waren in den bisherigen Kriegen bloße Zusatzwaffen gewesen, mit denen Panik in die feindlichen Linien getragen oder herausragende Punkte im Gelände verteidigt werden konnten. In direkter Kombination mit der vorrückenden Infanterie waren sie bisher jedoch kaum eingesetzt worden. Dafür waren die Kanonen noch zu schwer und ihr Transport zu aufwendig. Das änderte sich durch die Entwicklung leichterer Kanonen, die sich auch während einer Schlacht bewegen ließen. Als Folgerung daraus hatte Guibert die Strategie entwickelt, Kanonen mit der Infanterie zusammenwirken zu lassen, um durch die auf einen einzelnen Punkt gerichtete Feuerkraft überraschende Einbrüche in die feindlichen Linien zu erzielen und diese dadurch aufzurollen. Dafür war allerdings eine Vergrößerung der Heere nötig, und deshalb hatte Guibert auch schon an die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht gedacht. Seine Ideen hatten sich allerdings im Ancien Régime als unausführbar erwiesen und überlebten vorerst nur in der Theorie. Es ist aber erwiesen, dass der angehende Artillerieoffizier Bonaparte diese Schriften kannte und durch fortschrittliche Lehrer in Auxonne darauf hingewiesen wurde.11
Den Vorgesetzten entging die Begabung des jungen Korsen keineswegs. Der Regimentskommandeur in Auxonne, Jean-Pierre Du Teil, selbst ein führender Theoretiker der neuen Schule, betraute ihn im Sommer 1788 mit der Durchführung einer Versuchsreihe, bei der die Treffsicherheit und die Belastbarkeit von Kanonen und Mörsern verglichen wurde. Der damals 17-jährige Napoleon beaufsichtigte dabei bis zu 200 Soldaten und 30 Arbeiter, was ihm das Missfallen einiger hochadeliger Kameraden eintrug. Du Teil hatte aber offenbar das Talent des jungen Offiziers erkannt, der die Flugbahnen der Geschosse mittels des Integrals im Voraus errechnete und dabei die Menge des verwendeten Pulvers so konsequent reduzierte, dass sich die Münder der Kanonenrohre nicht mehr zu stark verzogen. Der anstrengende Dienst und das ungesunde Klima im Tal der Saône setzten Napoleon allerdings so zu, dass er sich ein Fieber zuzog, das erst am Ende des Jahres auskuriert war.
Was erwartete sich der angehende Artillerieoffizier Bonaparte von seiner Zukunft? Hier tat sich zwischen Wunschvorstellungen und der Realität noch eine Kluft auf, die der junge Offizier lebhaft empfunden haben muss. »Ruhm« zu erlangen war sicher eines der Mittel, um der Leere zu entgehen, die das Garnisonsleben versprach. Aber wem sollte er nacheifern? Gab es ein konkretes Vorbild? Andere Große der Geschichte haben sich frühzeitig Gestalten gewählt, in deren Fußstapfen zu treten sie sich vornahmen. Napoleon bewunderte antike Feldherren wie Alexander den Großen, Hannibal und Cäsar, weil sie es vermocht hatten, mit einer numerisch unterlegenen Streitmacht, allein auf ihren Mut und ihr Gespür für den rechten Augenblick vertrauend, den Ausgang einer Schlacht zu entscheiden. Noch auf Sankt Helena hat er über die alles entscheidende Rolle des Feldherrn sinniert:
»Nicht vor der karthagischen Armee an den Toren Roms zitterte die Republik, sondern vor Hannibal; nicht das römische Heer unterjochte Gallien, sondern Cäsar; nicht das mazedonische Heer stürzte das persische Reich, sondern Alexander […].«12
Von den jüngeren Feldherren bestanden nur Gustav Adolf und Friedrich der Große vor seinem kritischen Blick, der erste als genialer Angreifer, der zweite, weil er es verstanden hatte, sich gegen eine übermächtige Koalition von Feinden immer wieder Luft zu verschaffen. Aber zum Vorbild taugte weder der eine noch der andere und auch die beiden berühmten französischen Marschälle, der große Condé und Turenne, hielten vor dem moralischen Urteil des jungen Offiziers nicht stand. Sie alle seien nämlich der eigenen Größe mehr als dem Vaterland verpflichtet gewesen.13 Dieses Verdikt ereilte im Übrigen auch den Vernichter der römischen Republik Julius Cäsar.14
Die Suche nach einem Vorbild beschäftigte den jungen Napoleon umso mehr, als da der Vater diese Rolle aufgrund seines vorzeitigen Todes nicht ausfüllen konnte. Zudem hatte er ihn früh als Anpasser durchschaut, während er seine geliebte Mutter lange im Verdacht hatte, dass sie sich der französischen Fremdherrschaft mit Seele und Körper hingegeben habe. So gab es kein Alter Ego, in das er hätte hineinschlüpfen können wie etwa später sein Neffe in seine, Napoleons, Gestalt. Und so füllte diese Leerstelle Korsika aus, genauer gesagt: der Mythos eines Korsikas, den er sich durch Boswell-Lektüre und eigene Studien zurechtlegte. Korsika war für ihn das Bindeglied zwischen einer idealisierten Antike und der Gegenwart. Ein unverbrauchtes Volk, das sich römische Tugenden bewahrt hatte und nur auf die Gelegenheit wartete, um der Gegenwart seine Selbstbefreiung abzutrotzen. Verkörpert sah er dieses ideelle Korsika eine Zeitlang in Pasquale Paoli, der zwar kein militärisches Genie, aber ein charismatischer Patriot und einflussreicher Führer, dazu ein anerkannter Gelehrter war. Der gealterte Aufklärer seinerseits durchschaute bei seiner Rückkehr auf die Insel im Jahre 1790 die Attitüde des jungen Mannes, als er diesem bescheinigte, seine Vorstellungen seien »ganz aus dem Plutarch« entnommen.15 Als sich auch diese in Paoli personifizierte Illusion auflöste und zudem der Mythos Korsika erlosch, trat an die Stelle des unauffindbaren Vorbilds der Glaube an das eigene mächtige Ego.
Jünglingsnöte
Doch noch war es nicht soweit, und die Gegenwart hielt für die kühnen Träume des jungen Offiziers nur wenig Nahrung bereit. Das Kriegsspiel, auch wenn es auf hohem intellektuellem Niveau stattfand, konnte Napoleon nicht wirklich befriedigen, zumal kein Krieg in Sicht war. Die letzte große Auseinandersetzung mit Großbritannien, die Intervention in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf der Seite der Kolonien, hatte zwar zum militärischen Ruhm Frankreichs beigetragen. Allerdings waren die ohnehin überstrapazierten Finanzen seitdem endgültig ruiniert. Das seinem Ende entgegen taumelnde Ancien Régime war viel zu tief in innere Krisen verstrickt, um eine grundlegende Reform in Angriff zu nehmen. Der begabte, aber eigensinnige Jüngling dürfte das gespürt haben. Er muss die Inkongruenz empfunden haben, die zwischen seinen Fähigkeiten und den realen Möglichkeiten ihrer Verwirklichung bestand. Ein Garnisonsleben mit wechselnden Standorten und einem zähen Aufstieg auf der Karriereleiter bis zum Hauptmann (capitaine), allenfalls zum Major (colonel) – das war es, was ihm das überforderte Königtum Ludwigs XVI. bieten konnte.
Hinzu kam, dass die Rahmenbedingungen, die ein solches Offiziersdasein bot, für die Ausbildung eines eigenen Privatlebens ausgesprochen ungünstig waren – darin ähnelten sich Kirche und Armee. Der gerade sechszehnjährige »Nabulione« war noch ein grüner Junge, was den gesellschaftlichen Schliff, sein äußeres Auftreten und die eigene Selbsterkundung auf dem Terrain der Emotionen anging. Daran änderten auch die gelegentlichen Kontakte zu Töchtern aus am Ort ansässigen Honoratiorenfamilien wenig. Die Anknüpfung einer Beziehung, die in eine standesgemäße Ehe führen konnte, wurde durch die Versetzungen von einem Garnisonsstandort zum nächsten verhindert. Erst war er knapp ein Jahr in Valence, ab 1788 dann anderthalb Jahre in Auxonne. Dazwischen lag ein mehrmonatiger Urlaub in Ajaccio, den er großzügig genehmigt bekommen hatte, um die finanziellen Probleme seiner Familie nach dem plötzlichen Tod des Vaters zu beheben. Von Auxonne aus machte er sich dann im Herbst 1789 wiederum für anderthalb Jahre nach Korsika auf.
Seine ersten sexuellen Erfahrungen soll Napoleon laut eigenem Bekunden als 18-Jähriger mit einer Pariser Prostituierten gemacht haben.16 Für einen jungen Mann mit geregeltem Einkommen, aber ohne Familienanschluss war dies durchaus nicht unüblich. Damals befand er sich gerade als Bittsteller in Paris, um die liegengebliebenen Projekte, für die sich sein Vater Carlo hoch verschuldet hatte, weiterzutreiben. Allerdings ohne Erfolg, wie sich bald herausstellte. Man zeigte Paris-Besuchern im 19. Jahrhundert lange noch das ärmliche Zimmer des Hotel de Cherbourg in der Rue du Four-Saint-Honoré, wo er damals abgestiegen war.17 Vielleicht erklärt diese doppelte Ernüchterung seiner frühen Paris-Reise die resignierte Haltung in seinen Briefen, die Klage über den ›ennui‹ des Lebens, die sich bis zur Idee des Selbstmords steigern konnte:
»Immer allein inmitten der Menschen, kehre ich heim, um mich mit meinen Träumen zu beschäftigen und mich der ganzen Lebhaftigkeit meiner Melancholie hinzugeben. Wohin neigt sie sich heute? Auf den Tod zu. In der Morgenröte meiner Tage kann ich noch auf ein langes Leben hoffen. Was also treibt mich an, mich selbst zerstören zu wollen? Gewiss, was soll man in der Welt? Wo ich ja doch sterben muss, wäre es da nicht besser, mich selbst zu töten?«18
Solche Sätze, vermutlich durch die Lektüre Goethes Werther angeregt, dürfen indes nicht überschätzt werden. In ihnen manifestierte sich weniger eine konkrete suizidale Absicht des Heranwachsenden als vielmehr die tiefempfundene Unvereinbarkeit von Ruhm- und Lebensgier einerseits und seiner bescheidenen, von materiellen Sorgen überschatteten Existenz als faktisches Oberhaupt einer vom Niedergang bedrohten Familie. Es war dies eine schlechterdings erdrückende Zukunftsperspektive. Wer konnte wissen, dass kurze Zeit später die scheinbar festgefügte Welt des Ancien Régime zusammenbrechen würde und sich einem Emporkömmling wie ihm ungeahnte Möglichkeiten eröffnen würden, die sich ihm beim Fortbestand der sozialen Strukturen vor 1789 niemals aufgetan hätten? Charles Nodier hat in seinen Betrachtungen zur Französischen Revolution Überlegungen angestellt, was aus Gestalten wie Robespierre und Bonaparte geworden wäre, wenn die Revolution nicht dazwischen gekommen wäre:
»Robespierre, […] ein Provinzadvokat, allenfalls würdig der Akademie von Arras; Bonaparte, nicht mehr als ein guter Offizier, zänkisch, schwer zu nehmen, ein unangenehmer Begleiter, der ein unnützes Genie in sich ausbrütet.«
Nodier fügte hinzu:
»Werfen Sie den einen und den anderen mit unwiderstehlicher Gewalt mitten hinein in eine bis in ihre Fundamente erschütterte Welt, und diese Welt wird ihr Gesicht verändern.«19
Trittbrettfahrer der Revolution (1789–1793)
Frühe Erfahrungen
Für die eigenartige Rolle, die Korsika in der frühen Biografie Napoleons spielte, hat einer seiner jüngsten Biografen, Patrice Gueniffey, eine kluge Formel gefunden. Gueniffey vergleicht seine innere Entwicklung mit der von Einwandererkindern der zweiten und dritten Generation, die sich, obwohl gänzlich in der neuen Heimat akkulturiert, anders als ihre Eltern wieder dem ursprünglichen Herkunftsland zuwenden. Gueniffey gelangt dabei zu der erstaunlichen Erkenntnis, Napoleon »liebte den Franzosen nicht, der er geworden war, und er bemühte sich, der Korse zu werden, der er nicht mehr war.«20 Gueniffeys Bemerkung trifft die zwiespältige Beziehung, in der Napoleon zu beiden ›Vaterländern‹ stand, vergleichbar der Zerrissenheit, die heutige Immigrantenkinder in ähnlicher Lage empfinden.
Diese eigenartige Doppelbindung, die zu einer lebenslangen Ambivalenz zu werden drohte, geriet durch die Revolution in Bewegung, sodass es nicht einfach ist, in Napoleons Äußerungen eine klare Linie zu erkennen. Zwei grundlegende Tatsachen sind zu beachten: Zum einen projizierte er alle Ergebnisse der Revolution auf seine Heimat. Er beurteilte die Französische Revolution also vor allem in Bezug auf Korsika. Zum anderen muss bei den Äußerungen Napoleons zur Revolution gefragt werden, ob er sie als bloßer Zeitgenosse oder als Augenzeuge traf, der quasi beruflich in die Vorgänge involviert war. Dann urteilte in ihm nicht der Fortschrittsgläubige, als der er sich gab, sondern der Militär. Für alle frühen Urteile Napoleons über die Französische Revolution ist aber die persönliche Distanz kennzeichnend, die er zu den Geschehnissen erkennen lässt. Man hätte ihn für einen ausländischen Beobachter halten können.
So erkannte er völlig richtig die Bedeutung der am 8. August 1788 verkündeten Entscheidung des Königs, für den Mai des folgenden Jahres die Generalstände einzuberufen. Denn er hatte begriffen, dass damit für Korsika eine Gelegenheit geschaffen wurde, die bestehende französische Administration loszuwerden. Auch befürwortete er die Bewerbung seines Bruders Joseph als eines der Vertreter Korsikas für die Abordnung zu den Generalständen in Versailles. Zugleich bedauerte er, dass die allgemeine Verunsicherung dem Erfolg »unserer Angelegenheit« – gemeint war die von seinem Vater mit viel Aufwand betriebene Maulbeerbaumschule – hinderlich war.21
Vor Ort, in Auxonne, versah er derweil ohne Bedenken die ihm zugewiesene militärische Aufgabe, nämlich Ordnung zu schaffen und Aufruhr zu verhindern. So auch im April 1789, als er für mehrere Wochen in das Städtchen Seurre abkommandiert wurde, wo er zusammen mit einem anderen Offizier revoltierende Kleinbürger »zur Raison rief«, die verhindern wollten, dass die Getreidevorräte von Wucherern weggeschafft wurden. Seiner Mutter schrieb er:
»Das Volk hat einen Aufstand gemacht und sich gegen seine städtischen Beamten erhoben, es hat Getreidemagazine geplündert, die die Wucherer nach Lyon bringen wollten. Deshalb sind wir als Hundertschaft ausgerückt, um dem Einhalt zu gebieten.«22
Die Motive der Aufständischen waren Napoleon also bekannt, aber er verwandte kein Wort des Verständnisses darauf, sondern erhoffte sich die Lösung der Probleme allein von der Versammlung in Versailles, wobei er nicht mit düsteren Farben sparte:
»Der Augenblick der Stände naht. Man spürt es allenthalben. Die Unruhen in den Städten, den Dörfern, auf dem Land nehmen überhand. Gebe der Himmel, dass diese Flamme des Patriotismus Bestand hat, und dass sich die Dinge nicht verschlimmern. Das fürchte ich. Sie wissen ja, dass sich kurz vor dem Tod immer eine Besserung einstellt.«23
Als die Generalstände schließlich am 5. Mai 1789 zu ihrer Eröffnungssitzung in Versailles zusammentraten, interessierte ihn daran hauptsächlich die Frage, ob er deshalb die Veröffentlichung seines Buches über Korsika verschieben sollte. Die vorausgegangenen Réveillon-Unruhen in Paris, bei denen über hundert Personen zu Tode gekommen waren, streifte er nur mit lässiger Geste. In einem Brief an seinen Bruder Joseph schreibt er etwa:
»Man musste Truppen heranführen, um den Pöbel zu beruhigen, man hat zehn oder mehr von ihnen gehängt und getötet, vielleicht zwanzig, vielleicht dreißig Personen, die Berichte darüber waren übertrieben.«24
Von der ›juristischen‹ Revolution, die sich in den folgenden Wochen in Versailles vollzog, verfolgte er im Wesentlichen nur den äußeren Ablauf, nämlich dass der leitete Minister Necker, der ihm imponierte, gegen das Reformprogramm Ludwigs XVI. vom 23. Juni 1789 opponierte und deshalb zurücktreten musste. Ob er zu diesem Zeitpunkt bereits begriff, welcher Stellenwert dem Ballhausschwur und dem folgenden Nachgeben des Königs gegenüber der nun als ›Assemblée nationale‹ firmierenden Ständeversammlung zukam, ist jedoch mehr als fraglich. Er verfolgte, wie Ludwig XVI. unter dem Eindruck der fortgesetzten Unruhe in Paris das unzuverlässig gewordene Militär aus der Hauptstadt abzog und dadurch den Bastillesturm erst ermöglichte, dessen Dynamik er anschließend nur dadurch dämpfen konnte, dass er die Ergebnisse der Verfassungsrevolution in Versailles anerkannte und den beliebten Minister zurückrief. Diese neuerliche Volte der Regierung scheint der junge Napoleon als das gesehen zu haben, was sie in den Augen eines Soldaten war: als Einknicken vor dem Druck der Straße infolge des Versagens der militärischen Führung und mangelnder Konsequenz in der Haltung des Königs.25
Abb. 2: Europa zu Beginn der Französischen Revolution 1789
Im kleinen Maßstab bekam er Ende Juli 1789 die Gelegenheit, es besser zu machen. Bei den Unruhen, die im Gefolge der ›Grande peur‹ auch die Bourgogne erfassten, sprang er für einen von der Situation überforderten 75-jährigen General ein, schloss sich mit der neugegründeten Bürgerwehr von Auxonne kurz und ließ 35 der Unruhestifter festsetzen. »In einem Monat«, meinte er zu seinem Bruder, würde »alles erledigt sein«.26 Und über die Opfer der Unruhen in ganz Frankreich urteilte er nun, ganz im Sinne der offiziellen Lesart:
»Das war das unreine Blut der Feinde der Freiheit und der Nation, das sich seit langem schon auf ihre Kosten mästete.«27
Von den Männern der Nationalversammlung, die sich daran machten, dem Land eine Verfassung zu geben, hielt er allerdings nicht allzu viel. »Sie kommen langsam voran und schwätzen zu viel«. Insgesamt überwog ein Gefühl gebremster Erleichterung. »Alles das ist brillant, aber es existiert vorerst nur auf dem Papier.« Dass Ludwig zum »Wiederhersteller der französischen Freiheit« gekürt und auf einer Medaille verewigt worden war, ließ er unkommentiert. Ob er ihn damals noch als seinen König ansah – wenn er dies jemals getan haben sollte –, sagen seine Briefe nicht und ist mehr als zweifelhaft. Die Widmung an Necker, die er seinem Buch über Korsika voranstellen wollte, begann mit den Worten:
»Im Namen Ihres Königs.«28
Ganz anders wurde sein Ton, wenn Korsika ins Spiel kam. Als Beleg dafür dienen den Biografen der Brief an seinen Paten und das Schreiben an Paoli. Man muss aber in Rechnung ziehen, dass es sich hier um Schreibübungen eines Jünglings handelt, der sich für einen angehenden Literaten hielt und dem Sprachgestus seiner Vorbilder nacheiferte. Dem Paten, der gleichzeitig Schriftführer der korsischen Stände war und zu einer vorsichtigen Reform neigte, wollte er vor Augen führen, dass der Moment für eine Abschaffung der französischen Administration – »das dreifache Joch des Soldaten, des Richters und des Steuereintreibers« – günstig war und nicht verpasst werden durfte.
»An einem korrupten Hof besitzt die Wahrheit wenig Reize; aber heute hat sich die Bühne gewandelt, man muss auch sein Verhalten ändern. Wenn wir diesen Augenblick versäumen, werden wir für immer Sklaven sein.«29
Der Brief an Paoli begann gleich mit einem verbalen Paukenschlag à la Rousseau:
»Ich ward geboren, als das Vaterland unterging. 5000 an unsere Küsten gespiene Franzosen ertränkten den Thron der Freiheit in Strömen von Blut, dieses ruchlose Schauspiel umfing als erstes mein Blick.«30
Er ging dann zu der schon im anderen Brief gegeißelten Trias über (»unter der dreifachen Kette des Soldaten, des Legisten und des Steuereintreibers leben meine verachteten Landsleute dahin«), um zu seinem eigentlichen Anliegen zu kommen:
»Eine seit geraumer Zeit begonnene Studie in französischer Sprache, die sich aus langem Anschauen speiste, sowie die Auswertung von Erinnerungen, die ich in den Taschen meiner Mitbürger fand, ließ mich auf einen gewissen Erfolg hoffen.«31
Es handelte sich hierbei um die Briefe über Korsika (Lettres sur la Corse), ein etwa 140 Seiten umfassender Extrakt seiner Studien zur Geschichte Korsikas, der den Bogen von der Antike zur Gegenwart spannte. Dabei stellt er die zeitgenössische Unfreiheit einer ruhmvollen Geschichte entgegen, um damit für die Befreiung vom französischen »Joch« aufzurufen. Napoleon hatte das Elaborat seinem Lehrer Dupuy in Valence vorgelegt, der ihm jedoch dringend von einer Veröffentlichung abriet. Daraufhin widmete er es dem Abbé Raynal, den er für seine kritischen Schriften über das Ancien Régime inzwischen mehr bewunderte als Rousseau. Durch die Revolution allerdings hatte dieses Manuskript sein eigentliches Angriffsobjekt verloren, sodass er die Veröffentlichung einstweilen auf Eis legte. Stattdessen wollte er nun aktiv bei der Veränderung Korsikas mitwirken und beantragte – zur Besserung seiner Gesundheit – einen viermonatigen Heimaturlaub, der ihm postwendend gewährt wurde. Seine Abwesenheit sollte sich nach einer abermaligen Verlängerung des Urlaubs inklusive dessen Überziehung bis zum Frühjahr 1791 hinziehen.
Aufenthalt in Korsika 1790/91
Um die verworrenen Vorgänge während dieses Aufenthalts auf der Insel zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass in Napoleons Augen wie in denen der meisten Franzosen die Revolution inzwischen zu einem glücklichen Ende gekommen war und die durch die dramatischen Ereignisse vom Mai bis Oktober 1789 erfolgten Erschütterungen von einem Zustand der Normalität abgelöst wurden. Die Ungleichheit der Bürger untereinander, die Willkür der Justiz, die obszöne Prachtentfaltung des Hofes, wie sie die Gesellschaft des Ancien Régime gekennzeichnet hatten, waren abgeschafft worden; und das Gemeinwesen war mittels der von der Nationalversammlung ausgearbeiteten Verfassung auf ein neues, dauerhaftes Fundament gestellt worden. In diesem reformierten Frankreich sollten alle Entscheidungen, ob auf kommunaler, regionaler oder staatlicher Ebene, unter aktiver Mitwirkung der Bürger bzw. ihrer Repräsentanten stattfinden. Es war nur noch nicht geklärt, wie weit sich die Definition der Aktivbürgerschaft erstrecken und ob sie auch die in einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis zu anderen Stehenden, also die Arbeiter, Knechte, Tagelöhner usw., umfassen sollte. Sicher aber war, dass auf der Grundlage eines weit gefassten Wahlrechts Gebietskörperschaften gebildet werden sollten, die auf der Ebene der Gemeinde, des Distrikts und des Departements die alte Verwaltung durch bürgerliche Vertreter ersetzen würden. Diese Körperschaften traten schon 1790 ins Leben und begannen mit der Arbeit. Ausdruck der Reorganisation und des damit einhergehenden neuen Wir-Gefühls war das Föderationsfest am 14. Juli 1790, zu dem Zehntausende Abgesandte aus allen Teilen Frankreichs auf dem Marsfeld in Paris zusammenkamen.
Die politische Elite der Korsen begriff schnell, dass sich ganz neue Perspektiven für ihre Insel auftaten. Nicht im Gegensatz zu Frankreich, sondern im Zusammenwirken mit den neuen Institutionen ließ sich die Lage der Insulaner verbessern. Deren Engagement richtete sich darauf, die alte Verwaltung möglichst rasch loszuwerden und in den neuen Ämtern eigene Leute zu platzieren. Dass sich dieses Ziel nicht gegen, sondern nur im Zusammenwirken mit der allmächtigen Nationalversammlung verwirklichen ließ, verstand nicht nur Korsikas politischer Vertreter des Dritten Standes in Versailles, Antoine Christophe Saliceti, sondern auch dessen Protektor Pasquale Paoli.32 Sie begrüßten die Erklärung der Nationalversammlung vom 30. November 1789, welche die Insel, die formal immer noch als von Frankreich treuhänderisch verwalteter Besitz Genuas fungierte, zum integralen Bestandteil der französischen Nation erklärte. Paoli ließ sich im Frühjahr 1790 für zwei Monate in Paris nieder und wurde von Ludwig XVI. als offizieller Botschafter seines Landes empfangen, bevor er in einem Triumphzug im August 1790 auf die Insel zurückkehrte.
Die Angriffe Napoleons gegen die Trias von Militär-, Justiz- und Steuerbehörde waren also zum Zeitpunkt ihrer Proklamation eigentlich schon obsolet. Es hätte vermutlich gereicht, abzuwarten, bis sich etwas verzögert auch auf der Insel die Arbeit der neuen Institutionen in greifbaren Ergebnissen bemerkbar machten. Für den künftigen Regionalpolitiker Napoleon Bonaparte galt es, sich mit der Nationalversammlung gut zu stellen und Aussagen zu unterlassen, die nach offenem Separatismus klangen. Das war eine nicht immer einfache Gratwanderung, wie die Wortwahl der Inschrift zeigte, die er am Haus der Buonaparte in Ajaccio anbringen ließ. Den Slogan »Evviva la nazione« deutet Gueniffey als Bekenntnis zu Frankreich.33 Diese Interpretation ist jedoch fraglich, denn abgesehen von der Tatsache, dass die Worte in Italienisch bzw. Korsisch abgefasst waren, lässt sich vermuten, dass Napoleon bewusst eine eindeutige Zuordnung vermeiden wollte. Die meisten Bewohner werden die Formel als Bekenntnis zur korsischen Nation begriffen haben. Doch ein explizites und eindeutiges Bekenntnis zu Korsika hätte ihn in direkten Gegensatz zu Frankreich gebracht, was er zu diesem Zeitpunkt nicht wollte. Und so bot ihm dieses Motto einen Weg, um alle außer den Anhängern des Status quo zu bedienen. Die weiteren Lobsprüche bestärken diesen Verdacht. Mit »Evviva Paoli« pries er den Befreier vom genuesischen Joch, und mit »Evviva Mirabeau« feierte er den starken Mann der Nationalversammlung und Vater des Dekrets vom 30. November 1789, den er in eine Reihe mit »ehrenwerten Männern« der Konstituante wie Lameth, Robespierre, Pétion, Barnave und Lafayette stellte.34