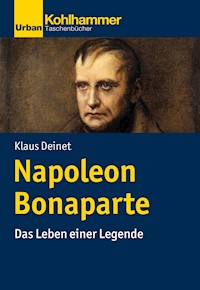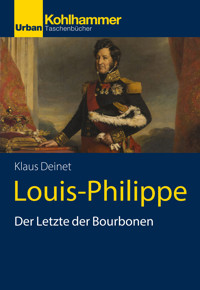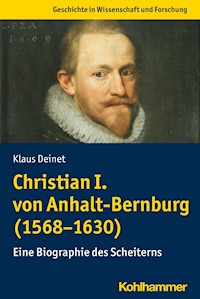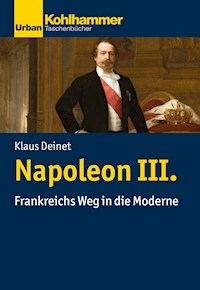
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Napoleon III determined the fate of France and all of Europe during the second half of the nineteenth century. His personality reflects the contradictions and conflicts, fresh departures and upheavals of an entire epoch. Napoleon III was a putschist, the backward-looking founder of a dynasty and executor of the last testament of his uncle, Napoleon Bonaparte. He cherished ambitious sociopolitical plans that were far ahead of his time, paving the way for processes of democratization and parliamentarization, but he failed in his foreign policy and also militarily against his German opponent, Bismarck. This volume describes the complex and sometimes dazzling figure of the last French Emperor and provides a historical outline of nineteenth-century France of the nineteenth century, which was politically, economically and culturally one of the leading European powers, on the threshold of today=s modern age.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Deinet
Napoleon III.
Frankreichs Weg in die Moderne
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2019
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-031852-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-031853-3
epub: ISBN 978-3-17-031854-0
mobi: ISBN 978-3-17-031855-7
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
1 Einleitung: Napoleon III., das Stiefkind der Geschichtsschreibung
2 Lehrjahre eines Thronprätendenten (1808–1848)
2.1 Ein romantischer Jüngling auf den Spuren Napoleons I.
2.2 Straßburg und Boulogne – die Putschversuche von 1836 und 1840
2.3 Ham oder die Neuerfindung des Bonapartismus
2.4 1848 – der Durchbruch
3 Der Präsident (1848–1852)
3.1 Der Präsident richtet sich ein (Dezember 1848–März 1849)
3.2 Die »Römische Frage« (April 1849–Oktober 1849)
3.3 Der Zweikampf (November 1849–Dezember 1851)
3.4 Von der Diktatur zum Kaiserreich (1852)
4 Ein Neuling unter Europas Monarchen (1852–1856)
4.1 Von Louis Bonaparte zu Napoleon III.
4.2 Herrschaftsantritt mit Hindernissen
4.3 Der Krimkrieg – die erste Bewährungsprobe (1854–1856)
5 Die glücklichen Jahre (1856–1859)
5.1 Die großen Werke des Friedens
5.2 Die Krise von 1858
6 Italien und die Widersprüche der Außenpolitik
6.1 Der italienische Krieg von 1859
6.2 Nizza, Savoyen, Rom und der Rhein
6.3 Ausgreifen in die Welt
7 Im Zenit der Macht – eine Zwischenbilanz (1860–1863)
8 Napoleon III. und Bismarck (1863–1867)
8.1 Die frühen Jahre
8.2 Die Anfänge des Konflikts: Polen und Schleswig-Holstein
8.3 Die Eskalation des Konflikts: vom »Sadowa«-Schock zur Luxemburg-Krise
9 Das Wagnis der Reform (1867–1870)
9.1 An den Grenzen der Modernisierung: die Weltausstellung von 1867
9.2 Die Krise von 1868 und der Übergang zum
Empire libéral
10 Die finale Katastrophe 1870–1873
10.1 Die Julikrise von 1870
10.2 Der Weg nach Sedan (August 1870–2. September 1870)
10.3 Epilog in England (1870–1873)
11 Schlussbetrachtung: Napoleon III. vor der Geschichte
Anmerkungen
Literatur- und Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Personenregister
1 Einleitung: Napoleon III., das Stiefkind der Geschichtsschreibung
Wer im heutigen Paris nach dem Namen Napoleons III. Ausschau hält, der wird lange suchen müssen. Zwar stammen die meisten der Boulevards, der Plätze und ein Großteil der Gebäude, die Paris sein unverwechselbares Gesicht geben, aus seiner Regierungszeit, aber keine Straße trägt seinen Namen. Gewiss, die mächtigen Achsen, die die östliche Stadthälfte durchschneiden, sind entweder nach Siegen benannt, die unter seiner Herrschaft errungen wurden (der Boulevard de Magenta, der Boulevard de Sébastopol), oder sie tragen wie im Falle des Boulevard Haussmann den Namen einer Persönlichkeit, deren Wirken er ermöglicht hat. Allein der Initiator solcher Taten fristet ein Schattendasein im öffentlichen Geschichtsbewusstsein der Franzosen. Nur der wenig anheimelnde Platz vor der Gare du Nord (Nordbahnhof), genau genommen dessen nördliche Hälfte, ist nach ihm benannt. Es gibt kein spezielles Bauwerk, das an ihn erinnert, wie der Invalidendom an Napoleon I. Sein Grab liegt fern von Frankreich in der Saint-Michael’s Abbey in Farnborough in der Nähe Londons, und bis heute sind alle Versuche einer Umbettung seiner Gebeine im Ansatz steckengeblieben. Der Erneuerer von Paris, der wie kein zweiter der Stadt seinen Stempel aufgedrückt hat, scheint ein Paria in der französischen Geschichte zu sein.
Napoleons Nachleben
Für das Ende steht stellvertretend der Name der nordfranzösischen Stadt Sedan, und obwohl dieser Name durch den Sieg der deutschen Wehrmacht zu Beginn des Zweiten Weltkriegs für die Franzosen endgültig zum Synonym der nationalen Katastrophe geworden ist, hat die Wiederholung des Debakels von 1871 durch das Desaster von 1940 die Dimension der ursprünglichen Niederlage nicht verkleinert, sondern in der Rückschau noch vergrößert. Auch dies scheint sein Urheber vorausgeahnt zu haben, wie die letzten Worte des Delirierenden auf dem Sterbebett vermuten lassen: »Du warst in Sedan, Henri? Nicht wahr, wir sind keine Feiglinge gewesen«, soll er seinem Gefährten Dr. Conneau in einem Moment plötzlicher Klarheit zugeflüstert haben1. Napoleon muss gespürt haben, dass der Name »Sedan« sich über seinen Tod hinaus als noch wirkungsmächtiger erweisen würde als das Datum des 2. Dezember 1851, denn dieser Name deklassierte ihn nicht nur in den Augen der Republikaner, sondern aller Franzosen, und heftete ihm vor der Geschichte das Signum des Verlierers an.
Die französische Sicht
Das scheint bis heute so geblieben zu sein. Davon zeugen nicht zuletzt die Darstellungen, die aus dem republikanischen Lager stammen, von Taxile Delords 6-bändiger Histoire du Second Empire2 bis zu den quasi offiziellen Geschichtsdarstellungen von Charles Seignobos3 und Louis Girard4. Gemäßigter waren von Anfang an die Konservativen. Pierre de La Gorce, ein bekennender Katholik, der sein Richteramt unter der Dritten Republik freiwillig aufgab, weil er deren Kirchenpolitik nicht mittragen wollte, hat versucht, dem Zweiten Kaiserreich, das er als Heranwachsender miterlebt hatte, in einer 7-bändigen Darstellung Gerechtigkeit widerfahren zu lassen5. André Lebey, eine der führenden Gestalten des französischen Freimaurertums, plante ein umfassendes Werk mit dem Titel » Les Coups d’Etat de Louis Bonaparte«, kam aber über die vorbereitenden Bände, die die Staatsstreichversuche von 1836 und 1840 untersuchten, sowie zwei gewichtige Studien zu 1848 und dem ersten Jahr der Präsidentschaft Louis Bonapartes nicht hinaus6.
Die deutsche Sicht
Es ist ein eigenartiges Paradox, dass der negative Blick auf Napoleon III. weitgehend auf Frankreich beschränkt blieb. Wie es scheint, haben die Sieger von 1871, die Deutschen, dem einstigen Gegner rascher verziehen als die Besiegten. In der deutschen Geschichtsschreibung stand die maßvolle Bewertung des zweiten Franzosenkaisers allerdings von Anfang an unter der national gefärbten Einschränkung wohlwollender Überheblichkeit. Man verübelte Napoleon III. seine auf territoriale Kompensationen schielende Einmischung in den innerdeutschen Einigungsprozess, wofür ihm Bismarck in Sedan die verdiente Strafe verpasst hatte. Es ist bezeichnend, dass diese Sehweise nach der deutschen Niederlage von 1918 noch an Schärfe zunahm. Ein seriöser Historiker wie Hermann Oncken verwandte viel Mühe darauf, in einer auf drei Bände angelegten Dokumentensammlung nachzuweisen, dass das Streben Frankreichs nach der Rheingrenze ein durchgehender Zug der Außenpolitik des Kaisers gewesen sei.
Der Fokus veränderte sich wieder nach der »Machtergreifung« Hitlers. Hatten zunächst einige nationalsozialistische Schreiber in dem letzten Kaiser der Franzosen ein Vorbild für die NS-Sozialpolitik zu finden gemeint, so betrachtete ihn die Geschichtsschreibung nach 1945 durchgehend unter der Marx’schen Prämisse, nämlich als den Erfinder des »Bonapartismus«. Entweder indem sie, getreu dem Urheber der These, Marx, in ihm den Büttel der Bourgeoisie zu sehen meinte, oder indem sie sich durch die Marx’sche Analyse zu einer mehr oder weniger kritischen Begutachtung der bonapartistischen Innenpolitik anregen ließ7. Gewissermaßen als literarische Zugabe gesellte sich – im Gefolge der Wiederentdeckung Walter Benjamins und dessen Interpretation Baudelaires – eine Sehweise hinzu, die es der Suhrkamp-Kultur der alten BRD erlaubte, mit einer Mischung aus Faszination und Degout auf die Welt des Zweiten Kaiserreichs zu blicken. Die tragische Entstehungsgeschichte von Benjamins unvollendet gebliebenem Passagen-Werk, in dem er quasi die Summe der Geschichte des 19. Jahrhunderts in der Wandlung der Physiognomie von Paris nachzuzeichnen versuchte, tat ein Übriges. Frankophile Parissehnsucht und deutsche Gründlichkeit durchdrangen sich gegenseitig und gebaren gewichtige Werke, die nichts weniger wollten als Benjamins Projekt zu Ende zu schreiben.
Die einzige Ausnahme in dieser Phalanx deutscher Betrachter, die allesamt der Person Napoleons III. eher abschätzig, seinem Werk freilich nicht ohne Respekt gegenüberstanden, bildete Heinrich Euler, der in den 1950er Jahren zu einer monumentalen Biographie Napoleons III. ansetzte, die leider nicht über den mächtigen Anfangsband hinauskam8. Johannes Willms, der in seiner Biographie von 2002 seine begrenzte Sympathie für Napoleon III. nicht verhehlt, hat Eulers Buch als »seltsam uninspiriert« bezeichnet9. Eine Qualifikation, die insofern zutrifft, als damit die ausufernde Herangehensweise des Autors gemeint ist, der in einer seit Lebey nicht mehr erreichten Akribie die zugänglichen Quellen der französischen Archive durchgemustert hat und damit eine verkappte Geschichte der Zweiten französischen Republik lieferte, die in der Breite der Quellennutzung und in der Überfülle der Details bis heute ihresgleichen sucht. Leider hat aber auch Euler sein Vorhaben einer definitiven Biographie nicht zu Ende führen können. Der von seiner Frau posthum aus dem Manuskript veröffentlichte Band über die eigentlichen Regierungsjahre des Kaisers blieb eine Vorstudie für künftige Arbeiten10.
Die anglo-amerikanische Sicht
In England war das anders. Dort besaß der polyglotte Franzosenkaiser schon zu seinen Lebzeiten eine feste Gemeinde von Bewunderern, und das hat sich bis heute in der Historiographie niedergeschlagen. Frankreichkenner von jenseits des Kanals wie Theodore Zeldin bezeugten ihm eine Anerkennung, bei der sich kritische Distanz mit vorsichtiger Hochachtung paarten11. Besonders die Innenpolitik des späten Kaiserreichs fand gesteigerte Aufmerksamkeit, vielleicht genährt durch das Missverständnis, dass Napoleon III., der für seine Bewunderung britischer Lebensart und politischer Berechenbarkeit bekannt war, angeblich eine Adaption des insularen Parlamentarismus in Frankreich angestrebt hätte. Auch amerikanische Forscher zollten dem autoritären Neuerer, der Napoleon III. war, Respekt12.
Könnte es sein, dass die nachhaltigen Deutungsantriebe von jenseits des Kanals und des Atlantiks schließlich doch in Frankreich Früchte trugen? Oder war es die veränderte Weltlage nach 1989, die die alten Rechts-links-Schemata nachhaltig durcheinanderwarf und auf die Dauer nicht ohne Auswirkung auf die Beurteilung der großen Figuren des 19. Jahrhunderts blieb, ein Phänomen, das sich neuerdings auch für Metternich feststellen lässt? Jedenfalls ist seit 2008, seit dem 200. Geburtstag Napoleons III., in Frankreich eine Neubewertung seiner Person in Gang gekommen, die ihren Niederschlag in zwei umfangreichen Biographien gefunden hat. Davon betritt zwar nur diejenige von Eric Anceau wirklich Neuland, indem sie bisher wenig beachtete Memoiren und Archivalien heranzieht13, während Pierre Milza sich stärker auf die Sekundärliteratur stützt14. Doch beiden Autoren gelingt es, den letzten Kaiser der Franzosen in ein neues, zumindest in Frankreich bisher unbekanntes Licht zu stellen.
Es scheint, dass damit Napoleon III. aus dem Schatten herausgetreten ist, in den ihn eine voreingenommene Historiographie und zweifelhafte Biographen, die ihn allzu oft auch als Projektionsfläche von erotischen Phantasien missbrauchten, lange verbannt hatten15. Doch wäre dies nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer notwendigen Rehabilitation. Die Tatsache, dass es bis heute keine kritische Ausgabe der Schriften Napoleons III. gibt, mag angesichts des Stiefkind-Daseins, das er in Frankreich fristet, nicht überraschen. Sein Briefwechsel wurde niemals umfassend ediert und ist noch längst nicht in seinem Gesamtbestand gesichert. Ein Teil davon wie die Briefe an Vieillard, die Aufschluss über die Weltsicht des jungen Louis Bonaparte geben können, liegt in Privatarchiven; ein anderer ist Bestandteil öffentlich zugänglicher Nachlässe, wie im Falle der Korrespondenz mit Emile Ollivier, blieb aber unveröffentlicht; ein Teil ist auch verschollen, ging beim Brand der Tuilerien und des Schlosses von Saint-Cloud im Jahr 1871 verloren oder taucht gelegentlich auf dem Auktionsmarkt wieder auf16.
Memoirenliteratur
Da der republikanische Staat es nie für nötig befunden hat, eine umfassende Bestandsaufnahme der Hinterlassenschaft Napoleons III. vorzunehmen, ist die Geschichtswissenschaft bei dem Versuch, dem Charakter und den inneren Antriebskräften seiner Person auf die Spur zu kommen, auf eine zwar umfangreiche, in ihrer Qualität aber recht uneinheitliche Memoirenliteratur angewiesen. Deren bekannteste Vertreter wie Viel Castel, Maupas, Haussmann und Persigny17 – um nur die Wichtigsten zu nennen – sind insofern mit Vorsicht zu behandeln, als sie dem Kaiser entweder in Bewunderung ergeben oder in uneingestandener Rivalität verbunden waren. Objektiver scheinen die ausländischen Freunde Napoleons wie Orsi, Evans oder Malmesbury gewesen zu sein. So oder so handelt es sich hier aber immer um Informationen aus zweiter Hand, um Spiegelungen, die diese gleichermaßen rätselhafte wie faszinierende Gestalt in der Betrachtung ihrer Gegenüber hinterlassen hat. Das gilt auch für die Erinnerungen des von Anceau wieder ausgegrabenen Barons d’Ambès18.
Die vorliegende Darstellung kann schon aufgrund ihres beschränkten Umfangs nicht den Anspruch erheben, die Sicht auf den letzten französischen Kaiser zu revolutionieren. Was mit diesem Buch allerdings angestrebt wird ist, die Person Napoleon III. in ihrer Ambivalenz zu begreifen. Er war zugleich ein Neuerer und ein Traditionalist. Er stand unter dem Anspruch, das vermeintliche Werk seines Onkels, des ersten Napoleon, zu vollenden; aber zugleich versuchte er aus dessen Schatten herauszutreten, indem er die Akzente seiner Außenpolitik anders setzte, die ins Auge gefassten Projekte den Erfordernissen seiner Zeit anpasste und den Forderungen der europäischen Völker nach nationaler Selbstverwirklichung Rechnung zu tragen suchte. Dass er sich dabei in Widersprüchen verfing, in Halbheiten steckenblieb und letztlich an dem Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit zerbrach, hat seiner Gestalt jene Größe versagt, die man Napoleon I. schwerlich absprechen kann. Sie macht ihn aber sympathischer als dieser, war der Neffe bei allem kriegerischen Gepränge doch weniger rücksichtlos im Verbrauch menschlicher Ressourcen als jener. Ob indes die durch Milza und Anceau angeregte neue Sehweise, der diese Studie neben den genannten älteren Darstellungen ihre wichtigsten Anregungen verdankt, irgendwann einmal ins öffentliche Bewusstsein der Franzosen gelangen wird, bleibt abzuwarten. So etwas braucht Zeit, und bis dahin wird der unscheinbare Platz vor der Gare du Nord, den die meisten Reisenden rasch hinter sich lassen, wohl weiterhin seinen Namen tragen.
2 Lehrjahre eines Thronprätendenten (1808–1848)
Die erste Lebenshälfte Louis Bonapartes war ein langes, von Misserfolgen durchzogenes Warten. An ihrem Ende stand die Erfüllung eines Versprechens, von dem schon der Knabe vage gespürt haben muss, dass das Schicksal sie ihm gegeben hatte, um sie eines Tages einzulösen, und an dem der Jüngling mit der ganzen Leidensbereitschaft seiner Jugend allen Rückschlägen zum Trotz festgehalten hat. Freunde und Beobachter des späteren Kaisers, auch die kritischen, waren sich darin einig, dass er den Aufstieg aus der Marginalisierung, in die ihn der Zusammenbruch des ersten französischen Kaiserreichs und die nachfolgende Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress gestoßen hatte, nur dieser Kraft der eigenen Überzeugung zu verdanken hatte. Er besaß einen Traum, den die Mutter in der Idylle von Arenenberg in ihm heranzüchtete und von dem er, als er ihn sich einmal zu Eigen gemacht hatte, sein Leben lang nicht mehr abließ. Darin lag der Charme und der Reiz seiner Persönlichkeit, mit der er eine Schar abenteuerlustiger und erlösungssüchtiger Männer und Frauen um sich scharte und mit der er später die Massen seiner Anhänger zu begeistern wusste.
Der Name des Traums lautete Napoleon. Es war allerdings nicht der reale Napoleon, dem Louis Bonaparte sein Leben nachbaute, sondern der ideelle. Jener Napoleon, dem von den großen Gewaltmenschen der Geschichte das seltene Privileg zugefallen war, sich selber um einige Jahre zu überleben und in dieser Zeit seine eigene Legende zu entwerfen. Das »Evangelium von Sankt-Helena«, wie es vor allem Las Cases überliefert hat, wurde für eine ganze Generation junger Menschen in der Öde der Restaurationsepoche zu einer Art Leuchtfeuer der Geschichte. Versicherte es ihnen doch, dass eine glorreiche, opfervolle Vergangenheit die spröde Gegenwart in die Schranken wies und eine ebensolche Zukunft schemenhaft in Aussicht stellte.
2.1 Ein romantischer Jüngling auf den Spuren Napoleons I.
Die frühen Jahre Louis Bonapartes1 standen noch ganz unter dem Schatten Napoleons. Dessen politisches Schicksal bestimmte nicht nur über Kindheit und Jugend des Neffen; der Onkel blieb auch in Gestalt einer weitverzweigten Familie präsent, deren verschiedene Mitglieder häufig seinen Lebensweg kreuzten und die Sogwirkung der Napoleonlegende mit immer neuen Details anreicherten. Allerdings sollte sich diese Familie mit ihren Nebenlinien (allein Napoleon besaß vier Brüder und drei Schwestern, die allesamt verheiratet waren und Kinder hatten) auch als Hindernis und Bremsklotz erweisen, die den Anspruch des jungen Mannes auf die Rolle des Thronprätendenten in Frage stellen konnte. Selbst als Kaiser sollte ihm diese Familie in der Gestalt seines Vetters noch jede Menge Schwierigkeiten bereiten. Aber bis dahin war es einstweilen noch ein weiter Weg.
Eltern
Schon die Ehe der Eltern hatte Napoleon I. gestiftet. Er hatte für die Heirat seines jüngeren Bruders Louis mit Hortense, der Tochter seiner ersten Frau Joséphine aus deren Ehe mit Alexandre de Beauharnais, gesorgt. Dieser erste Gatte Joséphines, der Großvater Louis Bonapartes, war nach kurzer Karriere als General 1794 einer Säuberungswelle der Jakobiner zum Opfer gefallen, die fast alle Adeligen der Armee erfasst hatte. Die ebenso schöne wie lebenslustige Witwe hatte 1796 den sechs Jahre jüngeren Napoleon Bonaparte geheiratet, mit dem sie trotz verschiedener Affären, die beide hatten, verbunden blieb. Erst 1809 war die Ehe Napoleons mit Joséphine geschieden worden, letztlich wegen deren Kinderlosigkeit. Die zweite Heirat Napoleons mit Marie-Louise, der Tochter des Habsburgerkaisers, hatte die Beziehung der Bonapartes zu den Beauharnais kaum gelockert.
Die Ehe der Eltern war von Anfang an unglücklich gewesen. Louis scheint seine Frau zwar begehrt zu haben, ein dauerhaftes Zusammenleben der Eheleute war aber wegen der unterschiedlichen Charaktere der beiden nicht möglich.
Geschwister
Drei Söhne waren aus dieser Verbindung hervorgegangen, der erste 1802 geborene starb bereits als 5-Jähriger, es folgten 1804 Napoléon Louis und am 20. April 1808 Louis Napoléon. Das dritte Kind war nicht in Den Haag, sondern in Paris zur Welt gekommen, ohne dass der Vater auch nur zu Besuch an das Kindbett seiner durch die Geburt geschwächten Frau geeilt wäre, was zu der Vermutung Anlass gab, Louis Napoléon sei nicht das leibliche Kind Louis Bonapartes. Dieses Gerücht hat sich aber definitiv als falsch erwiesen. Erst Hortenses viertes Kind, das 1811 das Licht der Welt erblickte, entstammte der Verbindung mit ihrem langjährigen Liebhaber Flahaut (einem unehelichen Sohn Talleyrands); dieser Halbbruder hat später als Duc de Morny eine nicht unerhebliche Rolle im Leben Napoleons III. gespielt. Nach der Flucht Louis’ aus Holland lebte Hortense die meiste Zeit bei ihrer Mutter, der Napoleon nach der Scheidung das Schlösschen Malmaison überlassen hatte.
Schon in diesen frühen Jahren muss der Name Napoleon sich dem Kind eingeprägt und seine Vorstellungswelt beherrscht haben, als Gestalt der Phantasie, wie sie ihm in den Erzählungen der Mutter entgegentrat. Dem leiblichen Napoleon ist der Knabe zwar als Kleinkind öfters begegnet, aber es ist ungewiss, wie viel er davon wirklich in seinem Gedächtnis aufbewahrt hat. Der einzige Moment, an den er sich später erinnerte, war der Tag des Maifeldes am 1. Juni 1815, als der aus Elba zurückgekehrte Kaiser seine neue Herrschaft mit der Anknüpfung an die revolutionären Traditionen von 1790 neu zu begründen versuchte. Nach einem letzten Aufenthalt in Malmaison Ende Juni 1815 – gewissermaßen im Zwischenstopp von Waterloo nach Sankt-Helena – verschwand der reale Napoleon für immer aus dem Gesichtskreis des Kindes, doch hat der Tod der geliebten Großmutter ein Jahr zuvor sicherlich die größere Erschütterung in seinem Gefühlshaushalt ausgelöst.
Napoleon als Vorbild
Umso präsenter war der Kaiser von da an in dem Bewusstsein des Heranwachsenden. Hortense ließ sich nach einer Zeit unsteten Umherirrens 1819 dauerhaft in Arenenberg, einem idyllisch gelegenen Ort auf der Schweizer Seite des Bodensees gegenüber der Insel Reichenau, nieder. Das kleine Schloss wurde nun bis zum Tod der Mutter 1835 zum Fixpunkt im Leben Louis Bonapartes und zu einem Sammlungsort für durchreisende Getreue aus der Zeit vor 1815. Die Gestalt Napoleons fesselte den Knaben und ängstigte ihn zugleich. Es gibt die Anekdote, dass Hortense seine Furcht vor der Dunkelheit dadurch zu besiegen wusste, dass sie ihm drohte, sämtliche in seinem Schlafzimmer befindlichen Porträts des Onkels zu entfernen, weil sie nicht in das Zimmer eines »Feiglings« passten; damit hätte sie den Knaben derart bei seiner Ehre zu packen gewusst, dass er seine Furcht überwand oder zumindest nicht mehr von ihr sprach2. Dass der Onkel nicht tot war, sondern auf einem fernen Eiland gefangen gehalten wurde, muss die Gefühlswelt des Kindes unablässig beschäftigt haben. Die Nachricht von seinem Ende erreichte ihn als 13-Jährigen; bereits vorher hatte Las Cases, der spätere Verfasser des Mémorial, Hortense in Arenenberg aufgesucht und von seinem Leben mit dem Gefangenen von Sankt-Helena berichtet. In der Folge baute die frühere Königin von Holland ihre neue Residenz endgültig zum Weiheort und zur Wallfahrtsstätte für Napoleon-Pilger aus.
Für Hortense war nach der erzwungenen Trennung von ihrem älteren Sohn, der bei dem Vater in Florenz aufwuchs, das Kind Louis Bonaparte die sichtbare Verbindung mit der eigenen Vergangenheit. Sie richtete sich – für die damalige Zeit ungewöhnlich genug – in der Rolle der alleinerziehenden Mutter ein, nachdem der Comte de Flahaut eine mehrfach erwogene Heirat mit ihr endgültig ausgeschlagen hatte. Diese wechselseitige Gefühlsabhängigkeit von Mutter und Sohn, die
Abb.1: Arenenberg: Das Schlösschen auf der Schweizer Seite des Bodensees wurde ab 1819 zu einem Fixpunkt im Leben Louis Bonapartes (Napoleonmuseum im Schloss Arenenberg).
sich in der Gestalt des Onkels Napoleon I. überschnitt, dürfte eine tiefe Bindung erzeugt haben, die den Charakter Louis Bonapartes dauerhaft und weit über den Tod der Mutter hinaus formte und sein Verhalten anderen Menschen gegenüber bis an sein eigenes Lebensende geprägt hat. Gewiss war Hortense nie eine rückhaltlose Schwärmerin Napoleons. Sie hatte den Kaiser als imponierenden Machtmenschen erlebt wie auch als dominantes Familienoberhaupt, der allerdings menschlichen Regungen durchaus zugänglich war. Er hatte das Schicksal herausgefordert und sich durch sein Übermaß schließlich den eigenen Untergang bereitet: Diese Version der Geschichte gehörte ebenso zu ihrer Lebenserfahrung wie das Bewusstsein, einem herausgehobenen Geschlecht anzugehören. Der sensible Junge wuchs in diesem Bewusstsein auf, er gewöhnte sich daran, sein Anderssein als Teil seines Wesens zu begreifen; aber er hütete das Wissen um seine Herkunft wie einen verborgenen Schatz, den er mit keinem seiner frühen Spielkameraden teilte.
Abb. 2: Königin Hortense: Die alleinerziehende Mutter, eine große Verehrerin ihres Schwiegervaters Napoleon I., vermittelte ihrem Sohn Louis Bonaparte das Bewusstsein eines herausgehobenen Familiengeschlechts (Miniatur von Jean-Baptiste Isabey; Napoleonmuseum Schloss Arenenberg).
Die Kehrseite dieser Erziehung zu einem Sonderbewusstsein war, dass sich der junge Louis Bonaparte weitgehend fremdbestimmt gefühlt haben muss, zudem geängstigt durch die diffusen Erwartungen, die die Mutter auf ihm ablud. Einen Ausgleich dazu verschaffte ihm der Erzieher, den man ihm verordnete, als offensichtlich wurde, dass der milde Abbé Bertrand den Jungen hoffnungslos unterforderte. Es war Philippe Le Bas, der Sohn des Konventsabgeordneten und Robespierre-Vertrauten Philippe-François-Joseph Le Bas, der sich aus Verzweiflung über das Schicksal seines Helden selbst das Leben genommen hatte. Der asketische Sohn wird dem jungen Prinzen eine Idee von dem spartanischen Republikanismus der Revolutionäre von 1793 vermittelt haben, die die vaterlosen Beauharnais-Kinder Hortense und Eugène seinerzeit der Mutter Joséphine entzogen und bei Handwerkern in die Lehre gegeben hatten. Die Ausstrahlung des ernsten, ja pedantischen Republikanertums verbreitete Le Bas freilich weniger durch seine Erzählungen als durch die Strenge, mit der er die träumerisch-phlegmatischen Impulse seines Zöglings zu bekämpfen suchte und ihm ein rigides Lernprogramm aufnötigte, das den Tagesablauf des Kindes reglementierte. Mit dem Erfolg, dass der junge Louis, der bis dahin nur die sanfte Hand der Mutter und des Paters Bertrand gekannt hatte, nach anfänglichem Widerstand sich den neuen Erwartungen anpasste und in der Rangfolge der Schüler des Augsburger Gymnasiums, das er von 1819 bis 1821 besuchte, auf einen der vorderen Plätze rückte. Doch sobald der Druck nachließ, kam wieder die andere Natur durch, die ihn seine Selbstverwirklichung im Sport und in der Gesellschaft Gleichaltriger suchen ließ. Er war ein guter Schwimmer (einmal soll er sogar den Untersee bis zur Reichenau durchquert haben), er ritt ausgezeichnet und er wusste mit zunehmendem Alter bei öffentlichen Auftritten und während der Besuche bei den Töchtern seiner Tante Stéphanie in Baden-Baden, der Adoptivtochter Napoleons und Witwe des badischen Großherzogs, eine gute Figur zu machen.
Nach 1823, als alljährliche Reisen nach Italien zum festen Teil des Erholungsprogramms der Mutter wurden und er mehrfach seinen beim Vater in Florenz lebenden Bruder besuchen durfte, verdrängte die wachsende Neugier auf das Leben, die der Jüngling in sich spürte, die strengen Auflagen seines Lehrers, dem er sich nun mehr und mehr entfremdete. Aber die erwachende Männlichkeit verband sich in impulsiver Weise mit der verträumten Vergangenheitsfixierung, die die Mutter ihm mitgegeben hatte. Louis Bonaparte wollte sich bewähren, aber er wusste noch nicht wie, und so entwarf er für sich das Ideal des romantischen Revolutionärs. Auf die Umwelt, etwa auf einen so wohlerzogenen jungen Aristokraten wie den dritten Earl of Malmesbury, der ihn 1829 in Rom kennenlernte, konnte diese Mischung durchaus verstörend wirken: »Er war ein wilder junger Tunichtgut oder das, was die Franzosen ›un crâne‹ [einen Draufgänger] nennen«, erinnerte sich der spätere britische Außenminister und langjährige Freund, der ihm damals zum ersten Mal begegnete.
»Er ritt zum Entsetzen der Umstehenden in vollem Galopp die engen Gassen herunter, fechtend und mit der Pistole schießend, und war offensichtlich keines vernünftigen Gedankens mächtig, obwohl er schon damals die feste Überzeugung besaß, dass er eines Tages über Frankreich herrschen werde«3.
Unruhen 1830/31
Die ebenso abenteuerliche wie konfuse Verwicklung des jungen Louis Bonaparte in die Unruhen, die im Gefolge der Pariser Julirevolution 1830 und 1831 Mittelitalien und besonders den Kirchenstaat erfassten, ist vor allem unter diesem psychologischen Aspekt zu sehen. Wenn er sich auf Seiten der Aufständischen mit seinem Bruder unter die Freiwilligenverbände mischte, die damals gegen die päpstlichen und die sie unterstützenden österreichischen Truppen in Bologna und den Marken kämpften, so war das weniger eine Manifestation seiner republikanischen Gesinnung als die selbstauferlegte Bewährungsprobe eines sich seiner Lebenskraft bewusst werdenden jungen Mannes, dessen politische Orientierung noch unscharf blieb und dessen Wollen sich in dem Ziel erschöpfte, etwas Ruhmvolles für ein vermeintlich unterdrücktes Volk zu tun. »Es war wie im Rausch«, beschrieb er später dem Baron d’Ambès die Quintessenz seiner Erlebnisse während der Kämpfe.
»Man empfing uns als Befreier. Der patriotische Atem dieser braven Leute hüllte uns ein, benebelte uns. Ich selbst habe seitdem nicht mehr mit einer solchen Intensität gelebt. In solchen Augenblicken erfährt man, was der gemeinsame Glaube an eine schöne Sache vermag«4.
Vorerst keine Rückkehr nach Frankreich
Zu diesem Initiationserlebnis seines politischen Lebens gehörte dann auch die bittere Erfahrung des Scheiterns und des Verlusts. Dieser traf den neben der Mutter ihm nächststehenden Menschen, den vier Jahre älteren Bruder, der sich bei der aufregenden Flucht vor den in den Kirchenstaat vorrückenden österreichischen Truppen eine Maserninfektion zuzog, an der er nach wenigen Tagen starb5. Hortense, die herbeigeeilt war, bot all ihr Geschick auf, um den überlebenden Sohn der drohenden Verhaftung zu entziehen. Die abenteuerliche Flucht nach Frankreich, bei der Louis Bonaparte, als Diener verkleidet, nur knapp der Entdeckung und einer möglichen Hinrichtung als Rebell entging, bildete zugleich die erste Kontaktaufnahme mit dem Land, das er nun als sein eigentliches Vaterland und als das künftige Objekt seiner politischen Bestrebungen wahrnehmen sollte. Noch fieberkrank wurde er in Paris zum Zeugen der Verehrung, die sein toter Onkel dort immer noch genoss. Von dem Fenster des Hotels, in dem Hortense Zuflucht gefunden hatte, beobachtete er, wie am 5. Mai 1831, dem zehnten Todestag Napoleons, zahlreiche Menschen sich am Fuß der Vendômesäule versammelten, um an dieser Weihestätte des Kaiserreichs Blumen niederzulegen und in Vive-l’Empereur-Rufe auszubrechen. Aber auch die Regierung Louis Philippes, des neuen Herrschers, wurde sich der von den ungebetenen Gästen ausgehenden Gefahr jäh bewusst und verfügte deren umgehende Ausweisung. Bereits am nächsten Tag fuhren Mutter und Sohn, kaum dass es dessen Gesundheit zuließ, nach England weiter und kehrten erst im August 1831 nach Arenenberg zurück.
Die Jahre zwischen 1831 und 1835 gestalteten sich für die beiden wie ein neues, zweites Exil, das sich umso bitterer anfühlte, als ihm berechtigte Hoffnungen auf eine Rückkehr nach Frankreich vorausgegangen waren. Louis Philippe, mit dessen Herrschaftsantritt die Napoleon-Erben die Illusion verbunden hatten, dass er ihnen den Weg in die Heimat ebnen würde, hatte sich zwar bei einer Audienz, die er Hortense gewährte, voller Mitleid gezeigt und wollte dem Sohn der früheren Königin sogar eine Offizierskarriere und die Aussicht auf eine spätere Pairwürde verschaffen; er hatte aber im Gegenzug kategorisch verlangt, dass dieser den Namen Bonaparte ablegte, wozu sich der Prinz – zumal nach den Vorgängen auf dem Vendômeplatz, deren Zeuge er geworden war – nicht bereit fand. Es war daher nur zu verständlich, dass der »Bürgerkönig«, dessen Regime in den ersten Jahren nach der Julirevolution heftigen Erschütterungen ausgesetzt war, jeden als Rivalen ansah, der Ansprüche auf seinen Thron erhob. Das galt für den bourbonischen Kronanwärter »Henri V« ebenso wie für die Mitglieder der Bonaparte-Familie, von den leiblichen Brüdern Napoleons über den in Wien lebenden Napoleonsohn, den Herzog von Reichstadt, bis zu dem Napoleonneffen. Sie alle musste der Orléans als eine Gefährdung seines Throns ansehen, und er wusste seinen Einfluss geltend zu machen, damit die Kammer den schon in Aussicht genommenen Erlass, der den Angehörigen der Bonapartes die Rückkehr nach Frankreich gestatten sollte, widerrief und die Familie zwang, weiterhin im Exil zu leben.
In den folgenden fünf Jahren, die er zumeist in Arenenberg, aber auch in England zubrachte, lebte Louis Bonaparte als Prätendent im Wartestand, nachdem im Juli 1832 der Herzog von Reichstadt, den die Getreuen als »Napoleon II.« verehrten, kaum 21-jährig im österreichischen Exil gestorben war. Von da an betrachtete sich Louis Bonaparte als der legitime Erbe des Onkels und zeichnete seine Briefe mit dem Namen »Louis Napoléon Bonaparte«. Allerdings stieß er innerhalb der Familie auf erhebliche Widerstände. Zwar hatte er keinen direkten Konkurrenten, aber die Vertreter der älteren Generation der Bonapartes misstrauten seinem Ungestüm und zogen es vor, sich mit Louis Philippe zu arrangieren, um der Familie die Rückkehr nach Frankreich doch noch zu ermöglichen und an die noch gesperrten Vermögenswerte heranzukommen. Joseph, Napoleons ältester Bruder, betrachtete sich als natürlicher Verwalter des Erbes, nicht nur aufgrund seiner Geburt, sondern weil er von allen Bonapartes über das größte Vermögen und damit über den stärksten Einfluss innerhalb des Clans verfügte.
Joseph war es als einzigem 1815 gelungen, in die Vereinigten Staaten zu entkommen und dabei beträchtliche Geldsummen mitzunehmen. Er hatte diese in lukrativen Geschäften angelegt, so besaß er in Tennessee einen gut gehenden landwirtschaftlichen Betrieb und er unterstützte, wenn auch vorsichtig und ohne allzu großen Risiken, die Aktivitäten einzelner Bonapartisten in Europa. Für sich selbst hegte Joseph keine politischen Ambitionen, aber er hatte sich immerhin auf die Nachricht von der Julirevolution hin entschlossen, sein Vermögen in den USA zu versilbern und nach Europa zu kommen, um den Ansprüchen seiner Familie mehr Nachdruck zu verleihen. Die Abwicklung der entsprechenden finanziellen Transaktionen nahm Zeit in Anspruch, und als Joseph im Juli 1832 in England eintraf, war Napoleon II. schon tot. Das für den folgenden Herbst und Winter anberaumte Familientreffen stand daher ganz im Zeichen realistischer Bescheidenheit. Die älteren Bonapartes wiederholten ihren schon früher ausgesprochenen Verzicht auf politische Betätigung und wünschten sich dafür von Louis Philippe die Rückholung der Asche Napoleons von Sankt-Helena. Eine Aktion, von der man hoffte, dass auch die gegenwärtige britische Regierung sich ihr nicht kategorisch verweigern würde.
Kaisertum und Revolution
Louis Bonaparte war offiziell gar nicht zu dem Familienrat eingeladen worden, er erschien aber trotzdem und verkündete den anwesenden Clanmitgliedern seine inzwischen in Umrissen entwickelte Doktrin, die diese sich – wohl mehr um des Familienfriedens willen – anhörten. Aus dem italienischen Abenteuer des Vorjahres, so führte er aus, hätte er gelernt, dass der Name Napoleon eine elektrisierende Wirkung ausübte, nicht nur in Italien, wo er sich mit den Freiheitshoffnungen des Volkes verband, sondern auch in Frankreich, wo die Erinnerung an die Revolution und das Kaiserreich durch die Vorgänge von 1830 eine Neubelebung erfahren hatte; ein Effekt, dem sich auch das Bürgerkönigtum auf die Dauer nicht würde entziehen können.
Louis Bonaparte referierte hier nur, was er in einer soeben erschienenen Schrift dargelegt hatte. In den » Rêveries politiques (politische Träumereien)« blieb er ganz in den Spuren des Mémorial de Sainte-Hélène, dessen andächtiger Leser er bereits in den zurückliegenden Jahren geworden war. Das Fazit dieser noch vor dem Tod des Herzogs von Reichstadt vollendeten Schrift war, dass Kaisertum und Revolution einander nicht ausschlossen, sondern sich vielmehr ergänzten. So wie die Legislative ihre Legitimität aus der Wahl durch die Gemeinschaft der Bürger schöpfte, um ihrer Aufgabe, deren Freiheit zu schützen, nachzukommen, so stützte sich die Exekutive auf den Willen des Volkes zur Lenkung seiner Belange. Dabei müsste sie allerdings über die nötige moralische Autorität verfügen, und eine solche sei nur durch den Namen eines großen Mannes – sprich: eines Bonaparte – verbürgt.
Dieser Schlussfolgerung mochten die Vertreter des Familienrates noch zustimmen. Anders war es dagegen mit dem politischen Auftrag, den der neue Thronprätendent aus seiner Analyse ableitete. Er lief auf die rasche Durchführung eines Staatsstreiches hinaus, wobei der Widerspruch zwischen der theoretischen Herleitung der angestrebten Herrschaft und deren ziemlich undemokratischer Herbeiführung dadurch überwunden wurde, dass Louis Bonaparte das Julikönigtum kurzerhand zu einer Diktatur erklärte, die es dem französischen Volk unmöglich machte, seine Meinung frei zu äußern. Würde es dies aber tun können – darüber bestand für ihn kein Zweifel –, so würde es dem neuen Mann mit dem klingenden alten Namen sein Vertrauen schenken und ihm in einer Verfassung die skizzierte Konstruktion der Herrschaft gewähren.
Die in London Versammelten mussten einem solchen Vorhaben skeptisch gegenüberstehen. Auch wenn der Bonapartismus – besser wäre zu sagen: der Napoleonismus – in den 1830er Jahren eine breite Grundströmung im ländlichen Frankreich bildete, so war doch ein Unterfangen, das die Zukunft der Familie ganz und gar auf einen riskanten Putschversuch setzte, ihren Hoffnungen diametral entgegengesetzt. Joseph Bonaparte dachte gar nicht daran, seine verbliebenen Geldmittel in ein solches Unternehmen zu stecken; und auch Hortense, der die Erfahrungen von 1831 noch in den Knochen saßen, riet ihrem Sohn dringend von solchen Plänen ab. Außerdem waren ihre Finanzen nach dem Aderlass des vorausgehenden Jahres derartig zusammengeschmolzen, dass sie nur mit Mühe ihr bescheidenes Glück in Arenenberg zu sichern vermochte. Doch die Aussicht, ein Landedelmann zu werden, lockte den romantischen Schwärmer nicht; dafür erfuhr er zu viel interessierte Aufmerksamkeit von auswärtigen Besuchern und Briefpartnern, die den im Exil lebenden Prinzen mit ihren eigenen Plänen zu verbinden trachteten. Die Skala solcher Aspiranten reichte von bloßen Abenteurern über angesehene Journalisten bis hin zu Vertretern der italienischen und polnischen Aufstandsbewegung.
Doch für Louis Bonaparte stand seit seinem italienischen Abenteuer allein Frankreich im Mittelpunkt seiner Pläne. Nur von hier erwartete er den entscheidenden Ruf, der ihn aus seiner Idylle, die er zunehmend als eine Gefangenschaft erlebte, befreien würde. Bis dahin beförderte er sein Streben auf literarische Weise, allerdings auch durch konkrete Arbeiten, die ein praktisches Geschick verrieten. Das über 500 Seiten umfassende Lehrbuch für die schweizerische Artillerie, das er 1833 verfasste, verdankte seine Entstehung sicher nicht nur der ihn umgebenden Langeweile oder einem snobistischen Hang zum Waffenhandwerk, sondern auch dem nüchternen Kalkül, dass er sich damit der Berner Regierung empfahl und sich so die Möglichkeit offenhielt, weiter in der Eidgenossenschaft leben zu dürfen.
Eine eigentliche Herzensangelegenheit aber war dieses Artilleriehandbuch nicht. Das waren schon eher die » Considérations politiques et militaires sur la Suisse (politische und militärische Betrachtungen über die Schweiz)«, die er ebenfalls nach seiner Rückkehr 1833 niederschieb. Zwar dienten auch sie der Absicherung des weiteren Exils. Gleichzeitig jedoch boten sie dem Verfasser die Möglichkeit, von Napoleon zu sprechen, indem er über die Schweiz redete. Das verbindende Glied war dabei das allgemeine Männerwahlrecht, wie es in der Eidgenossenschaft praktiziert wurde, eine Errungenschaft, von der der junge Louis Bonaparte zu wissen meinte, dass sein Onkel sie auch in Frankreich dauerhaft eingeführt hätte, wenn er erst die Widerstände seiner Feinde, allen voran Englands, überwunden hätte. Denn Napoleon – das war die Grundüberzeugung, die er aus der Lektüre des Mémorial destilliert hatte – betrachtete seine Herrschaft als Verwirklichung des Volkswillens, und das allgemeine Wahlrecht, wie er es bei einzelnen Plebisziten praktiziert hatte, hätte dieser Übereinstimmung den endgültigen Ausdruck verliehen.
In diesem Sinne äußerte er sich auch gegenüber dem Dichter Chateaubriand, der zwar Napoleons dämonische Persönlichkeit bewunderte, der in ihm aber letztlich einen Tyrannen sah: »Ich teile in keiner Beziehung ihre Meinung über den Kaiser«, schrieb er dem Dichter, der 1834 einige Tage in Arenenberg verweilt hatte.
»Ich bin überzeugt, dass Napoleon der Sache der Freiheit nützlich war und dass er die Freiheit gerettet hat, indem er die überkommenen willkürlichen und überlebten Formen abgeschafft hat und indem er die Einrichtungen seines Landes in Übereinstimmung mit dem Fortschritt des Jahrhunderts brachte. Aus dem Volk hervorgegangen, musste er die Zivilisation begünstigen, während die Autorität, die sich nicht auf die Wahl durch das Volk stützt, natürlicherweise deren Fortschritte hemmen muss. Das hat das Volk verstanden, und da Napoleon alles für das Volk tat, hat das Volk seinerseits alles für Napoleon getan. Wer hat ihn zur Würde des Konsuls erhoben? Das Volk. Wer hat ihn mit vier Millionen Stimmen zum Kaiser berufen? Das Volk. Wer hat ihn im Triumphzug von Elba zurück nach Paris gebracht? Das Volk. Wer waren die Feinde Napoleons? Die Unterdrücker des Volkes. Deshalb war sein Name bei der Masse des Volkes so angesehen und deshalb wurde sein Porträt, das sich in jeder Hütte findet, zu einem Gegenstand der Anbetung. Verzeihen Sie, wenn ich so lange von meinem Onkel spreche, aber ich bete Napoleon und die Freiheit an!«6
Der Brief zeigt, dass sich Louis Bonaparte in diesen Jahren noch ganz im Stande des unkritischen Napoleon-Verehrers befand, und sein Duktus lässt erkennen, dass er diese Verehrung inzwischen zu einem regelrechten Mythos ausgebaut hatte. Dazu gehörte, dass er die mittlere Position all derer, die zwischen Napoleons angeblich hehren Zielen und seinen fragwürdigen politisch-militärischen Mitteln unterschieden, zwar zur Kenntnis nahm, aber nicht wirklich gelten ließ. Einem von diesen wohlmeinenden Kritikern, dem Historiker Friedrich Christoph Schlosser, den er in Heidelberg kennengelernt hatte, schrieb er über dessen 1832 erschienenes Napoleon-Buch:
»die Verehrer des Kaisers Napoleon werden Sie vielleicht als einen zu strengen Richter betrachten, während seine Feinde Sie als seinen Lobredner schildern werden. Was mich betrifft, so ist es ganz natürlich, dass ich mich in der Reihe der ersteren aufstelle, da ich Napoleon als den Gott des Lichts verehre, dessen glänzende Erscheinung die Welt beleuchtete, und dessen wohltätige und fruchtbare Spuren heutzutage die Freiheit hervorbringt.«7
Es wäre falsch, wenn man die schriftlichen Bekundungen des jungen Louis Bonaparte als geistiges Nebenprodukt seines späteren Verschwörertums abtut und in ihnen bloßes Beiwerk nachfolgender Taten sieht. Weniger durch ihren Inhalt als durch ihr Bekenntnispotenzial vermitteln die Darlegungen des jungen Mannes einen Eindruck von der persönlichen Ergriffenheit und von der Leidensbereitschaft, die hinter dem noch unbeholfenen Agieren des künftigen Napoleon-Nachfolgers steckte. Es war der gleiche Impuls, den er Narcisse Vieillard, dem Erzieher seines Bruders und langjährigem Freund und Berater, offenbarte:
»Ich weiß, dass ich vieles durch meinen Namen und wenig durch mich selbst bin. […]. Weil ich weiß, welche Schwierigkeiten sich meinen ersten Schritten bei einer wie auch immer gearteten Karriere in den Weg stellen würden, habe ich es mir zum Prinzip gemacht, nur den Inspirationen meines Herzens, meines Verstandes und meines Gewissens zu folgen… und mich so zu bemühen, hoch genug emporzusteigen, damit mich noch einer der erlöschenden Strahlen der Sonne von Sankt-Helena erleuchten möge.«8
Das Pathos solcher Passagen war ehrlich empfunden und verfehlte ganz offensichtlich nicht seine Wirkung auf die Altersgenossen Louis Bonapartes. Es traf jene Grundhaltung des » mal du siècle (Krankheit des Jahrhunderts)«9, den die Generation der um 1800 Geborenen in Frankreichs kannte und pflegte: das Ungenügen an der Gegenwart, der man vorwarf, dass sie es nicht mit der Vergangenheit aufnehmen konnte und die Nachgeborenen um ihre Zukunft betrog. Dahinter verbarg sich zugleich die Angst einer Generation, die nach großen Taten lechzte und die ihr eigenes Lebensdefizit durch die Nachahmung der »Väter« – egal, ob sie nun Robespierre, Saint-Just oder Bonaparte hießen – kompensieren zu müssen glaubte. Nur wenige erkannten, dass die Aufgabe der » enfants du siècle« gerade darin bestand, sich von dem übermächtigen Schatten dieser Väter zu lösen.
2.2 Straßburg und Boulogne – die Putschversuche von 1836 und 1840
Die Jahre zwischen dem italienischen Abenteuer und dem ersten Putschversuch im Oktober 1836 verbrachte Louis Bonaparte in einem Wechsel von melancholischer Apathie und hektischer Betriebsamkeit. Die Abfassung der drei Schriften, von denen das Artilleriehandbuch die meiste Arbeit verlangte, diente letztlich auch dazu, die öden Wintermonate in Arenenberg zu verkürzen. Vom Frühjahr bis zum Herbst herrschte auf dem Landsitz Hortenses dagegen ein reges Treiben; alte Haudegen der Grande armée und junge Napoleon-Enthusiasten, aber auch Männer mit klingenden Namen wie Chateaubriand oder Armand Carrel gaben sich ein Stelldichein und blieben oft mehrere Tage, manchmal auch Wochen. Einige Bekannte Hortenses hatten sich sogar in der Nähe angesiedelt. Der »Prinz«, wie man ihn nun meist nannte, pflegte herzliche Kontakte zur heimischen Bevölkerung und genoss vor allem bei Schweizer Liberalen ein hohes Ansehen. Er verkehrte im Thurgauer Schützenverein und bekam ohne sein Zutun einige Stimmen für einen Sitz im Landtag des Kantons. Zudem nahm er regelmäßig an den Artilleriekursen teil, die der Oberst Dufour in jedem Sommer in Thun veranstaltete. Mit diesem, der ebenfalls zu den Besuchern Arenenbergs zählte, standen Hortense und ihr Sohn bald in freundschaftlichem Verkehr.
Existenz als Landedelmann?
Alles war bereit, um Louis Bonaparte eine halbwegs gesicherte Existenz als Landedelmann zu sichern. Es fehlte nur noch eine entsprechende Heirat, um der Perspektive auf einen behaglichen Lebensweg ein gesichertes Fundament zu verleihen; dies war umso wünschenswerter, als die Finanzen Hortenses durch die Kapriolen ihres Sohnes wie auch durch unglückliche Geldtransaktionen gelitten hatten. Die Mutter sah sich deshalb nach einer aussichtsreichen Partie um, zumal der junge Mann beträchtliches Interesse am weiblichen Geschlecht zeigte und unter der Thurgauer Nachbarschaft den Ruf eines Schürzenjägers genoss. In den bürgerlichen Kreisen von Konstanz war er ebenfalls bestens bekannt und wäre zweifellos als prospektiver Schwiegersohn in mancher begüterten badischen Familie willkommen gewesen.
Doch es war nicht diese Zukunft, die der Prinz mit dem klingenden Namen für sich erträumte. Er wollte nach Frankreich zurückkehren, aber weder als Privatier noch als Parteiführer. Die Aussichten dafür standen allerdings schlecht. Seit der Niederschlagung des Lyoner Aufstands im April 1834 befand sich das Julikönigtum in einer gesicherten Position. Die auswärtigen Mächte goutierten die maßvolle Außenpolitik Louis Philippes, sogar Metternich zog ein berechenbares Juste milieu einem Umsturz, auch einem solchen zugunsten des Bourbonensprößlings Henri V, vor. Würde – so fragten sich die älteren Bonapartes – eine gefestigte Julimonarchie ihnen gegenüber vielleicht doch irgendwann zu Konzessionen bereit sein?
Louis Bonaparte schlug alle solche Überlegungen in den Wind. Er umgab sich mit Unzufriedenen des Juste milieu, die er zum Ärger seiner Mutter sogar mit Geldgeschenken ausstattete. Sein Bestreben ging dahin, durch eine militärische Aktion, ähnlich der Rückkehr Napoleons von Elba im Jahr 1815, das verhasste Julikönigtum zu stürzen und danach einen Nationalkongress einzuberufen, auf dem das französische Volk über seine politische Zukunft entscheiden sollte. Er hegte keinen Zweifel daran, dass die Vertreter eines solchen nach dem allgemeinen Männerwahlrecht gewählten Kongresses ihm die Leitung des Staates anvertrauen würden, – ob als Präsident, Konsul oder Kaiser, ließ er einstweilen offen. Auch den Ausgangspunkt eines solchen Unternehmens hatte er schon bestimmt: Straßburg, eine Stadt, die über eine große Garnison verfügte, dazu eine Bevölkerung, die, wenn auch deutschsprachig, im Ruf des Patriotismus stand und die zudem vom benachbarten Baden aus leicht zu erreichen war. War die Garnison der Grenzstadt erst einmal gewonnen, so glaubte Louis Bonaparte, würde einem Marsch auf Paris nichts mehr im Wege stehen, denn die Gesinnung der Bevölkerung im nordöstlichen Frankreich galt als ausgesprochen national. Was bei der Vorbereitung dieses Plans fehlte, waren Kontakte zu führenden Persönlichkeiten vor Ort, von deren Unterstützung der Erfolg des Unternehmens abhing. Diese konnte sich Louis Bonaparte nicht selber verschaffen, weil er sich dazu persönlich auf französischen Boden hätte begeben müssen, was der Polizei Louis Philippes vermutlich nicht entgangen wäre.
In dieser Lage kam ihm ein Landsmann zu Hilfe, der sich in der Folge zur eigentlichen Seele der Umsturzversuche entwickeln sollte. Jean Gilbert Victor Fialin de Persigny war gleichaltrig mit Louis Bonaparte und stammte trotz des adeligen Namens, den er sich zugelegt hatte, aus ärmlichen Verhältnissen. Er hatte wie so mancher unbemittelte junge Mann aus der Provinz in Paris sein Glück zu machen gehofft und war durch die Vermittlung einiger hochgestellter Personen aus dem Umfeld der älteren Bourbonen, die aber Kontakte zu Napoleons Stieftochter Hortense pflegten, nach Arenenberg gekommen10. Die beiden jungen Männer hatten sich schnell angefreundet; ihr gemeinsamer Nenner war die »Religion«, die Louis Bonaparte, den Worten Hortenses zufolge11, aus Napoleon gemacht hatte und die in dem hochemotionalen Persigny einen hingebungsvollen Adepten fand. Es blieb nicht beim Austausch von Bekenntnissen. Persigny wurde der »permanente Handlungsreisende«12 in Sachen Louis Bonaparte. Er war es, der durch mehrere Besuche den Kontakt zu Offizieren der Straßburger Garnison herstellte, darunter zu Oberst Vaudrey, dem Kommandanten der beiden Artillerieregimenter. Der 51-jährige Vaudrey entsprach ganz dem Typ des in seinen Karrierehoffnungen enttäuschten Abkömmlings der Grande armée. Mehrfach ausgezeichnet, in Waterloo verwundet, war er unter der Restauration und der Julimonarchie als unzuverlässig eingestuft worden und blieb auf der militärischen Karriereleiter im mittleren Segment hängen. Obwohl er es seiner eigenen Einschätzung nach längst zum General hätte bringen müssen, wurde er mehrfach versetzt und musste sich mit nachgeordneten Posten begnügen. Zudem war er hochemotional und – ein schöner Mann mit ergrauenden Schläfen – weiblichen Reizen nahezu widerstandslos ausgeliefert.
Auf ihn als Zielobjekt richteten Persigny und Louis Bonaparte jetzt ihre Bemühungen. In Baden-Baden, wo sich französische Offiziere gerne aufhielten, führte ihm Persigny den »Prinzen« zu, und bei einem längeren Gespräch unter vier Augen gestand der Oberst diesem seine napoleonischen Überzeugungen zusammen mit seiner Verachtung der gegenwärtigen Machthaber. Da dies aber noch nicht zu einem energischen Handlungsimpuls reichte, zückte Persigny, schon ganz im Stile späterer Verschwörungen, eine weitere Karte. Er setzte eine mit ihm befreundete Sängerin, eine gewisse Eléonore Gordon, Witwe eines begüterten englischen Beamten13, auf den Offizier an, mit dem sie mühelos ein Liebesverhältnis anspann, dessen sexuelle Erfüllung indes an das Versprechen einer aktiven Teilnahme des verliebten Obersten am bevorstehenden Putschversuch gekoppelt war. Vermutlich erfolgte die Einlösung des beiderseitigen Geschäfts wenig später, denn nach Anbahnung des Kontakts in Baden-Baden und in Straßburg trafen sich die beiden füreinander Bestimmten einige Tage lang heimlich in Dijon, wo die Dame dem Oberst zwischen beiderseitigen Liebesschwüren die näheren Umstände des geplanten Unternehmens mitteilte. Vaudrey, so die Absprache, sollte die ihm unterstehenden Artillerieregimenter zum Aufstand überreden, die Infanterieregimenter hinzugewinnen und zusammen mit Louis Bonaparte, der rechtzeitig zu ihnen stoßen würde, den Marsch auf Paris antreten.
Wie stand es um die Chancen dieses phantastisch anmutenden Plans? War es wirklich so leicht, eine ganze Garnison zur offenen Rebellion zu bewegen? Der zeitgenössischen Terminologie folgend, hat man sich angewöhnt, die Straßburger Unternehmung als eine » échauffourée« (einen »missglückten Handstreich«) zu bezeichnen. Das Wort unterschlägt nicht nur das zumindest projektierte Ausmaß des Unternehmens, es verschweigt auch die Chancen, die ein solcher Marsch auf Paris nach dem Vorbild von 1815 gehabt hätte, wenn es erst einmal gelungen wäre, die dem Plan innewohnende Dynamik in Gang zu setzen. Persigny erwartete, dass sich in wenigen Tagen weitere Garnisonen anschließen würden. Bereits am sechsten oder siebten Tag hoffte er in Reims zu sein; bald würde sich – so ging das Kalkül – ganz Nordwestfrankreich in der Hand Louis Bonapartes befinden und die Aussicht, die Hauptstadt im Sturm zu nehmen, wäre dann in den Bereich des Möglichen gerückt. Vielleicht, so hoffte er, würde Louis Philippe auch ähnlich wie Ludwig XVIII. es nicht auf eine bewaffnete Konfrontation ankommen lassen und freiwillig das Feld räumen. Dass eine solche Eroberung eines ganzen Landes durch Teile der Armee gelingen konnte, hatten die erfolgreichen pronunciamientos in Spanien und Portugal bewiesen. Zwar war Frankreich ein stärker durchpolitisiertes und administrativ konsequenter auf die Zentrale ausgerichtetes Land als die Staaten der iberischen Halbinsel, aber die Kommunikationswege waren schwerfällig, und wenn eine Regierung sich mangelnder Beliebtheit erfreute, war die Macht ein labiles Gut, das leicht den Besitzer wechseln konnte.
Die Straßburger Garnison
Alles hing in der Tat davon ab, ob der erste Schritt gelingen würde. Die Eroberung der Straßburger Garnison wurde detailliert vorbereitet, mehrere Personen vorab eingeweiht. Allerdings durfte Louis Bonaparte erst im letzten Augenblick öffentlich am Ort des Geschehens auftreten, die vorherigen Kontakte mussten, wie geschildert, entweder über Mittelsmänner laufen oder jenseits der Grenze, in Karlsruhe, Kehl und Baden-Baden, eingefädelt werden. Fatal war, dass die Verschwörer mit Vaudrey zwar über einen verlässlichen Befehlshaber verfügten, dass aber die oberste Kommandogewalt vor Ort bei General Voirol lag, der unmittelbar dem Kriegsminister unterstand. Parallel dazu gab es noch die Zivilverwaltung mit dem Präfekten des Departements Bas-Rhin, der dem Innenminister verantwortlich war. Nur wenn es gelang, einen dieser beiden verlängerten Arme der Regierung zu gewinnen oder zu neutralisieren, hatte das Unternehmen eine Chance auf Erfolg; entzog sich einer von ihnen dem Zugriff und organisierte Widerstand, dann war ein baldiger Zusammenbruch vorprogrammiert.
Romantisch waren die unmittelbaren Vorbereitungen des Putsches. Hortense hatte, Böses ahnend, alles getan, um ihren Sohn möglichst noch vor Ende des Jahres unter die Haube zu bringen, und auch die Kandidatin stand fest, die 16-jähige Cousine Mathilde, Tochter Jérômes, deren weibliche Reize den Heiratsanwärter bei einem Besuch im Sommer nicht unbeeindruckt gelassen hatten. Die Zustimmung des Vaters Louis war eingeholt worden und die Absprache über die zu erwartende Mitgift war zur beiderseitigen Zufriedenheit gediehen. Auch ein Haus war für die zu Vermählenden bereits in Aussicht genommen worden; es war das heruntergekommene Schlösschen der Badener auf der Insel Mainau.
Doch es kam anders. Zufällig erhielt Louis eine Einladung zur Jagd von den Hohenzollern aus Hechingen. Diese Gelegenheit ließ er sich nicht entgehen, um einen Vorwand zur Abreise zu haben, der plausibel genug war, um die Mutter für einige Tage in Sicherheit zu wiegen. Am 1. Oktober 1836 verließ der Prinz Arenenberg und brach nach Hechingen auf, wo er indes nie ankam. Auf Umwegen über den Schwarzwald und Freiburg traf Louis Bonaparte am Abend des 4. Oktober in Straßburg ein, ohne dass er erkannt worden wäre. Er hielt sich einen Tag lang versteckt und traf Persigny und Vaudrey. Die drei beschlossen, das Unternehmen am nächsten Tag zu wagen.
Der Ablauf des Putschversuchs
Die Verschwörer, 15 Männer und eine Frau, versammelten sich am folgenden Abend in einer eigens zu diesem Zweck angemieteten Wohnung in der unmittelbaren Nähe der Austerlitz-Kaserne. Um 11 Uhr erschien Louis Bonaparte, es fand eine durch Wein und Champagner belebte Besprechung statt; man präsentierte eine mitgebrachte Adlerstandarte, das Wahrzeichen Napoleons I.; der Prätendent diktierte drei vorbereitete Proklamationen, eine an die Armee, eine an das französische Volk und eine an die Bevölkerung von Straßburg. Anschließend schrieb er noch zwei Briefe an seine Mutter, je einen für den Fall des Sieges oder des Scheiterns. Dann herrschte angespanntes Warten bis zum Morgengrauen. Vaudrey zog sich für eine letzte Nacht mit seiner Geliebten zurück, die übrigen verließen gegen 5 Uhr früh das Haus, nicht ohne durch ihren Lärm die Nachbarn aufzuwecken, die sich aber, nichts Böses ahnend, gleich wieder zu Bett legten. Louis Bonaparte selbst mag kaum zwei Stunden Schlaf gefunden haben.
Zunächst lief alles wie am Schnürchen. Vaudrey, um 5 Uhr in der Kaserne zurück, gab Befehl, das vierte Artillerieregiment antreten zu lassen und die Pferde zu holen, um die Kanonen zum Abmarsch bereit zu machen. Um 6 Uhr trat Louis Bonaparte in der Uniform eines Artilleriehauptmanns vor die versammelte Truppe und wurde den Soldaten in einer kurzen, aber wirkungsvollen Ansprache Vaudreys als der legitime Nachfolger Napoleons vorgestellt. Auf die Frage, ob sie ihn als solchen anerkennen und sich seinem Befehl unterstellen würden, antworteten diese mit dem nahezu einhelligen Ruf » Vive l’Empereur!« Der Prinz, gerührt von der Szene, deren Ablauf ganz und gar mit seiner Wunschvorstellung übereinstimmte, bat das Regiment, sich in loser Formation um ihn zu versammeln, und hielt eine flammende Rede, in der er die Soldaten daran erinnerte, dass es ihr Regiment gewesen war, das Napoleon 1794 gegen die Engländer in Toulon geführt hatte und das ihm 1815 bei seiner Rückkehr von Elba die Tore Grenobles geöffnet und damit entscheidend zum Erfolg seines Marsches auf Paris beigetragen hatte. Dann befahl er den Soldaten, sich in Viererreihen aufzustellen und mit ihm zum Haus des Ortskommandanten, des Generals Voirol, zu ziehen. Einige Detachements wurden eingeteilt, um das andere Artillerieregiment und die Pioniere zu gewinnen, sich des Präfekten zu bemächtigen sowie den Telegraphen zu besetzen und die drei Proklamationen Louis Bonapartes drucken zu lassen.
Doch von diesem Zeitpunkt an verzögerten sich die Abläufe. Voirol, von Louis Bonaparte in seinem Schlafzimmer überrascht, weigerte sich kategorisch, sich dem Aufstand anzuschließen. Es gelang ihm sogar, in dem sich entwickelnden Tumult zu entkommen und sich der Loyalität eines der drei Infanterieregimenter zu versichern. Ähnlich erging es dem zur Präfektur ausgesandten Persigny mit dem Chef der Zivilverwaltung, den dieser zwar aus dem Bett heraus verhaften konnte, von dem er aber keine Unterschrift unter einen ihm vorgelegten Abdankungsbefehl zu erhalten vermochte.
Die entscheidende Verzögerung des Unternehmens erfolgte schließlich in der Finckmatt-Kaserne, wo zwei der drei Infanterieregimenter lagen. Die einfachen Soldaten, die inzwischen von den Vorgängen erfahren hatten, schienen bereit zu sein, sich den Aufrührern anzuschließen, aber ein Unteroffizier widersetzte sich energisch einer entsprechenden Aufforderung Vaudreys. Louis Bonaparte machte möglicherweise den entscheidenden Fehler, als er einem älteren Sergeanten die Hand auf die Schulter legte und sich als »der Sohn Napoleons« zu erkennen gab. »Der Sohn ist tot und ich kenne nur den König«, soll ihm dieser geantwortet haben14. Einer der Offiziere wusste die jäh umkippende Stimmung zu nutzen, indem er mit lauter Stimme rief:
»Soldaten, man täuscht euch! Der, den man euch als Sohn Napoleons vorstellt, ist nur eine verkleidete Puppe (»un mannequin«) … Es ist der Neffe des Obersten Vaudrey!«15
Die Notlüge tat ihre Wirkung, es entstand ein gefährlicher Tumult, in dem die Infanteristen, die ihre Vorgesetzten schützen wollten, gegen ihre Waffenbrüder von der Artillerie Front machten. Diese wären vielleicht bereit gewesen, ihre Kanonen einzusetzen, aber Louis Bonaparte gab den entsprechenden Befehl nicht. So blieb es trotz gezogener Säbel und aufgepflanzter Bajonette auf beiden Seiten bei geringen Blessuren. Die Infanteristen schossen in die Luft, um die auf den Mauern erschienenen Zivilisten zu vertreiben, die offensichtlich die Partei des Aufstands ergreifen wollten – ihre drückende Überlegenheit entschied den kurzen Kampf. Vaudrey und Louis Bonaparte ließen sich, an die Kasernenmauer gedrängt, widerstandslos festnehmen und auf die Wache führen. Beide gingen davon aus, dass man sie ohne Umstände füsilieren werde, und verabschiedeten sich voneinander, nicht ohne sich nochmals gegenseitig versichert zu haben, dass sie für eine ehrenwerte Sache gestritten hatten. Nach einem kurzen Verhör brachte man den Prinzen in seine Zelle, wo er sofort einschlief. Um 8 Uhr morgens war alles vorbei.
Gründe für das Scheitern
Im Rückblick und im Vergleich mit späteren Aktionen, vor allem dem Staatsstreich von 1851, zeichnet sich die »échauffourée de Strasbourg« durch ein eklatantes Missverhältnis zwischen Absicht und Durchführung – genauer: zwischen der Überzeugungskraft des gesprochenen Wortes und der Inkonsequenz des praktischen Handelns – aus. In seinen Proklamationen, den improvisierten Reden vor den Soldaten wie den für den Druck vorbereiteten Verlautbarungen, die erst im Nachhinein bekannt wurden, wusste der Prätendent alle Register zu ziehen. Die drei Hauptideen seines Glaubens waren hier wirkungsvoll versammelt. Louis Philippe, der eine »große Nation« um ihre Hoffnungen betrogen hatte, der den Freiheitsimpuls von 1789 und 1830 in ein ängstliches und kleinliches Regiment »ohne Ehre und Großzügigkeit« umgemodelt hatte, in dem es nur »eine Gegenwart ohne Zukunft« gab, wurde gegen den großen Napoleon ausgespielt, von dessen Andenken die Franzosen immer noch zehrten, der ihnen Größe und Freiheit gebracht hatte (»Franzosen, Napoleon war größer als Cäsar, er ist das Emblem der Zivilisation des 19. Jahrhunderts«, hieß in der Proklamation an das französische Volk). Louis Bonaparte selbst sah sich ganz in der Rolle des Vollenders einer großen Mission, »das Testament des Kaisers Napoleon in der einen Hand, das Schwert von Austerlitz in der anderen«. Und wieder fehlte nicht das wirkungsvolle Bild, in dem Prometheus mit Jason verschmolz:
»Vom Felsen von Sankt-Helena ist ein Strahl der untergehenden Sonne über meine Seele gefahren: ich werde dieses heilige Feuer bewahren; ich werde siegen oder sterben für die Sache der Völker«16.
Soweit die Rhetorik. Auf einem anderen Blatt stand die Ausführung. Ähnlich wie den Revolutionären von 1830 und 1848 fehlte es diesem Romantiker an der Skrupellosigkeit, mit der die so bewunderten Vorbilder von 1789 und 1793 das Mittel der Gewalt gehandhabt hatten. Louis Bonaparte mochte es sich zur Ehre anrechnen, dass bei seinem ersten Putsch kein Mensch ernsthaft zu Schaden gekommen war; für die Zukunft hat er daraus dennoch die Lehre gezogen, dass die Menschen mit Überzeugung allein nicht zu gewinnen waren. Darin und nicht in einer stümperhaften Vorbereitung lag die Ursache des Scheiterns. Seine erklärte Absicht war es, Voirol »nicht die Pistole an den Hals, sondern den Adler vor die Augen zu halten«17. Doch wie die Vorgänge zeigen, waren die Vertreter der älteren Generation nicht mehr so einfach für diese Option zu gewinnen, vor allem dann nicht, wenn sie nach 1815 in gesicherte Positionen gelangt waren. Sie waren allerdings, wie sich in der Folge zeigen sollte, bereit, dem jugendlichen Schwärmer seine ehrliche Überzeugung zugute zu halten und ihm sogar Respekt zu zollen. Für die Staatsmacht war diese Art der Loyalität auf die Dauer alles andere als beruhigend, machten die Staatsdiener ihr Verhalten doch vornehmlich an der Opportunität, nicht an der Legalität fest. Über eine solche natürliche Legalität verfügte aber kein Regime in Frankreich mehr, seit die Revolution und die ihr im Abstand weniger Jahre folgenden Regimewechsel zur Erosion der staatlichen Autorität geführt hatten.