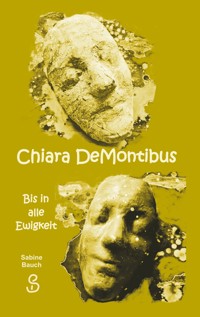Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Früher, als ich ein Kind war, konnte ich den Nebel nicht leiden. Es machte mir Angst, wenn ich weder den Wald noch die Wiese vor dem Haus sehen konnte. Ich war dann überzeugt, dass sich unser Haus losgerissen hat, wie ein Boot von einem Steg und durch das Nichts treibt, ohne Aussicht, je wieder zu unserem Berg und der Wiese zurückzukommen. Als ich wieder einmal so beunruhigt aus dem Fenster sah, in der Hoffnung, viel-leicht das Ufer unserer Heimat wieder zu finden, hat sich meine Mutter neben mich gestellt und ihre Hand ganz leicht auf meinen Kopf gelegt. Sie erzählte, dass sie es jeden Herbst kaum erwarten kann, bis die Nebelpferde an unserem Hof vorbeiziehen auf ihrem Weg zu den Winterweiden. Sie fragte, ob ich sie sehen kann, die vielen weißen Pferde, groß und kräftig und die kleinen Fohlen dazwischen. Zum Ende des Winters kehren sie zurück und die Fohlen sind dann schon groß. Ich habe lange im Nebel gesucht und nichts gesehen, aber irgendwann ist es mir gelungen und von da an hatte ich niemals wieder Angst vor dem Nebel, denn ich wusste, dass ich eines Tages mit ihnen gehen werde, wenn sie es erlauben, um zu sehen, wo sie den Winter verbringen und im Frühjahr an unserem Hof vorbei auf ihre Sommerweiden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
~Zeit vergeht~
~Thomas~
~Das Mädchen~
~Der Unfall~
~Die Stadt~
~Die Kapelle~
~Nebelpferde~
~Zeit vergeht~
Vorwort
Es ist nicht so, dass ich und meine Figuren leidenschaftlich Tabus brechen, wir interessieren uns nur nicht dafûr.
Die Figuren entsprechen selten der Gesellschaftsnorm. Die einzige Regel, an die sie sich halten, ist: Leben und leben lassen. Errichten befriedigt sie mehr als zerstören. Und manche zerbrechen so lautlos.
Stilistisch merkt man es, weil wörtliche Reden keine neuen Absätze bekommen, sondern im Fluss bleiben wie im echten Leben, und deshalb sind die Geschichten auch in der Gegenwartsform geschrieben.
~Zeit vergeht~
Der Hof, hoch oben über dem Dorf zwischen den sattgrünen Bergwiesen, scheint lange schon verlassen zu sein. Vom Tal aus gesehen, bietet er einen romantischen Anblick und reiht sich harmonisch in die Kette der Berghöfe ein, doch bei näherer Betrachtung ist nicht zu übersehen, dass die Zeit auch in diesem abgelegenen Winkel gründlich ihre zersetzende Arbeit leistet.
Das Haupthaus lehnt sich mit dem Rücken gegen den Berg - linker Hand, wenn man die letzte Kurve der Schotterstraße vom Dorf her erreicht. Ihm gegenüber steht das Stallgebäude, das den Eindruck erweckt, es würde jeden Augenblick den Abhang hinunterrutschen, auf die darunter liegende Straße und vermutlich weiter über die steile Wiese, ein zweites Mal über den Fahrweg, bis es von den ersten Bäumen des Waldes aufgefangen werden würde. Der rückwärtige Teil des Gebäudes stützt sich auf große Felsbrocken, die mit dicken Holzpfählen im Hang verkeilt sind. Hart wurde mit dem Berg um diese wenigen Quadratmeter waagerechter Fläche gekämpft. Hinter dem Stall steht ein weiteres winziges Nebengebäude. Kunstvoll wurde es zwischen zwei Felsblöcken eingepasst, die es beinahe rechtwinkelig umschließen. Einer der Felsen fällt zur Straße hin senkrecht ab. Dort sprudelt aus einem Riss klares Wasser und überquert in einer Rinne die Straße. Der zweite Fels gräbt sich den Berg hinauf in die Erde ein. Die Schotterstraße folgt ihm noch ein Stück und löst sich in einen schmalen Feldweg mit tiefen Spurrillen auf, der zuerst an Wiesen, die mit massiven Pflöcken und dickem Draht zu Weiden aufgeteilt sind, vorbeiführt, um dann hinter der Bergkuppe zu verschwinden. Es gibt kaum waagrechte Flächen. Das Gelände ist stark gefaltet und wenn zur landwirtschaftlichen Nutzung dann nur zur Viehhaltung geeignet. Doch entlang der Straße zum Hof, zwischen der letzten Kurve und dem Hauptgebäude wurde einst ein Acker bestellt. Noch lässt sich ein gewisser Grad an Kultivierung erkennen, doch die Natur ordnet sich die Fläche gerade wieder unter. Zwischen unzähligen Wildkräutern ragen trotzig einige vertrocknete Getreidehalme heraus. Der letzte Teil des Ackers ist zu einem Gemüsegarten eingezäunt, er liegt brach und die Stauden und Sträucher wuchern lange schon ungezähmt. Die Gehwege zwischen den Gebäuden wurden liebevoll mit Rundlingen gepflastert, nun lagert genügsames Hochlandgras in dicken Polstern darüber, aus denen die ersten frühlingshaften Spitzen hervortreiben. Das dicke Wurzelgeflecht zeugt davon, dass es in seinem Ausbreitungsbestreben lange nicht gestört wurde. Die abgestorbenen Zweige der Wildstauden aus dem letzten Sommer, überwiegend Disteln und Brennnesseln, zeigen wie mahnende dürre Finger in den blassblauen Himmel. Gewächse, die ein geschützteres Dasein vorziehen, konnten sich ungestört entlang der Hauswände ansiedeln und fangen vorsichtig an zu treiben. Das erste Grün des Frühjahrs garniert den Zerfall mit einem Hauch von Hoffnung, und doch trommelt die Natur auf dem Menschenwerk ihren unaufhörlichen Rhythmus.
Ein kräftiger Windstoß zerrt an der Stalltür, die nur noch von einem Scharnier und einem stark verrosteten Riegel getragen wird. Die Holzbohlen sind von unten her morsch und brüchig und knarren missmutig im letzten Widerstand. Wer es wagt einzutreten, sieht, dass in den Boxen hoch das Stroh liegt, als ob das Vieh am Abend wieder hereingetrieben werden würde. Der Wind hat Staub, abgestorbenes Moos und vertrocknete Grashalme durch den Spalt am Tor die Stallgasse entlang geblasen, ansonsten wirkt alles aufgeräumt. Nur das Heu oben auf dem offenen Boden ist wegen der Löcher im Dach, durch die der Regen eindringt, größtenteils verfault. Es hängt dunkelgrün und fransig über der Kante und verströmt einen unangenehm stechenden Geruch. Auf einem Holzgestell steht umgedreht eine leere Milchkanne und die Jutesäcke daneben sind vielleicht einmal mit Getreide gefüllt gewesen, nun baumeln sie schlapp und zerfressen herunter. Einige Schalen haken noch in dem Gewebe und es ist mit Mäusekot verklebt. Selbst den Spinnen ist es zu einsam geworden. Ihre verlassenen, zu dicken, staubigen Fetzen zusammengerafften Netze hängen wie alte Vorhänge von der Decke. Die Hühnernester auf den drei Etagen des Regals an der hinteren Wand sind verlassen und zerzaust. Zwei hat der Wind hinuntergestoßen und so lange mit ihnen gespielt, bis sie sich in einer kometenhaften Spur Stroh aufgelöst haben. Der Hühnerkot am Regal ist zu Staub zerfallen und nur noch als weißer Schatten zu erkennen. Gleich neben dem Eingang stehen die üblichen Gerätschaften zur Stallarbeit an die Mauer gelehnt, ein Besen aus Binsen gebunden, ein hölzerner Rechen, dem zwei Zinken fehlen und eine verrostete Mistgabel. Das Gebäude selbst wurde für Jahrhunderte gebaut und hat einen Teil davon schon überstanden. Ein Fundament aus grob behauenen Steinen trägt dicke Eichenbalken, die die Witterung schwarz gebeizt hat. Das Brennholz, das außen entlang der hinteren Stallseite aufgeschichtet ist, wurde von der Sonne silbrig gebleicht. Ein Vogelnest hat sich vom Dachgiebel gelöst und liegt auf dem Stapel, vergilbter Mais hängt an Haken darüber. Unter dem Giebel ist die Zahl 1805 eingeschnitzt.
Die Wände des Haupthauses sind weiß gekalkt, doch liegt dicker Staub in den groben Poren des Putzes, der an einigen Stellen abfällt. Die hölzernen Fensterstöcke und der Giebel trotzen schon mehrere Generationen der Witterung und werden dies weiterhin ohne größeren Schaden tun. Auch die Fensterläden sind massiv gearbeitet, sehnen sich allerdings nach einem neuen Anstrich. Einst war es wohl ein dunkles Grün, von dem Reste in den tieferen Rillen des Holzes klemmen. Die Fassade des Hauses ist schlicht, ohne Erker, ohne Vorsprünge, kein Vordach über dem Eingangsbereich. Hier oben werden seit Generationen keine Gebäude mehr errichtet. Die neuen, höchstens einhundert Jahre alten, aufwendiger verzierten Höfe der wohlhabenden Bauern gibt es nur unten im Tal. Die Bergbauern waren nie reiche Leute und sind es auch heute nicht. An der dunklen, eichenen Eingangstür hängt ein schweres Schloss, das zusammen mit dem Riegel offensichtlich nachträglich angebracht wurde. Silbern blinkt beides in der Sonne und passt so gar nicht zum Rest des altertümlichen Anwesens. Dicke Löwenzahnstauden zwängen sich durch die Steinplatten der beiden Stufen zur Haustür und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie sie bald zersprengen. Sogar eine kleine Holunderstaude streckt sich ungestört die halbe Türhöhe hinauf, doch die beiden steinernen Pflanztröge links und rechts sind leer. Regenwasser hat die Erde dort festgestampft. Unkraut beginnt zu sprießen. Die Fenster des Haupthauses sind von außen verstaubt. Doch dort, wo Neugierige den Staub kreisförmig wegwischten, strahlen die halbhohen gehäkelten Gardinen erstaunlich sauber hervor. Wer ins Innere blickt, schrickt vermutlich zurück, denn es sieht bewohnt aus und jederzeit könnte jemand den Raum betreten oder vielleicht schon lesend auf dem alten Lehnstuhl in der Ecke am Fenster sitzen. Bücher und Geschirr reihen sich in den einfach gearbeiteten Holzregalen. Auf dem massiven Tisch, der sicherlich schon mehrere Generationen überlebt hat, liegt eine sonnengelbe Decke mit einer schlichten Schale aus rotem Ton. Auf dem Dielenboden sind ohne erkennbare Ordnung Teppiche in leuchtendem Dunkelrot, Orange und Rostbraun verstreut, farblich passende Kissen und eine helle, gestrickte Schafwolldecke auf dem modernen rostfarbenen Sofa. Ein dunkelbraun gefliester Kachelofen ragt in den Raum. Die Einrichtung ist schlicht und auf das Nötigste beschränkt, kein übertriebener Schmuck, kein Zierrat. Es paart sich ländliche Moderne mit Altertum in schweigender Harmonie. Durch das Fenster auf der anderen Seite der Eingangstür sieht man in die Küche. Kein Obst liegt in der Schale, kein schmutziges Geschirr steht herum, keine Töpfe mit Essensresten vom Vortag auf dem alten, noch mit Holz zu beheizenden Herd. Die Körbe für das Feuerholz zu beiden Seiten sind leer. Töpfe stapeln sich in einem Regal darüber. Neben einem Buffet zwängt sich ein Tisch mit zwei Stühlen und einer Bank in die Ecke zum Fenster. Auf der anderen Seite stehen ein hoher, moderner Kühlschrank und eine alte, aber bereits elektrische Waschmaschine. Die antike Spüle nimmt die gesamte vierte Wandseite ein. Ein langer niedriger Holzschrank mit Marmorplatte und emaillierten Becken unter dem Wasserhahn. An Lackresten in den Spalten der Türfüllungen des abgebeizten, blanken Kiefernholzes erkennt man, dass er einmal weiß und hellblau gestrichen war. Die hohen Füße wirken wie Stelzen und man sieht den Staub, der sich darunter in lockeren Ballen auf den glatten Dielen zusammenrollt. Die dünne Staubschicht, die auf allem ruht, ist unberührt und damit von außen nicht zu sehen. Auch die mit ‚Theresa‘ unterschriebene Notiz auf dem Buffet, wonach das Vieh in den benachbarten Höfen untergebracht wurde, sieht man nicht. Aufmerksamen Beobachtern wird nicht entgehen, dass der vertrocknete Kaktus, der einsam auf der Fensterbank steht, die einzige Pflanze im ganzen Haus ist. Tote und ebenfalls vertrocknete Fliegen leisten ihm zweifelhafte Gesellschaft.
Die Leute im Dorf haben keinen Grund, hinauf zu kommen, wollen es auch nicht. Wandernde Touristen fragen manchmal, ob und warum der Hof unbewohnt ist und wundern sich über die schroffen, wenig informativen Antworten. Die Einheimischen wollen nicht erinnert werden an das, was gewesen ist. Es ist lange her und man redet nicht darüber. Es ist nicht zeitgemäß, laut von einem Fluch zu sprechen, doch viele, auch die Jüngeren glauben, dass auf dem Hof und seiner nächsten Umgebung einer liegt.
Der alte Brandhuber hauste dort lange allein und die Einsamkeit hat ihn verschlossen und sonderbar gemacht, doch das war er wohl irgendwie schon immer. Sprach man ihn im Dorf an, antwortete er mit einem Brummen oder Knurren, je nach Laune. Irgendwann wurde er nicht mehr beachtet. So wandelte er jahrelang wie ein unsichtbarer Geist durch die Gegend. Die meiste Zeit verbrachte er ohnehin auf seinem Hof. Er wirtschaftete nur für den eigenen bescheidenen Bedarf und so erübrigte sich jeglicher Kontakt zu Nachbarn und Dorfbewohnern.
Seine Gattin ist in jungen Jahren verstorben, niemand erfuhr jemals woran. Sie war eine freundliche und immer lustige Frau, die mit nicht zu bremsender Tatkraft die täglichen Arbeiten zwischen Küche und Stall verrichtete und das Brummen ihres Mannes nicht beachtet oder höchstens belächelt hat. Eines Tages mühte sich ein viel zu moderner Krankenwagen den holperigen Weg zum Hof hinauf. Der Brandhuber verrichtete jede Arbeit bis zum Schluss mit seinem Pferdefuhrwerk selbst als alle anderen schon Autos und Traktoren hatten. Die Brandhuberin wurde auf Veranlassen des alten Doktor Wanger ins Krankenhaus in die Stadt gebracht. Sie war noch jung gewesen, vielleicht Anfang vierzig, ist aber nie mehr zurückgekommen. Der Arzt verstarb kurz darauf selbst und von dem kauzigen Bauern hat niemand etwas erfahren. Bei einem seiner seltenen Besuche im einzigen Wirtshaus des Ortes konnte man zwischen dem Knurren vielleicht so etwas wie ‚Pfuscher‘ oder ‚totgedoktort‘ hören und trotz seiner verschlossenen Art waren sich die Dorfbewohner sicher, dass er um seine Frau getrauert hat.
Thomas, der Sohn, war damals zehn Jahre alt gewesen. Man erzählte sich, dass die Brandhuberin mehrmals schwanger war, aber nur diesen einen Jungen zur Welt bringen konnte. Weiter wurde gemunkelt, dass sie an den Komplikationen einer Schwangerschaft gestorben ist. Der Junge, in der Schule als lebhaft bekannt, wurde nach dem Tod seiner Mutter sehr verbissen. Oft erzählte er von den täglichen Streitigkeiten mit dem Vater, und dass er weggehen würde, sobald er könnte. Aus dem verbissenen Kind wurde ein zorniger junger Mann, der den Hof nach einer der vielen Auseinandersetzungen tatsächlich verließ. Er ergriff die Gelegenheit, nach dem Abschluss der Schule eine Ausbildung in der Stadt anzufangen. Seitdem hat keiner von ihm gehört. Dem knurrenden Alten ging jeder bei seinen glücklicherweise seltenen Besuchen im Ort aus dem Weg. Er hätte ohnehin nichts von seinem abtrünnigen Sohn erzählt. Eines musste man dem Alten lassen: Er redete nie viel und schon gar nichts Schlechtes - über niemanden. In den letzten Jahren kam er seltener. Der Pfarrer betrachtete es als seine Pflicht, alle paar Wochen nach ihm zu sehen, auch wenn der Brandhuber niemals ein fleißiger Kirchgänger war. Er brachte ihm Kuchen oder ein Päckchen Kaffee, Salz oder Tabak mit. Zur Beerdigung kam weder sein Sohn noch jemand aus dem Dorf. Eine alte, schwarz gekleidete Frau, die zufällig zur selben Zeit die Ruhestatt ihrer Angehörigen pflegte, blieb während der kurzen Ansprache des Pfarrers andächtig stehen. Der Brandhuber wurde an einem wunderschönen, sonnigen Frühsommertag zu Grabe getragen, als ob der Himmel daran erinnern wollte, dass er trotz allem kein schlechter Mensch gewesen war. Der Hof stand dann lange Zeit leer.
~Thomas~
Es sind drei Jahre seit dem Tod des Alten vergangen, als Thomas unangemeldet vor der Tür des Bürgermeisters steht und nach dem Schlüssel zum Hof fragt. Die Angelegenheit wurde wegen mangelnder Erben und sonstiger Interessenten ruhen gelassen. Der Gemeinde wird in solchen Situationen die Aufsichtspflicht übertragen.
Von da an kommt der junge Brandhuber jedes Wochenende. Erst allein, bald in Begleitung einer Frau. Jeden Freitagabend fahren sie den Berg hinauf in ihrem dunkelroten VW-Bus. Aus dem schlaksigen, zornigen Jungen ist ein ruhiger, besonnen wirkender Mann geworden. Zu ruhig, wie die Dorfbewohner bedauern, die gerne mit ihm ins Gespräch gekommen wären. Vermutlich wissen die beiden gar nicht, dass sie das Hauptgespräch der Gemeinde sind. Dass die jungen Leute ihre Heimat verlassen und nur zu seltenen kurzen Besuchen zu den Angehörigen zurückkehren, ist man gewohnt. Dass jemand, der so lange weg war - es waren wohl an die fünfzehn Jahre und Thomas muss inzwischen über dreißig sein - zurückkommt, das ist ungewöhnlich. Man versucht bei jeder Gelegenheit Kontakt aufzunehmen, um sie auszuhorchen, doch beide sind nicht sonderlich gesprächig. Es entgeht auch so niemanden, dass sie den Hof herrichten. Sie hätten sich aber viel lieber mit Thomas ausgiebig darüber unterhalten. Will er wirklich dort oben leben? Es ist nicht nur seine Schweigsamkeit, er ist nicht mehr der vertraute Junge von früher, er war lange weg und ist ihnen fremd geworden. Thomas ist nicht unfreundlich, nicht brummig, aber schweigsam wie sein Vater. Der Junge wirkt reif und erweckt den Eindruck, als ob er genau weiß, was er will. Doch diese Berghöfe sind kaum gewinnbringend zu bewirtschaften und es wäre nicht der Erste, der nach dem Wegsterben der alten Generation leer steht oder nur im Sommer genutzt wird. Die Lebensqualität verbesserte sich schon zur Zeit des alten Brandhubers im bescheidenen Rahmen, die Gemeinde legte Strom hinauf und die Schotterstraßen werden gut instandgehalten, im Winter sogar geräumt, trotzdem ist das Leben sehr einfach und für Stadtmenschen vermutlich viel zu einsam. So bleiben die Leute skeptisch.
Als die Telefongesellschaft den Hof durch eine Leitung mit der Zivilisation verbindet, sind die Zweifel wie weggewischt. Als sich ein Möbeltransporter die enge Schotterstraße hinauf quält, kommt die Skepsis zurück. Nun haben sie zwei neue Mitglieder in ihrer Gemeinschaft und außer seiner Abstammung weiß niemand etwas über ihn und schon gar nichts über seine Frau. Oft bekommen sie das junge Paar auch weiterhin nicht zu Gesicht. Erst ist sicherlich viel zu tun, doch auch später leben die beiden sehr zurückgezogen. Thomas Brandhuber trifft man manchmal auf dem Markt oder wenn er beim Metzger oder bei einem der Bauern seine Kälber verkauft. Seine Frau kommt in unregelmäßigen Abständen mit dem klapprigen VW-Bus ins Dorf, um die wenigen Dinge zu kaufen, die sie nicht selbst erzeugen können. Sie ist schweigsam und immer seltsam abwesend. Wenn sie einen Menschen wahrnimmt, dies geschieht ganz plötzlich und ohne ersichtlichen Grund, beschenkt sie denjenigen mit einem strahlenden und herzlichen Lächeln. Der jeweils Beglückte ist darüber so erstaunt, dass es auch bei dieser Gelegenheit zu keinem Gespräch kommt. Es ist normal, dass in kleinen Ortschaften wenig vorteilhaft über Außenseiter geredet wird, doch wer von der jungen Brandhuberin angelächelt wurde, fängt an, sie gegenüber den anderen zu verteidigen, auch wenn er weiterhin nichts über sie weiß. Und schließlich wird sie in ihrer freundlichen Sonderlichkeit akzeptiert.
Erst wird gemunkelt, dann ist es nicht mehr zu übersehen, die Brandhuberin ist schwanger. Lange kommt sie trotzdem regelmäßig, um ihre Einkäufe zu erledigen. Dann sieht man wochenlang nur Thomas, bis wieder Gerede aufkommt. Dieses Mal über den Verbleib von Mutter und Kind. Endlich wagt es jemand, den jungen Brandhuber darauf anzusprechen und der erzählt mit einem stolzen Grinsen, es sei längst da und auf dem Hof und Rosalinde viel zu beschäftigt, um die Einkäufe zu erledigen. Dann kommen Thomas und seine Frau abwechselnd, doch das Gerede will nicht aufhören, denn das Kind hat immer noch niemand gesehen. Keiner hat so engen Kontakt zu den jungen Leuten, um sie auf dem Hof zu besuchen und zu fragen traut sich auch niemand. Wenn mit dem Kind etwas geschehen ist, würde die Frage nur Unannehmlichkeiten nach sich ziehen. So verhält man sich zurückhaltend, wachsam, beobachtend und fühlt sich bei jeder der wenigen Begegnungen unangenehm an das ungewisse Schicksal des Kindes erinnert. In dieser Zeit steht das Schweigen auf beiden Seiten wie eine unüberwindbare Mauer.
~Das Mädchen~
Viele haben das Kind und den ganzen Vorfall schon vergessen. Seit Generationen ist man daran gewöhnt, Schicksalsschläge mit ländlichem Gleichmut hinzunehmen. Nicht, dass die Bewohner gefühllos sind, es ist vielmehr die Gewissheit, dass gegen diese Macht, die ohnehin Vorbestimmung ist, keiner etwas ausrichten kann. Man erträgt die Schläge und lächelt kaum merklich in sich hinein, wenn einmal etwas Gutes geschieht. Daher erstarrt die alltägliche Szene in und um das kleine Lebensmittelgeschäft für Sekunden, als neben der jungen Frau Brandhuber ein dunkelhaariges, inzwischen sicherlich zweijähriges Mädchen aus dem Auto springt und sich neugierig umsieht. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer und im Nachhinein hält es jeder für selbstverständlich, dass man mit einem Säugling nicht die gefährliche, kurvige Straße hinunterfährt. Die beiden jungen Leute haben das Misstrauen gespürt, konnten es sich allerdings nicht erklären und kümmerten sich nicht weiter darum. Das Aufeinandertreffen verläuft wieder entspannter. Die Dorfbewohner sehen das Kind heranwachsen und über das Mädchen kommt man mit der Mutter das eine oder andere Mal ins Gespräch. Nicht dass die junge Frau redseliger geworden ist, doch sie antwortet höflich auf Fragen und erzählt ein wenig von dem Leben der kleinen Familie. In der altbäuerlichen Gemeinde gilt dies als angemessener Kontakt.
Zur nächsten Verstimmung kommt es erst wieder, als Verona eingeschult wird. Jeden Morgen muss sie einen Fußmarsch von über einer Stunde ertragen. Bei der heftigen und übereifrigen Kritik bleibt unbeachtet, dass auch von den anderen Berghöfen die Kinder zur Schule kommen. Der Hof der Brandhubers ist der einzige, der direkt über dem Ort liegt. Die anderen Kinder gehen nach unten zur Hauptstraße, wo sie von einem Schulbus aufgesammelt werden. Veronas Abstieg bringt sie direkt ins Dorf. Allerdings gibt es auf den meisten Höfen mehrere Kinder, die gemeinsam den Weg zurücklegen. Das Mädchen kommt allein. Im Winter sieht man sie schon von weit oben oder vielmehr ihre dicke rote Wolljacke, die sich die Serpentinen herunter arbeitet, zeitweise hinter Bäumen verschwindet, um mit rosigen Backen zur Schule zu marschieren. Im Sommer läuft sie geradewegs durch den Wald den Hang hinunter. Egal wie, es ist Grund genug für einige Eltern, die Situation lautstark als nicht zeitgemäß anzuprangern.
Thomas hat zwei Kälber zum Metzger herunter getrieben und wartet vor der Schule auf seine Tochter. Hinter Verona kommt der Klassenlehrer auf ihn zugelaufen. „Herr Brandhuber, kann ich Sie kurz sprechen?“ - „Was gibt es denn? Hat Verona etwas angestellt?“ - „Nein. Kommen Sie bitte herein. Es dauert nicht lange.“ Thomas wird unruhig. „Können wir das nicht hier besprechen? Ich würde gerne wieder hinauf zum Hof.“ Der Lehrer sieht zum Schulhaus zurück, als würde er sich von dort Unterstützung erwarten und tritt nervös von einem Fuß auf den anderen. „Wissen Sie, es ist so. Einige Mütter von Veronas Klassenkameraden haben mich angesprochen, dass sie das Mädchen während der Woche gerne bei sich aufnehmen würden, da der Weg für die Kleine sehr anstrengend ist. Das würde Ihnen gar nichts kosten und Ihre Tochter hätte mehr Kontakt zu den anderen Kindern.“ Thomas Gesicht verfinstert sich. Er schweigt nachdenklich, starrt dabei den Lehrer unverwandt an, dieser wird noch nervöser. Dann beugt er sich zu seiner Tochter hinab. „Wenn du gerne während der Woche im Dorf bleiben möchtest, dann finde ich das in Ordnung und auch Mama würde ich es irgendwie erklären. Was meinst du?“ Das Mädchen sieht unsicher zu ihrem Lehrer auf. Seit Tagen redeten viele Erwachsene in der Schule auf sie ein. ‚Sie hätte es viel besser im Dorf. Sie könnte bei ihren Klassenkameraden bleiben und nach der Schule mit ihnen spielen. Es wäre viel lustiger als dort oben auf dem einsamen Hof‘. Das Mädchen hat nie darauf reagiert und ging unbeirrt nach der Schule hinauf. Oben hatte sie alles vergessen und ihren Eltern nichts erzählt. Nun blickt sie ängstlich zu ihrem Vater. „Darf ich bei euch bleiben?“ Thomas lächelt. „Genau das würden sich deine Mutter und ich wünschen.“ Er sieht kurz zum grauverhangenen Himmel hinauf. „Na komm, lass uns gehen, bevor es zu regnen anfängt.“ Thomas dreht sich im Fortgehen zum Lehrer um und streift ihn mit einem Blick, der unmissverständlich sagt, dass er keine weitere Beeinflussung seiner Tochter wünscht.
Damit verstummen die Kritiken. Veronas schulische Leistungen sind gut und ihr zurückhaltendes Wesen wird von vielen ohnehin für Höflichkeit gehalten. Das Mädchen verhält sich nicht auffällig, wirkt gesund und manchmal sogar munter. Es gibt keinen haltbaren Grund für weitere Einwände. Zu Theresa Müller, einem Mädchen aus ihrer Klasse, entwickelt sich eine engere Freundschaft und sie bleibt an manchen Nachmittagen im Dorf, um zusammen mit ihrer neuen Freundin die Hausaufgaben zu machen. Immer noch gibt es Misstrauische, die die beiden beobachten, wenn sie im Garten spielen, doch das Kind verhält sich absolut normal und so akzeptiert die Dorfgemeinschaft die Situation, wenn auch mit Murren. Bei keiner der alteingesessenen Familien hätte man gewagt, sich derart einzumischen. Es ist ungewöhnlich, dass es wegen einem kleinen Mädchen zu einem fast revolutionären Verhalten kam, wo man gewohnt ist, die Dinge auszusitzen, abzuwarten, um dann, wenn ein Unglück geschieht, laut zu bekunden, dass man es von Anfang an gewusst hätte.
Verona und Theresa kümmern sich nicht um diese Unstimmigkeiten, bemerken sie vermutlich nicht einmal. Sie sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Mit sich und der Welt, die es zu entdecken gibt. Man sieht sie von der Schule zum Haus der Müllers laufen. Theresa, die vorauseilt, hier und dort hinrennt, Dinge entdeckt und dies lautstark verkündet, Leute anspricht und allerlei erzählt. Verona, die hinterherkommt, langsam, bedächtig, alles aufmerksam beobachtend. Auch sie bleibt stehen, um etwas genauer zu betrachten, einen Käfer, der einen Ast hinauf läuft, den Wind, den sie auf ihren Wangen spürt und nachlauscht. Sie lächelt dann und blickt sich um, weil sie sicher ist, dass alle es bemerken müssen, aber sie sieht nur Theresa weit voraus rennen, sich umdrehen und ungeduldig winken. Schon in dieser Zeit fühlt sich so mancher von dem Kind unangenehm überwacht, wenn sie vor ihnen stehen bleibt und sie bei ihren Tätigkeiten beobachtet. Manch einer wird sogar ungehalten und fährt es an, ‚was es zu schauen gäbe’, auch wenn sie sich im Nachhinein darüber ärgern, da es doch nur ein kleines Mädchen ist.
Als die beiden in das Alter kommen, in dem Mädchen stundenlang tausend Dinge miteinander besprechen, übernachtet Verona oft bei den Müllers. Und Theresa hat viel mit ihrer Freundin zu bereden. All die Dinge, von denen sie behauptet, man kann sie nicht mit den Eltern besprechen. „Die haben dafür überhaupt kein Verständnis“, sagt sie und schüttelt ernst den Kopf. Dann verzieht sich ihr Mund zu einem geheimnisvollen Lächeln. „Hast du gesehen, wie dich Sebastian heute ansah? Es fehlte nicht viel und er hätte dich angesprochen. Was hältst du von ihm? Der ist süß, oder?“ Verona zögert. „Ich weiß nicht. Und was soll ich mit dem reden?“ - „Reden? Du sollst mit ihm nicht reden, das ist ein Junge, mit denen redet man nicht.“ Verona verzieht das Gesicht, als ob sie etwas sehr Saures gegessen hätte. „Ach Verona“, seufzt ihre Freundin und schüttelt den Kopf, „manchmal bist du schon komisch.“