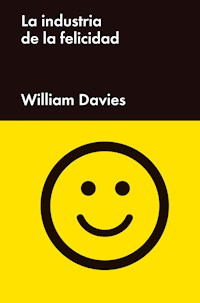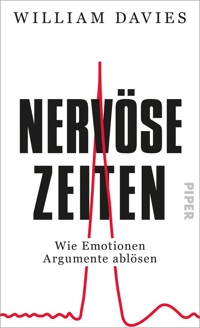
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir befinden uns in einer neuen politischen Ära, die viele ratlos zurücklässt: Wo bisher Zahlen, Daten und Expertisen Grundlage politischer Entscheidungen waren, sind nun Emotionen Trumpf. Ob Donald Trump in den USA, der Front National in Frankreich oder die AfD in Deutschland – überall greifen Populisten die Ängste der Menschen auf und sind mit ihren gefährlichen Ideologien auf Erfolgskurs. Doch wie konnte es dazu kommen, dass statt objektiver Größen wie Arbeitslosenzahlen oder Wirtschaftswachstum plötzlich Wut und Angst über unsere Zukunft entscheiden? William Davies erklärt unter Einbeziehung ökonomischer, philosophischer und politischer Theorien, wie es zum »Niedergang der Vernunft« und dem »Siegeszug der Gefühle« kommen konnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Martha
Aus dem Englischen von Ursel Schäfer und Enrico Heinemann
© William Davies 2018
Die Originalausgabe erschien 2018 in Großbritannien unter dem Titel »Nervous States. How Feeling Took Over the World« bei Jonathan Cape.
© Piper Verlag GmbH, München 2019
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Inhalt
Cover & Impressum
Einführung
Teil I
Der Niedergang der Vernunft
1. Demokratie der Gefühle
Das neue Zeitalter der Massen
Ansammlungen von Körpern
Politik als Virus
Waffen des Alltags
Nicht in meinem Namen!
2. Wissen für den Frieden
Die Geburt des Expertenwissens
Das Entrinnen aus dem Krieg
Die Welt abbilden
Frieden um jeden Preis
Die Verbindlichkeit der Fakten
Die ersten Technokraten
Die Gewalt von Experten?
3. Fragwürdiger Fortschritt
Gefühle jenseits der Statistik
Darstellungen der Gesellschaft
Das Maß des Fortschritts
Wie die gesellschaftliche und die wirtschaftliche Realität auseinanderfallen
Das Problem der Intensität
Noch einmal mit Gefühl
Die Blindheit der Fakten
4. Der politische Körper
Fühlen jenseits der Medizin
Unter der Haut
Fragwürdiger physischer Fortschritt
Psychosomatische Politik
Das Symptom behandeln
Die Kontrolle zurückgewinnen
Ohnmacht als Verletzung
Auf der Suche nach Empathie
Teil II
Der Siegeszug der Gefühle
5. Wissen für den Krieg
Geheimhaltung, Stimmungen und Nachrichten in Echtzeit
Die Massen mobilisieren
Von »Fakten« zu »nachrichtendienstlichen Informationen«
Die Nase überflügelt das Auge
Die Sprache des Körpers
Leiden kollektivieren
Vom Konsens zur Koordination
6. Ratespiele
Stimmungen am Markt und der Preis des Wissens
Der Krieger-Unternehmer
Nützliches Wissen
Gegen Experten
Wissen in Echtzeit
Überleben des Wahrsten
7. Krieg der Worte
Von »Fakten« zu »Daten«
Der physische Geist
Den Geist zur Waffe machen
Zwischen Geist und Welt
Von der Naturwissenschaft zur Datenwissenschaft
Das Streben nach Krieg mit anderen Mitteln
Sabotagemacht
Daten von der Masse abschöpfen
8. Zwischen Krieg und Frieden
Der neuen Gewalt Widerstand leisten
Die Natur wird politisch
Fakten allein werden uns nicht retten
Der Wunsch nach Krieg
Den Krieg verlagern
Versprechen abgeben
Institutionelle Innovationen
Gewaltlosigkeit
Danksagung
Anmerkungen
Einführung
An einem Spätnachmittag, einem Freitag im November 2017, wurde die Polizei zur Londoner U-Bahn-Station Oxford Circus beordert, aus »terrorbezogenen« Gründen, wie es hieß. Bei der Evakuierung entstand ein Gedränge, als die Menschen zu den Ausgängen eilten. Berichte von Schüssen kursierten. Im Internet tauchten Bilder und Videos fliehender Menschenmassen auf, denen schwer bewaffnete Polizeibeamte entgegeneilten. Augenzeugen berichteten von Schreien und Chaos, als sich Passanten in Ladengeschäften in Sicherheit zu bringen versuchten.
Inmitten der Panik blieb unklar, woher genau die Bedrohung kam oder ob gleichzeitig mehrere Anschläge stattgefunden hatten, wie zwei Jahre zuvor in Paris. Bewaffnete Polizisten stürmten in die Filiale der Kaufhauskette Selfridges, während die Ladenbesucher Anweisung zur Evakuierung erhielten, unter ihnen der Popsänger Olly Murs. »Alle nichts wie raus aus Selfridges«, tweetete er seinen acht Millionen Followern, »jetzt wird geschossen!!« Während Kunden zu den Ausgängen stürzten, sorgten von draußen hereinstürmende Passanten für Panik.
Dank Smartphones und den sozialen Medien wurde dieses gesamte Geschehen aufgezeichnet, geteilt und in Echtzeit diskutiert. Während die Polizei die Panik über ihren Twitter-Feed zu entschärfen versuchte, griff das Chaos durch die alarmierten Reaktionen weiterer Beobachter immer stärker um sich. »Sieht nach einem weiteren Dschihad-Anschlag in London aus«, twitterte Tommy Robinson, der ehemalige Führer der ultrarechten English Defence League. Die Online-Ausgabe der Daily Mail nahm einen belanglosen Tweet von zehn Tagen zuvor, wonach »ein Lieferwagen auf einem Bürgersteig in der Oxford Street zum Stehen gekommen« sei, unerklärlicherweise zur Grundlage für den Tweet: »›Schüsse abgefeuert‹, als bewaffnete Polizisten die U-Bahn-Station Oxford Circus umzingeln, nachdem ›Lieferwagen in Fußgänger rast‹.« Anders als in der Hochphase der Presse berichteten die Medien weniger über Fakten, sondern trugen vielmehr dazu bei, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit und Emotionen wechselseitig hochschaukelten.
Eine Stunde nach Evakuierung des Oxford Circus gab die Polizei eine Erklärung ab, wonach sie »bislang keine Spur eines Verdächtigen, Hinweise auf Schüsse oder Opfer ausgemacht« habe. Später sollte bekannt werden, dass sich neun Verletzte der Panik, deren Ursache bis dahin noch unklar war, in Krankenhäusern behandeln lassen mussten. Wenige Minuten darauf tweetete der Betreiber der Londoner U-Bahn, dass die Stationen wieder geöffnet seien und die Züge regulär verkehrten. Wenig später wurde der Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten offiziell beendet. Von Schüssen oder Terroristen fand sich keine Spur.
Was hatte die Panik ausgelöst? Bei der Polizei waren zahlreiche Anrufe von Passanten eingegangen, die Schüsse in der U-Bahn-Station und auf der Straße gemeldet hatten. Sechs Minuten später waren Beamte einsatzbereit vor Ort. Zeugen hatten aber nur ein Handgemenge auf einem überfüllten Bahnsteig während der Rushhour gesehen. Zwei Männer waren aneinandergeraten und hatten ein- oder zweimal mit der Faust zugeschlagen. Wie der akustische Eindruck von Schüssen entstanden war, blieb unklar. Allein der handgreifliche Streit hatte unter den zurückweichenden Passanten ein Gedränge ausgelöst, das sich wie eine aufbrandende Welle den überfüllten Bahnsteig entlang und durch die U-Bahn-Station ausbreitete. In London waren im selben Jahr bereits zwei Terroranschläge geglückt, sieben weitere Versuche hatte die Polizei vereiteln können: gut nachvollziehbar also, wie sich in der Enge eines öffentlichen Raumes wie der U-Bahn-Station Panik ausbreitet.
Aus dem Nichts entstandene Massenpaniken wie diese hatte es schon früher gegeben. 2016 hatte New Yorks JFK-Flughafen einen ähnlichen Zwischenfall erlebt. Twitter-Meldungen, wonach ein »feuernder Schütze« unterwegs sei, hatten in mehreren Terminals für Chaos gesorgt. Eine Erklärung lautete, dass an einer Warteschlange Metallpfosten der Absperrgurte umgerissen worden seien. Die scheppernden Aufschläge auf den Boden hätten sich wie Schüsse angehört. Durch wahnhafte Vorstellungen, verbreitet über die sozialen Medien, hatte sich ein kleiner Zwischenfall oder eine Fehldeutung kraft Übertreibung zu einer akuten Gefahrenlage ausgewachsen.
Nach dem Zwischenfall vom Oxford Circus verlangten örtliche Ladenbesitzer, in umliegenden Straßen ein Lautsprechersystem »wie in Tokio« zu installieren, über das sich die Polizei zeitgleich an die Massen wenden könne. Auch wenn die Idee kaum Befürworter fand, stand hinter ihr die richtige Diagnose. Wenn während rasant ablaufender Ereignisse Emotionen hochschlagen, fehlt plötzlich jede verlässliche Einschätzung der realen Lage. Dieses Fehlen an echtem Wissen lösen im digitalen Zeitalter rasch Gerüchte, Fantasien und Spekulationen ab, von denen manche schnell so zurechtgebogen und übertrieben werden, dass sie ins bevorzugte Narrativ passen. Angst vor Gewalt kann so verheerend wie tatsächliche Gewalt wirken. Hat sie sich erst ausgebreitet, lässt sie sich mitunter nur noch schwer unter Kontrolle bringen.
Tatsächlich ist das Risiko, in London oder New York bei einem Terroranschlag oder einer Massenschießerei umzukommen, statistisch gesehen extrem gering. Diese Art nüchterne und objektive Betrachtung ist für den Betroffenen, der unmittelbar um sein Leben fürchtet, allerdings weder verfügbar noch besonders nützlich. Wenn eine Panik abgeflaut ist, sind Politik, Presse und Experten gefragt, die Tatsachen zum Geschehen aufzuklären. Niemand würde erwarten, dass sie in der Hitze des Augenblicks, wenn Gedränge und Geschrei herrschen, im Einklang mit Fakten handeln. Wo rasche Reaktionen wesentlich sind, kommen Körperinstinkte ins Spiel.
Ereignisse wie diese sind typische Symptome unserer Zeit, in der schnelle Reaktionen über langsamere, umsichtige Bewertungen häufig die Oberhand gewinnen. Wir sind stärker an »Echtzeit«-Erlebnisse und -Medien angepasst und vertrauen so am Ende zwangsläufig Wahrnehmungen und Empfindungen eher als Beweisen. Wissen muss schnell verfügbar und wirksam sein statt nüchtern und objektiv. Und emotionsgeladene Lügen verbreiten sich oft schneller als Fakten. In Situationen physischer Gefahr, wenn Schnelligkeit gefragt ist, sind unmittelbare Reaktionen durchaus sinnvoll. Aber inzwischen haben »Echtzeit«-Daten weit über Sicherheitsbelange hinaus Einfluss gewonnen. Aus den Nachrichten, den Finanzmärkten, über Freunde und bei der Arbeit stürzen in einem nicht abreißenden Strom Informationen auf uns ein, die wir kaum noch distanziert betrachten und zu einem zuverlässigeren Abbild der Wirklichkeit zusammenzusetzen können – mit der Gefahr, dass eigentlich harmlose Situationen als Bedrohung erscheinen und so am Ende tatsächlich zur Gefahr eskalieren.
Die moderne Welt wurde auf zwei grundlegenden Unterscheidungen errichtet, die beide zur Mitte des 17. Jahrhunderts in den Vordergrund rückten: die eine zwischen Geist und Körper sowie die andere zwischen Krieg und Frieden. Schrittweise verlieren beide nun schon seit über hundert Jahren immer mehr an Schärfe. Wie wir noch sehen werden, rückte der Siegeszug von Psychologie und Psychiatrie gegen Ende des 19. Jahrhunderts Geist und Körper enger zueinander, indem sie aufzeigten, dass unsere Gedanken von Nervenimpulsen und Empfindungen beeinflusst werden. Und mit den ersten Luftangriffen Anfang des 20. Jahrhunderts zogen in die Kriegsführung Methoden ein, mit denen sich Zivilbevölkerungen bis weit über die Grenzen des Kampfgeschehens hinaus terrorisieren und kontrollieren lassen.
Diese beiden Unterscheidungen – zwischen Geist und Körper sowie Krieg und Frieden – haben inzwischen offenbar vollständig an Glaubwürdigkeit verloren, mit dem Ergebnis, dass der Krieg inzwischen in unseren Alltag einrückt. Seit den 1990er-Jahren haben rasante Fortschritte in den Neurowissenschaften dem Gehirn gegenüber dem Bewusstsein Vorrang in der Frage verschafft, auf welchem Weg wir hauptsächlich zu einem Verständnis unserer selbst gelangen, indem sie aufzeigten, welche Bedeutung Gefühle und Physiologie für sämtliche Entscheidungsabläufe haben. Inzwischen sind neue Formen von Gewalt aufgetaucht, bei denen nichtstaatliche Gruppen Staaten angreifen oder Staaten ihre Konflikte untereinander mit nichtmilitärischen Mitteln (wie Cyberkrieg) austragen, sodass zwischen Polizeimaßnahme und militärischer Intervention schwerer zu unterscheiden ist. Die Schwemme von Digitaltechnik in der Gesellschaft hat die Unterscheidung erschwert, was zum Geist und was zum Körper gehört, was friedfertiger Dialog und was Konflikt ist. Im verschwimmenden Grenzbereich zwischen Geist und Körper, zwischen Krieg und Frieden stellen sich nervöse Zustände ein: Individuen und Regierungen leben in ständig erhöhter Alarmbereitschaft, in der sie sich immer stärker auf Gefühle als auf Fakten verlassen. Diese Gesamtverfassung zu kartieren und seine Ursprünge auszumachen ist das Anliegen dieses Buchs.
Wenn wir von Gefühlen reden, bezeichnen wir damit zweierlei Dinge: erstens körperliche Empfindungen wie Lust oder Schmerz, die entscheidend dabei mithelfen, dass wir uns in unserer Umwelt zurechtfinden. Unser Nervensystem empfängt aus der Außenwelt Sinnesreize, mit deren Hilfe wir unseren Körper und unsere instinktiven Bewegungen koordinieren. Die Brillanz unseres neurologischen Netzwerks liegt darin, dass es blitzschnell auf neue Informationen zu reagieren vermag, ob sie aus unserer physischen Umgebung oder aus unseren inneren Organen stammen. Unser Gehirn verarbeitet Sinneseindrücke in Höchstgeschwindigkeit und versetzt uns so unter anderem in die Lage, äußere Bedrohungen abzuwehren.[1] Das Gehirn ist seinerseits ein komplexes Sinnesorgan, das mit der Zeit Eindrücke zu organisieren und aus ihnen Muster zu extrahieren lernt. Auch wenn einzelne Sinnesreize noch nicht als Wissen zählen, sind sie ein unverzichtbarer Lieferant von Daten, auf die wir uns fast ständig verlassen.
Zweitens gibt es Gefühle im emotionalen Sinn – als innere Erfahrungen, die wir beständig reflektieren und artikulieren können. Um sie zu benennen und auszudrücken, steht uns ein breit gefächertes Vokabular zur Verfügung. Wir teilen sie körperlich mit unserer Mimik und Körpersprache mit. Und sie verraten uns wichtige Dinge über unsere Beziehungen, Lebensstile, Wünsche und Identitäten. Gefühle dieser Art gelangen in unser Bewusstsein, sodass wir sie wirklich wahrnehmen, auch wenn wir sie nicht unter Kontrolle haben. Heute können sie anhand von Verhaltensdaten, die mit digitaler Technik erfasst werden, aufgezeichnet und algorithmisch analysiert (»Sentimentanalyse«) werden. Und doch sind Gefühle dieser Art nicht überall willkommen. Im öffentlichen Leben beinhaltet der Vorwurf der »Emotionalität« von jeher, dass jemand die Objektivität verloren habe und irrationalen Antrieben freien Lauf lasse.
Gefühle geben uns Orientierung, erinnern uns aber auch an das Mitmenschliche in uns. Unsere Fähigkeit, Liebe und Leid zu empfinden, spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie und warum wir füreinander Sorge tragen. Aber wie die geschilderten Massenpaniken am Oxford Circus und JFK-Flughafen zeigen, sind Überlebensinstinkte und Nerven nicht immer zuverlässige Ratgeber. Die Informationen, die uns Gefühle in der Hitze des Augenblicks liefern, stehen mitunter in starkem Kontrast zu den Fakten, die sich im Nachhinein herausstellen. Durch ihre entscheidende Qualität – ihre Unmittelbarkeit – können Gefühle auch täuschen, Überreaktionen provozieren und Ängste auslösen. Skrupellose Politiker und Geschäftsleute nutzen seit Langem Instinkte und Gefühle dazu aus, uns Dinge weiszumachen oder zu verkaufen, die wir bei sorgfältigerem Nachdenken nicht geglaubt oder erstanden hätten. Echtzeitmedien, verfügbar über Mobilfunktechnik, verschärfen insofern das Problem, als wir uns dem Strom der Bilder und Sinnesreize länger und länger aussetzen, sodass zum Nachdenken und zur nüchternen Analyse immer weniger Zeit bleibt.
Im 17. Jahrhundert präsentierten mehrere europäische Gelehrte Ideen und Vorschläge für Institutionen mit dem Ziel, den Einfluss von Gefühlen zu begrenzen, galten sie ihnen doch als trügerisch und womöglich sogar gefährlich. Der französische Philosoph René Descartes begegnete den äußeren Wahrnehmungen mit besonderem Misstrauen, im Gegensatz zu den rationalen Prinzipien, die zur Sphäre des Bewusstseins gehörten. Der englische Staatstheoretiker Thomas Hobbes sah es als die zentrale Aufgabe des Staats an, Gefühle wechselseitiger Angst auszumerzen, weil sie andernfalls zu Gewaltausbrüchen führten. In eben diesem Zeitalter stellten wegweisende Kreise aus Kaufleuten und Gentlemen strenge neue Regeln dazu auf, wie Äußerungen zu ihren Eindrücken aufgezeichnet und wiedergegeben werden sollten, um Übertreibungen und verzerrten Darstellungen vorzubeugen – mithilfe von Zahlen und öffentlich zugänglichen Protokollen. Zu den herausragenden Kennzeichen dieser »Experten«, wie sie später genannt wurden, zählte ihre Fähigkeit, das persönliche Empfinden von ihren Beobachtungen zu trennen.
In dieser Zeit entstanden die geistigen Bausteine der Moderne. Die gegenwärtigen Vorstellungen von Wahrheit, wissenschaftlicher Expertise, öffentlicher Verwaltung, experimenteller Beweisführung und Fortschritt sind allesamt ein Erbe des 17. Jahrhunderts. Den Verstand über die Gefühle zu setzen erwies sich als ein höchst fruchtbarer Schritt mit faktisch weltverändernden Auswirkungen. Und doch galt das Streben nicht nur dem Wissen, sondern auch dem Frieden. Bis auf den heutigen Tage beruht der Wert von Objektivität im öffentlichen Leben, der sich in Statistiken oder den Wirtschaftswissenschaften niederschlägt, zu einem Großteil darin, dass sie einen Grundkonsens zwischen Menschen bietet, die ohne sie wenig verbinden würde. Wie die deutsche Philosophin Hannah Arendt bemerkte, lassen sich die historischen Wurzeln der »merkwürdigen Leidenschaft« des Abendlands für »Objektivität« bis zu Homers Epen zurückverfolgen, die Kriegsgeschichten von der ganz ungewöhnlichen Warte des unbeteiligten Beobachters aus erzählen.[2] Eine Gesellschaft, welche die Verbindlichkeit von Fakten anerkennt, muss zudem bestimmte Berufe und Institutionen einführen, die sich vom Gewühl der Politik, der Stimmungen oder Meinungen nicht beeinflussen lassen.
Dieses Buch erzählt die Geschichte, wie dieses Projekt aus dem 17. Jahrhundert – mit dem heute erkennbaren Ergebnis – auf Grund gelaufen ist. Experten und Fakten scheinen nicht mehr in der Lage zu sein, Streitigkeiten in der Weise zu schlichten, wie es dereinst gelungen ist. Objektive Äußerungen zu Wirtschaft, Gesellschaft, Körper und Natur des Menschen lassen sich von Emotionen nicht mehr erfolgreich trennen. In 82 Prozent der Länder rund um den Globus spricht weniger als die Hälfte der Bevölkerung den Medien ihr Vertrauen aus. Dies trägt unmittelbar zum wachsenden Zynismus gegenüber Regierungen bei.[3] Die öffentlichen Institutionen der Europäischen Union und von Washington, D. C., gelten als Zentren privilegierter Eliten, die eher sich selbst als der Öffentlichkeit dienen. Solche Einstellungen herrschen oft am stärksten gerade unter den Gemeinschaften vor, die von der Politik dieser Regierungen wirtschaftlich selbst profitieren.
Manche Gefühle sind politisch wirkmächtiger als andere. Sehnsüchte nach der Vergangenheit, Ressentiments, Zorn und Angst haben den Status quo erschüttert. Ein Symptom dafür sind populistische Aufwallungen, wie sie sich in den Wahlsiegen Donald Trumps, der Brexit-Kampagne und einer Woge des Nationalismus quer durch Europa manifestierten, deren Vertreter in der Kritik stehen, Expertenwissen zu verunglimpfen und Emotionen zu schüren. Aber sie sind Symptome, nicht die Ursachen des Problems. Führer und Kampagnen kommen und gehen, während die sie ermöglichenden Verhältnisse bestehen bleiben.
Als Reaktion können wir entweder den Aufgeregtheiten mehr Fakten entgegenhalten oder die zugrunde liegenden Antriebe diagnostizieren. Dieses Buch verfolgt den letztgenannten Weg in der Hoffnung, dass die Ideengeschichte dazu beitragen kann, unsere verwirrende Gegenwart besser zu verstehen. Die dabei genannten Fakten und Zahlen dienen nur als Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit historischen Umbrüchen und deren Deutung, haben aber nie das letzte Wort. Meine Argumentation beinhaltet zwei Teile. Der erste untersucht, wie das Ideal des Expertenwissens im 17. Jahrhundert aufgekommen ist und warum es – insbesondere seit den 1990er-Jahren – an Glaubwürdigkeit verloren hat. Allem voran die wachsende Ungleichheit in der westlichen Welt sorgt dafür, dass von Experten und Technokraten veröffentlichte Fakten die gelebte Realität zahlreicher Menschen schlicht nicht mehr widerspiegeln. Objektive Fortschrittsindikatoren wie das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) übertünchen tiefe Risse innerhalb der Gesellschaft. Entscheidend dabei: Sie sind nicht rein wirtschaftlicher Art, sondern weisen inzwischen auch eine physische und existenzielle Dimension auf. Als prägende Erfahrung der Menschen driften die Verhältnisse bei der Gesundheit, den Lebenserwartungen und mit Blick auf körperliches und seelisches Leid immer weiter auseinander. Wenn der Körper schneller altert und häufiger leidet, wächst Pessimismus am stärksten heran.
Man könnte es dabei belassen und schlicht den Niedergang der modernen Vernunft beklagen, als hätten Emotionen wie barbarische Horden die Zitadelle der Wahrheit erstürmt. Wie es die erbittertsten Verfechter der wissenschaftlichen Rationalität sehen, soll fremden Mächten – Lügnern, Demagogen, der Troll-Armee des Kreml oder den ungebildeten Massen – ein Übermaß an Einfluss zugestanden worden sein, weshalb sie wieder vollständig aus der Politik verdrängt werden müssten. Diese Reaktion blendet eine historische Entwicklung nach der Aufklärung aus, die für die Gestaltung der Welt nicht minder bedeutsam ist und im zweiten Teil dieses Buchs ausgelotet wird: Der Antrieb, Emotionen und Instinkte für politische Zwecke einzuspannen, hat ebenfalls eine lange Geschichte. Auch aus ihm gingen Zentren elitärer Kontrolle hervor, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er eher im Dienst des Krieges als in dem des Friedens operiert. In der Blütezeit der Aufklärung, als die Vernunft endgültig zu triumphieren schien, zeigte die Französische Revolution, welch gewaltige Kraft Stimmungslagen im Volk entfesseln können. Die Fähigkeit, die einfachen Volksmassen zu mobilisieren, war eine Offenbarung, die Napoleon bald für seine Zwecke nutzen sollte.
Die moderne Kriegsführung schafft eine ungesunde Atmosphäre aus Emotionen, Informationen, Desinformation, Täuschung und Geheimhaltung. Sie mobilisiert auf innovative Weise Infrastrukturen, Zivilbevölkerungen, Industrien und Geheimdienste. Die wachsende Bedeutung des Luftkriegs verschärfte das Problem, wie sich die Moral der Zivilbevölkerung aufrechterhalten lässt und wie Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden können. Neue Techniken entstanden, um öffentliche Stimmungen zu beherrschen und aufkommende Bedrohungen vorwegzunehmen. Die einhergehenden Ängste führten zur Entwicklung des Digitalrechners und später des Internets. Der Krieg weist dem Gefühl in beiderlei Wortsinn strategische Bedeutung zu: Die richtigen Stimmungen müssen geschaffen und feindliche Bewegungen und Pläne so schnell wie möglich durchschaut werden. Informationen werden ebenso sehr wegen der Geschwindigkeit ihrer Übertragung wie wegen ihrer öffentlichen Glaubwürdigkeit geschätzt. Diese ganz neue Art des Umgangs mit der Frage nach der Wahrheit läuft dem wissenschaftlichen Ideal von Verstand und Expertise häufig gänzlich zuwider.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts versuchten Nationalisten, die Volksmassen dadurch zu mobilisieren, dass sie Erinnerungen an vergangene und Begeisterung für künftige Kriege beschworen. Aber in jüngerer Zeit stellte sich eine weitere Entwicklung ein, die den Kriegsgeist und eine zunehmende Aggressivität geräuschlos ins zivile Leben einziehen ließ. Die Betonung des »Echtzeit«-Wissens, ursprünglich im Krieg privilegiert, verbreitete sich als Markenzeichen in der Geschäftswelt, insbesondere im Silicon Valley. Die Geschwindigkeit, mit der Erkenntnisse erworben und Entscheidungen getroffen werden, rückt ins Zentrum und schiebt den Konsens beiseite. Anstatt auf Fachleute zu vertrauen, weil sie einen neutralen Standpunkt über dem Schlachtengetümmel einnehmen, verlassen wir uns inzwischen auf Dienste, die schnelle Ergebnisse abwerfen, aber deren öffentlicher Status unklar ist. So stellte eine Umfrage von 2017 beispielsweise fest, dass Menschen eher Suchmaschinen als Redakteuren vertrauen.[4]
Nach dem Versprechen, das erstmals im 17. Jahrhundert abgelegt wurde, versorgt uns Expertise mit einer Darstellung der Realität, auf die wir uns alle verständigen können. Dagegen verspricht die digitale Datenverarbeitung, das Gespür für eine Umwelt im Wandel zu maximieren. Der Zeitfaktor wird zum alles entscheidenden Kriterium. Experten erstellen Fakten; Google, Twitter und Facebook bieten Trends. Wenn der objektive Blick auf die Welt schwindet, ersetzen ihn Eingebungen, in welche Richtung sich die Dinge geradeentwickeln. Dieser nervöse Zustand hält mehr emotionale Reize und Empfänglichkeit bereit, wirkt deswegen aber auch in ruhigen Situationen verunsichernd und störend. Unter Umständen löst er sogar aus dem Nichts heraus Konflikte aus und stiftet Aufruhr. Inzwischen stellt sich in unseren Hinterköpfen ständig die Frage, wer wohl diese oder jene Stimmung schürt und warum.
Die größte von dieser Situation ausgehende Gefahr hat bereits Hobbes im 17. Jahrhundert ausgemacht. Wenn Menschen sich unsicher fühlen, spielt es keine Rolle, ob objektiv Sicherheit herrscht oder nicht: Am Ende nehmen sie die Dinge in die eigene Hand. Den Menschen zu sagen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, hilft nur begrenzt, wenn sie sich bedroht fühlen. Deswegen müssen wir Gefühle politisch ernst nehmen, anstatt sie als irrational abzutun. Gefühle haben die individuelle und die kollektive Welt erobert. Wir müssen nicht die Sprache des »Kulturkampfs« sprechen oder eine aggressive Rhetorik wählen, um anzuerkennen, dass zunehmend quasimilitaristische Begriffe die Politik und ihre Ansätze bestimmen. Die politische Aufgabe besteht darin, uns auf einem Weg voranzutasten, der zu weniger paranoiden Mitteln im Umgang miteinander führt.
Populismus ist eine Bedrohung, bietet aber auch Chancen. Welcher Art? Wie meine Untersuchung zeigen wird, entspringen viele Kräfte, die heutige Demokratien verändern, aus Regungen der menschlichen Natur, die jenseits von Fakten tief in unserer Psyche und unserem Körper verankert sind: körperliche Leiden, Zukunftsängste, ein Gefühl für die eigene Sterblichkeit sowie das Bedürfnis nach Fürsorge und Schutz. Diese menschlichen Züge mögen etwas düster, ja, erschreckend anmuten, sind uns aber dennoch allen gemein. Wenn es schwieriger wird, über Fakten und Aussagen von Experten breiten Konsens zu erzielen, müssen wir tiefer in unserer Gefühlswelt und Psyche graben, um auf eine gemeinsame Welt zu stoßen. Wenn diejenigen, die dem Frieden verpflichtet sind, sich diesem Graben verweigern, springen die anderen, die auf Krieg aus sind, mit Begeisterung ein.
Demokratien ändern sich durch die Kraft der Gefühle in Richtungen, die weder ignoriert noch umgekehrt werden können. Dies ist heute Realität. Wir können Geschichte weder rückgängig machen noch sie ignorieren. Wir müssen die gegenwärtige Ära mit besonderer Urteilskraft und Sorgfalt durchschreiten. Anstatt den Einfluss der Gefühle in der heutigen Gesellschaft zu geißeln, tun wir besser daran, zuzuhören und aus diesen Empfindungen zu lernen. Anstatt zu beklagen, dass sich in der Politik Emotionen breitmachen, müssen wir die Fähigkeit von Demokratie wertschätzen, Ängsten, Kummer und Besorgnissen eine Stimme zu geben, die sonst in weitaus destruktivere Bahnen gerieten. Wenn wir durch die neuen nervösen Zeiten navigieren und jenseits von ihnen etwas Stabileres wiederentdecken wollen, müssen wir sie vor allem verstehen.
Teil I
Der Niedergang der Vernunft
1. Demokratie der Gefühle
Das neue Zeitalter der Massen
Donald J. Trumps Präsidentschaft begann mit dem Streit um eine Zahl: die der Menschen, die an seiner Amtseinführung teilgenommen hatten. Am fraglichen Abend veröffentlichte die New York Times eine Schätzung, wonach die Menge nur ein Drittel so groß gewesen sei wie 2009 bei Obamas Festakt, die manche auf 1,8 Millionen Menschen veranschlagt hatten. Luftaufnahmen der Menge von 2017 schienen dies zu bestätigen: Sie zeigten auf der National Mall deutlich größere menschenleere Areale als damals. Zu diesem Anlass hielt Sean Spicer, der damalige Pressesprecher des Weißen Hauses, die erste von zahlreichen weiteren außerordentlichen Pressekonferenzen ab, in der er den Medien vorwarf, sie versuchten, die »gewaltige Unterstützung kleinzureden«, die Trump hinter sich geschart hatte. Tatsächlich sei die Menge »das größte Publikum gewesen, das jemals einer Amtseinführung beigewohnt hat. Punkt.« Am selben Tag informierte Trump die Teilnehmer einer Sitzung im CIA-Hauptquartier, dass die Menge zwischen 1 und 1,5 Millionen Menschen umfasst habe.
Auf Spicer prasselte aus verschiedenen Ecken von Presse und sozialen Medien Spott hernieder, nicht zuletzt, weil er in der Manier des plumpen Propagandisten, der die Parteilinie herunterbetet, keine Fragen des Pressekorps zugelassen hatte. Als Reaktion versteifte sich das Weiße Haus allerdings nur auf seine Linie mit so manchen verblüffend neuen philosophischen Rechtfertigungen. Trumps Beraterin Kellyanne Conway leugnete entschieden, dass Spicer gelogen habe. Er habe nur »alternative Fakten« zu denen geäußert, an die die Journalisten glaubten. Auf einer weiteren Pressekonferenz am nächsten Tag sagte Spicer: »Manchmal können wir den Fakten nicht zustimmen.« Binnen 72 Stunden nach Trumps Amtseid war deutlich geworden, dass das Weiße Haus Grundkriterien für Wahrheit außer Kraft gesetzt hatte.
Der Schlagabtausch mit den Medien gab Trump offenbar Auftrieb und erneute Gelegenheit, die moralischen und emotionalen Schachzüge einzusetzen, die sich im Verlauf seines Wahlkampfs als so effizient erwiesen hatten. Er erblickte in den offenkundig sachlichen Feststellungen der Medien zur Größe der Menschenmengen Ungerechtigkeit, Elitismus und Verfolgung. »Sie würdigen mich auf unfaire Weise herab«, beschwerte er sich Tage später bei einem Interviewer von ABC News und führte ihn zu einer Fotografie an der Wand, die die gewaltige Größe der Massen bei der Amtseinführung angeblich aus einem besseren Blickwinkel zeigte. »Ich nenne es ein Meer der Liebe«, sagte er und deutete auf das Foto. »Diese Leute sind aus allen Teilen des Landes – vielleicht der Welt – angereist, schwierig für sie herzukommen. Und sie liebten, was ich zu sagen hatte.« Für Trump drehte sich der Streit nicht mehr um »Fakten«. Es war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Emotionen: dem arroganten Spott seiner Kritiker und der Liebe seiner Unterstützer. Zumindest darin hatte er recht.
Zu den Menschenmengen bei Amtseinführungen von Präsidenten gibt es keine offiziellen Daten. Der National Park Service veröffentlicht keine eigenen Schätzungen mehr, seitdem er 1995 in eine Kontroverse über die Größenordnung des »Million Man March« geraten war, zu dem afroamerikanische Männer nach Washington angereist waren. Die Behörde hatte die Teilnehmerzahl damals auf 400 000 geschätzt, was (aus offensichtlichen Gründen) den Erfolg der Kundgebung etwas in Zweifel gezogen hatte. Wegen der politischen Brisanz, die solche Themen umgibt, beteiligte sie sich anschließend nicht mehr an solchen Hochrechnungen.
Auch ohne Politik sind Größen von Menschenmengen Gegenstand völlig unterschiedlicher Schätzungen: Die angegebenen Zahlen zur Menge, die zur Hochzeit von Prinz William und Kate 2011 in London zusammenströmte, schwankten zwischen 500 000 und über einer Million Menschen. Aufnahmen von Satelliten und Ballons mit angepasster Technik, die einst zum Ausspionieren des sowjetischen Waffenarsenals entwickelt worden war, lieferten stets die zuverlässigsten Angaben, haben aber Defizite. Satellitenbilder sind ungenau, wenn Wolken im Weg sind oder die Schatten von Menschen oder die Farbe des Untergrunds über die tatsächliche Dichte der Menge hinwegtäuschen.
Als eines ihrer entscheidenden Merkmale erscheinen Menschenansammlungen je nachdem, von wo aus man sie sieht, in Größe und Dichte radikal unterschiedlich. Zweifellos hat Trump tatsächlich eine dicht gedrängte Menge erblickt, die bis weit in die Ferne reichte, als er am fraglichen Tag vor dem Kapitol als frisch vereidigter US-Präsident seine Ansprache hielt. So hat es wohl ausgesehen. Vielleicht dachte er, dass ihm die Journalisten zustimmen würden, hätten sie nur seinen Blickwinkel gehabt. Auch wenn Organisatoren von Märschen und Protestveranstaltungen aus strategischen Gründen dazu neigen, Teilnehmerzahlen überhöht anzugeben, erscheinen Menschenmengen (auch dem Gefühl nach) den Beteiligten immer deutlich größer als Außenstehenden. Es mag eine Art optische Täuschung sein, hinter der nicht unbedingt Unehrlichkeit geargwöhnt werden muss.
Mit der Verbreitung von Smartphones im städtischen Raum werden zusätzliche Daten verfügbar, anhand derer sich die augenblicklichen Bewegungen von Massen einschätzen lassen. Aber solche Einschätzungen sind nicht exakt dasselbe, als mit einer abschließenden Zahl aufzuwarten. Man kann die Anzahl der Mobiltelefonsignale an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit ermitteln oder städtische Infrastruktur (wie Straßenlaternen) mit intelligenten Sensoren ausstatten, gewinnt dann aber nur Datensätze, die von Natur aus fließend sind. Auch wenn sich aus diesen die Wellen an Aktivitäten und Bewegungen gut herauslesen lassen – wozu solche Konzepte der »Smart City« üblicherweise auch dienen sollen –, sind Menschenansammlungen naturgemäß noch immer schwer objektiv erfassbar.
So absurd Trumps, Spicers und Conways Äußerungen auch geklungen haben, durchaus aufschlussreich ist, dass sich der Streit um die Amtseinführung gerade an diesem Detail entzündete: an einer Frage von großer emotionaler Bedeutung, bei der aber Experten relativ machtlos sind, um Differenzen auszuräumen. Menschenmengen widersetzen sich nicht nur wissenschaftlichen Beobachtungs- und Messtechniken. Zu viele Stimmen wenden sich dagegen, Massen auf diese Art zu bestimmen, auch die Organisatoren, Redner und Teilnehmer großer Kundgebungen wollen das nicht. Eine neutrale, objektive Perspektive ist daher schwierig zu erreichen und zu vertreten.
Öffentliche Versammlungen sind so alt wie die Politik, haben aber seit der globalen Finanzkrise von 2007 bis 2009 insbesondere im linken Spektrum ganz neue Bedeutung erlangt. Die Occupy-Bewegung, die sich 2011 aus Protest gegen die Banken formierte, erkor die öffentliche Versammlung zu ihrem politischen Hauptzweck, griff zur nüchternen Sprache der Statistik und machte mit dem berühmten identitätsstiftenden Slogan »Wir sind die 99 Prozent« mobil. Linke Führer wie Alexis Tsipras in Griechenland, Pablo Iglesias in Spanien und Jeremy Corbyn in Großbritannien setzten politisch wieder verstärkt auf die Fähigkeit, Menschenmassen auf öffentlichen Plätzen zusammenzuscharen. Auch hier ruft die Größe von Versammlungen bei Unterstützern wie Gegnern eine Reihe emotionaler Reaktionen hervor: Übertreibung, Spott, Mitleid, Desinformation, Hoffnung und Ressentiments. Corbyns Unterstützer beschwerten sich häufig darüber, dass die etablierten Medien über seine Veranstaltungen trotz deren augenscheinlich gewaltiger Größe nicht in angemessener Breite berichteten.
Aber noch einmal: Nach welchem Maßstab lässt sich die Bedeutung einer Menschenmenge einschätzen? Wie groß muss eine Versammlung sein, damit sie als berichtenswert gilt? Auf Twitter kursierende Fotos, die angeblich eine bestimmte Kundgebung zeigen, während sie tatsächlich von einer anderen (gewöhnlich deutlich größeren) stammen, verdichten den Nebel, der die Politik der Massen umgibt. Dann folgt der Spott der Gegner, die Massenkundgebungen als politisch bedeutungslos abtun – mit dem Hinweis auf die Gegensätze zwischen dem Erfolg auf der Straße und dem an der Wahlurne. Andererseits zeigten Analysen von Corbyns unerwartet gutem Abschneiden bei den britischen Parlamentswahlen 2017, dass sich seine Massenveranstaltungen im Nahbereich auf das Wahlverhalten durchaus positiv ausgewirkt hatten.[1] Aber wer kann schon sagen, wodurch und warum?
Eine Ahnung, dass wir in ein neues Zeitalter der Massen eingetreten sind, vermitteln drastisch die Weiterverbreitung und der zunehmende Einfluss der sozialen Medien. Seit dem 18. Jahrhundert betrieben Zeitungs- und Buchverlage eine »One-to-many-Kommunikation«, in der sie bestimmte Zuhörerschaften und Leserkreise mit Informationen versorgten. Die Empfänger blieben weitgehend passiv und zeigten einigermaßen absehbare Reaktionen. Seit Anfang der 2000er-Jahre haben die sozialen Medien dieses System durch eine »Many-to-many-Kommunikation« ersetzt (und in gewisser Weise vereinnahmt), in der sich Information weitaus erratischer wie ein Virus in einem Netzwerk ausbreitet. Manche Ideen oder Bilder können sich scheinbar aus eigenem Antrieb verbreiten, die Experten überrumpeln und dabei außergewöhnliche Wählerbewegungen auslösen. Neue Methoden von Marketing und Informationsübermittlung tauchten auf, um die Prozesse der Verbreitung und Nachahmung von Inhalten auszutesten und zu beeinflussen. Massen spielten seit der Antike in der Politik eine Rolle, besaßen aber bis zum 21. Jahrhundert nie entsprechende Werkzeuge, um sich in Echtzeit selbst zu koordinieren.
Die Kontroverse um die Teilnehmerzahl bei Trumps Amtseinführung mag an der Oberfläche als lächerlicher Konflikt zwischen Fakten und Fiktion, Realität und Fantasie anmuten. Sie mag als die Art Streitfrage erscheinen, die sich mit der Autorität der Expertise leicht beilegen ließe, wenn dieser nur ausreichend Respekt entgegengebracht wird. Aber sie verschafft uns einen Ausgangspunkt, um das beunruhigende neue politische Terrain zu erkunden, auf das wir vorgerückt sind: Auf ihm sind neutrale Blickpunkte rar und haben Gefühle größeres Gewicht. Die Bedeutung einer Menschenmenge liegt weitgehend im Auge des Betrachters. Wohin führt dies die Politik? Und ist eine Logik erkennbar, die dieses chaotische neue Umfeld durchzieht?
Eine Logik besteht durchaus, aber um sie zu erfassen, müssen wir Gefühle ernst nehmen. Gleichzeitig müssen wir uns von lieb gewonnenen Annahmen über die repräsentative Demokratie verabschieden. Die meisten Menschen haben es sich in unserer vertrauten Vorstellung von Massendemokratie bequem gemacht und lassen andere für sich sprechen: einen gewählten Vertreter, Richter, Berufskritiker, Experten oder Kommentator. Daran beteiligt sind professionell organisierte Parteien, Behörden oder Zeitungs- und Buchverlage, bei denen bedeutsame Angelegenheiten in guten Händen sind und wo jedermann nach denselben Regeln spielt. Damit es aber funktioniert, muss sich die große Mehrheit der Menschen stets damit begnügen, die meiste Zeit zu schweigen und auf die zu vertrauen, die an ihrer Stelle reden. Und dies widerstrebt den Menschen offenbar immer mehr. Mit dem schwindenden Vertrauen in Berufspolitiker und Medien rund um die Welt ist die Unterstützung für direkte Demokratie gestiegen.[2] Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sich dieser Trend in naher Zukunft auflöst.
Wenn die Logik der Massen in die Politik einzieht, dreht diese sich weniger um friedliche politische Vertretung und mehr um Mobilisation. Ob auf den Straßen oder online, im Gegensatz zum Parlament, das das Wahlvolk, oder zum Richter, der das Justizsystem vertritt, agieren Massen nicht als Stellvertreter. Sie geben nicht vor, die Gesellschaft als Ganzes so zu repräsentieren wie eine »repräsentative Stichprobe«, mit deren Hilfe ein Meinungsforscher herauszubekommen versucht, was die gesamte Nation denkt. Wenn Massen überhaupt Bedeutung haben, dann wegen der Intensität der Gefühle, die eine so große Zahl von Menschen veranlasste, zu einer bestimmten Zeit auf einem bestimmten Platz zusammenzuströmen. Wie in Kriegen, welche die nationalistische Fantasie beherrschen, ermöglichen es Massen dem Einzelnen, Teil von etwas zu werden, das größer als er selbst ist (und sich auch so zu fühlen). Dies muss nicht negativ sein, birgt aber Risiken und spielt mit unseren Nerven.
Die entscheidende politische Frage lautet, wer oder was die Macht besitzt, Menschen zu mobilisieren. Wie der Sieg von Rebellen und Newcomern in jüngerer Zeit den etablierten Politikern vor Augen führte, lassen sich Menschen mit Appellen an Objektivität und Faktentreue nur selten physisch oder emotional mobilisieren. Was also treibt Menschen zu einer so unmittelbaren Beteiligung an, und wovon lassen sie sich in ihr dann leiten? Diese Fragen beschäftigen Werbefachleute, Markenberater und PR-Experten ebenso wie die Politiker. Soziale Medien konkurrieren um das »Engagement« von Zielgruppen und versuchen, unsere Aufmerksamkeit möglichst lange zu fesseln, wobei »Inhalt« nur als Köder dient. Sind Worte und Bilder erst zu reinen Werkzeugen geworden, um Menschen zu mobilisieren und zu engagieren, spielt es kaum noch eine Rolle, ob sie die Wirklichkeit zuverlässig oder objektiv widerspiegeln. Eben diese Sorge umgibt inzwischen die Themen »Fake News« und Propaganda. Aber sie herrscht bei Weitem nicht zum ersten Mal.
Ansammlungen von Körpern
Im Jahr 1892 wurde der französische Arzt, Medizinforscher und Anthropologe Gustave Le Bon (1841 – 1931) bei einem Ritt durch Paris vom Pferd abgeworfen und wäre beinahe ums Leben gekommen. Le Bon versteifte sich darauf, der Ursache des Unfalls auf den Grund zu gehen. Ließen sich anhand einer eingehenden Untersuchung Aussagen über das Temperament eines Pferds treffen? Auf der Suche nach Anhaltspunkten inspizierte er Aufnahmen der Reittiere und versuchte, in physischen Merkmalen Anzeichen psychischer Abläufe auszumachen. Stark beeinflusst war er von Charles Darwin (1809 – 1882), der sich bei Forschungen zum Ausdruck der Gemütsbewegungen von Tieren ebenfalls auf die Fotografie gestützt hatte. Deren Erfindung hatte der Wissenschaft neue Möglichkeiten eröffnet, weil sich Gesichter und Mimik jetzt mit einem objektiven Auge erforschen ließen. Dass ein flüchtiger Blick erstmals festgehalten und studiert werden konnte, machte den Weg frei für eine methodischer arbeitende Wissenschaft der Gemütsbewegungen, die sich bis dato auf Hypothesen und Beschreibungen beschränken musste. Bei seinem Studium der Pferde stieß Le Bon auf Fragen der Psychologie und auf die Frage, wie sich das menschliche Verhalten anhand von Physis und Biologie erklären ließ. Dabei bemühte er sich vor allem um den Bereich der Psychologie, der ihn am bekanntesten gemacht hatte: das Verhalten von Massen.
Die gewaltige Wirkung und das realitätsverändernde Potenzial von Massen hatte Le Bon aus erster Hand erfahren: Zurückgeblieben war eine tief sitzende Angst vor dem, wozu Massen fähig sind. Le Bon hatte sich in den 1860er-Jahren in Paris zum Arzt ausbilden lassen und nach Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges 1870 eine Abteilung von Militärambulanzen geleitet. Die demütigende Niederlage der französischen Armee, gefolgt vom Aufstand der Pariser Kommune im Sommer 1871 trugen zu seinen erzkonservativen Tendenzen und der Anschauung bei, dass ein pazifistischer Geist, unterstützt durch sozialistisches Gedankengut, Frankreich zugrunde gerichtet hätten. Ein demokratisches und sozialistisches Vertrauen in »das Volk« gingen mit der Ablehnung von militärischer Stärke und Nationalstolz einher, der seiner Ansicht nach entschieden entgegengetreten werden musste. Inspiriert von neuen Theorien zur Evolution, verknüpfte Le Bon seine Abneigung gegen den Sozialismus mit einigen zutiefst rassistischen und sexistischen Gedanken über Bedrohungen der Nationalkultur und Militärtüchtigkeit und versuchte, einige dieser Anschauungen mit der damals hoch im Kurs stehenden Schädellehre zu untermauern. Einen Großteil der 1880er-Jahre verbrachte er auf Reisen in Asien und Nordafrika, die ihm ein breit gefächertes, neues anthropologisches Material zur Typisierung bescherten.
Im Jahr 1895 schrieb Le Bon sein bekanntestes Werk, Psychologie der Massen, das eine umfassende, wenn auch zutiefst pessimistische Darstellung zur Dynamik der Massenpsychologie bot. Was eine Masse charakterisiere, so Le Bon, sei die Ersetzung vielfältiger individueller Ichs (mit aller Begabung zur Vernunft und zum wissenschaftlichen Denken, die Philosophen dem menschlichen Geist zugesprochen hatten) durch eine einzige Massenpsyche, die den gesunden Menschenverstand und die Moral des Einzelnen potenziell untergrub. »Es gibt Ideen und Gefühle«, argumentierte er, »die nur bei den zu Massen verbundenen Individuen auftreten oder sich in Handlungen umsetzen.«[3] Wenn dies geschehe, schwinde das »Beobachtungsvermögen und der kritische Geist eines jeden von ihnen […] sofort«.[4] Spätere Gedanken Sigmund Freuds (1856 – 1939) vorwegnehmend, vertrat Le Bon die Ansicht, dass Massen die gefährlichere Seiten der Zivilisation offenbarten, die ansonsten durch individuelle Selbstkontrolle unterdrückt würden.
Wie das Beispiel des republikanischen Frankreichs in Le Bons Augen empirisch belegte, stellten Massen für die Prinzipien von Vernunft und Wahrheit eine ständige Bedrohung dar. »Ist das Gebäude einer Zivilisation wurmstichig geworden«, warnte er, »so sind es stets die Massen, welche dessen Zusammensturz herbeiführen.«[5] Dies geschehe durch eine Vielzahl an Mechanismen, die er in Psychologie der Massen aufzudecken versuchte. Der erste sei das schiere Gefühl von Macht, das von ansehnlichen Menschenansammlungen ausgehe. Einzelne würden zu Handlungen angestachelt, die sie ansonsten als vermessen, unmoralisch oder peinlich empfänden. Dabei spielt die Größe einer Masse eine gewaltige Rolle, allerdings auf emotionaler Ebene und nicht auf der der Statistik – wie bei Trumps »Meer der Liebe«. Erst die Größe einer Masse ermögliche es Menschen, ihr individuelles Urteilsvermögen auszuschalten, Hemmungen zu überwinden und Gefühlen freien Lauf zu lassen.
Angesichts seines Militarismus und Fanatismus sind Le Bons Gedanken wohl mit Vorsicht zu genießen. In seinen Ansichten zu den Pariser Massen äußerte er Abscheu vor ihrer angeblichen Disziplinlosigkeit und Dummheit. Auch hing er einem düsteren Kulturpessimismus an. Aber sein Werk liefert einen Ausgangspunkt, um die Politik der Massen zu durchdenken. Um deren Verhalten zu verstehen, muss man sie als eine Art eigenständigen Organismus betrachten, mit Eigenarten und besonderen Verhaltensweisen – ähnlich wie Le Bon das Pferd zu verstehen versuchte, das ihn abgeworfen hatte. Teil einer Masse zu werden, so sagt uns Le Bon, bedeutet, die eigene Individualität abzuschütteln und in einem Körper aufzugehen, der größer als der eigene ist. Was als Hinweis auf einen Politikstil aufzufassen ist, der weniger auf Konzepte und Debatten als vielmehr darauf setzt, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort physische Präsenz zu zeigen.
In welchem Sinn unterscheidet sich dies beispielsweise von der Beteiligung an einem Markt oder einem demokratischen System? Immerhin engagieren sich Individuen ständig in sozialen Institutionen, die Menschen zusammenbringen und damit etwas aufbauen, das mehr als die Summe seiner Teile ist. Als Unterschied, so legt Le Bons Werk immer wieder nahe, besteht das Wesen einer Masse in der Nähe, die sie zwischen menschlichen Körpern schafft. Während es uns der Markt ermöglicht, über das Medium Geld zusammenzuwirken, und Demokratie dies mithilfe von Stimmabgabe, Text und Rede erreicht, ist die Masse zuallererst ein physisches Phänomen. Sie schafft körperliche Nähe und ermöglicht es so, dass vielfältige Gefühle aufkommen und sich ausbreiten. Einzelne Körper werden zu einem einzigen Nervensystem verschaltet.
Die Menschen, die sich am 20. Januar 2017 auf der National Mall versammelten und zu Trumps »Meer der Liebe« verschmolzen, hätten dieses Ereignis auch im Fernsehen verfolgen und ihre Beteiligung darauf beschränken können, am 8. November 2016 ihre Stimme abzugeben und abzuwarten, welche Politik das Weiße Haus einschlagen würde. Stattdessen entschlossen sie sich, mit ihren Gefühlen körperlich präsent auf der Nationalpromenade in Erscheinung zu treten. Entsprechend bestand der anfängliche Zweck der Occupy-Bewegung nicht in der Kritik an der Wall Street, einer Debatte über die Finanzmarktregulierung oder Lobbyarbeit für eine alternative Wirtschaftspolitik. Vielmehr ging es darum – wie der Name sagt –, physischen Raum zu besetzen, menschliche Körper dazu zu nutzen, um eine politische Bewegung unvermeidlich zu machen. Aktivisten in anderen gegenwärtigen Bewegungen, wie Black Lives Matter oder Greenpeace, blockieren strategisch wichtige Infrastrukturen (Flughäfen und Schnellstraßen) mit ihren Körpern. Schweigemärsche wie der monatlich stattfindende zum Gedenken an die Brandopfer in Londons Grenfell Tower setzen schlicht durch ein physisches Miteinander ein kraftvolles Zeichen der Anteilnahme. Entgegen Le Bons Befürchtungen kennt die Geschichte zahlreiche Beispiele von Massen, die friedlich der Unterdrückung entgegentraten. Nicht, dass Emotionen dabei eine geringere Rolle spielten als in wütenden Mobs, sie zielen einfach nur in eine andere Richtung.
Massen sind nie dasselbe wie Zuhörerschaften, Leserkreise oder Wählerschaften. Sie empfangen nicht einfach Informationen und reagieren auf sie. Der Unterschied, so glaubte Le Bon, liege darin, dass sie durch Prozesse der Ansteckung beeinflusst würden – ein weiterer Hinweis auf den Einfluss, den die Biologie auf sein Denken ausübte: Nach ihm breiteten sich in Menschenansammlungen Gedanken und Gefühle wie Infektionskrankheiten aus. »In der Masse ist jedes Gefühl, jede Handlung ansteckend«, so Le Bon, »und zwar in so hohem Grade, dass das Individuum sehr leicht sein persönliches Interesse dem Gesamtinteresse opfert.«[6] Während in einem vernünftigen öffentlichen Dialog Fakten und Argumente zählen, um andere zu überzeugen, wirkt Ansteckung in Massen mithilfe bewusster, unbewusster und körpersprachlicher Botschaften. In ihnen akzeptieren Einzelne die Ideen und Aktivitäten von ihresgleichen nicht durch bewusste Entscheidungen. Sie werden schlicht mitgerissen. »So mächtig ist die Ansteckung«, schrieb Le Bon, »dass sie den Individuen nicht bloß bestimmte Anschauungen, sondern auch bestimmte Gefühlsweisen aufzwingt.«[7] Die Masse verschmilzt zu einem einzigen großen neuronalen Netzwerk, in dem sich Emotionen mit Ultrahochgeschwindigkeit von einem Körper zum nächsten ausbreiten.
Für Le Bon sind Massen besonders empfänglich für die Stimmungen, die von Rednern geschürt werden, insbesondere wenn diese herrisch und mit physischen Drohungen auftreten. »Der Redner, der sie hinreißen will, darf mit starken Ausdrücken Missbrauch treiben«, schrieb er. »Übertreiben, bekräftigen, wiederholen und niemals einen logischen Beweis versuchen, sind die den Rednern in Volksversammlungen wohlbekannten Argumentationsweisen.«[8] In Gegenwart eines solchen Demagogen werden Massen bemerkenswert gefügig, sodass der Führer ihre finstersten und primitivsten Antriebe zum Vorschein bringen kann. Der Volkskult um den Führer ähnelt der militärischen Kultur, was Hierarchie und Gewaltbereitschaft angeht, lässt aber – entscheidend für Le Bon – die Disziplin und Organisation vermissen, mit denen Kriege gewonnen werden. Er verleiht rhetorisch begabten, aber skrupellosen Individuen gefährliche Macht.
Es liegt etwas Paradoxes in Le Bons Einschätzung. Einerseits sah er die modernen Massen durch übertriebenen Pazifismus sowie sozialistische und demokratische Ideen geschwächt, womit ihre Kriegstauglichkeit beeinträchtigt sei. Andererseits erblickte er in der Psyche der Massen die Gefahr von Gewalt, die jederzeit hinter der Fassade des zivilisierten Lebens hervorbrechen könne. Die Masse gab insofern Rätsel auf, als sie gefährlich und gleichzeitig feige war, Lust auf Gewaltexzesse hatte und doch vor Gewalt zurückschreckte. Angst und Aggressionen treten häufig im Tandem auf. Wie Le Bon pessimistisch schloss, konnten Massen weder Kriege ausfechten noch den Frieden ertragen. Besser ließe sich dieser Zwiespalt auch so formulieren, dass sich Massen nicht nur für Gewalttaten mobilisieren lassen: Sie können auch persönliche Gefühle der Angst und Betroffenheit aufgreifen und sie in die Öffentlichkeit tragen. Menschen können körperlich zur Masse zusammenrücken, um eine Drohkulisse aufzubauen, sich aber auch versammeln, um demonstrativ für das Bedrohte einzutreten (und sich mit ihm zu solidarisieren). Dieser Unterschied entscheidet darüber, wie politische Allianzen geschmiedet werden – und widerspricht jenen, für die sämtliche populistische Bewegungen und Massendynamiken grundsätzlich »dasselbe« seien.
Zu Recht sah Le Bon die Massenpsychologie als ein eigenständiges Gebilde, das in unserer gemeinsamen körperlichen Existenz verankert ist. Er leitete daraus aber allzu düstere Annahmen zu den notwendigen Folgen ab. Vom menschlichen Körper und seinem Nervensystem gehen schließlich nicht nur Gefahr und Angst, sondern auch Mitgefühl aus. Die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden, kann Paranoia und Feindseligkeit, aber auch Empathie und mitmenschliche Regungen auslösen. Wenn die Massenpsychologie, wie von Le Bon behauptet, im Menschen Instinkte zum Vorschein bringt, die von der Zivilisation im Zaum gehalten werden, dann können Massen auch wertvolle therapeutische Arbeit dabei leisten, Sorgen und Ängste ins Licht zu rücken, die ansonsten keine Beachtung fänden. Diese Züge der Menschheit freizulegen, die lang als »irrational« verunglimpft wurden, ist tatsächlich riskant. Aber irgendwie müssen sie sich äußern.
Politik als Virus
Die Faszination, die von Stimmungen der Masse ausgeht, mag befremdlich wirken, insbesondere für jeden, der Politik als Parteiorganisation, Strategieplanung und Gesetzgebung versteht. Im Zeitalter der repräsentativen Demokratie mag die physische Mobilisierung der Massen überholt und irrelevant erscheinen, als die Sache einer Minderheit von übermäßig begeisterten politischen Aktivisten. Aber die Abläufe, die Le Bon analysierte, lassen sich bis weit über die Grenzen der politischen Versammlungen hinweg verfolgen: Tatsächlich prägen sie unser heutiges Leben weitaus vielfältiger, als Le Bon sich das hätte vorstellen können.
Was wir heute unter »viralem Marketing« verstehen (das subtil nur auf einflussreiche Leute anstatt auf die gesamte Öffentlichkeit abzielt), ist ein Beispiel für eine systematische Nutzung von Ansteckungsprozessen. Dank der zunehmenden digitalen Erfassung unseres Verhaltens und unserer Mitteilungen und dank rasanter Fortschritte in der »emotionalen künstlichen Intelligenz« (oder im »Affective Computing«) lassen sich die Wege, auf denen sich Emotionen und Stimmungen in Massen ausbreiten, mit zunehmender wissenschaftlicher Präzision verfolgen. Techniken der digitalen »Sentimentanalyse«, die mithilfe selbstlernender Algorithmen Inhalte sozialer Medien, menschliche Mimik oder andere Formen der Körpersprache auswerten, wenden Le Bons biologischen Ansatz auf die Psychologie an und lassen so eine ganze Industrie der Marktforschung entstehen. Der emotionale Inhalt eines Tweets, einer Augenbewegung oder einer Stimmlage lässt sich inzwischen erfassen und analysieren. Intelligente Kameras, wie sie die Sicherheitskräfte in einem Pilotprojekt im chinesischen Chongqing einsetzten, erkennen Gesichter in der Menge. Im April 2018 konnte die Polizei in Nanchang mit Gesichtserkennung unter den 60 000 Teilnehmern eines Popkonzerts einen Tatverdächtigen ausfindig machen.
Moderne politische Aktivisten erkennen, dass sich die öffentlichen Meinungen und Stimmungen häufig am besten durch kleinräumige und scheinbar marginale Eingriffe anstatt durch groß angelegte offizielle Ankündigungen oder Informationen beeinflussen lassen. Für virale Taktiken im Wahlkampf und für Massenveranstaltungen besonders anfällig sind politische Systeme mit einfachem Mehrheitswahlrecht wie in den Vereinigten Staaten oder Großbritannien, weil schon die Beeinflussung von wenigen in entscheidenden Regionen auf das Gesamtergebnis durchschlägt. Vornehmlich auf kleinräumige, aber einflussreiche Auslöser zu setzen kennzeichnet auch die »Nudge«-Techniken, mit deren Hilfe Politstrategen unser Verhalten in Bereichen wie Ernährung oder privaten Finanzen zu beeinflussen versuchen – durch eine raffinierte Gestaltung, wie uns Wahlmöglichkeiten präsentiert werden. In all diesen Fällen beherrscht die Logik der Massen (wie Le Bon sie charakterisierte) bereits unser Alltagsleben mit, selbst dann, wenn wir nie auf den Gedanken kämen, an einer Kundgebung oder Besetzung teilzunehmen.
Die meisten von uns würden zustimmen, dass wir im alltäglichen gesellschaftlichen Umgang miteinander für emotionale Ansteckung empfänglich sind. Tatsächlich ist es leichter, sich von sozialen Stimuli mitreißen zu lassen, anstatt jede Situation anhand ihrer objektiven Vorzüge zu beurteilen. Es wäre befremdlich, wenn wir Freunde bei einem gemeinsamen Abend stets mit einem kritischen Auge betrachten, all ihre Äußerungen einem Faktencheck unterziehen und uns jeder spontanen Einigkeit oder geselligen Stimmung verweigern würden. Wir wissen, wie stark wir auf soziale Reize wie Körpersprache oder sogar auf physiologische Phänomene wie Pulsraten reagieren. Im Privaten gibt nichts davon Anlass zur Besorgnis. Dagegen entsprangen Le Bons Befürchtungen der Überzeugung, dass demokratische Bewegungen stets aus ein und derselben Reihe von Emotionen und Suggestionen der menschlichen Psyche hervorgingen, so sehr, dass für die Masse nie zählt, was gesagt wird, sondern nur, welche Gefühle es in ihr auslöst. Tatsächlich wirkt Ansteckung weniger über verbale als vielmehr über visuelle und körperliche Kommunikation. Wenn Anschauungen in Bilder gefasst werden, die unser Fühlen verändern, springen sie von einer Person zur nächsten über und breiten sich so als »Stimmungen« über die Masse aus. Marken und Logos, denen es gelingt, ohne Worte eine Vorstellung oder Laune zu kommunizieren, zeugen von der Kraft visueller Symbole, Verhalten zu beeinflussen.
Um die Zeit, als Le Bon seine Gedanken entwickelte, machte sich auch erstmals die Werbung daran, diese Erkenntnisse zum Aufbau einer spezialisierten Industrie zu nutzen. In den 1880er-Jahren führten Psychologen Studien zur menschlichen Aufmerksamkeit durch, bei denen sie Augenbewegungen maßen, um nachzuvollziehen, wie das Bewusstsein auf verschiedene äußere Reize reagiert. Werbefachleute der ersten Stunde versuchten anhand dieser Methoden zu verstehen, wie sich mit Bildern und Markenpolitik das Interesse von Konsumenten wecken ließ. Edward Bernays (1891 – 1995), ein aus Österreich stammender US-Amerikaner (und Neffe Sigmund Freuds), schlug 1928 in seinem Werk Propaganda vor, ähnlich wissenschaftlich auch an die politische Sphäre heranzugehen. Seine Kritik lautete, dass die Politik über der Wirtschaft vernachlässigt worden sei, wenn es darum ging, die emotionalen Dimensionen von Kommunikation zu analysieren. Während Unternehmen die Macht der Bilder eifrig für ihre Zwecke einspannten, fixierten sich die Politiker weiterhin unbedarft auf das Wort als dem wichtigsten Vehikel, um öffentliche Stimmungen zu beeinflussen. Bernays war überzeugt, dass die Demokratie nur dann überleben könne, wenn sich Politiker entgegen der Sorge, öffentliche Wünsche zu bedienen, verstärkt darum kümmerten, die öffentliche Stimmung so zu beeinflussen, dass sich die Menschen mit dem Status quo begnügten.
Bernays sah keinen Widerspruch zwischen Propaganda und Demokratie, sondern hielt seine Vision einer Wissenschaft der Public Relations für notwendig, um die Demokratie zu retten. »Unsere Demokratie muss von einer intelligenten Minderheit geführt werden, die weiß, wie man die Massen leitet und lenkt«, so seine Argumentation. »Ist das gleichbedeutend mit ›Regierung durch Propaganda‹? Nennen Sie es ›Regieren durch Bilden und Erziehen […].«[9] Seiner Annahme nach verlangte die Öffentlichkeit in einer Demokratie ein Gefühl der Vertrautheit mit ihren Führern: Sie wolle nicht gehört oder repräsentiert werden, sondern ein Gefühl der Nähe zur Macht erhalten. Daraus folgte, dass Regierungen dann »demokratisch« seien, wenn sie es verstanden, ein solches Gefühl der Vertrautheit zu vermitteln. Als Alternative drohten die Wünsche der Menschen, die er vielfach für unbewusst hielt, und die Tagespolitik zusehends auseinanderzuklaffen. Im neuen Umfeld des massenhaften Stimmrechts wurde Propaganda zu einem unverzichtbaren Werkzeug, um eine Abdrift der Demokratie ins Chaos zu verhüten.
Ob Wahlen oder repräsentative Mechanismen überhaupt notwendig waren, um diese massenpsychologische Wirkung zu entfalten, ist unklar. Als eines der Hindernisse, auf das Politiker stießen, so glaubte Bernays, erhielten sie wegen ihres öffentlichen Status in den Medien allzuleicht Aufmerksamkeit und Beachtung, weshalb sie selten strategischer darüber nachdenken müssten, wie sie ihre Botschaften gestalteten. Methoden der Öffentlichkeitsarbeit eigneten sie sich deshalb nur langsam an, weil ihnen überholte Annahmen zur repräsentativen Demokratie und zur öffentlichen Sphäre im Wege stünden. Die Frage, die sich Politiker stellen müssten, so Bernays, lautete, wie sie am besten Bilder, Töne und Sprache im Verbund miteinander einsetzen könnten, um im Volk die richtige Stimmung zu erzeugen. Die Wahl Ronald Reagans, eines ehemaligen Filmstars, zum US-Präsidenten hätte Bernays vollkommen eingeleuchtet. Mit der Wahl eines Reality-TV-Stars ins Oval Office im Januar 2017 war dann die nächste Stufe erreicht.
Das Internet hat dem Multimediaaspekt der Massendynamik neue Formen gegeben, darunter das, was man »Propaganda« nennen könnte. Dass das Internet als Medium ebenso visuell wie textuell arbeitet, verleiht ihm seine entscheidende Macht, Massen zu mobilisieren und zu beeinflussen. Die rechtsextreme weiße »Alt-Right«-Bewegung startete in Online-Foren als Gemeinschaft von Libertären und Ethnonationalisten, deren Botschaften und Stimmungen über bildlich gestaltete Meme – im Internet viral geteilte Einheiten von Bewusstseinsinhalten – verbreitet werden, im Gegensatz zu Pamphleten, Büchern und Artikeln, die in der Vergangenheit den Boden für das Heranwachsen politischer Bewegungen bereiteten. Eine Studie zur Online-Propaganda identifiziert dreißig Staaten rund um die Welt, darunter Russland und China, die bewusst auf die sozialen Medien setzen, um die öffentliche Meinung und das Wahlverhalten zu manipulieren.[10]
Die gegenwärtige Angst vor Propaganda verweist tatsächlich auf das eher endemische Problem, wie rasch sich Informationen verbreiten, wenn sie auf einer visuellen und emotionalen Ebene als wahr erscheinen und empfunden werden. Wie Forscher zeigten, machen Lügen auf Twitter schneller die Runde als feststehende Tatsachen.[11] Auch hier sind wir alle Teil der Masse, die laut Le Bon »[d]as Unwirkliche […] fast so stark [beeinflusst] wie das Wirkliche«.[12] Leser der Financial Times mögen glauben, dass sie sich nur durch Fakten und niemals allein durch den Anschein beeinflussen lassen. Aber teilen sie Infografiken der Zeitung auf Facebook deshalb, weil ihnen Fakten und ihre methodische Erschließung wichtiger sind oder weil das Logo und der rosa Hintergrund glaubwürdiger erscheinen? Immer stärker zeichnet sich ab, dass die urteilsfähige, gebildete Öffentlichkeit in den jeweils eigenen kulturellen Filterblasen des Content Sharing lebt. Auch Zahlenangaben beinhalten bestimmte emotionale Konnotationen, die verschiedene Menschen auf unterschiedliche Weise anziehen oder abstoßen. Die Bedrohung durch »gefakte« digitale Inhalte wächst, wenn künstliche Intelligenz erst die Fähigkeit erwirbt, künstliches Videomaterial zu generieren.
Wenn Ansteckung in einer Ansammlung von Körpern ihre Zauberkraft entfaltet, setzt sie die abendländischen Grundannahmen zur individuellen Selbstbestimmung (den »freien Willen«) außer Kraft. Le Bon wird nicht mehr so sehr wegen seiner physiologischen Analyse gelesen, aber seine Spekulation in der Geist-Körper-Frage ist nichtsdestotrotz einleuchtend. In einer Masse stehen Handlungen einer Person »viel öfter unter dem Einfluss des Rückenmarks als unter dem des Gehirns«.[13] Das Nervensystem, das für Schmerz, Erregung, Stress und Aufregung zuständig ist, wird zum wichtigsten Steuerungsorgan der politischen Aktivität. Eben als fühlende Geschöpfe und nicht als Intellektuelle, Kritiker, Wissenschaftler oder etwa als Bürger sind wir für ansteckende Stimmungslagen empfänglich – ganz im Widerspruch zum politischen Ideal des informierten, rational denkenden Wählers. Für einen Mann wie Edward Bernays bildete dies allerdings eine weitaus realistischere Basis, auf der sich in Zeiten des massenhaften Stimmrechts und der Massenmedien Demokratie bewältigen ließ, als auf öffentliche Argumentation zu vertrauen. Die Frage lautete, ob die noch von der Demokratie überzeugten Führer, wie Bernays hoffte, oder ihre Gegner aus der Massenpsychologie (und der »Propaganda«-Wissenschaft) die besten Lehren ziehen würden.
Wenn die Dynamik der Massen die Massendemokratie zu beherrschen beginnt, müssen Parteien und Führer sich bemühen, die Öffentlichkeit zu mobilisieren und einzubinden, nicht nur auf der Ebene politischer Vorlieben, sondern indem sie Begeisterung und starkes Engagement wecken. Linke wie rechte populistische Bewegungen erschüttern den Status quo, weil sie eine breitere Vielfalt an tieferen Gefühlen, Ängsten und physischen Bedürfnissen in den politischen Prozess hineinleiten. Populismus mag erschrecken, wenn er die Eigenschaften eines gewaltbereiten »Pöbels« annimmt, vor dem Le Bon gewarnt hat. Aber er kann auch den Reiz und die Lebendigkeit der Demokratie über die Grenzen der parlamentarischen Systeme und Parteienspektren hinaus erweitern. Die Dynamik der Massen hilft der Politik, den Anschluss an tiefe menschliche Bedürfnisse zurückzugewinnen, indem sie gemeinsame Gefühle – einschließlich gemeinsamer Verletzlichkeiten – unmittelbar in die öffentliche Domäne einbringt, ohne dass erst darauf gewartet werden muss, dass sich Journalisten oder Berufspolitiker ihrer annehmen. Wellen des Populismus in Europa und den Vereinigten Staaten haben das Leben und die Erfahrungen Marginalisierter in den Blick gerückt, die bislang ignoriert worden waren. Sicher geht dies mit Risiken einher, gehört aber zum Wesen von Demokratie.