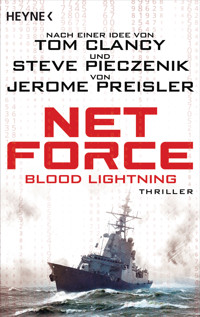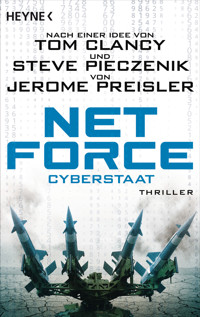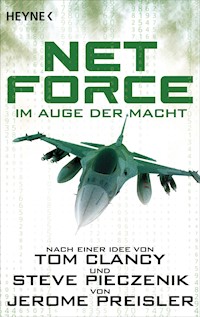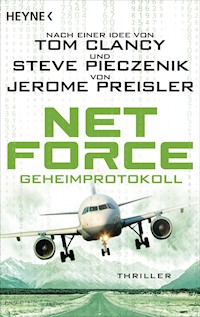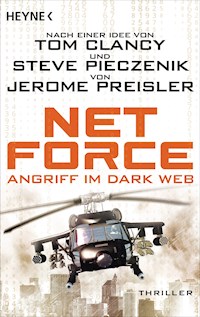
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Special Unit Cyberterrorismus
- Sprache: Deutsch
Band 1 der Serie: Cyberterrorismus aus dem Dark Net droht die Welt ins Chaos zu stürzen
Cyberkriminalität wird zu einer immer größeren Bedrohung. Daher installiert die US-amerikanische Präsidentin Annemarie Fucillo eine neue Elite-Einheit: Net Force. Doch bevor die Ermittler ihre Arbeit aufnehmen können, wird das Land Opfer eines massiven Cyberanschlags. Die Net Force muss schnell reagieren und an verschiedenen Fronten gleichzeitig versuchen, die Attacken abzuwehren. Scheitert sie, wird das katastrophale Konsequenzen haben – auf globaler Ebene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 792
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Im Jahr 2023 ist die digitale Vernetzung weit vorangeschritten. Die Welt ist nicht nur durch das Internet, sondern auch durch neue Technologien wie selbstfahrende Autos, intelligente Kühlschränke und Kameradrohnen miteinander verbunden – das sogenannte »Internet der Dinge«. Damit eröffnen sich Cyberkriminellen ganz neue Möglichkeiten, Cyberattacken werden zu einer immer größeren Bedrohung. Daher installiert die US-amerikanische Präsidentin Annemarie Fucillo eine neue Elite-Einheit: Net Force. Doch bevor die Ermittler ihre Arbeit aufnehmen können, wird das Land Opfer eines massiven Cyberanschlags, der zunächst die gesamte Infrastruktur in Downtown Manhattan lahmlegt. Das Strom- und Kommunikationsnetz bricht zusammen, Panik bricht aus. Rasend schnell verbreitet sich das Computervirus auch im Rest der USA, es kommt zu Massenunfällen, Flugzeuge stürzen ab, technische Geräte spielen verrückt. Das Land droht, im Chaos zu versinken. Die Net Force muss schnell reagieren und an verschiedenen Fronten gleichzeitig versuchen, die Attacken abzuwehren. Scheitert sie, wird das katastrophale Konsequenzen haben – auf globaler Ebene.
Der Autor
Jerome Preisler ist der Autor von Tom Clancys New-York-Times-Bestsellerreihe »Power Play«. Er hat bisher mehr als dreißig Bücher veröffentlicht und als Experte für Militärgeschichte zahlreiche Vorträge an Schulen, in Museen und an Militärstützpunkten gehalten. Preisler lebt in New York.
ENTWICKELT VON
TOM CLANCY
UND
STEVE PIECZENIK
GESCHRIEBEN VON
JEROME PREISLER
NET
FORCE
ANGRIFF IM DARK WEB
Aus dem Englischen
von Frank Dabrock
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe NETFORCE Dark Web
erschien erstmals 2019 bei Hanover Square Press, Toronto.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 10/2021
Copyright © 2019 by Netco Partners
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Florian Oppermann
Covergestaltung: Nele Schütz Design
unter Verwendung von AdobeStock (trafa)
und shutterstock (tsuneomp, Nekelser Kate)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-26728-5V002
www.heyne.de
Im Gedenken an Martin H. Greenburg
Was uns verbindet, ist größer als das, was uns trennt.
– PRÄSIDENTJOHNF.KENNEDY
Im Leben gibt es ein Gleichgewicht zwischen
Festhalten und Loslassen.
– RUMI
Ich denke, wir sollten im Umgang mit künstlicher
Intelligenz sehr vorsichtig sein.
– ELONMUSK
PROLOG
Außerhalb von Valletta, Malta
30. Juni 2023
I
Kali Alcazar saß vor ihrem Laptop, dessen LED-Monitor ihre schmalen, hageren Gesichtszüge in einen bläulichen Schimmer tauchte. Über die jahrhundertealten Sandsteinwände des Zimmers flackerte weiches Kerzenlicht. An diesem Abend war es im Haus ruhig, und sie konnte in der Ferne das leise Rauschen der heranrückenden Flut hören. Draußen auf der Terrasse saß der Kater, der den Besitzern des Gästehauses gehörte. Er hatte den Schwanz um sein Hinterteil geschlängelt und die Ohren gespitzt, während er wachsam auf die sich sanft wiegenden Palmen und die Schatten hinunterschaute, die sie im Mondlicht warfen.
Kali tippte ihr Cloud-Passwort ein, rief den in der Blockchain verschlüsselten Speicherordner auf, den sie sich mit Lucien Navarro teilte, und warf noch einmal einen Blick auf die gehackten Dateien, bevor sie sie verschickte. Obwohl sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Bildschirm gerichtet hatte, trug sie den zarten Rhythmus der mediterranen Brandung weiter in ihrem Herzen.
Sie trug sie stets in ihrem Herzen.
Seit ihrer Kindheit war sie einmal pro Jahr auf die Insel, die ihre Großmutter einfach nur Die Insel genannt hatte, zurückgekehrt. Mit zwei Ausnahmen um ihren siebzehnten und achtzehnten Geburtstag herum, aber sie hatte mit dieser dunklen, schmerzhaften Phase ihres Lebens abgeschlossen.
Kali ließ nicht zu, dass ihre Erinnerungen für sie zur Last wurden. Die unangenehmen Erinnerungen würden sie nur deprimieren, solange sie nicht in der Lage war, sie zu akzeptieren, und sie hätte nur wenige der Entscheidungen korrigiert, die sie in ihren sechsundzwanzig Jahren auf diesem Planeten getroffen hatte. Ihre Erfolge, Niederlagen, richtigen Entscheidungen, Fehltritte … Kali war die Summe ihrer Erfahrungen. Wenn sie irgendetwas davon ändern oder ungeschehen machen würde, wäre sie ein anderer Mensch.
Sie wusste, wer sie war, und fühlte sich wohl in ihrer Haut.
Sie las jetzt Seite für Seite die Dateien der Bank durch, die mit Querverweisen und Links zu ihren Notizen versehen waren. Die schmutzigen Geschäfte der Volke-Bank reichten sehr viel weiter als bis zu König und seinen Marionetten im Aufsichtsrat von NORN Aeronautics. Sicher, es war gelungen, ihre Machenschaften aufzudecken. Aber das Netzwerk, das die Bank zur Geldwäsche unterhielt, war unglaublich weit verzweigt. Kali hatte seine Ausläufer bis zu Politikern und Geldinstituten in Moskau, London und den Vereinigten Staaten zurückverfolgt, bis zu Drogendealern, Waffenschmugglern und den Staatskassen korrupter Regierungen. Seit Jahren betrieb die Volke-Bank Geldwäsche und hatte ihre Kontakte weiter ausgebaut. Während die internationalen Regulierungsbehörden einfach weggeschaut hatten, hatte die Bank die verbotenen Transaktionen geschickt mit ihren legalen Geschäften verflochten.
Kali scrollte weiter nach unten. Sie war in dem unübersichtlichen Beziehungsgeflecht auf eine Verbindung zur Bank Leonides gestoßen. Mit ihren Kontakten zu russischen Oligarchen und dem dubiosen Handel mit Kryptowährungen war die Bank eines der korruptesten Geldinstitute auf diesem Planeten. Kali hatte die Fakten, so gut sie konnte, überprüft und überließ es jetzt anderen, sich um den Rest zu kümmern. Die Informationen, die sie aus Königs Aufzeichnungen zutage gefördert hatte, würden auf beiden Seiten des Atlantiks für reichlich Unmut sorgen. Die Kriminellen und diejenigen, die sie hatten gewähren lassen … sie alle traf eine Schuld.
Als Kali ans Ende der Seite kam, öffnete sie ein weiteres Browserfenster, loggte sich bei einem anonymen Remailer ein und begann, die Dateien an eine Mail anzuhängen.
Doch in diesem Moment klopfte es an die Tür. Dreimal in kurzer Folge. Plötzlich war sie hellwach und begriff, dass jemand gegen den unteren Bereich der Tür klopfte. Guzzepi, dachte sie. Einen Moment später hörte sie auf dem Treppenabsatz seine hohe, aufgeregte Stimme. »Ku-sister! Ku-sister!«
Sie erhob sich von ihrem Stuhl, ging zur Tür, entriegelte sie und zog sie halb auf.
Draußen stand der Junge in seinem Schlafanzug und schaute zu ihr hoch, während er langsam wieder zu Atem kam.
»Guzzepi … Was ist los?«
Er starrte sie mit seinen aufgerissenen braunen Augen besorgt an. Kali warf einen kurzen Blick auf die geschwungene Treppe hinter ihm und richtete ihn dann wieder auf Guzzepis Gesicht.
»Schnell«, sagte sie, riss die Tür ganz auf und winkte ihn in ihr Apartment. »Komm rein.«
Der neunjährige Junge trat ein und blieb mit seinen nackten Füßen direkt hinter der Tür auf dem Holzboden stehen.
Kali ging in die Knie, sodass sie beide auf Augenhöhe waren. »Ku-bro«, sagte sie. »Erzähl mir, was los ist.«
Er schluckte. »Da waren zwei Männer«, sagte er mit zitternder Stimme. »Sie haben Omm nach dir gefragt.«
»Hast du sie sehen können?«
»Ich war in meinem Zimmer … habe ferngesehen …«
Plötzlich glänzten in seinen Augen Tränen. Sie streckte den Arm aus und berührte mit der Hand seine Wange. »Ganz ruhig. Alles in Ordnung«, sagte sie lächelnd. »Ku-bro … diese Männer … Bist du sicher, dass es nur zwei waren? Draußen waren keine weiteren Männer?«
»Ich weiß nicht. Ich – ich habe sie nicht gesehen.«
»Aber du hast ihre Stimmen gehört. Die Stimmen der Männer, die mit deiner Mutter gesprochen haben.«
»Ja.« Er schluckte. »Ich glaube, es waren Amerikaner. Sie haben Omm gesagt, sie wüssten, dass du hier bist.«
»Und was hat sie ihnen erzählt?«
»Dass du im Strandhaus bist«, sagte er. »Als sie wieder weg waren, ist sie zu mir ins Zimmer gekommen und hat gesagt, ich soll rasch nach oben laufen und dir Bescheid geben.«
»Dass sie im Strandhaus nach mir suchen?«
»Ja.«
Sie nickte nachdenklich. »Wo ist Omm jetzt, Ku-bro?«
»Unten. Sie behält die Tür im Auge. Falls sie noch mal zurückkommen.«
Kali nickte erneut, hielt für einen Moment seine Wange und lächelte zaghaft. »Warte hier«, sagte sie. »Ich muss ein paar Dinge erledigen.«
Sie richtete sich wieder auf und ging zur Terrasse. Als sie nach draußen trat, kam der Kater mit geschmeidigen Bewegungen zu ihr herübergelaufen und streifte schnurrend ihren Arm.
Kali kraulte ihn hinter den Ohren und schaute in den Innenhof ein Stockwerk weiter unten. In den Schatten rührte sich nichts, zumindest war nichts zu erkennen. Aber vor ihrem geistigen Auge konnte sie die Männer deutlich sehen. Der Mann mit den blonden Haaren … er war bestimmt bei ihnen dort draußen. Er hatte die Suche nach ihr von Anfang an geleitet.
Kali saugte die Nachtluft ein und konnte das Salzwasser des Meeres riechen. Vom Haupteingang bis zum Strandhaus waren es durch die Dünen gut hundert Meter. Falls die Männer dorthin unterwegs waren, blieb ihr vielleicht noch genug Zeit. Sie ging wieder hinein, betrat den begehbaren Wandschrank, zog ein schwarzes Paar kniehoher Reitstiefel an und schnürte sie über ihren Leggings zusammen. Dann hob sie ihren Rucksack vom Boden auf. Darin befanden sich lediglich ein paar wenige Kleidungsstücke, aber sie konnte jederzeit neue kaufen. Außer ihrem Computer würde sie alles hier zurücklassen. Nichts davon hatte für sie irgendeine Bedeutung. Sie hing nicht an ihrem Besitz, nicht mal an ihrem Laptop. Alle wichtigen Informationen hatte sie verschlüsselt in der Cloud gespeichert. Allerdings war der Computer ihre Eintrittskarte dafür. Ihr Zugangsportal.
Kali eilte zu ihrem Rechner, schickte die Daten ab, klappte ihn zu und verstaute ihn in ihrem Rucksack. Mit dem Rucksack auf dem Rücken kehrte sie zu Guzzepi zurück und ging vor ihm erneut in die Hocke.
»Wo willst du hin?«, fragte er. Seine Trauer und Angst schnürten ihm die Kehle zu. »Diese Männer werden dir wehtun.«
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Das können sie nicht.«
»Ku-sister … Kali …«
»Pst. Hör mir zu.« Sie beugte sich vor, fasste ihn an den Schultern und sagte im Flüsterton: »Was habe ich dir gesagt, als du noch klein warst … so groß wie eure Katze? Für den Fall, dass ich eine Weile von hier verschwinde?«
Er schaute sie an und schluckte schwer. »Dass du nicht wirklich weg bist.«
»Und wo kannst du mich jederzeit finden?«
Er legte seine Hand auf die Brust, während aus seinen Augen Tränen hervorquollen.
»Hier«, sagte er schniefend und ließ die Hand auf seiner Brust liegen. »In meinem Herzen.«
»Na also. Tapferer Junge.« Lächelnd beugte sie sich weiter vor. »Pass gut auf Omm auf. Und sag ihr Danke für ihre Gastfreundschaft und Großzügigkeit. Eines Tages möchte ich ihr das gerne zurückgeben.«
Der Junge stand da und schaute sie an. »Werde ich dich wiedersehen, Kali?«
Sie verzog keine Miene. »Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen habe, zählst du bis fünfzehn«, sagte sie. »Dann gehst du zurück auf dein Zimmer, okay?«
Er nickte.
Lächelnd tätschelte Kali seine Schultern und gab ihm einen kurzen Kuss auf die Stirn. Mit geschlossenen Augen atmete sie den Duft seiner Haut und seiner Haare ein. Das werde ich mitnehmen, dachte sie.
Schließlich richtete sie sich wieder auf, trat an die Tür und rannte nach unten.
II
Am Fuß der Treppe lief Kali durch die Tür in den Innenhof, schaute nach links und nach rechts, und als sie niemanden entdecken konnte, stürzte sie über die Steinplatten zur niedrigen Mauer auf der Nordseite hinüber. Mit ihrem schwarzen, von einer violetten Strähne durchzogenen Haar, der schwarzen Kleidung und den schwarzen Stiefeln war sie zwischen den Schatten nur ein weiterer Schatten, während sie sich mit den Händen auf den Backsteinen abstützte und über die Mauer in die benachbarte Gasse krabbelte.
Sie holte tief Luft, schaute sich erneut um und spähte in die mondbeschienene Dunkelheit hinaus. Sie glaubte zu wissen, warum die beiden Männer hinter ihr her waren … oder zumindest, in wessen Auftrag sie handelten. Es war zwar nur eine Vermutung, und vielleicht irrte sie sich auch, aber eigentlich war sie sich ziemlich sicher. Die Sache in München war gerade noch mal gut gegangen.
Allerdings wusste sie nicht, wie viele Leute es sonst noch gab … oder wo sie sich aufhielten. Vorausgesetzt, es gab tatsächlich noch weitere.
Sie hatte keine Lust, lange genug hierzubleiben, um das herauszufinden.
Sie rannte die Dorfstraße hinauf, bog in eine andere Straße und dann in eine weitere, wobei sie sich von den Gehwegen mit den tiefen Hauseingängen fernhielt, in denen man sich gut verstecken konnte. Sie bewegte sich im Zickzack in südlicher Richtung auf Valletta zu. Wenn sie in diese Richtung weiterlief, mehr oder weniger parallel zur Hauptstraße, die von der Küste zum Portes des Bombes führte – dem doppelten Torbogen der alten Verteidigungsanlage in der Hauptstadt –, würde sie vielleicht eine Stelle finden, wo sie bis Tagesanbruch ausharren konnte, um dann in der morgendlichen Menschenmenge abzutauchen.
Kalis hochgewachsene, schlanke Gestalt huschte, abseits der fahlen Lichtkegel der Laternen, durch die Straßen. Sie atmete gleichmäßig, folgte dem Rhythmus ihres Körpers, und trotz ihrer Stiefel und des schweren Rucksacks war sie flink auf den Beinen. Das Dorf Pietà lag dunkel und still da; seine Gassen waren in tiefblaue Schatten gehüllt, die Geschäfte geschlossen und nirgends Einkäufer, Spaziergänger oder Autos zu sehen …
Plötzlich blieb sie wie angewurzelt stehen. Keine Autos. Obwohl auf den Straßen weder Pkws noch Busse unterwegs waren, konnte sie jetzt ein Fahrzeug hören. Ganz in der Nähe. Da das Motorengeräusch zwischen den verwinkelten Straßen und riesigen Torbögen hin und her hallte, ließ sich jedoch nicht sagen, aus welcher Richtung es kam.
Kali stand eine Sekunde lang da und lauschte. Dann eine weitere. Ihr Herz pochte wie verrückt. Das Geräusch wurde rasch lauter, kam näher …
Weiter vorne. Es kam von der Querstraße vor ihr. Irrtum ausgeschlossen. Sie hörte, wie sich das Fahrzeug von rechts näherte und seine Reifen über das Kopfsteinpflaster rollten.
Sie warf einen Blick nach links über die Schulter, wo eine Gasse zwischen zwei verwitterten Gebäuden mit Säulen – einer Bank und einem Kaufhaus – hindurchführte. Sie waren in ehemaligen Verwaltungsbauten aus der Zeit Napoleons untergebracht. Die meisten der ältesten Häuser in Pietà standen direkt nebeneinander, im Gegensatz zu den Bauten aus der Kolonialzeit. Die Europäer hatten Wert auf Fußwege und Straßen gelegt.
Kali könnte sich in der Gasse verstecken und warten, bis der Wagen vorbeigefahren war. Vielleicht hatte er nichts mit den Männern im Gästehaus zu tun. Vielleicht überquerte er die Kreuzung und fuhr weiter, bis das Motorengeräusch schließlich in der Nacht verhallte. Aber ihr Instinkt sagte ihr etwas anderes.
Sie machte kehrt und lief die Straße zurück, die sie gekommen war, um auf einem anderen Weg zur Hauptstadt zu gelangen … und schnappte nach Luft. So viel zu ihrem Plan. Zwei Männer, die sich im Schein der Laternen als Silhouetten abzeichneten, kamen auf sie zugerannt. Wie hatten die beiden sie gefunden? Hatten sie geahnt, wohin sie unterwegs war? Hatten sie gewusst, welchen Weg sie nehmen würde?
Sie hatte kaum Zeit, darüber nachzudenken, bevor das Brummen eines beschleunigenden Motors ertönte, worauf sie sich erneut zur Straßenecke umdrehte. Die Männer, die auf sie zugerannt kamen, waren nicht die Einzigen, die sie aufgespürt hatten. Das Fahrzeug, das sie gehört hatte, ein dunkler Audi Q7, bog von der Kreuzung in die Straße. Das Licht seiner Scheinwerfer erhellte kurz die Gebäude an der Ecke und wanderte dann weiter in ihre Richtung.
Während sie zwischen den Männern und dem Audi in der Falle saß, schaute sie erneut zur Bank hinüber. Selbst die Bewohner von Pietà fanden das Labyrinth aus Gassen bei Nacht verwirrend, aber sie hatte keine andere Wahl. Sie musste darauf vertrauen, dass sie es schaffte, sich ihren Weg durch dieses Labyrinth zu bahnen.
Sie machte erneut auf dem Absatz kehrt und rannte in die Gasse.
III
Während Kali davonlief, hörte sie, wie der Wagen quietschend zum Stehen kam, sich die Türen öffneten und die Insassen ausstiegen. Dann, wie hinter ihr in der Gasse die Schritte mehrerer Personen ertönten. Sie glaubte, dass sie von mindestens vier Personen verfolgt wurde, aber sie konnte es nicht riskieren, einen Blick über die Schulter zu werfen.
Sie waren ihr dicht auf den Fersen.
Kali rannte, bis sie eine Biegung erreichte, und nach ein paar Schritten kam sie an einen hüfthohen Holzzaun und sprang darüber hinweg in eine dunkle Seitengasse, wobei sie mehrere Mülleimer umstieß. Über den ganzen Boden verteilten sich Abfälle, und sie konnte gerade noch das Gleichgewicht halten.
Eins, zwei, drei, vier Personen; sie konnte hören, wie ihre Verfolger hinter ihr über den Zaun sprangen, geräuschvoll zwischen den umgeworfenen Mülltonnen landeten und sich krachend und scheppernd ihren Weg durch den Hindernisparcours aus Abfällen bahnten. Der Lärm weckte die Leute in den Gebäuden zu beiden Seiten der Gasse. Lichter gingen an, Fenster wurden aufgerissen, und die verdutzten und beunruhigten Bewohner streckten die Köpfe in die Nacht hinaus, um zu sehen, was unten auf der Straße los war.
Das wilde Getümmel hatte die Männer einen Moment aufgehalten, und Kali nutzte ihren Vorteil. Während sie in der feuchten Luft heftig schwitzte und das Salz in ihren Augen brannte, stürzte sie auf einen schmalen Fußweg zwischen zwei Gebäuden und rannte weiter. Sie sah, dass der Weg ein paar Meter vor ihr in eine Seitenstraße führte, und dachte, wenn sie es schaffte, dem Gewirr der Gassen zu entkommen und auf die Straße zu gelangen, könnte sie sich dort erneut orientieren und entscheiden, wohin sie weiterlaufen sollte, um den Abstand zwischen sich und ihren Verfolgern zu vergrößern.
Ihr Brustkorb hob und senkte sich vor Anstrengung, während sie mit langen Schritten auf den Gehweg zulief. Doch als sie ihn fast erreicht hatte, spürte sie, wie eine Hand nach ihrem Rucksack griff. Sie biss die Zähne zusammen und zwang sich, noch schneller zu rennen, und für einen kurzen Moment schaffte sie es, sich loszureißen. Aber dann hörte sie fast direkt an ihrem Ohr ein angespanntes Stöhnen. Erneut schnellte die Hand hervor, und diesmal umklammerte sie einen der Riemen des Rucksacks und zerrte fest daran.
Sie warf sich nach hinten und fuhr herum. Während ihr Verfolger seinen Arm um sie schlang, erhaschte sie einen Blick auf seine kräftigen, grobschlächtigen Gesichtszüge und seine Datenbrille und wusste, dass sie ihn schon mal irgendwo gesehen hatte. Sie fragte sich, ob der andere Mann auch bei ihm war, der Mann mit den blonden Haaren.
Dann vertrieb sie all ihre Gedanken, überließ ihrem motorischen Gedächtnis die Kontrolle und handelte vollkommen instinktiv. Da sie dem Mann körperlich unterlegen war, vertraute sie auf ihre Entschlossenheit und das Überraschungsmoment. Als er sie zu sich heranzog, verlagerte sie leicht das Gewicht und schob ihre linke Hand hinter seinen Rücken, packte mit der rechten seinen Arm und drehte sich auf den Absätzen herum. Dabei drückte sie ihre Hüfte gegen seinen Körper, zerrte ihn darüber hinweg und rammte ihm mit voller Wucht das Knie in den Schritt. Der Mann taumelte vorwärts und stöhnte schmerzerfüllt auf, bevor er auf dem Gehweg zu Boden sank.
Sie stürmte an ihm vorbei auf die Straße und hielt nach vertrauten Orientierungspunkten Ausschau. Zu ihrer Linken fiel die Straße steil zu einem kleinen Platz ab, an dessen hinterem Ende eine breite Steintreppe zum Hafen hinunterführte. Sie befand sich ein gutes Stück nördlich ihrer ursprünglichen Route Richtung Hauptstadt.
Ohne sich umzudrehen, rannte sie – ihr Trägerhemd klebte inzwischen an ihrem Körper – auf den Platz zu. Hinter ihr waren jetzt weniger Schritte zu hören, aber sie war sich sicher, dass sie immer noch von zwei Männern verfolgt wurde. Kali konnte sie fast körperlich spüren; sie fröstelte und bekam eine Gänsehaut.
Nach wenigen Sekunden erreichte sie den Platz, und sie stürmte an einem runden Springbrunnen vorbei und eilte, halb rennend, halb hüpfend, die Treppe hinunter. Sie konnte jetzt das Wasser des Hafenbeckens sehen, auf dessen Oberfläche sich die Lichter spiegelten – der Mond, die Sterne, die Laternen am Kai und die Lichter der Frachtschiffe, die übers Wasser glitten, sowie der Jachten, die dort vor Anker lagen. Am Fuß der Treppe, auf der anderen Seite einer asphaltierten Straße, hatten die Moslems in früheren Zeiten an einem Berghang eine Bastion errichtet, um die Barbaresken-Piraten abzuwehren, und am höchsten Punkt der Befestigung ragte ein hoher Wachturm empor. Hinter der Brüstung der Mauer erstreckte sich eine abschüssige dunkle Fläche, die sie als il-Ġnien tal-Milorda wiedererkannte – den Garten ihrer Ladyschaft, der später von anderen Besatzern angelegt worden war. Dort gab es Palmen, Sträucher und mehrere verschlungene Pfade, die zum Wasser hinunterführten.
Jetzt, nach Einbruch der Dunkelheit, war das Haupttor des Gartens verschlossen, aber auf einem einsamen Spaziergang hatte sie auf der landeinwärts gelegenen Seite der Mauer einen Zugang zum Garten entdeckt. Wenn sie es schaffte, dort hinzugelangen und die Anlage zu betreten, konnte sie ihre Verfolger vielleicht abschütteln, weiter zum Hafen hinunterlaufen und sich zwischen den Kais und Lagerhallen verstecken.
Eigentlich war das zwar nicht ihr Plan gewesen, aber das schien jetzt die beste Möglichkeit.
Mit einem Satz rannte Kali die letzten zwei, drei Stufen hinunter und lief Richtung Mauer.
IV
Sie füllte ihre Lunge mit Luft und rannte so dicht an die Mauer heran, dass sie mit dem Ellbogen daran entlangschrammte; erneut legte sie einen Zahn zu, um den Abstand zwischen sich und ihren Verfolgern zu vergrößern. Sie näherte sich der Nische in der Befestigung, die sie vor langer Zeit darin entdeckt hatte, dem Zugang zu einer Treppe, die zur Brustwehr hinaufführte. Sie wollte möglichst weit von den Männern entfernt sein, wenn sie sie erreichte.
Los! Beeil dich!
Und dann entdeckte sie die Nische. Endlich. Nur ein oder zwei Schritte entfernt, kaum sichtbar. Sie glaubte nicht, dass die Männer die Nische in der pechschwarzen Dunkelheit sehen konnten, oder wie sie darin abtauchte. Sobald sie feststellten, dass sie verschwunden war, würden sie an der Mauer entlanglaufen, um nach ihr zu suchen, und die Nische vielleicht finden. Aber sie betete, das würde erst passieren, nachdem sie zur Brustwehr emporgestiegen und auf der anderen Seite in den Garten geklettert war.
Sie stürzte in den Durchgang, und dahinter konnte sie die abgewetzten Stufen erkennen, die zum Wehrgang hinaufführten.
Mit einem stummen Gebet auf den Lippen rannte sie, so schnell ihre Beine sie trugen, nach oben.
V
Sie trat von der Treppe auf den Wehrgang, der fünf Meter oberhalb der Straße verlief und dessen verfallene mittelalterliche Zinnen auf der Meerseite an eine Reihe loser, abgeschlagener Zähne erinnerte. Ein paar Schritte rechts von ihr führte der Gang zur obersten Terrasse des il-Ġnien tal-Milorda hinunter. Links von ihr stieg er weiter zu einem Wachturm an, der einem einzelnen Wachposten Platz bot.
Sie lief nach rechts, hinunter Richtung Garten … und blieb plötzlich stehen.
Sie hatte über sich ein kaum hörbares Brummen vernommen. Das Geräusch erinnerte sie an ein ferngesteuertes Modellflugzeug, nur dass es leiser war.
Kali spähte in den Nachthimmel hinauf, und ihre Augen weiteten sich. Das Fluggerät glitt wie ein Raubvogel über die Mauer hinweg. An seinem röhrenförmigen Körper waren weder Positionsleuchten noch irgendwelche beweglichen Teile angebracht.
Natürlich nicht, dachte sie, als sie plötzlich begriff.
Sie richtete den Blick auf die Treppe. Die Männer, insgesamt drei, hatten inzwischen die Mauer betreten und versperrten ihr den Weg zum Garten. Wie ihr Kollege in der Gasse trugen sie alle eine Datenbrille.
Dank der lautlosen Drohne, die ihre Bilder auf die Brillen übertragen hatte, waren die Männer die ganze Zeit über Kalis Position informiert gewesen. Das Fluggerät verfügte offensichtlich über ein Luftkissen. Vermutlich war es vom Meer aus durch ein Satellitensignal gestartet worden und hatte seit ihrem Aufbruch im Gästehaus jeden ihrer Schritte verfolgt.
Kali starrte die Männer mit pochendem Herzen an, die jetzt über den Wehrgang langsam auf sie zukamen. Sie mussten gar nicht rennen, und das wussten sie. Kali wirbelte herum und rannte auf den Wachturm zu.
VI
Der zinnenbesetzte Wachturm befand sich an der nordöstlichen Ecke der Mauer, und Kali stürmte, vorbei am Gestrüpp zu beiden Seiten des Wehrgangs, darauf zu, während Mörtel- und Steinbrocken unter ihren Füßen knirschten. Sie rannte zu einem winzigen Absatz hoch und weiter zwei Stufen hinauf, dann hatte sie den Eingang des Turms erreicht.
Sie stürzte ins Innere und ließ ihren Blick über seine runden Wände wandern. Ein ruhiger, separater Bereich ihres Gehirns nahm alle Eindrücke blitzschnell in sich auf. Die Fenster in sämtlichen Richtungen, durch die das Mondlicht fiel, und die schwach leuchtenden silbernen Graffiti auf den Backsteinwänden. Den vagen Gedanken, dass in vergangenen, ruhmreicheren Zeiten hier ein einzelner Ritter eine Fackel entzündet hatte, um die anderen Wachposten entlang der Küste vor einer Belagerung zu warnen.
Während sie sich den Rucksack von den Schultern riss, registrierte sie an den gewölbten Innenwänden den geschmeidigen Schatten der Drohne, die jetzt am Turm vorbeiflog.
Sie eilte zu einem dem Meer zugewandten Fenster und schleuderte ihren Rucksack hinaus in die Dunkelheit. Garantiert würden die Männer ihn auf dem Abhang wiederfinden. Vielleicht würde ihr Nachtvogel ihn aufspüren, seine genaue Position bestimmen. Aber sie wollte es den Männern nicht allzu leicht machen.
Kali drehte sich zum Eingang, in ihre Richtung um.
»Die Hände über den Kopf«, sagte der groß gewachsene Mann, der vornweg lief. »Los!«
Kali starrte die Männer wortlos an.
Sie trugen alle Schusswaffen, kleine, kurze halbautomatische Pistolen. Als der vorderste Mann näher kam und die Treppe hinauflief, wanderten ihre Augen zu seinem Gesicht.
Der Mann mit den blonden Haaren. Das überraschte sie nicht.
»Hände hoch, hab ich gesagt!«, wiederholte er. »Los!«
Sie stieß ein Zischen aus, griff nach der Hand mit seiner Waffe und bohrte ihre Finger hinein. Sofort verpasste er ihr mit der freien Hand eine Ohrfeige, worauf sie zu Boden ging. »Sie sind jetzt in Gewahrsam der US-Regierung«, sagte er und kniete sich mit der Pistole in der Hand neben sie. »Und, meine Liebe, Sie sollten Ihrem Schicksal dankbar sein, dass Sie niemand anders geschnappt hat.«
BUCH EINS
DER HACK
1
New York City, USA/Satu Mare, Rumänien
1.–5. Juli 2023
I
Als Stella Vasile an diesem Morgen aufstand, begann sie damit, im Geist all die Dinge aufzuzählen, die sie an New York vermissen würde. Sofort fielen ihr die Hamburger ein. Es ging doch nichts über einen riesigen, saftigen Burger, den man mit einem kalten Bier hinunterspülte. Dann waren da die Restaurants, chinesische, indische, mexikanische, japanische … auf die würde sie größtenteils verzichten müssen. Stella dachte an ihre Lieblingsboutiquen; sie würde die Schaufensterbummel vermissen, die große Auswahl an Markenkleidung, Accessoires und Kosmetika. Ihr fielen die Kinos ein, die sich in Fußnähe ihrer Wohnung in Chelsea befanden, und die unzähligen Bars, in denen sie sich mit ihren Kollegen und Bekannten – sie hatte keine richtigen Freunde – nach Feierabend auf ein paar Drinks traf.
Das Beste an der Stadt war ihre Vielfalt, dachte sie. In Rumänien besaßen die technologie vampiri, wie die Behörden sie – voller Verachtung und mit einer gehörigen Portion Neid – nannten, zwar ein riesiges Vermögen, errichteten Luxushäuser und fuhren exotische Autos. Aber nach acht Uhr abends war es für diese Leute unmöglich, ein geöffnetes Lebensmittelgeschäft zu finden.
Stella würde sich erst wieder daran gewöhnen müssen, aber sie konnte damit leben. Sie hatte jetzt einen Punkt in ihrem Leben erreicht, an dem sie die richtigen Prioritäten setzen musste.
Als sie auf ihrem Smartphone die Uhrzeit ablas, stellte sie fest, dass es fast zehn Uhr morgens war, und schaute nach, ob die erwartete E-Mail-Benachrichtigung schon eingegangen war. Um Punkt zehn wurde das Badge angezeigt, ihr Bruder Emil war pünktlich wie immer. Sie stellte sich vor, wie er neben Drajan Petrovik saß und auf dessen Okay gewartet hatte. Die beiden waren seit ihrer Kindheit unzertrennlich.
Sie öffnete die Nachricht und las den Benutzernamen und das Passwort, die nur fünfzehn Minuten lang gültig waren. Dann scrollte sie nach unten und tippte auf einen Link, wartete, bis das Log-in-Fenster erschien, und gab die Zugangsdaten aus der E-Mail ein.
Einen Augenblick später wurde sie mit der Download-Seite verbunden. Darauf befand sich ein einzelner Button mit der Aufschrift:
HEKATE
Sie tippte auf den Button und wartete erneut. Als die Statusleiste angezeigt wurde, klingelte das Telefon auf dem Schreibtisch, und sie nahm ab.
»Berne Financial.«
»Stella, hier ist Chloe. Gibt’s irgendwelche Probleme?«
»Alles ruhig hier«, erklärte Stella ihrer Chefin. »Kein Grund zur Sorge.«
»Sehr gut. Hör zu, ich möchte, dass du Adrián anrufst und unseren Termin für nächste Woche bestätigst.«
Stella warf einen Blick auf den Kalender in ihrem Computer. »Am Dienstag um elf?«
»Genau. Im Büro. Anschließend lade ich ihn zum Mittagessen ein. Dabei fällt mir ein, könntest du bei Monello’s auch noch einen Tisch für zwei Personen reservieren? Sag ihnen, dass wir gerne im Garten sitzen würden.«
Stella wandte sich erneut ihrem Handy zu. Der Download war inzwischen abgeschlossen.
»Ich kümmere mich sofort darum«, sagte sie.
Nachdem sie das Restaurant angerufen hatte, nahm sie das Handy und stand vom Empfangstresen auf, lief zum Haupteingang der Büroflucht und schloss ihn ab. Dann betrat sie durch eine Tür neben ihrem Arbeitsplatz Chloe Bernes Büro.
Der Computer brummte leise vor sich hin, und der Bildschirmschoner zeigte mehrere animierte Meerjungfrauen. Dieser alberne Anblick hatte Stella stets genervt – endlich etwas, das sie nicht vermissen würde.
Sie beugte sich über die Tastatur, drückte eine Taste, und die Unterwasserwelt verschwand. Sie aktivierte die Bluetooth-Funktion ihres Handys und stellte eine Verbindung zum Computer her, übertrug das Hekate-Programm, zog es ins Systemverzeichnis des Computers und installierte es mit einem Mausklick auf seinen Archivordner.
Erledigt, dachte sie, als die Installation beendet war. Bald würde das ursprüngliche Betriebssystem durch eine Simulation ersetzt werden, die vor Schadsoftware nur so wimmelte.
Als Stella einen Moment später wieder hinter ihrem Schreibtisch saß, öffnete sie die oberste Schublade und sah die wenigen persönlichen Gegenstände durch, die sie darin aufbewahrte. Schminktasche und Haarbürste, eine Flasche Handcreme, die verschreibungspflichtigen Allergiemittel, ihr Regencape in einer durchsichtigen Plastikhülle … nichts davon war unersetzbar. Trotzdem steckte sie die Allergietabletten, ihre Schminksachen und die Haarbürste in ihre Handtasche. Das war’s.
Stella schloss die Tasche wieder. Sobald sie heute Abend ihren Arbeitsplatz verlassen hatte, würde sie nicht mehr hierher zurückkehren. Zu ihrer Überraschung stellte sie fest, dass sie ihren Job ebenfalls ein wenig vermissen würde.
II
»Der Rechner ist startklar … keine Ahnung, warum er so einen Lärm macht«, sagte Chloe Berne und trat an den Schreibtisch mit dem Computer. Seit ihrem Eintreffen hatte der CPU-Lüfter nicht mehr aufgehört zu brummen. »Ich schätze, die Tage dieses Dinosauriers sind gezählt.«
Adrián Soto lächelte leicht geistesabwesend. Chloe Berne war jetzt seit zwei Jahrzehnten seine Firmenanwältin und noch sehr viel länger eine gute Freundin. Schon seit der Zeit, bevor die Sache mit Malika in Bagdad passiert war.
Soto trat hinter den Schreibtisch. Es hatte ewig gedauert, bis er geglaubt – wirklich geglaubt – hatte, dass sein großer Traum tatsächlich in Erfüllung ging. Er war äußerst pragmatisch und verdaute alles, was ihn emotional berührte, wie eine Kuh, die ihr Futter wiederkäute. Diese nüchterne, rationale Haltung war seine Rettung gewesen, als er Malika auf so brutale Weise verloren hatte. Allerdings hatte er sich nach seinem letzten Einsatz für das CECOM, das Heereskommando für elektronische Kommunikation, nicht immer darauf verlassen können. Nach seiner Rückkehr in die Staaten war Soto von Trauer und Verlustgefühlen verzehrt worden, und seine Gedanken hatten zwischen Selbstmord und Rache geschwankt und manchmal die schlimmsten Fantasievorstellungen heraufbeschworen.
Diese Gefühle hätten ihn beinahe aufgefressen. Aber nach einiger Zeit überwogen die schönen Erinnerungen. Er dachte an Malikas Stimme, in der sich stets ihre Stimmungen widergespiegelt hatten, eine Stimme, die tief und rauchig klang, wenn sie ernst war, und mädchenhaft und hoch, wenn sie ausgelassen war. Er erinnerte sich an ihre Leidenschaft für den Gesang und die Musik, an ihren Traum, in Amerika kleine Kinder zu unterrichten … und als seine Frau selbst Kinder zu haben. Sotos Geschäfte, seine Innovationen, befriedigten eine Leidenschaft, die seit seiner Kindheit in ihm loderte. Aber das Unity Project hatte er ihr zu Ehren ins Leben gerufen. Ein Licht, das der tiefen Dunkelheit entsprang, die ihr Tod hinterlassen hatte.
Entspann dich. Glaub daran. Am Ende wird etwas Gutes daraus entstehen …
»Adrián.«
Er spürte, wie Chloes Hand seinen Arm berührte.
»Sie schaut uns von irgendwo zu«, sagte die Anwältin mit sanfter Stimme. »Ich weiß es.«
Soto war immer noch in Gedanken versunken. Bei der Gründung von Unity hatte er nicht allzu viele Erwartungen gehabt. Es war schon schwer genug gewesen, nur einen einzigen Tag zu überstehen, geschweige denn, irgendwelche Zukunftspläne zu schmieden. Trotz des plötzlichen Erfolgs von Cognizant Systems, der Comtech-Firma, die er nur wenige Jahre zuvor mit zwei zivilen Mitarbeitern seines früheren nachrichtendienstlichen Koordinationsteams gegründet hatte, trieb er die Expansion nur langsam, aber dafür systematisch voran. Mit derselben Besonnenheit leitete er auch die Stiftung. Zunächst hatte das Unity Project seinen Sitz in einem gemieteten Ladenlokal in der East 114th Street gehabt, dessen Secondhand-Tresen mit ehrenamtlichen Helfern besetzt waren. Sotos Philosophie, Menschen mit unterschiedlicher religiöser, ethnischer und sozioökonomischer Herkunft durch »teilhabende Aufklärung« – ein spenderfreundlicher Begriff für gemeinnützige Gruppenaktivitäten – zusammenzubringen, hatte sich auch dann noch weiterentwickelt, als er sie bereits in die Tat umgesetzt hatte. Er verfolgte bedächtig, aber stetig sein Ziel, indem er einen Schritt nach dem anderen machte.
Mit der gleichen Zurückhaltung hatte Soto auch an jenem heißen Augustabend seine Begeisterung gezügelt, als die Stiftung genügend Gelder gesammelt hatte, um in ein anderes Gebäude zu ziehen. Er bewahrte den ganzen Spätherbst über seine Ruhe, selbst als er in der Gegend von East Harlem, in der er aufgewachsen war, die perfekte Immobilie gefunden hatte. Erst nach dem Vertragsabschluss an einem verschneiten Morgen Ende März hatte er sich eingestanden, dass ihr Vorhaben Wirklichkeit geworden war, aber selbst dann versuchte Soto, gelassen und vernünftig zu bleiben.
Heute allerdings …
Heute fiel es ihm schwer, seine Gefühle zurückzuhalten. Malika hatte oft von den neun Himmelssphären gesprochen. Er hingegen war sich nicht mal sicher, ob es überhaupt ein Leben nach dem Tod gab, einen einzigen Himmel, von dem aus sie auf ihn herabschauen konnte. Er wusste zwar nicht, ob sie ihn beobachtete. Aber er konnte ihre Gegenwart spüren. Sie war heute bei ihm, auf irgendeine Weise.
»Na los«, sagte Chloe und ging zu ihrem Schreibtisch. »Das Leben hat dir Zitronen geschenkt. Jetzt musst du Limonade daraus machen.«
Soto starrte in die Ferne. Früher hätte er vielleicht eine ironische Version des Sprichworts benutzt, irgendwas von Tequila und Salz gesagt. Aber jetzt verzichtete er darauf. Dieser Wendepunkt in seinem Leben war kein Grund für Sarkasmus, dieses Ereignis, das er bis ins kleinste Detail geplant und vorbereitet hatte.
Soto setzte sich auf Chloes Stuhl, griff nach seiner Brieftasche und nahm seine Onlinebanking-Karte heraus, um fünfzig Millionen Dollar auf ein Treuhandkonto zu überweisen, das für den Bau des Stiftungszentrums eingerichtet worden war. Nach einem Moment holte er tief Luft. »Amor mìo, hago esto por ti, y para ti.«
Die Anwältin sah ihn fragend an. Als er merkte, wie sie ihn wortlos anblickte, warf er ihr ein versonnenes Lächeln zu.
»Eine Art privater Trinkspruch«, sagte er. »Denn an diesem Morgen, Chloe, koste ich von dem süßesten Wein.«
Sie lächelte und verlangte keine weitere Erklärung, während Soto die Webadresse seiner Bank eintippte.
Fünftausend Meilen entfernt, in Satu Mare, Rumänien, holte Drajan Petrovik zum entscheidenden Schlag aus.
III
Während Petrovik vor seinem Laptop wartete, bat er Carla, ihm einen cafea turcească zu bringen und einen eisgekühlten Raki, um damit den Kaffee hinunterzuspülen. Auf seinen Kopfhörern lauschte er dem dröhnenden Stakkato von Apocalypticas »Betrayal/Forgiveness«, mit seinen wilden elektrischen Cellos und hämmernden Drums.
Um genau 11:15 Uhr New Yorker und 19:15 Uhr rumänischer Zeit informierte ihn eine Mitteilung auf dem Bildschirm darüber, dass Adrián Soto jetzt online war. Petrovik nahm den Kaffee vom Tablett und atmete durch die Nase seinen intensiven, aromatischen Duft ein. Er nahm einen Schluck davon und kippte dann den Raki hinterher; er genoss das Aufeinandertreffen von Hitze und Kälte in seinem Mund und das Gefühl, wie sich der Anisschnaps mit dem süßen Kaffee vermischte.
Drajan hatte zwei Browserfenster geöffnet; das größere der beiden zeigte genau das, was Soto gerade auf seinem Bildschirm sah: die gefälschte Website, zu der der Geschäftsmann weitergeleitet worden war. In dem anderen Fenster wurde das Sicherheitszertifikat einer Zertifizierungsstelle angezeigt, die Drajan gehackt hatte, sodass ein HTTPS-Protokoll, wie es von seriösen Finanzinstituten benutzt wurde, in Sotos Adressleiste erschien. Denn Drajan wusste, dass ein unsicheres HTTP-Protokoll – ohne das S am Ende – einer aufmerksamen Zielperson verraten würde, dass es sich um eine gefälschte Website handelte. Bei Soto war dieses zusätzliche Täuschungsmanöver angebracht.
Drajan richtete sein Augenmerk auf das kleinere Fenster links auf dem Bildschirm. Eines der ersten Tools von Hekate, das dekomprimiert wurde, war ein Remote-Access-Trojaner, der die Webcam des entfernten Computers aktivierte. Drajan konnte in dem Fenster jetzt deutlich Sotos Gesicht sehen.
Der Geschäftsmann wollte die Daten für die Überweisung selbst eingeben und hatte nicht seine Anwältin damit beauftragt. Obwohl Petrovik nicht damit gerechnet hatte, war er froh, dass er das gültige Sicherheitszertifikat besorgt hatte.
Er nahm erneut einen Schluck Kaffee und dachte nach. Als Stella Hekate auf Chloe Bernes Rechner installiert hatte, hatte sich das Programm tief in die Registry gegraben und unbemerkt seine Exploits laufen lassen, um durch die Hintertür seine anderen Tools einzuschleusen.
Beim Durchsuchen der Festplatte hatte Petrovik festgestellt, dass das Leben der Anwältin aus wohlgeordneter Langeweile bestand. Auf dem Computer gab es Fotos von ihrer Wohnung, ihrem Ferienhaus, ihren zwei Katzen, von ihren Reisen und ihrer Familie. Sie hatte eine Tochter im Teenageralter, die kürzlich an der Brown University angenommen worden war, und einen Ex-Mann, mit dem sich zu versöhnen sie mehrfach vergeblich versucht hatte. Ihr Liebesleben war eine gähnende Leere. Unlängst hatte sie sich bei einer Partneragentur für Leute in gehobenen Positionen angemeldet.
Es war ein Kinderspiel für Petrovik gewesen, das simple, standardmäßige Verschlüsselungsprogramm des Computers zu überwinden und sich Zugriff auf die Finanzdaten ihrer Klienten zu verschaffen. Berne hatte Sotos Bank-Passwort zwar nicht gespeichert – das hätte Drajan auch überrascht –, aber Hekate fand heraus, über welches Geldinstitut Cognizant Systems und das Unity Project ihre Transaktionen abwickelten, eine Geschäftsbank namens H&L Trust. Sobald Hekate die Buchungsplattform der Bank identifiziert hatte, hatte es das System mit jeder Menge inaktiver Malware infiltriert.
All das war passiert, während Petrovik die Dateien durchsucht hatte. Als Soto dann die Webadresse seiner Bank eintippte, leitete Hekate die Verbindung von der Seite zu einem Botnet oder Zombie-Server in Belgien um. Dieser wiederum leitete ihn zu der gefälschten Website auf einem Zombie-Rechner in Nordkorea weiter. Aufgrund der zweifachen Weiterleitung war es schwer, die IP-Adresse des Hosts und damit seinen Standort zu ermitteln.
Petrovik hatte jetzt die Kontrolle über Sotos Transaktion. Bis hierhin war alles automatisch passiert; Hekate hatte, während es seinen elektronischen Lebenszyklus durchlief, die programmierten Befehle ausgeführt. In der nächsten Phase seines heimlichen Manövers hingegen würde Petrovik aktiv eingreifen. Das versetzte ihm jedes Mal einen Adrenalinstoß und bewahrte ihn vor der Langeweile, die bei der Computerarbeit leicht aufkommen konnte.
Er leerte den Rest seines Kaffees, setzte die Tasse auf der Untertasse ab und beugte sich vor, um in dem kleineren Browserfenster das Gesicht des Geschäftsmanns zu betrachten. Wie wurde Soto noch mal in den Nachrichten genannt? La Piedra. Der Fels von East Harlem. Er hatte breite, kräftige Kiefer, markante Wangenknochen und einen selbstbewussten Gesichtsausdruck. Der Spitzname passte gut zu ihm.
Petrovik hatte für seine Dienste eine Million Dollar im Voraus verlangt und einen großen Anteil vom Kuchen nach der Durchführung des Auftrags, und Koschei hatte nichts dagegen einzuwenden gehabt. Aber es ging den Russen nicht nur darum, Soto um das Geld zu erleichtern. Sie wollten ihn persönlich treffen, was die Aktion umso befriedigender machte. Es bereitete ihm großes Vergnügen, diesen unerschütterlichen Fels zurechtzustutzen.
Petrovik wandte sich in Emils Richtung. »Bereit?«
Emil nickte, während er auf die echte Login-Seite von H&L Trust starrte. Er saß an dem Arbeitsplatz rechts neben ihm und war so konzentriert, dass sein blasses, schmales Gesicht noch hagerer als sonst wirkte. Geistesabwesend befingerte er den Ohrstecker in seinem linken Ohr – einen stilisierten Maya-Schädel mit Augen aus Diamantsplittern und einem Mund aus kleinen roten Rubinen.
Petrovik zuckte innerlich mit den Achseln. Solche Momente machten Emil stets nervös. Erst wenn der Job beendet war, konnte er wieder entspannen. Vermutlich würde er sich dann etwas sehr viel Stärkeres als Kaffee und Schnaps gönnen. Das Biohacking, das unter den technologie vampiri zu einem extravaganten Statussymbol geworden war, hatte sich in Europa inzwischen zu einem Trend entwickelt und schwappte jetzt über den Atlantik in die Vereinigten Staaten hinüber.
Drajan war die Underground-Szene der Cybermods alles andere als fremd. Er war stiller Teilhaber eines Stim Club in Bukarest und fand die gesteigerte sensorische und kognitive Wahrnehmung, die durch eine Kombination aus Nervenimplantaten und nootropischen Drogencocktails erzeugt wurde, durchaus verlockend. Allerdings erlitten viele Konsumenten der neuesten Cocktails ein Burn-out, man konnte sie an ihren eingesunkenen Augen und ausgemergelten, bleichen Gesichtern deutlich erkennen. Und der veränderte Bewusstseinszustand, den sie im Wechselspiel mit anderen Gästen in den Hinterzimmern der Clubs erlebten, beschleunigte diesen Prozess noch. Ein Mensch konnte die Reizüberflutung des Frontallappens und des zentralen Nervensystems nur eine gewisse Zeit ertragen. Es gab Hinweise darauf, dass diese Aktivitäten einen völligen Verlust der Selbstwahrnehmung zur Folge haben konnten. Diese durch äußere Reize herbeigeführte Wahrnehmungsstörung konnte im weiteren Verlauf dazu führen, dass man vergaß, wie das eigene Gesicht im Spiegel aussah, dass man seine Arme und Beine nicht mehr spürte oder man seinen Körper mit dem eines anderen Menschen verwechselte.
Petrovik war nicht Emils Kindermädchen. Trotz ihrer Beziehung und gemeinsamen Vergangenheit war Emil immer noch für sich selbst verantwortlich. Seine Ausschweifungen gingen Petrovik nur etwas an, wenn Emils Arbeit darunter litt. Aber das war bislang nicht der Fall gewesen. Dennoch hatte Petrovik stets ein wachsames Auge auf ihn.
Als er sich wieder der gefälschten Website zuwandte, sah er, dass Soto das System des Unity Project aufgerufen hatte und in zwei getrennte Eingabefelder seinen Benutzernamen und sein Passwort eintippte. Obwohl die Zahlen und Buchstaben auf der Kopie von Sotos Bildschirmmaske nur als Sternchen erschienen – wie das auch auf der echten geschehen wäre –, wurden sie auf Petroviks Monitor angezeigt.
Er neigte seinen Laptop, damit Emil Benutzername und Passwort sehen konnte und in ihr Eingabefeld tippte. Einen Moment, nachdem Emil sich eingeloggt hatte, erschien eine weitere Eingabemaske.
BITTEFÜHRENSIEIHREKARTEEIN
UNDGEBENSIEDENZUFALLSCODEEIN,
DERANDASLESEGERÄTGESENDETWIRD.
Petrovik tippte etwas in die Tastatur. Sotos Bank verwendete ein Sicherheitsprotokoll, das einen zufälligen Zahlencode generierte und zur Authentifizierung an ein Kartenlesegerät sendete. Er würde eine Kopie der Aufforderung auf der gefälschten Log-in-Seite anzeigen lassen.
Die Aufforderung auf der gefälschten Website sah genauso aus wie die echte auf Emils Bildschirm. Petrovik lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und beobachtete über die angezapfte Webcam, wie Soto seine Karte in das Lesegerät schob, seinen Authentifizierungscode erhielt und in den Computer eingab.
Petrovik nannte Emil den Code und wartete, während sein Freund die Zahlen in das Eingabefeld tippte. Auf dem Bildschirm erschien die Seite mit Sotos Überweisungsformular. Sie waren jetzt als Adrían Soto eingeloggt.
»Okay«, sagte Petrovik. »Lass ihn ein wenig zappeln.«
IV
Auf Adrián Sotos Rechner wurde folgende Mitteilung angezeigt:
AUFGRUNDHOHERSYSTEMBELASTUNG
KOMMTESZUVERZÖGERUNGEN,
WIRDANKENIHNENFÜRIHREGEDULD.
Darunter war eine digitale Zeitanzeige eingeblendet.
GESCHÄTZTEWARTEZEIT 6:00 MINUTEN.
Soto starrte auf den Bildschirm. »War ja klar«, sagte er mit finsterer Miene.
»Das Wochenende vom 4. Juli ist vorbei.« Chloe zuckte mit den Schultern. »Offensichtlich geht alles wieder seinen gewohnten Gang.«
V
Als die falsche Mitteilung zur Systemverzögerung auf Sotos Computer erschien, öffnete Petrovik auf seinem Laptop ein drittes Fenster und tippte rasch einen Befehl für den koreanischen Zombie ein, der seinerseits sofort eine Verbindung zum Webserver von H&L Trust herstellte. Hekates Python-Script und Sniffer-Software hatten sich drei Tage lang durch die Plattform der Bank gepflügt, und das Python-Script hatte seine Angriffs-Algorithmen wie Eier in den verschiedenen Schichten verteilt.
Jetzt öffneten sich auf Petroviks Kommando die Eier und überfluteten das System mit Web-Bots. Er drückte auf sein Touchpad. Eines der Fenster wurde minimiert, und es öffnete sich ein neues, mit einer Grafik, die den Datenfluss auf dem internen Netzwerk der H&L Trust anzeigte. Die grünen Linien bedeuteten, dass eine normale Datenmenge von den Portalen übertragen wurde, die orangenen, dass der Datenfluss überdurchschnittlich hoch, und die roten, dass das System überlastet war. Die ständig wechselnden Zahlenwerte längs der farbigen Linien zeigten die Art und Menge der Daten an, die in jedes Portal eingespeist wurden.
Nach nur wenigen Sekunden konnte Petrovik sehen, welche Wirkung sein Schwarm aus Bots hatte. Die meisten der grünen Linien wurden eine nach der anderen erst orange und dann rot.
Mit konzentriertem Blick und zusammengepressten Lippen neigte er zufrieden den Kopf. Hekate leistete ganze Arbeit. Das System der Bank signalisierte, dass sämtliche Bereiche dem Angriff ausgesetzt waren.
Er hoffte, dass die Personen, die in einem solchen Fall Schutzmaßnahmen ergreifen sollten, die Warnzeichen bemerkten.
Das heißt, eigentlich rechnete er fest damit.
VI
Voller Stolz und Zärtlichkeit betrachtete Alex Michaels seine Kleine, während er dachte, dass sie jetzt so weit sei.
»A’kou!«, befahl er, während er die Nylonleine in der Hand hielt. Er hatte noch reichlich Spiel, und die abgewickelte Leine lag in einer geraden Linie hinter ihm auf dem Boden.
Julia, eine große Schäferhündin der Körklasse I, blickte ihn mit ihren intelligenten braunen Augen an. Ihre Körper-sprache verriet Motivation und Selbstvertrauen, ohne dass sie allzu aufgeregt wirkte.
So sollte es sein, dachte Alex. Meistens konnte er erkennen, welches Tier mal einen guten Diensthund abgeben würde, und er war überzeugt, dass sie alles dafür mitbrachte – mehr als jeder andere Hund, den er bisher trainiert hatte. Julia war etwas Besonderes. Er hatte das bereits gespürt, als sie noch ein Welpe gewesen war.
Julia war jetzt neunzehn Monate alt und würde in vier Wochen die SchH2-Zwischenprüfung absolvieren. Die Prüfung bestand aus drei Phasen – Unterordnung, Schutzdienst und Fährtensuche –, und Alex glaubte, dass sie die ersten beiden mühelos meistern würde.
Aber die Fährtensuche zeichnete sich durch ein paar besondere Aspekte aus. Es war die einzige Phase der Schutzhundprüfung, die den Instinkten des Tieres zuwiderlief. Seine genetische Veranlagung hielt es davon ab, die ganze Zeit mit der Nase am Boden zu schnüffeln. Als Jäger war es darauf programmiert, am Boden und in der Luft die Witterung der Beute aufzunehmen. Wenn ein Hund bei der Fährtensuche einen Fußabdruck aufspürte, nahm er ihn meistens nur als Beeinträchtigung im Erdreich oder Gras wahr. Frei liegendes Erdreich, zerquetschte Insekten, Pollen, Wurzeln: Nichts davon deutete auf Nahrung hin. Seinem natürlichen Trieb folgend, würde der Hund ihnen keine Beachtung schenken und dann in der Luft nach einem schmackhaften Kaninchen schnüffeln. Falls Julia das während der Fährtensuche tat, falls sie die Pflicht ihren Instinkten unterordnete, würde sie die Prüfung nicht bestehen.
Sie hatte ihre Nase tief ins Gras gesteckt, was ein vielversprechender Anfang war. Alex ließ sie das Tempo und den Rhythmus bestimmen und führte sie an der langen Leine, während sie ruhig den Spuren folgte. Julia musste ein gleichmäßiges Energielevel halten, geistige Ausdauer zeigen und ihre Aufgabe mit höchster Konzentration bewältigen.
Mühelos fand sie den ersten Gegenstand, hielt inne, beschnüffelte die Schuhsohle und nahm sie auf, dort, wo Alex sie unter einer dünnen Schicht Erde vergraben hatte. Er blieb stehen und wartete, dass sie die Sohle zu ihm brachte. Als Julia bei ihm war, setzte sie sich sofort vor ihm aufrecht hin.
»Tov kelev«, lobte Alex sie. Er nahm der Hündin die Ledersohle aus dem Maul, verkürzte die Leine und signalisierte ihr, mit der Aufgabe fortzufahren.
Julia gehorchte aufs Wort. Etwas weiter vorne spürte sie den zweiten Gegenstand auf, zeigte ihn und brachte ihn zurück, wartete auf Alex’ Zeichen und lief erneut voraus.
Der erste Winkel, das heißt die erste Kurve, kam nach etwa der Hälfte des Parcours, was über die Anforderungen für die Prüfung hinausging. Als Julia ihn umrundete, spürte Alex, wie das Smartphone in seiner Jeanstasche vibrierte.
Wer auch immer das ist, er kann warten. Beende erst die Übung.
Doch entgegen seiner eigenen Aufforderung griff Alex nach dem Handy in seiner Tasche und warf einen Blick auf den Namen des Anrufers.
»Leo, was gibt’s?«
»Hey, Professor. Was treibst du gerade? Führst du den Hund Gassi?«
»Aber sicher doch«, sagte er. »Und ihr macht nichts anderes, als Videospiele zu zocken.«
»Hör zu, ich will dir ja nicht auf die Nerven gehen. Aber wir brauchen deine Hilfe.«
Alex schwieg. Er hatte schon öfter den Eindruck gehabt, dass Leo Harris, sein Ansprechpartner beim FBI – mit dem offiziellen Titel Special Agent in Charge der New Yorker Abteilung für Cyberkriminalität und Spezialeinsätze –, ein angeborenes Talent dafür hatte, anderen auf die Nerven zu gehen.
»Erzähl mir, was los ist«, sagte er.
»Wir haben es mit einem DDoS-Angriff zu tun, der gerade in vollem Gang ist. Bei einem großen Geldinstitut. Ich dachte, du könntest vielleicht deine Computerfreaks zusammentrommeln.«
Alex blieb stehen und nahm Julia an die kurze Leine. »Ich habe keine Ahnung, wie viele Studenten gerade in der Stadt sind. Es ist kurz nach dem 4. Juli. Da sind viele noch im Urlaub …«
»Ich habe auch einen Kalender«, sagte Harris. »Ich habe diesen Ferago schon angerufen. Er ist bereits auf dem Weg zum Campus.«
Alex gab ein Knurren von sich. Bryan Ferago, sein talentiertester Student aus dem Aufbaustudium, hatte bei Leos Sondereinheit ein Praktikum absolviert und sich auch schon früher um Hackerangriffe auf Banken gekümmert.
Alex blickte Richtung Parcours und hob kurz den Unterarm, um Julia das Sitz-und-Platz-Zeichen zu geben. Sie gehorchte sofort.
»Der Angriff«, sagte er. »Wer hat ihn bemerkt?«
»Die hausinterne Abteilung der Bank für Internetsicherheit. Dieser Angriff ist eine ziemlich heikle Angelegenheit.«
»Und man hat dir die Sache zugeschustert?«
»Genau. Deine Freunde vom DSAC.«
Alex stand da und dachte nach, während eine Windböe, die vom Long Island Sound herüberwehte, seinen dichten roten Haarschopf zerzauste. Als ehemaligen Leiter des Domestic Security Alliance Council überraschte es ihn nicht, dass die Informationen von dort gekommen waren. Es handelte sich um eine vom FBI gegründete Organisation, die dem Austausch von Sicherheitsinformationen mit der Privatwirtschaft diente, um die nationale Infrastruktur zu schützen. Zu ihren Mitgliedern gehörten einige der größten Unternehmen und Geldinstitute des Landes. Dank seines ursprünglichen Postens in der Führung der Organisation sollte Alex die Leitung von Präsidentin Fucillos neu gegründeter Regierungsabteilung für Cybersicherheit übernehmen, falls sie es überhaupt schaffte, ihre Net-Force-Initiative gegen den Widerstand der Behörden durchzusetzen und die Zustimmung des Kongresses zu gewinnen.
»Wer ist Ziel des Angriffs?«
»Die H&L Trust«, sagte Harris. »Eine protzige Geschäftsbank. Angeblich gibt es eine Verbindung zu dem Skandal um die Volke-Bank in Deutschland.«
Alex hatte bemerkt, dass der Agent mürrischer als sonst klang. Er glaubte, dass er jetzt den Grund dafür kannte.
»Denkst du, dass Outlier dahintersteckt?«, sagte er.
Harris stieß ein Knurren hervor. »Sie könnte es schon davor geplant haben. Die Sache trägt eindeutig ihre Handschrift.«
Sie? Vor was? Die Sache war größer, als Alex vermutet hatte. »Woher weißt du das …?«
»Ich weiß, dass es sich um eine Frau handelt, weil die Jungs von der CIA sie in Gewahrsam genommen haben.«
Alex schnappte nach Luft. »Wo?«
»Auf Malta. Aber vielleicht ist sie inzwischen schon wieder woanders. Denn es gibt eine Menge Leute an einer Menge verschiedener Orte, die mit ihr sprechen wollen. Und plötzlich will von denen keiner mehr mit mir reden.« Harris schwieg einen Moment. »Prof, aber wir müssen reden. Persönlich. Wo zum Teufel steckst du gerade?«
»In Westchester.«
»Auf dem Trainingsgelände?« Harris knurrte. »Also führst du tatsächlich den Hund Gassi?«
Alex richtete die Schultern auf. »Gib mir eine Stunde«, sagte er. »Wir treffen uns in meinem Labor.«
2
Birhan, Niltal, Afrika
5. Juli 2023
I
Yunes Abrika hielt sich weder für einen Regimekritiker noch für einen Unruhestifter. Er verstand zwar, warum die Medien ihm dieses Etikett verpasst hatten, aber er wehrte sich gegen jede Form von Schubladendenken, weshalb diese Begriffe für ihn kaum von Bedeutung waren. Sie wiesen lediglich auf ein Problem hin, das sein Land von innen heraus zerfraß. Zwar unterstanden die Fernseh- und Radiosender in Birhan keiner direkten staatlichen Kontrolle, aber sie wurden von Prinz Negassies engsten Freunden, Verwandten und politischen Verbündeten geleitet. Sie verdrehten die Wahrheit, wie es ihnen gerade passte, und verunglimpften die Leute, die gegen den Prinzen die Stimme erhoben, als politische Extremisten.
Nach all dem Blutvergießen auf dem Weg zur Unabhängigkeit und den Versprechungen, für eine unabhängige Presse und freie Wahlen zu sorgen – warum hatte den Führer seines Landes plötzlich der Mut verlassen? Birhans Regierung verwandelte sich immer mehr in ein Abbild der verhassten Autokratie im Sudan … und, wie er fürchtete, zu einer Schachfigur in den geopolitischen Machtspielen fremder Mächte auf anderen Kontinenten.
Abrika zügelte seine Gedanken. Sie waren ebenfalls maßlos übertrieben. Prinz Negassie war weder ein Tyrann noch ein Feigling. Er hatte dem Schlächter al-Baschir und seiner Nationalen Kongresspartei die Stirn geboten. Die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die ihn von seinem Kurs abgebracht hatten, waren überaus kompliziert. Abrika hütete sich, die Dinge allzu sehr zu vereinfachen. Sonst würde er in dieselbe Falle wie seine Kritiker tappen.
Er stand jetzt, mit dem Rücken gegen die Fliegengittertür gelehnt, auf seiner Veranda und ließ den Blick über die jungen Männer und Frauen wandern, die zu seinem geräumigen Haus am Flussufer gekommen waren. Einige von ihnen unterhielten sich, während sie warteten, einige schlürften wortlos den eisgekühlten karkadeh seiner Frau Sekura, ihre spezielle Mischung aus Hibiskustee und Gewürzen. Seine Anhänger wurden sie genannt. Ebenfalls ein irreführender Begriff. Die meisten von ihnen waren Studenten an der Zayar University, wo Abrika Kulturgeschichte unterrichtete. Außerdem waren darunter einige Dozenten und Leute, die seine Artikel gelesen hatten. Bislang waren fünfzehn Personen erschienen, und es wurden drei oder vier weitere Teilnehmer erwartet. Sie gehörten keiner bestimmten politischen Bewegung, Religion, Rasse oder Stammesgruppe an. Hier waren sämtliche Hautfarben, von hell- bis dunkelbraun, vertreten. Es handelte sich um Bedscha, Kopten, Shukria, Qahtani und Baggara, eine bunte Mischung verschiedener Ethnien, die einen halbwegs repräsentativen Querschnitt von Birhans Bevölkerung darstellten.
Yunes Abrika war stolz darauf. Für die Gründung ihres Staates war ein beispielloser Zusammenschluss von Stämmen und politischen Interessen erforderlich gewesen. Sowie Tausende von Todesopfern. Die Kollegen und jungen Menschen, die zu seinen Versammlungen kamen, erwiesen den Toten mit ihrer Anwesenheit die Ehre. Sie forderten mit einer gemeinsamen Stimme, dass man den grundlegendsten Verfassungsauftrag – die Durchführung freier Wahlen – in die Tat umsetzte.
Er schenkte sich ein zweites Glas eisgekühlten Tee ein und nippte daran. Köstlich, dachte er. Das half gegen die Sommerhitze und Feuchtigkeit.
Als Abrika sein Glas erneut an die Lippen hob, hörte er draußen Stimmen. Laute, aufgeregte Männerstimmen, dann die unverkennbare Salve einer automatischen Waffe. Einen Moment später ertönte ein verzweifelter Schrei – diesmal von einer Frau –, gefolgt von einer weiteren Salve. Der Schrei verstummte.
Sekura, dachte er. Sie war nach draußen gegangen, um ein paar Neuankömmlingen das Tor zu öffnen.
Er ließ das Glas aus der Hand fallen, sodass sich das Eis und der Tee über den Boden ergossen, und drehte sich zur Verandatür um.
II
Leutnant Kadidu Tanzir starrte in der Dunkelheit auf die Leichen hinunter – auf die zwei Männer, die Richtung Vorhof gelaufen waren, und die Frau, die am Eingangstor gewartet hatte; sie lagen mit ausgestreckten Armen und Beinen in Blutlachen, die sich um sie herum ausbreiteten. Der schwarz gekleidete Soldat, der das Feuer eröffnet hatte, stand, sein R6-Sturmgewehr immer noch auf die Toten gerichtet, knapp einen Meter entfernt auf dem Kiesweg, der von der Straße zum Haus führte.
»Idiot!«, zischte Tanzir. »Was hast du getan?«
Der Soldat mit dem Namen Uksem drehte sich zu ihm um. Neben ihm, am oberen Ende des Wegs, standen die sechs anderen Männer ihres Trupps wie zu einem Gemälde erstarrt.
»Ich dachte, sie hätten Pistolen«, sagte Uksem. An seinen Wangen lief Schweiß herunter. Er ließ den Lauf seines Gewehrs zu dem Mann wandern, den er als Erstes erschossen hatte, einem groß gewachsenen Mann mit einem T-Shirt, dessen Vorderseite die rot-orange Fahne Birhans mit dem Schriftzug der Zayar University zierte. Das T-Shirt klebte jetzt an seinem Körper und war blutdurchtränkt. »Ich war mir sicher …«
Leutnant Tanzir riss seine 9-mm-Pistole aus dem Halfter, packte Uksem am Kragen seines Uniformhemds, zog ihn zu sich heran und drückte die Waffe gegen seinen Bauch.
»Du bist ein Idiot und ein Lügner«, sagte er und bemerkte, dass Uksems Pupillen stark geweitet waren. »Du hast dieses Zeug gekaut. Ist dir eigentlich klar, was du da angerichtet hast?«
Der Soldat öffnete den Mund, bevor er ihn mit ängstlich aufgerissenen Augen wieder schloss. Sein Atem, seine Haut und seine Kleidung verströmten den bitteren Gestank von Kathblättern.
Tanzir murmelte einen Fluch. Vermischt mit Adrenalin verwandelte die verbotene Droge einen Soldaten in einen Dummkopf mit nervösem Zeigefinger. Die Männer am Boden hatten vor dem Tor zum Hof gestanden, als derjenige mit dem T-Shirt bemerkt hatte, wie sich der Trupp ihnen von den Toyota-Geländewagen aus näherte. Er hatte sich verwundert umgedreht und seine Freunde aufgefordert, die Leute im Haus zu warnen. In diesem Moment hatte Uksems Gewehr Feuer gespuckt und die beiden niedergemäht, während sich das Tor geöffnet hatte und die Frau schreiend herausgestürzt war.
Darauf hatte sein Gewehr erneut Feuer gespuckt, und die Frau war verstummt und neben den beiden anderen zu Boden gesunken.
Das alles hatte nur ein paar Sekunden gedauert.
Leutnant Tanzir war ein erfahrener Soldat. Er hatte viele Menschen durch Waffengewalt sterben sehen. Wenn sie hinfielen, bewegten sie sich meistens nicht von der Stelle, sondern sanken wie die drei hier direkt zu Boden. Wie Gottes hilflose Marionetten, deren Schnüre zum Himmel man durchtrennt hatte.
Er stieß zwischen seinen Zähnen einen Schwall Luft hervor. Abrika und seine Leute hatten das Spektakel bestimmt gehört. Und jetzt?
Sein Verstand arbeitete auf Hochtouren. Er hatte den Befehl, Abrika und seine Unterstützer aufzuscheuchen. Ihr Treffen aufzulösen und sie einzuschüchtern. Aber sie sollten dabei weder verletzt noch verhaftet werden.
»Eigentlich sollte ich dich auf der Stelle töten«, sagte er und versetzte Uksem einen Stoß, worauf dieser zurückwankte. Er war kurz davor, seiner Wut Luft zu machen und den Abzug der Pistole zu drücken, die er auf den Bauch seines Gefreiten gerichtet hatte.
Stattdessen nahm er die Waffe herunter und senkte sie zu Boden, während er durch das Tor in die mondlose Dunkelheit spähte. Er hatte ein Geräusch gehört, das wie eine Schiebetür klang, die aufgezogen wurde. Dann ertönten auf der anderen Seite des Hofes Stimmen.
Eine Baumgruppe zwischen dem Leutnant und dem Haus des Lehrers versperrte ihm teilweise die Sicht. Aber er kannte von Geheimdienstfotos den Grundriss des Grundstücks. Das große, einstöckige Haus befand sich am Ende des Fußwegs, und der zehn Meter entfernte Haupteingang hinter den Bäumen ging nach Norden hinaus. Das Wohnzimmer, in dem Abrika seine Treffen abhielt, befand sich hinter der Veranda auf der Ostseite des Hauses. Er und seine Leute würden es auf dieser Seite verlassen und in die Richtung laufen, aus der Uksems Schüsse gekommen waren.
Leutnant Tanzir wusste, dass er sofort eine Entscheidung treffen musste. Ihm blieb kaum Zeit, um überhaupt nachzudenken.
Er schaute zu Nabat, seinem Unteroffizier. »Lauft zurück zu den Autos. Und nehmt Uksem mit – ich will nicht, dass der Blödmann noch mehr Ärger macht. Im Kofferraum ist ein Sack mit Pistolen. Ihr wisst schon, welche ich meine.«
Nabat sah ihn an und nickte kurz. Es handelte sich um Waffen, die sie bei ihren Einsätzen beschlagnahmt hatten.
Leutnant Tanzir schaute auf den jungen Mann mit dem Universitäts-T-Shirt hinunter. »Drückt ihm eine der Pistolen in die Hand. Aber passt auf, dass ihr keine Fingerabdrücke hinterlasst. Und bringt auch die anderen Pistolen mit.«
Nabat nickte erneut und eilte mit Uksem hinaus in die Nacht. Umgehend wandte sich der Leutnant an seine Männer. »Gehen wir«, befahl er. »Und tut genau, was ich euch sage.«
Einen Moment später rannte er durch das Tor.
III
Yunes Abrika sprang von der Veranda auf den weitläufigen, grasbewachsenen Hof und lief zur Vorderseite des Hauses weiter. Die Männer und Frauen, die zu seinem Treffen erschienen waren, folgten ihm.
Als Abrika um die Hausecke bog, sah er, wie etwa ein Dutzend dunkler Gestalten vom offenen Eingangstor auf ihn zumarschiert kamen. Und auf dem Weg dahinter …
Sein Herz verkrampfte. Auf dem Weg lagen mehrere Leichen. Er konnte in der Dunkelheit jedoch weder erkennen, wie viele es waren, noch die einzelnen Personen voneinander unterscheiden. Aber er hatte Sekura gehört. Den Klang ihrer Stimme erkannt. Er wusste, dass sie unter den Toten war.
Abrika hatte kaum eine Chance zu reagieren, bevor die Gestalten mit ihren Sturmgewehren im Anschlag ihn erreichten. Es handelte sich um Soldaten, die die grau-schwarzen Nachttarnuniformen und Barette der Civil Defense Force trugen. Seitlich an der Mütze des Soldaten, der einen Schritt vor den anderen stehen blieb und jetzt am nächsten zu ihm stand, prangte das kleine rote Abzeichen eines Leutnants.
Abrika versagte die Stimme. Stumm vor Fassungslosigkeit und Entsetzen starrte er die Soldaten an. Plötzlich trat eine der Studentinnen, Layisa, nach vorne und stellte sich neben ihn.
»Ihr seid alqatala«, sagte sie, den Blick auf den Mann mit dem Abzeichen eines Leutnants gerichtet. Ihre Stimme zitterte vor Wut. »Mörder.«
Der Leutnant sah sie wortlos an. Während seine Männer mit angelegten Waffen abwarteten, bereit, das Feuer zu eröffnen, traten die anderen Mitglieder der Gruppe, die hinter Abrika stehen geblieben waren, ebenfalls vor. Erst einer, dann zwei und schließlich auch die Übrigen, bis sie den Soldaten in der Dunkelheit des Hofes Seite an Seite gegenüberstanden.
»Alqatala«, riefen sie schließlich im Einklang, in einem lauten, rhythmischen Sprechchor. »Alqa-tala, alqa-tala …«