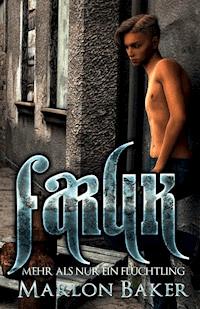Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mysteria Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Band 1: Im Herbst 2013 kam ein alter Mann auf Marlon Baker zu, mit der Frage, ob er aus seinen Erinnerungen ein Buch machen könnte. Marlon erhält ein handschriftliches Tagebuch von dem Mann, das ihn sofort in den Bann zieht. Neben den zahlreichen schriftlichen Aufzeichnungen gibt es aber auch Fotos zu sehen, die ihn erschüttern. Für Marlon Baker steht nach kurzer Zeit fest, dass er daraus ein Buch machen will, denn diese Geschichte muss seiner Meinung nach unbedingt erzählt werden, da sie doch Licht ins Dunkel bringt und dem Leser die Augen öffnet, wie es wirklich gewesen ist, als Jugendlicher im Konzentrationslager auf den Tod zu warten ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contents
Impressum
Widmung
Einführende Worte von Julian Glöckner
8. März 1944 - Mein 15. Geburtstag
13. März 1944 - Das erste Treffen der Hitlerjugend
20. März 1944 - Ringen macht Spaß!
21. März 1944 - Das heidnische Ritual
23. März 1944 - Martin … und ein Jude!
30. März 1944 - Veronika, die Hartgeldnutte!
10. April 1944 - Auch ich bin von diesem Fieber ergriffen!
30. April 1944 - Schabernack in der Hexennacht!
12. Mai 1944 - Die nächtliche Säuberung!
4. Juni 1944 - Das große Abenteuer lockt!
10. Juni 1944 - Ein Ende mit Schrecken!
11. Juni 1944 - Mein Martyrium beginnt!
12. Juni 1944 - Willkommen im Konzentrationslager!
20. Juni 1944 - Das überraschende Angebot!
21. Juni 1944 - Mitsommer!
24. Juni 1944 - Latrinentauchen!
3. Juli 1944 - Was essen wir da eigentlich?
9. Juli 1944 - Ein Hauptmann außer sich
1. August 1944 - Lammas, das Erntedankfest
5. August 1944 - Das Fleisch in der Suppe
19. August 1944 - Die Feinde vergiften wie die Ratten
23. August 1944 - Erste Anschuldigungen werden laut
31. August 1944 - Die Flucht beginnt mit einer Panne
1. September 1944 - Der Plan scheint aufzugehen
3. September 1944 - Auf Schleichwegen nach Berlin
4. September 1944 - Die Vagabunden
6. September 1944 - Berlin ist ein Schatten seiner selbst
7. September 1944 - Meine neue Familie
10. September 1944 - Die ersten Proben beginnen
21. September 1944 - Im Untergrund tut sich was
12. Oktober 1944 - Wie viel ist ein Menscheleben wert?
31. Oktober 1944 - Wohin soll das noch führen?
8. November 1944 - Die erste handfeste Auseinandersetzung
11. November 1944 - Der Ausflug nach Dresden
13. November 1944 - Samuel und die geheime Speisekammer
15. November 1944 - Werde ich meine Familie je wiedersehen?
18. November 1944 - Der Junge mit den zwei Gesichtern
19. November 1944 - Die Heimreise kommt früher als erwartet
21. November 1944 - Zurück in Berlin und doch nicht angekommen
6. Dezember 1944 - Die Zuschauer sind außer Rand und Band
Nachwort von Marlon Baker
Die Geschichte eines Paragrafen – Teil I
Marlon Baker
Neutrale
ZONE
Julians Tagebuch aus
dem Konzentrationslager
Band 1
Alle Texte, Textteile, Grafiken, Layouts sowie alle sonstigen schöpferischen Teile dieses Werks sind unter anderem urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, die Digitalisierung, die Farbverfremdung, sowie das Herunterladen z. B. in den Arbeitsspeicher, das Smoothing, die Komprimierung in ein anderes Format und Ähnliches stellen unter anderem eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung dar. Verstöße gegen den urheberrechtlichen Schutz sowie jegliche Bearbeitung der hier erwähnten schöpferischen Elemente sind nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Verlags und des Autors zulässig. Zuwiderhandlungen werden unter anderem strafrechtlich verfolgt!
© 2015 mysteria Verlag /www.mysteria-Verlag.de
Publishing Rights © 2015 Marlon Baker
E-Book-Erstellung & Cover:www.AutorenServices.de
Coverfoto von Lisa Spreckelmeyer, „Keine Chance“
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/deed.de Some rights reserved
Das Bild stammt aus der kostenlosen Bilddatenbankwww.piqs.de
»Es ist kein Verbrechen, geliebt zu haben, noch viel weniger ist es eines, geliebt worden zu sein.«
Dieses Buch ist all jenen gewidmet, die vor der Wahrheit nicht die Augen verschließen. Und natürlich auch all meinen Wegbegleitern in meinem ach so langen Leben.
Einführende Worte von Julian Glöckner
Ich habe mir nicht ohne Grund einen Autor gesucht, der aus meinen Aufzeichnungen ein Buch machen sollte. Denn jeder Tag könnte mein letzter sein, und ich will nicht, dass meine Erlebnisse in Vergessenheit geraten. Vielmehr möchte ich der Welt aufzeigen, wie es tatsächlich war, als Jugendlicher in einem Konzentrationslager zu laden, in dem du plötzlich nichts mehr wert warst.
Mit Marlon Baker habe ich einen Autor gefunden, der es verstand, was ich mit meinen Tagebuchaufzeichnungen erreichen wollte, und so bot er mir an, mich für das Buch zu interviewen. Ich sollte ihm mit meinen eigenen Worten schildern, wie es damals war, als ich als Fünfzehnjähriger in Gefangenschaft geriet, nur weil ich meinen Freund geküsst hatte.
In den letzten Monaten besuchte ich Marlon dann und wann und erzählte ihm jeweils eine Episode aus meinem Leben, dass mich so nachhaltig prägte. So entstanden viele Stunden Aufnahmen, woraus Marlon dann die Geschichte schrieb, die Sie nun zwischen zwei Buchdeckeln in Ihren Händen halten (oder als E-Book auf Ihrem Reader).
Manchmal legte ich Marlon auch Fotos vor, weil er mir oft nur kopfschüttelnd gegenübersaß, wenn ich ihm von den Ereignissen berichtete, die sich tatsächlich so zugetragen haben.
Durch die Fotos, die wichtige Zeitdokumente sind und meinen Aussagen, konnte sich Marlon ein Bild von dem machen, wie es damals war im Jahre 1944, als ich noch glaubte, mir stünden alle Türen offen.
Doch ich will hier der eigentlichen Geschichte nichts vorwegnehmen, um Ihnen die Spannung nicht zu verderben. Stattdessen überlasse es ich Ihnen, mir ein Stück weit zu folgen in meinem Leben. Und ich kann Ihnen versichern, dass Sie es nicht bereuen werden, sich für dieses Buch entschieden zu haben. Denn es wird Ihnen die Augen öffnen für das, was ein Jugendlicher ertragen musste, wenn er aus der Rolle fiel. Am Ende des Buches habe ich mir erlaubt, Ihnen den Werdegang eines Paragrafen aufzuführen, der auch noch jetzt mein Leben bestimmt.
Auch hier werden Sie Augen machen, wie sich dieser Paragraf in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat. Und doch bleibt ein bitterer Beigeschmack, da auch heute noch Menschen wegen ihrer Sexualität unterdrückt, angefeindet, verfolgt und sogar bestraft und getötet werden.
Und selbst im eigenen Land war es nicht immer einfach, sich zu seiner Sexualität zu bekennen. Denn auch heute noch stößt der schwule Mann vor allem auf eins: Ablehnung und Ausgrenzung; auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen.
Doch lesen Sie selbst, was mir alles widerfahren ist, bevor ich mich jetzt mit über 85 Jahren endlich in den Ruhestand begebe, mit der Gewissheit, dass meine Stimme Gehör finden wird.
8. März 1944
Mein 15. Geburtstag
Jetzt lebte ich schon seit über einem halben Jahr bei meinen Großeltern, die auf dem Land einen kleinen Bauernhof bewirtschafteten und der gerade einmal so viel Ertrag abwarf, um uns alle satt zu bekommen.
Das Dorf, in das ich verschickt worden war wie ein zur Last gewordenes Bündel, hatte vor dem Krieg knapp 800 Einwohner gezählt; doch die Zahl der Einwohner schrumpfte täglich — und das aus vielerlei Gründen.
Die meisten Männer waren eingezogen worden oder hatten sich freiwillig für den Einsatz an der Waffe rekrutieren lassen. Und seltsamerweise sahen es die meisten Männer als ihre Pflicht an, für die Ideologie der Nazis in den Krieg zu ziehen. Einem Krieg, der in den letzen Jahren auf der ganzen Welt wütete — und im Grunde schon als verloren galt. Doch darüber wollte natürlich niemand sprechen, so wie wir auch über andere Themen nicht laut sprechen durften, wenn wir nicht Gefahr laufen wollten, denunziert und dann deportiert zu werden, wie so viele vor uns.
Es gab keine einzige Familie mehr, die nicht ein Opfer zu beklagen hatte. Sogar mein Vater war in den Krieg gezogen, weil er sich hatte blenden lassen von den falschen Versprechungen, die niemals in Erfüllung gingen. Doch er hatte schon früh »Feuer gefangen« und war infiziert worden von dem Virus der Propagandamaschinerie, die Land auf Land ab in den Radiosendungen zu hören waren. Und wenn es nach Opa ginge, würde selbst ich längst irgendwo an der Front sitzen, um im Kreise meiner Kameraden den 15. Geburtstag zu feiern.
Ja, der 8. März 1944 war eigentlich ein Tag der Freude. Doch wie sollte ich all die Bilder vergessen, die ich gesehen hatte, als wir noch in Dresden wohnten. In einem schönen Haus, das nach dem Bombenhagel, wie der Rest der Elbflorenz, in Schutt und Asche lag. Wir hatten den Ort zum richtigen Zeitpunkt verlassen, an dem sich bislang mein gesamtes Leben abgespielt hatte.
Um wenigstens den Kindern ein Stück weit Normalität zu gewähren, hatte man schon sehr früh damit begonnen, uns Kinder aufs Land zu schicken. Viele lebten jetzt bei ihren Verwandten oder bei solchen, die es als lohnendes Geschäft ansahen, Kinder aus den Großstädten bei sich aufzunehmen. Doch in diesem Dorf, in dem ich jetzt lebte, gab es nur eine Handvoll Kinder. Und wahrscheinlich hätte es nahegelegen, dass wir uns zusammenraufen, statt getrennte Wege zu gehen oder gar Alleingänge. Ich war aber schon immer ein Einzelgänger gewesen — in Dresden noch mehr als hier. Denn den meisten anderen war ich einfach nicht geheuer, wie sie es nannten. Das lag wohl vor allem daran, dass ich für meine fünfzehn Jahre viel zu klein geraten war. Viel zu winzig. Viel zu mickrig.
Jeder, der mich ansah, hielt mich für einen Zwölf- oder Dreizehnjährigen; und was ich früher als Beleidigung oder Kränkung empfand, wenn ich als Kind abgestempelt wurde, sollte mir in den noch kommenden Wochen und Monaten den Arsch retten!
Schließlich war es auch bis zu uns vorgedrungen, dass sie längst damit begonnen hatten, Jugendliche zu rekrutieren — als Kanonenfutter an der Front! Kaum warst du sechzehn, hielten sie dich für alt und reif genug, in den Krieg zu ziehen, auch wenn du anderenorts nicht selten deiner Rechte beschnitten wurdest, wenn du noch nicht volljährig warst und dich der Erwachsenenwelt unterzuordnen hattest.
Jawohl, zu Befehl, mein Führer!
Der Nachschub an Soldaten musste schließlich gewährleistet bleiben, um das Ruder doch noch umzureißen, auch wenn viele ahnten, dass der Sieg auf verlorenem Posten stand. Und wie großartig hatte sich das noch zu Beginn angehört, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und dem Volk versprachen, dass das Deutsche Reich der Welt seinen Stempel aufdrücken wollte, wie es Vater nur allzu gern wiederholte. Und auch Opa wurde nicht müde, mir zu predigen, wenn wir mal wieder gemeinsam vor dem Radio hockten und den zahlreichen Reden und Versprechungen der Propaganda lauschten, dass das Deutsche Volk zu allem fähig wäre — selbst zur Weltherrschaft!
Doch im Grunde waren dies nur leere Versprechungen gewesen, die nicht (länger) eingehalten werden konnten. Jeder wusste es. Doch keiner muckte auf. Hitler und seine Herrscharen hatten längst das anvisierte Ziel aus den Augen verloren. Und mir schien, als betrieben sie diesen Krieg nur noch, um davon abzulenken, was im eigenen Land vor sich ging. Denn wer konnte schon leugnen, was wir sie gesehen hatten: All die Züge, mit den vielen Menschen, die in Kronzentrationslager deportiert wurden — auch welchen Gründen auch immer! Und es waren nicht nur Juden, denen sich ein Volk entledigen wollte.
Zuhause wollte dies aber niemand hören. Und ich tat gut daran, meine Zweifel nicht laut auszusprechen, und sie stattdessen besser für mich zu behalten. Auch wenn ich wie ein Kind aussah — und manchmal sicher auch wie eines wirkte —, so war ich aber auch ein Mensch, der sich seine eigenen Gedanken machte und nicht immer und allem Folge leistete, was von mir verlangt wurde. Ich dachte über gewichtige Dinge nach, hinterfragte sie zuweilen, die um uns herum geschahen … Und doch war auch ich zum Schweigen verdammt worden. Denn das sicherte einem das Überleben.
Und wenn erst einmal eine Bombe neben dir einschlägt, während du im dunklen Keller hockst und darauf hoffst, selbst keinen Schaden zu nehmen, und wenn du Dinge in deiner Straße, in deiner Stadt, beobachtest, über die man besser schweigt, statt sie zur Sprache zu bringen, so verändern dich diese Dinge mit der Zeit. Und mir war klar, dass ich in den Kriegsjahren schneller erwachsen werden musste, als in den Jahren zuvor. Schließlich musste doch auch ich heranwachsen, um früher oder später meinem Vaterland dienen zu können.
Doch bei mir sah das etwas anders aus. Mein knabenhafter Körper hatte wohl vorausgeahnt, was geschehen würde, und hatte mich daher stets um einen Kopf kleiner erscheinen lassen, als jeden anderen Fünfzehnjährigen, mit dem ich mir die Zeit vertrieb. Allerdings war ich in den letzten Monaten nicht wirklich warm geworden mit den Kindern aus dem Dorf; und meine Freunde in Dresden hatte ich alle zurücklassen müssen —
Nur mir Manuel, einem gleichaltrigen Jungen, hatte ich mich angefreundet. Manuel war der Sohn des einzigen Wirts im Dorf. Er war hier geboren und aufgewachsen und kein Stadtkind wie ich. Er kannte jeden Grashalm, jeden Baum, aber vor allem auch jene Verstecke, an denen sich ein heißer Frühlingstag am Nachmittag des 8. März aushalten ließ.
Schon vor einigen Tagen hatte er mir versprochen, mir eine Stelle im Wald zeigen zu wollen. Ich wusste, dass er die meiste Zeit im Wald verbrachte. Ich hingegen zog es vor, auf dem Heuspeicher zu liegen, auf einem Grashalm herumzukauen und meine Gedanken wandern zu lassen.
Im letzten Jahr hatte ich bereits begonnen, Tagebuch zu führen. Schon jetzt waren Dutzende Schulhefte vollgeschrieben, in denen ich all das festhielt, was mir wichtig erschien, oder über das ich mit niemandem sprechen konnte — nicht einmal mit Manuel.
Die Zeiten waren viel zu gefährlich, als dass man sich selbst denunzierte oder sich gar der Lächerlichkeit preisgab. Und das »sich gegenseitig denunzieren« war zu einer Art Volkssport geworden. Dann hätte ich mir auch gleich einen Strick drehen können, wenn ich jemanden in meinen Tagebüchern hätte lesen lassen. Nein, es gab Geheimnisse, die man nicht einmal seinem besten Freund verriet. Auch wenn Manuel und ich schon über viele Dinge gesprochen hatten, mit denen wir abends zu Tisch nie hätten kommen dürfen. Meine Großeltern wären schockiert gewesen, wenn ich ihnen schon jetzt die ganze Wahrheit über mich offenbart hätte. Und ehrlich gesagt, hatte ich es nicht eilig damit, irgendjemandem davon zu erzählen.
Ich wusste sehr genau, was auf mich zukäme, wenn ich den falschen Leuten erzählte, was in mir vorging, oder wie ich mich in den letzten Monaten verändert hatte. Eine Veränderung, die mir glücklicherweise nicht an der Nasenspitze anzusehen war —oder doch?Oma hatte mal gemeint, sie wüsste, wann ich log, da meine Nasenspitze dann ganz rot wurde. Doch eine Lüge hatte ich ihr in letzter Zeit nicht aufgetischt. Vielmehr schwieg ich mich aus.
Es hatte mich selbst aus den Latschen gehauen, als ich feststellte, dass mir Manuel mehr gefiel, als es unter Kameraden üblich war und es für einen Jungen gesund sein konnte. Zu Beginn hatte ich es stets auf die Pubertät geschoben oder auf einen Überschuss an Hormonen, die in meinem Körper verrückt spielten, wann immer wir zusammen waren und ich einen Steifen bekam. Ich versuchte, mir sogar einzureden, dass die Erektion nichts mit Manuel zu tun hatte, und dass ich nur deshalb einen Steifen bekam, weil mein Körper das so vorsah — als Leibesertüchtigung sozusagen!
Doch mir wurde sehr schnell klar, dass es eben nicht an der Pubertät lag, oder das irgendwelche Hormonschübe meinen Penis zu Leibesübungen anregen wollten. Vielmehr schien sich ein Gefühl in mir zu bestärken, vor dem ich mich mehr als alles andere fürchtete.
Vor einem Jahr hatte ich nicht einmal den Namen dafür gekannt. Sexualität war nie ein Thema bei uns gewesen, vielmehr ein mit Scham besetztes Tabu, das besser unausgesprochen blieb, wie so vieles, das ich in Erfahrung bringen wollte. Meine sexuelle Aufklärung — oder jedenfalls das, was ich davon in Erinnerung habe — vollzog sich in der Schule; weniger aber im Klassenzimmer, als vielmehr auf dem Jungenklo, und das war alles andere als das, was ich hätte hören oder sehen wollen.
Und unser Biologielehrer brachte es nicht nur einmal zur Sprache, dass es niederträchtig sei, eine gleichgeschlechtliche Beziehung einzugehen. Ein Wunder, dass er solche Abartigkeiten überhaupt ansprach.
Ja, abartig, widerwärtig, ekelhaft und abstoßend waren die Bezeichnungen, die er dafür in den Mund nahm, bis ich eher durch Zufall das Wort aufgriff, nachdem ich solange gesucht hatte. Ich hatte es in einer Radiosendung vernommen. Und das, was ich damals hörte, war beängstigend:
»Homosexuelle werden sich einer Therapie unterziehen müssen, um von ihrem frevelhaften Laster abzulassen … Auch Kastrationen können vorgenommen werden, um ihren perversen Sexualtrieb einzudämmen …«
Das waren keine rosigen Aussichten, die mich erwarteten, wenn ich es je laut ausspräche, dass ich mich selbst für einen Homosexuellen hielt, einen Perversen, einen Sodomit!
Doch anders konnte ich mir meine Gefühle für Manuel nicht erklären. Bislang hatte ich alles daran gesetzt, sie zu unterdrücken. Niemand sollte je erfahren oder gar wissen, wie ich geartet war.
ENTARTET nannten es jedenfalls die Nazis, ich jedoch nannte es LIEBE! Aber nur im Verborgenen, im Geheimen, wenn ich mal wieder mit mir alleine war und mir vorstellte, wie es sein könnte, jetzt mit Manuel gemeinsam hier im Heu zu liegen. Dann müsste ich gewiss nicht länger selbst Hand an mich legen, und mich in Gedanken »versündigen« — auch wenn ich noch immer nicht wusste, wie Homosexuelle ihre Liebe zum Ausdruck brachten oder ihrer Sexualität Befriedigung verschafften. Doch ich stellte mir vor, dass es beiunsnicht viel anders war, als bei den anderen. Küssen, streicheln … all diese schönen Dinge lagen in unerreichbarer Ferne!
Dabei wohnte Manuel nur einen Steinwurf von mir entfernt. Ein Fußmarsch von wenigen Schritten und wir schienen wie ein unzertrennliches … Freundespaar, das mit recht viel Argwohn beobachtet wurde. Galt es doch, uns im Auge zu behalten! Aber niemand wäre auf die Idee gekommen, gerade uns etwas anzudichten, obschon Denunziationen — wie bereits erwähnt — an der Tagesordnung waren. Schlimmer noch! Auf jeden Schritt und Tritt fühlten wir uns beobachtet und konnten nicht so leben, wie wir es gern getan hätten.
Erst im Februar hatten sie Willy, einen alleinstehenden Bauern, der am Rande des Dorfes lebte, der SODOMIE überführt, angeklagt und aus dem Dorf geschafft. Keiner hatte ihn seither mehr gesehen, und Manuel und ich malten uns oft aus, was es hieß, dieser Sodomie überführt worden zu sein.
Hatte Willy etwa Sex mit einem seiner Schweine gehabt?,fragten wir uns.
Und manchmal gab es Dinge im Leben eines Jungen, die einfach getan werden mussten, koste es, was es wolle. Schon oft hatte ich durchgespielt, wie es wohl werden würde, wenn ich Manuel meine Liebe gestehe. Wann immer ich mich auf den Heuboden zurückzog, stellte ich mir vor, wie Manuel neben mir läge und wie er mich streichelte … überall. Und wie er mich küsste … überall!
Und auch heute war es wieder so ein Tag. Ich lag im Heu, die Hosen auf halbmast heruntergelassen, die Augen fest verschlossen und ich träumte so vor mich hin. Meine rechte Hand war nach unten gefahren und ich stand kurz davor — jetzt schon zum dritten Mal an diesem Tag — mich selbst befriedigen zu wollen, da mein Penis mal wieder wie ein Mast aufrecht stand. Oder wie es Oma nannte:
Ich war im Begriff, Schande über mich zu bringen!
Schon vor Wochen hatte ich aufgehört, mich in meinem Bett zu befriedigen. Zum einen, weil praktisch zu jeder Tages- oder Nachtzeit jemand ins Zimmer hineinplatzen konnte, zum anderen, da ich die verräterischen Spuren nicht früh genug beseitigen konnte und dann nicht selten in Erklärungsnot geriet.
Aber glaubten meine Großeltern wirklich, dass die Sexualität eines schönen Tages einfach so vom Himmel fällt, und das erst, wenn ich ein Erwachsener bin — ein ganzer Kerl? Somit zog ich es also vor, mir stattdessen auf dem Heuboden ein Refugium zu schaffen, einen kleinen Rückzugsort, an dem ich tun und lassen konnte, was ich wollte. Und ich war gerade so schön in Fahrt gekommen, als die Tür zur Scheune aufgestoßen wurde.
Mir rutschte das Herz in die Hose!
Rasch zog ich meine Hosen wieder hoch. Ich suchte nach dem kratzigen Wollpullover, den ich mir ausgezogen hatte, auch wenn das Heu wie tausend Nadeln in meinen Rücken pikste. Hektisch versuchte ich, alle Spuren zu beseitigen, die darauf schließen lassen konnten, was ich hier oben hatte veranstalten wollen. Ich dachte zuerst, dass mich Opa holen kommen wollte, um den Kuchen anzuschneiden, den Oma heute Morgen in aller früh in die Röhre geschoben hatte. Ich hörte, wie jemand die klapprige Leiter emporstieg. Es waren seltsame Geräusche.
Es hörte sich nicht danach an, als würde Opa mit seinen Lederstiefeln … Und mit allem hatte ich gerechnet, nur nicht mit dem, was sich dann vor mir aufbaute, als ich zur Leiter hinüberspähte und so tat, als würde ich hier nur ein Schläfchen machen.
Ich gähnte und tat so, als wäre ich gerade eben erst erwacht, doch das half nicht, meine Schamesröte aufzuhalten, mir ins Gesicht zu steigen. Eine lästige Angewohnheit, die ich am liebsten loswerden wollte; verriet sie doch, dass ich log. Ich spürte, wie mein Gesicht wärmer wurde, wie ich händeringend nach Worten, aber vor allem auch nach Ausreden suchte —
Aber das hatte noch nie funktioniert. Ich war ja so leicht zu durchschauen. Und dann schockiert, als ich feststellen musste, dass ausgerechnet Manuel einer von ihnen geworden war.
Ich hatte stets geglaubt, dass wir hier auf dem Land sicher waren vor den Häschern und dass wir davon verschont blieben, selbigen Fehler zu tun, wie so viele vor uns. Doch offenbar hatte Manuel das anders gesehen und sich entschieden —
Da stand er nun in seiner Uniform der HJ, mit dem braunen Hemd, dem schwarzen Tuch und der leuchtroten Binde am linken Arm, der silbernen Gürtelschnalle und den kurzen schwarzen Hosen.
Aber vielleicht war ihm nur der Ausflug in die große, weite Welt zu Kopf gestiegen und hatte ihm alles andere als gut getan, dass er in den letzten zwei Wochen in der Stadt gewesen war — bei seinem Onkel, der in Berlin stationiert war und als eingefleischter Nazi verschrien war.
Eigentlich hatte ich schon nicht mehr damit gerechnet, dass er es zu meinem Geburtstag schaffen würde, aber offenbar hatte er »seine guten Beziehungen« spielen lassen, wie er mir sagte: »Gute Beziehungen«, so hatte mir Manuel schon früher erklärt, »sind wie das Salz in der Suppe. Ohne Beziehungen würden wir diesen Krieg ganz sicher nicht überleben.«
Aber musste er sich deshalb ausgerechnet jenen anschließen, die wir vor wenigen Wochen noch verteufelt hatten? Musste Manuel ausgerechnet in diese Uniform schlüpfen, um sich »gleichschalten« zu lassen? Wahrscheinlich war er viel zu sehr mit seiner eigenen Schamhaftigkeit beschäftigt, sodass nicht mehr festzustellen war, wem die ganze Sache peinlicher war. Dass er hier auf den Heuboden gekommen war, jenem Ort, an dem meine Träume bislang farbenfroh und wunderschön gewesen waren.
Und jetzt das!
Es fühlte sich an wie ein Faustschlag ins Gesicht.
»Da brat mir doch einer einen Storch«, kam es aus meinem Mund. Wie hätte ich auch beschreiben sollen, was mich derart schockierte, dass ausgerechnet Manuel in einer Uniform der Hitlerjugend steckte — die ich ihm am liebsten gleich über die Ohren gezogen und ihm ausgezogen hätte.
Träumen darf man doch schließlich noch, oder nicht?
Insgeheim wünschte ich mir, dass sich Manuel nur einen Scherz mit mir erlaubte, und dass er diese Uniform nur an seinem Leibe trug, weil er ansonsten keinen Fahrschein mehr bekommen hätte, um mich an meinem Geburtstag zu überraschen. Die Überraschung war ihm jedenfalls gelungen. Ich war sprachlos und irritiert zugleich — und das für mehrere Minuten!
Manuel warf sich neben mich ins Heu. Er sagte lange Zeit nichts. Doch dann drehte er sich zu mir und lächelte: »Du solltest mal darüber nachdenken, einer von uns zu werden. Dann könnten wir schon im Sommer gemeinsam auf große Fahrt gehen. Meine Meute plant eine Fahrt ins Bucklige Land.«
»Mit was haben sie dich nur geködert, dass du ihnen in die Falle gegangen bist? Etwa mit einem Freifahrtschein direkt an die Front?« Ich musste mir eingestehen, dass ich schon ein wenig neidisch war auf die schöne Uniform und auf den Dolch, den Manuel an seinem Gürtel trug. Aber sollte ich ihm gestehen, dass ich ihn am liebsten ohne diesen Firlefanz gesehen hätte?
»Unsere Meute befindet sich noch im Aufbau. Du könntest doch zu einem unserer Treffen kommen. Wir treffen uns ab sofort immer donnerstags abends ab 19 Uhr in der Kneipe meines Vaters«, sagte Manuel und präsentierte mir voller Stolz sein bestes Stück, das er zugleich aus der Lederscheide zog.
Eine Klinge, die einem offenbar Macht verlieh. Irgendwie.
»Komm schon! Mach mit! Das wird großartig werden, dich dort an meiner Seite zu haben!«
Doch bevor ich Manuel eine Antwort geben konnte, schallte Omas Stimme durch die Scheune, die mich davor bewahrte, einen großen Fehler zu begehen.
»Julian! Bist du da oben? Komm ins Haus. Wir wollen jetzt den Kuchen anschneiden.«
»Ja, Oma, ich bin hier oben. Ich komme gleich!«, rief ich ihr zu und lunzte kurz über den Rand des Heubodens.
Jetzt gab es kein Halten mehr, als Oma die Scheune verlassen hatte. Manuel und ich sprangen gemeinsam vom Dachboden in das frische Heu, etwas, das vor allem Opa missbilligte! War es doch viel zu gefährlich, solche Sprünge zu wagen. Den Hals hätten wir uns brechen können!
Ich rechnete nicht damit, dass es viele Geschenke gab, wahrscheinlich nur ein paar Sachen der nützlichen Art. Darunter sicher auch ein paar neue Socken, sowie einen weiteren, kratzigen Pullover, an dem meine Oma nächtelang gesessen hatte.
In der dunklen Stube erwartete mich ein Marmorkuchen mit Schokoladenklausur, auf dem eine einzige Kerze brannte. Kerzen waren Mangelware zu dieser Zeit, und ein kleines Wunder, dass wir eine schon am Tage anzündeten. Ein Licht, das Wärme ausstrahlte in dieser sonst so tristen Umgebung.
Für eine Torte hatte Oma nicht die richtigen Zutaten beschaffen können, und das, obwohl wir auf einem Bauernhof lebten. Das muss man sich mal vorstellen! Doch Zutaten wie Milch, Sahne und Eier waren heiß begehrte Nahrungsmittel, die nicht selten auf dem Schwarzmarkt der Stadt für exorbitante Preise verhökert wurden.
Manuel und ich setzten uns an den gedeckten Tisch. Opa zeigte sich keineswegs irritiert, dass Manuel der Hitlerjugend beigetreten war. Ganz im Gegenteil. Sicher schien er sich selbiges für mich zu wünschen, als ich die Kerze ausblies, und mir wünschte, dass ich niemals in solch eine Uniform gezwängt würde — Skeptisch musterte ich die Geschenke, die auf einem kleinen Beistelltisch lagen. Sie waren allesamt in Zeitungspapier eingeschlagen. Nur eines nicht. Und das kam wohl von Manuel.
»Blas die Kerze aus, mein Junge, und wünsch dir was«, sagte Oma, nachdem sie mir meinen Blondschopf aus dem Gesicht gestrichen hatte. In den letzten Wochen hatte ich es vermieden, mir die Haare schneiden zu lassen, denn ich wollte nicht so aussehen, wie all die anderen. Dann blies ich die Kerze aus, schloss meine Augen und wünschte mir, was noch heute in Erfüllung gehen sollte.
Natürlich wusste ich, dass es frevelhaft war, dabei nur an mich zu denken. Die meisten in diesem Land wünschten sich bestimmt, dass der Krieg bald ein Ende fand. Ich wünschte mir jedoch, nie uniformiert oder gleichgeschalten zu werden von einem Gedankengut oder System, das ich für frevelhaft hielt. Doch das sagte ich natürlich niemandem.
Und während Oma den Kuchen anschnitt und jedem von uns ein großes Stück auf die Teller legte, machte ich mich über die Geschenke her. Das Geschenk, das in braunem Papier gewickelt war, behielt ich mir für den Schluss auf. Zuerst öffnete ich das Geschenk, dessen Form mir schon verriet, dass darin lediglich warme Wollsocken zu finden waren. Doch ein Junge durfte nicht wählerisch sein — nicht in diesen Tagen der großen Entbehrungen!
Ich hielt ein paar graue Wollsocken in der Hand, schenkte meiner Oma ein Lächeln und konnte kaum noch erwarten, das nächste Geschenk zu öffnen. Nachdem auch der Wollpullover sowie fünf feinere Unterhosen auf dem Tisch lagen, widmete ich nun alle meine Aufmerksamkeit dem Geschenk, das mir Manuel aus der großen Stadt mitgebracht hatte.
Und selten hatte eine Person derart daneben liegen können!
Manuel hatte wahrscheinlich versucht, mir meine Entscheidung abzunehmen, sie mir einfacher zu machen, und hatte es auf jeden Fall gut gemeint. Aber sollte ich dieses Geschenk tatsächlich annehmen? Ich warf einen fragenden Blick zu Oma, dann zu Opa. Beide sahen nicht wirklich unglücklich aus, als ich das braune Hemd in der Hand hielt, und mich fragte:
Oh, Manuel! Wie kannst du mir das nur antun?
Doch dann sagte Opa (wahrscheinlich nur, um vor Manuel als Patriot dazustehen): »Worauf wartest du noch? Probier die Sachen doch mal an.« Und Opa meinte weder die Wollsocken noch den Wollpullover, geschweige denn die Feinripp-Unterhosen, die auf dem Tisch lagen (obwohl die gerade zur rechten Zeit kamen). Es gab wohl kein Kind im Deutschen Reich, das sich gewünscht hätte, dass ihm die Sachen nicht passten und dass sie zurückgegeben werden müssten, doch ich war wohl eines der wenigen Kinder, die entsetzt darüber waren, so durch die Straßen laufen zu müssen.
Meine Euphorie hielt sich in Grenzen, als ich mich aus meiner geliebten Lederhose und dem kratzigen Pullover pellte und sie gegen ein flauschiges Hemd und eine neue schwarze Hose eintauschte. Manuel konnte kaum noch erwarten, mich uniformiert zu sehen. Seine Augen wurden immer größer, als ich mich umzog, nicht zuletzt lag das wohl daran, dass ich es heute vorgezogen hatte, keine Unterwäsche zu tragen. Unterwäsche war knapp in diesen Tagen, und auf dem Land scherte es niemanden, wenn ich keine Unterwäsche trug, oder wenn ich nackt im nahegelegenen Weiher schwimmen ging. Ein absolutes Unding, wenn ich jetzt in der großen Stadt gewesen wäre.
Zuerst wollte ich sagen, dass mir die Uniform nicht passte. Doch sie passte mir wie angegossener Kruppstahl, als wäre sie wie für mich gemacht, und als hätte Manuel sie extra für mich anfertigen lassen. Manuel lächelte, stand von seinem Stuhl auf und gratulierte mir: »Glückwunsch! Jetzt kannst du dich überall sehen lassen. Jeder wird dir Respekt entgegenbringen. Jeder. Sogar die Erwachsenen.«
Das klang zwar vielversprechend – wurde mir in letzter Zeit doch vieles entgegengebracht, nur kein Respekt – und auch verlockend! Doch sollte ich dafür nicht weniger als meine Seele an den Teufel verkaufen, oder besser gesagt, an den Führer selbst? Sicher, Adolf würde es gefallen, mich in dieser feschen Uniform zu sehen. Aber würde es ihm auch gefallen, wenn ich ihm sagen würde, was ich in diesem Augenblick für Manuel empfand? Das uns weitaus mehr miteinander verband, als nur eine flüchtige Kameradschaft!
Adolf Hitler würde doch keine Sekunde zögern, den Befehl zu erteilen, mich in ein KZ stecken zu lassen. Es war längst kein Geheimnis mehr, wer alles in den Konzentrationslagern landete. Selbst vor Kindern wurde nicht Halt gemacht. Erst recht nicht, wenn sie den Vorstellungen einer so stolzen Nation nicht entsprachen, wie der unseren, die sich selbst als die Herrenrasse sah, als die Krone der menschlichen Schöpfung. Aber hatte in diesem Stolz auch ein Junge Platz, der homosexuell war?Wohl eher nicht, wie mir schien!
Zwar hatte ich noch nie ein KZ aus der Nähe gesehen, doch ich konnte mir vorstellen, wie unmenschlich und barbarisch es dort zugehen musste, schließlich wurde sich viel hinter vorgehaltener Hand darüber erzählt, und ich griff so manches auf — auch hier auf dem Land.
So versuchte ich, die Hitlerjugend-Uniform als das zu sehen, was sie für mich war: Eine Maskerade, ein Kostüm, das ich mir überstülpen konnte, um mich dazugehörig zu fühlen. Trug ich sie nicht, war ich einfach nur der zu klein geratene Julian Glöckner, ein fünfzehnjähriger Junge, dem nicht ganz wohl bei dem Gedanken war, jetzt einer dieser Hohlköpfe zu sein, die den Ideologien der Nazis blindlings folgten, bis in den Tod.
Die Zahlen waren zwar ein gut gehütetes Geheimnis, doch ich schätzte, dass bereits Millionen von Menschen ihr Leben gelassen hatten für einen sinnlosen Krieg, der unser Land — unser aller Vaterland — ins Verderben stürzte. Doch heute war ein viel zu schöner Tag, als dass ich mir mit derlei gewichtigen Themen die gute Laune verderben lassen wollte. Allerdings wollte ich die Uniform so schnell wie möglich wieder loswerden, und was lag da näher, als zu dem Bauern zu gehen, der am Ortsrand dafür gefürchtet war, dass er über zwei äußerst beißfreudige Köter verfügte. Sie würden mir die Kleidung schon vom Leibe reißen, wenn ich sie ärgern würde — meinen nackten Hintern könnte ich ihnen zeigen, oder meinen Schwanz und sie anpinkeln …
Manuel hatte eine völlig andere Idee, die zwar auch damit zu tun hatte, sich der Uniform zu entledigen, aber nicht immer waren seine Ideen von Erfolg gekrönt. »Traust du dich, durch den Teich zu schwimmen, mit nichts an deinem Leibe, außer deiner nackten Haut?«, fragte er, als wir am kleinen Weiher ankamen, nachdem wir losgezogen waren, um noch ein Abenteuer zu erleben. Und eigentlich hatte mir Manuel doch sein Versteck im Wald zeigen wollen, oder nicht?
»Na klar«, erwiderte ich, da ich nicht als Feigling dastehen wollte, nicht vor ihm, meinem besten Freund. Wahrscheinlich hatte mir aber auch die Uniform eine Extraportion Mut und Heldendrang verliehen, denn der Weiher war zu dieser Jahreszeit alles andere als warm, auch wenn es schon die ersten warmen Frühlingstage gegeben hatte, so war das Wasser bestenfalls drei Zentimeter kalt. »Aber nur, wenn du dich auch traust!«
Eigentlich hoffte ich inständig, dass Manuel einen Rückzieher machte. Doch schon nach wenigen Augenblicken begann er, sich vor mir aus der Uniform zu schälen. »Wer zuletzt im Wasser ist, hat verloren«, sagte Manuel. Er war inzwischen bei seiner schwarzen Hose angekommen, während ich noch damit beschäftigt war, die Knöpfe an meinem Hemd einzeln aufzuknöpfen. Und es wäre ihm gegenüber unfair, mir die Sachen einfach vom Leibe zu reißen. Wahrscheinlich hatte er seine gesamten Ersparnisse für meine Uniform ausgegeben.
Aber die Sachen ordentlich auf einen Haufen zu legen, war weder Manuels noch meine Vorstellung von einem Wettkampf, bei dem es vor allem darum ging, vor dem anderen im Wasser zu sein — und das aus gutem Grund! Auch wenn ich schon jetzt wusste, dass ich gegen Manuel nicht die geringste Chance hatte — und dann auch noch das! Als Manuel splitternackt vor mir stand und schon mit einem gewagten Sprung ins Wasser springen wollte, bemerkte ich, wie sich mein Glied allmählich zur vollen Größe aufrichtete.
Oh, nein!,dachte ich.Das darf Manuel auf keinen Fall sehen.
Das darf niemand sehen!
Ich schaute mich blitzschnell nach allen Seiten um, überzeugte mich zuerst davon, dass kein anderer zu sehen war. Erst dann hüpfte auch ich in das kalte Wasser, gerade, als Manuel untertauchte, um sich abzukühlen.Auch er?,dachte ich.