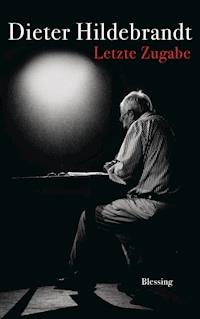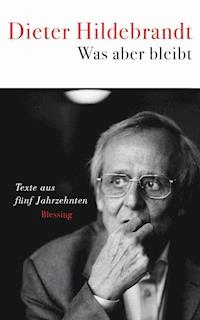5,99 €
5,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Angriffslustig, nachdenklich und hoch komisch!
Das neue Buch zeigt den großen Satiriker in Höchstform. Hildebrandt kommt vom Hundertsten ins Tausendste, er verknüpft die Politik mit der Kunst, das Persönliche mit dem Nationalen. Er ist angriffslustig, wo es Not tut, nachdenklich, wo es angebracht ist, und komisch, wenn es ihm gefällt. Das wird vielen gefallen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2008
4,5 (24 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Nie wieder 80!
Wg. Kohl
Copyright
Für Renate
Nie wieder 80!
Als das erste Mal auf mich geschossen wurde, wer das tat und warum, ist nie geklärt worden, habe ich mir Gedanken gemacht über das Leben. Es war, wie sich im Laufe des Weiterlebens herausstellte, typisch für mich. Ich habe beim Nachdenken immer am falschen Ende angefangen. Logischerweise hätte ich über den Tod nachdenken müssen, der eingetreten wäre, wenn der Schütze getroffen hätte. Aber nachdem dieser mich verfehlte, habe ich sofort das Interesse an dem verloren, was hätte passieren können, wenn es ein Treffer gewesen wäre.
Ich habe, recht oberflächlich finde ich, über das nachgedacht, was ich noch hatte: das Leben. Christian Morgensterns Palmström nach einem glimpflich verlaufenden Unfall: »Wie war«, (sprach er, sich erhebend und entschlossen weiterlebend), »möglich, wie dies Unglück, ja -: dass es überhaupt geschah?« Zeilen, die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben.
Wie auch der Satz von Albert Einstein: »Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben: Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eins. Ich glaube an Letzteres.« Ist es ein Wunder, dass ich noch lebe? Aber natürlich, wenn man bedenkt, wie viele Krankenhäuser ich wieder verlassen konnte, wie viele Kantinen ich einigermaßen unbeschädigt überstanden habe, wie oft und wie gern ich mich als Kind schon totgelacht habe, wie viele Bundeskanzler, Präsidenten und Intendanten ich überlebt habe. Die oft beschriebene »tödliche Langeweile« hat mich hie und da befallen, aber immer wieder von mir abgelassen. Nur etwas habe ich inzwischen widerwillig gelernt: Das Altern kann man nicht auf morgen verschieben, weil man dann noch älter ist.
Deshalb sollte man mit dem Altern früh genug anfangen, damit man Freude daran hat.
Und die habe ich.
Schon deswegen, weil ich gemerkt habe, dass das Altern Zukunft hat. Ich habe ungern Erfahrungen gesammelt, denn was sind schon Erfahrungen? Die haben mit wachsender Weisheit gar nichts zu tun.
Es wächst nicht alles nach. Günter Grass hat gemeint, ihm wäre die Scham nachgewachsen. Da muss er sich vertan haben. Nachwachsen kann man beispielsweise Skier, aber sonst gilt, dass kaum etwas nachwächst. Bei Armen, Beinen, Nasen oder Ohren wissen wir: Es ist endgültig. Entmannungen zum Beispiel sind in der Regel nie wieder gutzumachen.
Und damit bin ich wieder bei meinem Alter. Es ist wie mit der Scham: Jugend wächst nicht nach. Das Wort Nachwuchs ist darum mit Vorsicht zu verwenden.
Ich habe mit einigem Entsetzen festgestellt, dass auch die Weisheit im Alter nicht nachwächst. Das hat man mir, als ich noch jünger war, immer wieder vorgelogen.
Man muss Angst bekommen um seine Enkelkinder. Nicht weil sie nichts wissen, sondern weil die immer weniger wissen, die vom Staat bestellt sind, dafür zu sorgen, dass die Kinder immer mehr wissen.
Wenn im Ausfrageinstitut Jauch, dieser Produktionsstätte für deutsche Millionäre, die Fragen auf die Kandidaten niederkommen, die sich immerhin freiwillig zur Verfügung gestellt haben, um sich, viel zu oft jedenfalls, vor einem Millionenpublikum blamieren zu lassen, dann ist man schon ein bisschen eingeschüchtert. Erstens, weil man möglicherweise schon nach der dritten Frage ausgeschieden wäre … angenommen, es wäre gefragt worden, ob Bohlen dicke Hölzer sind oder ein junger Mann mit dem Doppelnamen Halbach, der in seinem Geld ertrunken ist, oder ein Dieter Bohlen, der dauernd von der Bildzeitung überfallen wird, und es sind die Hölzer gemeint und man muss den Joker nehmen …
Zweitens, weil die Vorstellung, man unterziehe sich öffentlich einer mündlichen Prüfung und käme angesichts eines überlegen lächelnden Prüfungsbefugten nicht darauf, dass der berühmteste Roman von García Márquez Hundert Jahre Einsamkeit heißt und nicht »Es kommt auf die Sekunde an«, so schrecklich ist, dass ich schon bei dem Gedanken, ich könnte zu solch einer Veranstaltung eingeladen werden, nasse Hände bekomme.
Ich bewundere den Mut von Lehrkräften, die von ihren Schülerinnen und Schülern noch relativ unbeschädigt zu sein scheinen, sich dort auf die Anklagebänke setzen und offenbaren, dass sie Arundhati Roy für einen der Dompteure aus Las Vegas halten.
Da müsste dann eigentlich dieser Präsidenten-Ruck durch das Land gehen. Kann es sein, dass daran wieder einmal die Politik in diesem Lande nicht unschuldig ist?
Fällt jemandem ein Kanzler ein, der im Verlaufe der letzten 58 Jahre nicht nur die Finanzlücken stopfen wollte, sondern auch die Bildungslücken? Mir nicht. Aber ich habe mildernde Umstände. Ich bin 80. Diese Zahl schreckt mich übrigens in keiner Weise. Das wird mir ja nie wieder passieren. 70 bin ich zum Beispiel nur einmal geworden. Dann nie wieder. Und ich werde 80 nur einmal werden. Da kann ich mich noch so sehr bemühen.
Dieses Wort, dieses bemühen, verfolgt mich seit meinem ersten Schuljahr. In den Zeugnissen stand es und war doch nur die Mitteilung an meine ehrgeizigen Eltern, dass ich nicht zu der kleinen Gruppe der Genies gehöre, die mühelos den Wissensstoff der Klasse bewältigen. Als ich einen Stammplatz in unserer Fußballmannschaft anstrebte, meinte unser Sportlehrer, dass ich sehr bemüht und mannschaftsdienlich spielen würde, was gleichbedeutend war mit dem Urteil: Zukunft hat er nicht. Nahezu niederschmetternd wirkte das Wort »bemüht« nach meinem ersten sexuellen Kontakt mit einer erfahrenen Arbeitsmaid. »Nie wieder!«, habe ich mir damals geschworen. Schon am nächsten Tag waren die Schwüre vergessen.
Mit einer gewissen Ausdauer habe ich es immer wieder versucht. Viel später tauchte dann das Wort »bemüht« wieder auf, in ein wortreicheres Synonym gekleidet, als ich Alleinunterhaltungsabende abhielt, also mich allein unterhielt, und zwar in dem Satz, der nach zweiundeinhalb Stunden gespieltem und gelesenem Programm einen gewissen Trost enthielt: »Die physische Leistung, also in Ihrem Alter, also Respekt.« Bemüht also.
Dieses schöne Wort möchte ich auf meinem Stein haben.
Im Untersuchungsausschuss, der ihm blüht, räumt man ihm sicher ein:
Er hat sich sehr bemüht.
KOHL. Warum fällt mir so ohne Zusammenhang Kohl ein? Es fällt mir jetzt ein. Zu spät. Ich erkläre es später. Immer fällt mir alles zu spät ein.
Leser meiner früheren Bücher wissen, dass ich leichtsinnigerweise meine Unarten und Gebrechen offengelegt habe. Zuerst war es das Bekenntnis, dass mein ganzes Haus voller Zettel ist, und im darauffolgenden, dass ich Brillen brauche, um die Zettel lesen zu können, und weil ich überall Zettel habe, auch überall Brillen brauche, und warum ich das alles brauche, schrieb ich ein paar Jahre danach, weil ich alles vergesse, was ich aufgeschrieben habe, sodass ich also Zettel brauche, auf denen ich ablesen kann, wo ich die Zettel hingelegt habe, auf denen zu lesen ist, wo die Zettel sind, auf denen steht, was ich mir merken soll, was aber nur geht, wenn ich die drei Lesebrillen, deren Liegeplatz auf einem Zettel notiert ist, wiederfinde, was alles aber hervorragend und theoretisch perfekt auf einem Plan in meinem Arbeitszimmer notiert ist, aber nicht in meinem Gedächtnis, das offenbar, wie Atomkraftwerke, ein höchst sensibles Alarmsystem eingebaut hat und das bei der kleinsten Irritation sofort den Haupthebel umlegt, und alles im Gedächtnis ist finster.
Die Wahrheit ist: Ich hatte immer schon alle drei Unarten zusammen. Seit Kurzem kommt aber noch eine vierte Sache hinzu: Ich überschreite durch meine nicht aufeinander abgestimmten Schwachheiten ununterbrochen Grenzen, die der moderne Mensch mit technischer Hilfe gesetzt bekommen hat. Um mich herum tutet, piept, hupt und pfeift es. Tönende Zurechtweisungen. Das macht mich nervös.
Ich habe mich nicht angeschnallt - es piept. Fahre ich zu nahe an den Bordstein, macht irgendwas im Auto mööb, lege ich den Rückwärtsgang ein, warnt es glückuck, komme ich mit der Hand an mein Herz, macht es tschiep, das ist mein Handy im Hemd, lasse ich das Fenster auf, jault eine Sirene, und irgendwann wird es so weit sein, dass es piept, wenn ich mich schief aufs Klo setze, und wenn ich mich ins Bett lege, geht schon wieder die Sirene los, weil ich mich nicht angeschnallt habe.
Ich muss weiterdenken. Positiv! Warum nicht diese Technik nutzen? Meine Lesebrille klingelt, wenn ich sie nicht dort habe, wo ich sie brauche, der Zettel mit der Notiz, wo ich hin muss, piept im Mantel, wo dann auch das Handy brummt, mit dem ich dann die Nummer abrufen kann, die ich anrufe, um meinem Arzt mitzuteilen, dass ich jetzt durchgedreht bin.
Alle Sprichwörter, die wir verwenden, haben einen alten, längst nicht mehr gebräuchlichen Sinn. Dieses: »Bei Ihnen piept’s wohl«, hat nun einen neuen.
Während ich darüber nachdenke, sehe ich auf einem Zettel den hastig hingeworfenen Namen Kohl. Aber es steht nicht dabei, warum? Doch, ich weiß es jetzt. Ich hatte mir drei Seiten zuvor die Frage gestellt, ob mir ein Bundeskanzler einfällt, der die Bildungslücken stopfen wollte. Kohl. Als mit ihm 1982 die erneuerten sittlich-moralischen Grundwerte auf dem Kanzlerstuhl zum Sitzen kamen, und dann unter ihm, also unter Kohl, zu blühen begannen, kam diese Wendehoffnung. Alles, versprach er, werde sich wenden und wandeln, predigte der Kanzler von der Kanzel, auch für die Menschenrechte und die Würde des Menschen, die er besonders zu schützen versprach, und zwar gleich nach der Stuhlübergabe im Herbst 1982. Genscher sorgte sich um Deutschland unter Schmidt, hatte alle wichtigen Machtwächter angerufen, Kohl sogar den lieben Gott. Es kam Bewegung in die Politik und Kohl ins Geschäft, und er war festen Glaubens, dass er das in direktem Kontakt mit dem lieben Gott erreicht hat, denn er sagte im November 1983: »Bei uns lacht der Himmel auch, weil ich Vorsitzender der Christlichen Union bin und nach Meinung mancher einen direkten Draht zum lieben Gott habe«, wodurch wieder einmal der lang gehegte Verdacht bestätigt wurde, dass Gott katholisch ist. Und es war gut so. Man spürte den Ruck, der durch Schaltstellen der Geldpolitik ging. »Jetzt geht’s«, sagte man sich, und schon ging es auch aufwärts mit den moralischen Grundwerten, und Kohl verkündete: »Das wird jetzt durchgekämpft, egal auf welchem Wege … wo sind wir denn eigentlich hingekommen in der Bundesrepublik Deutschland?« Sofort blies ein anderer Wind um das Kreuz der Wertvorstellungen. Kohl war quasi der Vorbläser, denn er rief bewegt aus: »Wir müssen den Staub von unseren Wertvorstellungen wegfegen.« Am 22. April 1983. Und er fegte weg, was an Skrupeln noch vorhanden war. Und weswegen?
Wg. Krupp, wg. Flick. Vor allem wegen Flick.
Es begann die Zeit der Untersuchungsausschüsse. Die haben sich bis in unsere Zeit hinein durchgesetzt. Heute müssten wir die Zahl der Bundestagsabgeordneten vergrößern, weil die vorhandene Menge der MdBs nicht ausreicht für die zu besetzenden Untersuchungsausschüsse.
Wg. Kohl
Mit der Ära Kohl begann das Jahrzehnt der Sorglosigkeit, die Zeit, in der Skrupel keine Chancen mehr hatten. Es waren diese fröhlichen 80er, in denen ich zu den 50ern gehörte. Darum beginne ich dieses Buch mit den Erinnerungen an jenen Mann, der denen unbeschwerte Jahre schenkte, die Gesetze als Beengung empfanden: mit Helmut Kohl.
Hinreißend, mit welcher Grandezza er alle Hürden, die ein demokratischer Staat aufgebaut hat, übersprang. Wie ein Ehrenwort von Kohl plötzlich so viel wert war wie das von Barschel, das Kohl aber offenbar nie irritiert hat. Ein Großteil der Verachtung, die junge Menschen für Politik empfinden, ist der Ära Kohl zuzuschreiben. Viele offene Rechnungen stammen aus seinen Regierungsjahren. Er muss eine Menge Augen zugedrückt haben, als die Waffenhändler alte Panzer verkauft haben und die Provisionen in Koffern herumgeflogen wurden. Die Empfänger wussten manchmal gar nicht, woher die gekommen waren.
Niemand wusste Genaues. Im Hamburger Hafen fand die Polizei auf einem Frachter, der landwirtschaftliche Maschinen nach Israel verschiffen sollte, Sturmgeschütze mit langen Rohren. Keiner wusste, wer die verladen hatte, keiner wusste, wer sie bekommen sollte. Auf die Frage, was die Geschützrohre mit der Landwirtschaft zu tun hätten, soll das Verladekontor gesagt haben: »Güllekanonen.«
Keine Frage, es wurden dringend Waffen gebraucht. Rund um die Erdkugel blitzte und krachte es. Warlords bezahlten gutes Geld, und jede Währung ist so wechselbar wie Meinungen oder Interessen. Wenn man nach der Bedeutung des Wortes »Interesse« forscht und im lateinisch-deutschen Wörterbuch blättert, liest man für »inter« das deutsche »zwischen« und erfährt, dass »esse« mit »sein« übersetzt wird. Also kann Interesse nur »dazwischen sein« bedeuten. Dann kann man gleich behaupten, dass es sich um nackte Provisionen handelt, die für Geschäftspartner von Interesse sind. Warlords sind Manager von bewaffneten Räuberbanden, die wie im Dreißigjährigen Krieg Landstriche mit Mord und Brandschatzung überziehen und vorgeben, Visionen zu haben. Und die werden von Jahr zu Jahr teurer. Man kann zum gegenwärtigen Stand sagen: Pro Vision eine Million.
Wenn die Vereinigten Staaten an der Entwicklung des Irak Interesse haben, muss ich fragen, wie groß das »Interesse« der Betreiber dieses Krieges an dessen Beendigung ist. Ich hatte immer den Verdacht, dass die Bush-Krieger bereits die Grundstücke gekauft hatten, die zu erobern sie ihre Soldaten ins Feuer geschickt haben. Hie und da gab es Mitteilungen, die den Verdacht nicht direkt bestätigten, aber untermauerten.
Es wäre einer der seltenen Kriege, in denen es um die Wiederherstellung der Würde von Menschen geht. Ganz gewiss gehörte das Eingreifen der Alliierten gegen Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg zu diesen Befreiungskriegen. Und auch hier muss man am guten Glauben für die gerechte Sache, die Stalin für sich in Anspruch nahm, zweifeln. Zum Beispiel im Jahr 1944, als seine unaufhaltsam vorwärtsstürmende Armee die deutsche Wehrmacht vor sich her jagte, als die polnischen Menschen ihre endgültige Befreiung greifbar nahe vor sich sahen, als sowjetische Truppen am Weichselbogen in Warschau ankamen, als die polnischen Soldaten sich erhoben und den russischen Brüdern am gegenüberliegenden Flussufer zuwinkten, konnte man noch daran glauben. Es war im Sommer 1944.
An diesem Weichselbogen in Warschau standen wir vor einiger Zeit mit unserem polnischen Freund Stashek. Wir sahen den Waldrand am anderen Ufer. Dort hatten sie gestanden, die sowjetischen Geschütze, ein paar 100 Meter weit entfernt. Und in Warschau warteten damals Tausende von Widerstandskämpfern darauf, dass sie befreit werden. Ein halbes Jahr später erst, als Warschau dem Erdboden gleichgemacht war, als man die Widerstandskämpfer bataillonsweise erschossen hatte, kamen die Russen im Januar 1945 über den Fluss und besetzten die tote polnische Hauptstadt, die vor den Augen der sowjetischen Armee von der deutschen Wehrmacht ausgelöscht worden war. Ein halbes Jahr lang hat Stalin gewartet, bis die Waffen-SS, die »unschuldige« Wehrmacht, die Gestapo und der Krakauer Massenmörder Frank alles erledigt hatten, was seine Pläne für die Zukunft Polens hätte stören können. Stalin hatte andere »Interessen«.
Bundeskanzler Kohl sagte zu diesem Vorgang erhellende Sätze, zum Beispiel diesen: »Wir bezeugen ebenso unsere Hochachtung vor jenen, die unter Einsatz ihres Lebens den Ghetto-Bewohnern geholfen haben, aus dem Inferno zu entkommen. Sie alle stritten für die Würde des Menschen. Vergleichbares darf nie wieder geschehen.«
Damals kam der Verdacht auf, dass auch ein Bundeskanzler manchmal nicht weiß, was er sagt, wohl aber etwas sagt, wovon er nichts weiß.
Aber wenn man drei Zitate Kohls zusammenfasst, erkennt man, dass man als deutscher Mensch gut aufgehoben ist in einem Land, in dem die Mehrheit der Wähler diese Lichtgestalt 16 Jahre lang gewählt hat:
Ich bin ein typischer Deutscher.
Die CDU bin ich.
In Hölderlin war ich immer gut.
Helmut Kohl hat mich inspiriert, den politischen Redner als solchen zu bearbeiten. Kohl gehörte zu denen, die den Texten ihrer Redenschreiber nicht trauen. Als Kanzler hat man vier oder fünf. Es sind meist routinierte Journalisten oder Schriftsteller, die nach Maßgabe dessen, der die Rede halten soll, mehr oder weniger beseelte, kämpferische, witzige und nach Möglichkeit geistreiche Texte schreiben sollen und dann überrascht feststellen, was der jeweilige Redner daraus macht.
In der Geschichte des Parlaments der Bundesrepublik gibt es große Reden zu verzeichnen. Hervorragende Rhetoriker traten an das Pult und sprachen spontan, ohne Manuskript, temperamentvoll, mitreißend.
Ich kann mich erinnern, dass ich, als in den Jahren zwischen 1955 und 1965 Herbert Wehner, Fritz Erler oder Adolf Arndt, ja auch Kiesinger und Dehler zum Pult schritten, mein Essen stehen ließ. Wenn heute ein Redner, den ich wegen der Verbreitung von tödlicher Langeweile fürchten gelernt habe, sich anschickt, an das Rednerpult zu schreiten, dann gehe ich in die Küche und koche mir was!
Politiker sollten ihr Mundwerk lernen, ihre Gesten sorgfältig einsetzen, wie die frühen Römer den Faltenwurf ihrer Toga. Die Damen und Herren von heute beherrschen nicht mehr die Kunst der Rede: Sie lesen monoton, ohne Melodie in ihren Sätzen, ohne Lust, Laune, Wut oder erkennbare Zielrichtung Texte herunter. Das Parlament ist meistens schlecht besucht. Jeder, der unten seine Zeit abgähnt, kennt die Rede, denn sie ist am Abend zuvor schon verteilt worden.
Pro Manuskriptseite verlesen sie sich drei- bis viermal. Das sind die einzigen Höhepunkte des Auftritts. Deutlich gehört: »Wenn Sie, meine Damen und Herren, nach dem Verstand der Handlungen fragen … äh, Verzeihung, nach dem Stand der Verhandlungen …« ein kurzer Lacher … dann zieht sich der Auftritt wieder bleiern hin. Auch wenn Redner wie Westerwelle, die den fehlenden Inhalt durch Schnelligkeit ersetzen, einen verbalen Output haben, der an eine schwere Zungenentzündung denken lässt, erhöht sich das Niveau dieser Filibusterfestivals nicht sonderlich. Das Interesse an Politik nimmt auf diese Weise nicht zu.
Und so blicke ich mit einer gewissen Wehmut zurück. Dabei denke ich nicht an Gerhard Schröder. Da hatten wir es mit einem Ausrufer zu tun, der nicht sehr viel Originelles zu bieten hatte. Ich denke dabei tatsächlich an Helmut Kohl. Er, der der Wirkung geschriebener Texte misstraute, fügte eigene Gedanken hinzu. Zum Entsetzen der Autoren. Zum Vergnügen der Abgeordneten. Zur Freude der Journalisten. Er hat nicht nur den wehenden Zipfel des Mantels der Geschichte, sondern auch den Tellerrand des morgigen Abends entdeckt. Aus einer Rede im Bundestag: »Eine gute Politik sieht über den Tellerrand des morgigen Abends.« Auch die Politik, die auf dem Tellerrand steht, ist einer seiner Einfälle gewesen. »Das ist nicht die Politik, die auf dem Tellerrand des morgigen Abends steht.«
Kohl war immer offen zu seinen Parteifreunden und sagte ihnen deutlich, wo sie zu stehen haben. »Ich will daran erinnern«, sagte er im November 1982, »dass wir, die heute noch leben können, auf ihren Schultern stehen.« Er hat immer geahnt, was eines Tages geschehen wird. Unvergesslich seine Warnung an sein Volk und die Sozialdemokraten insbesondere: »Was nützt die beste Sozialpolitik, wenn die Kosaken kommen.« Wie prophetisch! Sie sind da. Ohne Pferde. Mit Ferraris und Koffern voller Geld, mit breiten und satten Frauen, vielen Kindern, und sie liegen an den Stränden Europas.
Um Kohl jetzt endgültig vergessen zu können, dränge ich den Lesern zum letzten Mal einen Text auf, der sich mit seinem Hang zur zwischengeschobenen Bekräftigung in seinen Reden befasst.
Stellen Sie sich vor, wie Kohl mit seinem Hang zur klassischen Literatur einen Text von Matthias Claudius benutzt, um sein Volk in den verdienten Schlaf zu reden.
DER MOND
meine Damen und Herren, liebe Freunde, und dasmöchte ich hier in aller Offenheit sagen,IST AUFGEGANGEN
Und niemand von Ihnen, meine Damen und Herren, liebeFreunde, wird mich daran hindern, hier in allerEntschlossenheit festzustellen,DIE GOLDENEN STERNLEIN PRANGENUnd wenn Sie mich, meine Damen und Herren, liebeFreunde, fragen: Wo?Dann sack ich es Ihnen:
AM HIMMEL!
Und zwar, und das sei hier in aller Eindeutigkeit gesackt,so wie meine Freunde und ich, meine Damen und Herren,liebe Freunde, uns immer zu allen Problemen geäußerthaben:
HELL UND KLAR.
Und ich scheue mich auch nicht, hier an dieser Stelleganz konkret zu behaupten:DER WALD STEHT SCHWARZUnd lassen Sie mich hinzufügen
UND SCHWEIGET!
Und hier sind wir doch alle aufgerufen - gemeinsam -,die uns alle tief bewegende Frage an uns gemeinsam zurichten:
Wie geht es denn weiter?
Und ich habe den Mut und die tiefe Bereitschaft und dieEntschlossenheit, hier in allem Freimut zu bekennen,dass ich es weiß!
Nämlich:
UND AUS DEN WIESEN STEIGET
Das, was meine Reden immer ausgezeichnet hat:DER WEISSE NEBEL WUNDERBAR.
Verlagsgruppe Random House
Der Karl Blessing Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
1. Auflage
Copyright © by Karl Blessing Verlag GmbH München 2007
unter Verwendung einer Karikatur von Dieter Hanitzsch Layout und Herstellung: Ursula Maenner
eISBN : 978-3-894-80448-0
www.blessing-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de