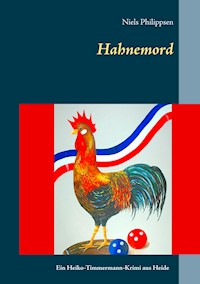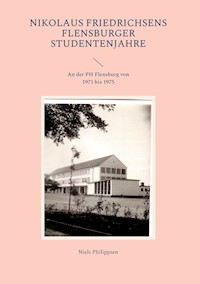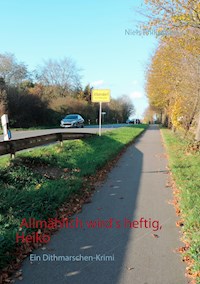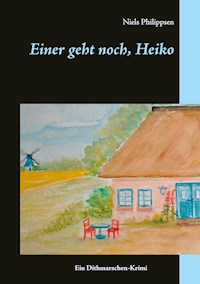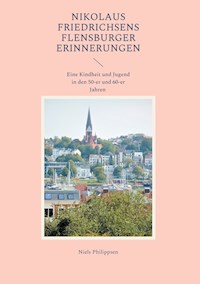
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Flensburg in den 50-er Jahren: Nach den Schrecken und Entbehrungen des Zweiten Weltkriegs und den Wirren der Nachkriegszeit hoffen die Menschen auf Sicherheit und Normalität. Auch viele "Flüchtlinge" hat es in die Stadt verschlagen. Erst allmählich verbessert sich die allgemeine Lebenssituation und die Jahre des "Wirtschaftswunders" beginnen. In diese Zeit hinein wird Nikolaus Friedrichsen geboren, genannt Nick oder Nicki. Die Familie lebt in einfachen Verhältnissen in der Wohnküche und drei Zimmern mit Ofenheizung. Aus Nicks Sicht erfahren wir, wie er allmählich seine kleine Welt erobert und auf die Suche nach seinem Platz im Leben geht. Es gibt viel Interessantes, Kurioses und teilweise auch Erschreckendes zu entdecken. Zahlreiche Einzelheiten bilden den Hintergrund der kleinen Erlebnisse: Die Straßenbahn, der erste Fernseher, Schulkindergarten und Schule, Micky-Maus-Hefte oder Elvis Presley, der 1958 in Bremerhaven als Soldat von Bord geht. Dann die 60-er Jahre: Eine neue Wohnung, eine andere Schule (diesmal ohne Schläge), neue Freunde und plötzlich ganz andere Interessen. Die Zeit der "Beat-Musik" beginnt, aber der Wunsch nach Beatles-Stiefeln und Lee-Jeans mit Schlag bleibt unerfüllt. Die erste Beatles-LP, das Tonbandgerät, die Konfirmandenzeit oder Episoden bei den Pfadfindern und im Hockey-Verein begleiten Nicks Weg genauso wie Klassenfahrten, die Tanzstunde und erste Erfahrungen mit der Arbeitswelt. Das Buch zeigt in 40 kleinen Kapiteln das Bild einer vielleicht typischen Kindheit und Jugend der 50-er und 60-er Jahre. Ob in Flensburg oder anderswo: Es gibt sicher die eine oder andere Parallele zur eigenen Kindheit und Jugend zu entdecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Hinweis zu diesem Buch
Dies ist die Geschichte meines Freundes Nikolaus Friedrichsen aus Flensburg, der mich darum gebeten hat, sie für ihn aufzuschreiben und auch zu veröffentlichen. Diesem Wunsch bin ich gerne nachgekommen.
Die Grundlage für das Manuskript bildeten die zahlreichen Gespräche mit Nikolaus, aber auch Tagebucheinträge, Auszüge aus Briefen, Bilder aus alten Fotoalben und dergleichen.
Wir haben uns darauf verständigt, die Namen aller auftretenden Personen zu ändern. Die in diesem Text gewählten Namen haben also nichts mit denjenigen Leuten zu tun, die zufälligerweise die gleichen Namen tragen sollten.
Nikolaus hat das Manuskript mehrfach durchgesehen und mir versichert, dass es mit seinen persönlichen Erinnerungen übereinstimmt.
Also können wir jetzt einfach beginnen:
Inhaltsverzeichnis
Vorwort: Was ich mit Flensburg zu tun habe
Kapitel: Hallo Flensburg, da bin ich!
Kapitel: In der Fruerlunder Straße
Kapitel: Unsere Wohnung
Kapitel: Auf Erkundungstour
Kapitel: Mein Abenteuerspielplatz
Kapitel: In der Innenstadt
Kapitel: Adelbykamp
Kapitel: Entspannung und Unterhaltung
Kapitel: Cola und Kohle
Kapitel: Kino
Kapitel: Im Schulkindergarten
Kapitel: In der Fruerlund-Schule
Kapitel: Glücksburg
Kapitel: Zwischendurch ein paar Kleinigkeiten
Kapitel: Neues Zuhause am Marrensdamm
Kapitel: In der Mürwik-Schule
Kapitel: Was sonst noch geschah (1960-1962)
Kapitel: Radio Luxemburg
Kapitel: Auf dem Fördegymnasium
Kapitel: Ein etwas seltsames Hobby
Kapitel: Schreibmaschine und Plattenspieler
Kapitel: Jeden Tag eine gute Tat
Kapitel: Ich werde cool
Kapitel: Halleluja
Kapitel: Grundig TK 145
Kapitel: Im Hockey-Verein
Kapitel: Glücksburg revisited
Kapitel: Der große Sturm von 1967
Kapitel: Mit der SMV nach Dänemark
Kapitel: Hausmeistergehilfe
Kapitel: In der Tanzstunde
Kapitel: „Auf Arbeit“ mit Hans-Heinrich
Kapitel: Austausch mit Carlisle
Kapitel: Sommer 68
Kapitel: Das Fräulein von der Post
Kapitel: Schule und Fahrschule
Kapitel: Unterwegs (Torquay, Paris, Berlin)
Kapitel: Beim THW
Kapitel: Als Fahrer bei der Reinigung
Kapitel: Endlich Abitur
Kapitel: Zum Schluss noch einmal Flensburg
Vorwort: Was ich mit Flensburg zu tun habe
Gut, Friedrichsen als Nachname ist nun nicht so ungewöhnlich in Flensburg. Es gibt hier ja jede Menge Leute mit –sen am Ende, das ist schon fast eine Art Sen-Buddhismus. Also Hansen, Petersen und so weiter und so fort. Mit Nikolaus ist das schon eine andere Sache, wer heißt denn schon Nikolaus mit Vornamen. Nikolaus Friedrichsen, daran muss man sich auch erst einmal gewöhnen.
Natürlich sagt nicht dauernd jeder Nikolaus zu mir, das wäre doch etwas zu umständlich. Die meisten nennen mich einfach Nick oder manchmal auch Nicki. Nicki finde ich etwas peinlich, aber Nick geht gerade noch so.
Und jetzt komme ich gleich mal auf den Punkt: Ich bin in Flensburg geboren und aufgewachsen. Das ist natürlich irgendwie normal und keineswegs außergewöhnlich. Vielen anderen in meiner Generation ist es genauso ergangen. Ich möchte aber schon behaupten, dass gerade diese Stadt mich besonders geprägt hat. Es wäre alles ganz anders gewesen, wenn ich zum Beispiel in Hamburg oder irgendwo in einem kleinen Dörfchen in Angeln meine Kindheit und Jugend verbracht hätte. Habe ich aber nicht, wahrscheinlich zum Glück, denn Flensburg hat mir viel gegeben und mich sicherlich auch beeinflusst. Flensburgs Einfluss auf mich war dabei natürlich sehr viel größer als mein Einfluss auf Flensburg, der wahrscheinlich kaum messbar war.
In den folgenden Kapiteln möchte ich ein paar Eindrücke und Erlebnisse schildern, die alle etwas mit meiner Heimatstadt zu tun haben. Im Wesentlichen wird es dabei um die Zeit der fünfziger bis siebziger Jahre gehen, einem Zeitraum also, in dem sich Flensburg ganz erheblich verändert und entwickelt hat. Ich wünsche allen viel Vergnügen bei meiner kleinen Zeitreise.
1. Kapitel: Hallo Flensburg, da bin ich!
Ausgerechnet am 1. Januar 1952 werde ich geboren. Man sagt mir später, es wäre sechs Uhr morgens gewesen, kurz vor dem Frühstück sozusagen. Ort des Geschehens: Die Förde-Klinik in der Mürwiker Straße 115. Eine Privatklinik, auf diesen Begriff hat meine Mutter später immer sehr großen Wert gelegt. Meine Geburt hatte also etwas Privates an sich.
Außer meiner Mutter, die ich bei dieser Gelegenheit auch mal von außen kennenlerne, sind natürlich noch weitere Personen am Gesamtgeschehen beteiligt, also Ärzte und Krankenschwestern. Vermutlich aber nur ein Arzt. Von einer Ärztin ist niemals die Rede gewesen.
Es hieß später, ich wäre ein besonders großes und schweres Kind gewesen, so eine Art Riesenmops mit mindestens 10 Pfund Lebendgewicht. Man hatte sogar den Verdacht, meine Mutter würde Zwillinge zur Welt bringen, dem war aber nicht so. Heutzutage würde man so etwas mit Ultraschall und anderen Methoden natürlich vorab zweifelsfrei geklärt haben, damals soll die ärztliche Kunst aber noch nicht ganz so weit gewesen sein.
Mein erster Eindruck von der Welt: Sehr hell und sehr laut, außerdem dürfte es ruhig etwas wärmer sein. Ich verbringe die folgenden Tage überwiegend schlafend im sogenannten Säuglingszimmer, übrigens zwischen zwei jungen Damen, die auch gerade erst angeliefert worden sind. Die Krankenschwestern sollen mich „König Faruk mit den zwei Frauen“ genannt haben. Das werden sie vielleicht auch in meiner Gegenwart so gesagt haben, aber, ehrlich gesagt, ich hatte es damals noch nicht so ganz verstanden.
Bei meiner Ernährung gibt es ein Problem: Mit der Muttermilch will es nicht so recht klappen, warum auch immer. Vielleicht hat man seinerzeit auch noch nicht so viel Geduld gehabt wie heute. Es wurde also einfach festgestellt, dass es nicht funktioniert, und damit war das Thema beendet. Aus Nikolaus Friedrichsen wird ein offizielles Flaschenkind. Was das Fläschchen damals enthielt, kann ich leider nicht mehr so ganz genau sagen. Offensichtlich war damit aber meine Verpflegung gesichert, und das war dann erst einmal die Hauptsache.
Meine Mutter habe ich ja bereits kennengelernt, sie heißt übrigens Annalena mit Vornamen und ist bei meiner Geburt 31 Jahre alt. Ich bin ihr zweites Kind. Auf meine Schwester, von der ich noch nichts weiß, werde ich noch zurückkommen. Ich habe auch einen Vater, das ist ja erfreulich, er war bei der Geburt aber nicht dabei, weil das damals noch nicht üblich war. Wie er davon erfahren hat? Ich nehme an, die Förde-Klinik wird ihn einfach angerufen haben: „Herr Friedrichsen, herzlichen Glückwunsch, Ihre Frau ist gerade mit einem gesunden Jungen niedergekommen.“ Oder so ähnlich, vielleicht war die Formulierung auch etwas anders. Ein Telefon gab es bei uns zu Hause allerdings schon, das lag daran, dass mein Vater beruflich immer erreichbar sein musste. Es war aber kein normales Telefon von der Deutschen Bundespost, sondern ein Apparat von der Stadt Flensburg, die ein eigenes Fernsprechnetz für ihre Mitarbeiter unterhielt. Es durfte eigentlich auch nicht für private Zwecke benutzt werden, aber in diesem Fall hat man sicher ein Auge zugedrückt.
Ein paar Worte zu meinem Vater: Heinrich Friedrichsen, Stadtinspektor in Flensburg. Was er genau bei der Stadt Flensburg macht, werde ich erst später erfahren. Jedenfalls ist er schon 38 Jahre alt und damit nicht gerade ein junger Vater, jedenfalls zu der damaligen Zeit nicht. Er sieht schon ziemlich kräftig aus, manche würden wahrscheinlich schon dick sagen. Die schlechten Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg sind vorüber, 1952 hat gerade begonnen, da ist die Versorgung mit Lebensmitteln schon wieder recht üppig, wenn auch viele über die hohen Preise klagen. Aber zurück zu Heinrich Friedrichsen: Er wird sicher auch ein paar Blumen aufgetrieben haben, vielleicht sogar am Bahnhof, denn heute ist Neujahr, da haben die Geschäfte geschlossen. Eventuell hat er auch etwas für mich dabei, möglicherweise ein Stofftier oder so etwas in der Art. Ich nehme aber auch an, dass er meine Schwester mitgenommen haben wird, es ist ja nur ein kleiner Weg zu Fuß von der Fruerlunder Straße bis zur Förde-Klinik.
Das ist also meine Heimatadresse: Fruerlunder Straße 29 in Flensburg. Eine Postleitzahl gibt es schon, 24, diese Nummer gilt aber für den ganzen nördlichen Raum bis runter ins nördliche Niedersachsen. 1962 wird dann 239 für Flensburg gelten, später kommen dann die fünfstelligen Postleitzahlen, aber die interessieren mich jetzt natürlich noch nicht so besonders.
Eher interessiert mich jetzt meine Familie, insbesondere meine Schwester. Gudrun, sechs Jahre alt. Mit einem bunten Pullover und einer Haarspange. Übrigens hat sie eher braune Haare, so wie meine beiden Eltern. Die haben außerdem auch braune Augen, während meine Augen und die meiner Schwester blau sind. Oder meinetwegen auch blaugrün oder blaugrau, da will ich mich jetzt nicht so festlegen. Meine Haare sind übrigens blond, so dass ich meinen Eltern auf den ersten bis zweiten Blick nicht besonders ähnlich bin. Aber noch ist mein Haupthaar eher spärlich und wird sich erst später zu einem ansehnlichen Haarschopf auswachsen.
Ob Gudrun wohl besonders erfreut ist über meine Ankunft? Ich kann es mir kaum vorstellen. Meine Eltern haben nur eine Dreizimmerwohnung, da werde ich dann ins Kinderzimmer mit reingequetscht und werde meine Schwester sicher auch oft ziemlich nerven. Aber okay, wenn sie jetzt enttäuscht ist oder gar verärgert, sie lässt es sich auf jeden Fall nicht anmerken.
Ich möchte das Kapitel über meine Ankunft in Flensburg mit einem etwas heiklen Thema abschließen: Heikel deshalb, weil ich zugeben muss, dass ich kaum etwas darüber weiß. Erst in späteren Jahren hat mir mal meine Tante Hella, die Frau von Onkel Karl, so ungefähr folgendes gesagt: „Nicki (sie hat tatsächlich Nicki gesagt), als du noch ganz klein warst, warst du ein halbes Jahr im Krankenhaus wegen einer Hirnhautentzündung. Das war eine ganz schlimme Zeit für deine Eltern. Aber sag‘ mal, wusstest du das denn noch gar nicht?“
Nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Nur, dass ich mal als kleines Kind im Krankenhaus war. Aber wie lange, nein, das war mir wirklich nicht klar. Ein halbes Jahr? Um Gottes Willen. Das ist ja eine schrecklich lange Zeit. Und ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, kein Stück. Na gut, das ist dann vielleicht auch besser so. Aber meine Eltern hätten es mir ruhig mal erzählen können, man muss so etwas ja nicht aus zweiter Hand erfahren. Hirnhautentzündung? Darüber möchte ich jetzt lieber nicht weiter nachdenken. Anscheinend habe ich das alles aber doch noch ganz gut überstanden.
Sommer 1952 im Garten hinter dem Haus
2. Kapitel: In der Fruerlunder Straße
Um genau herauszufinden, wo die Fruerlunder Straße liegt, nimmt man sich am besten den Flensburger Stadtplan zur Hand. Wenn man ihn aber gerade nicht dabei hat, hilft es vielleicht schon, wenn man sagt, die Straße liegt irgendwo im östlichen Teil von Flensburg. Etwas genauer: Sie ist eine Parallelstraße der Mürwiker Straße und befindet sich im weitesten Sinne in Höhe des Volksparks und des Stadions. Hier in der Nähe gab es auch einmal die Pädagogische Hochschule, die dann aber später wieder abgerissen wurde. Wer es ganz genau wissen möchte: Die PH Flensburg in der Mürwiker Straße 77 wurde 1959 eingeweiht und bereits 2004 wieder abgerissen. Aber das möchte ich hier eigentlich nur am Rande erwähnen.
Zurück zur Fruerlunder Straße: Sie beginnt als Einmündung von der Gerhart-Hauptmann-Straße und endet schließlich bei der Tilsiter Straße. Heute bildet sie dort das Ende einer Sackgasse, früher konnte man auch mit dem Auto noch bis zur Tilsiter Straße und zur Mürwiker Straße durchfahren. Die Fruerlunder Straße ist eben nur eine relativ schmale Nebenstraße, in der man heutzutage wegen der vielen parkenden Autos nicht so leicht durchkommt. Früher, und wir bewegen uns ja noch am Anfang der fünfziger Jahre, gab es dort nur ganz wenige private Kraftfahrzeuge.
Wenn man der Fruerlunder Straße von Anfang an folgt, trifft man bald auf eine Reihe von elf gleichen Mehrfamilienhäusern mit jeweils vier Wohnungen. Damals aus rotem Backstein mit einem Walmdach darauf, heute sind die Außenwände hell verkleidet oder verputzt und machen deshalb einen ganz anderen Eindruck als früher. Die Nr. 29 ist das erste dieser Häuser und sie wird ungefähr für die nächsten acht bis neun Jahre mein Zuhause sein. Noch eine Anmerkung zu diesen elf ehemals roten Backstein-Blocks: Angeblich sollen sie zu Anfang der 1930-er Jahre als Wohnungen für die Familien der in Mürwik stationierten Marinesoldaten erbaut worden sein. Nach heutigen Maßstäben waren sie natürlich alles andere als modern, mit Ofenheizung und Wohnküche, aber immerhin mit Bad inklusive Toilette. Das Wasser für die Badewanne musste allerdings umständlich mit dem Badeofen aufgeheizt werden. Mehr als einmal in der Woche war das normalerweise nicht drin.
Ich stand einmal im Jahr 2018 genau vor der Hausnummer 29 und habe mich gefragt, wie denn wohl heute die Wohnungen von innen aussehen. Vermutlich hätte ich durchaus irgendwo klingeln und danach fragen können, aber ich habe es dann doch gelassen. Ich nehme aber an, dass sämtliche dieser Wohnungen mit allem heutigen Komfort ausgestattet sein werden, auch mit der jetzt in Flensburg üblichen Fernheizung.
Aber wie gesagt, 1952 war man noch weit davon entfernt. Es gab auch noch gar keine elektrischen Türklingeln, sondern etwas eigenartige Drehklingeln in den Wohnungstüren, die man von Hand zu bedienen hatte. Je heftiger man drehte, desto lauter war das Klingelgeräusch. Durchaus komfortabel war jedoch der Umstand, dass der Postbote die Briefe durch den Schlitz in der Wohnungstür steckte. Auch die Zeitung nahm diesen Weg.
Dreizimmerwohnung: Wohnküche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Badezimmer. Die Wäsche wurde in der Waschküche im Keller gewaschen, bei vier Parteien im Haus musste man sich das natürlich aufteilen. Es gab einen Trockenboden, aber auch einen Platz zum Wäschetrocknen hinter dem Haus. Nicht mit Rasen bedeckt, sondern mit schwarzem Schotter, der unter den Füßen knirscht. Jeder hat einen Keller für die Vorräte: Kohlen, Holz, Kartoffeln, aber auch Eingemachtes in Weckgläsern. Kühltruhen waren noch genauso unüblich wie Waschmaschinen. Übrigens waren auch Kühlschränke zu Beginn der fünfziger Jahre eher selten zu finden. Im Treppenhaus, in der Wohnküche und im Badezimmer bestand der Fußboden aus Terrazzo, einem ziemlich feinkörnigem schwarz-weißen Steinbelag. Sehr praktisch, aber auch sehr kalt an Wintertagen.
Eines sollte ich noch erwähnen, um das Bild noch etwas abzurunden: Hinter dem Haus gab es für jeden Mieter noch einen eigenen Garten, der durchaus nicht klein war. Hier wurde auch alles Mögliche an Gemüse angebaut: Mohrrüben, Gurken, Zwiebeln, Bohnen oder auch Erbsen. Die wurden dann nach der Ernte in Weckgläser eingekocht und ergänzten die Lebensmittelvorräte bis zum nächsten Sommer. Sicher war das alles sehr mühevoll und zeitraubend. Diese Tätigkeiten, das Wäschewaschen in der Waschküche (es wurde auch noch das Waschbrett verwendet) und das Heizen der Öfen in den verschiedenen Zimmern waren überwiegend den Frauen vorbehalten. Nicht zu vergessen das Kochen und Backen. Berufstätige Frauen waren selten, natürlich gab es sie auch, aber die meisten Frauen waren mit dem Haushalt und den Kindern beschäftigt und damit auch mehr als voll ausgelastet.
Aber eigentlich kenne ich mein Zuhause noch nicht. Möglicherweise verbringe ich auch noch ein halbes Jahr im Krankenhaus, bevor ich endgültig in der Fruerlunder Straße 29 vor Anker gehe.
Fruerlunder Straße 29 – im Hinterhof
3. Kapitel: Unsere Wohnung
Meine erste richtig bewusste Erinnerung habe ich an einen Nachmittag in unserem Wohnzimmer. Ich spiele mit irgendetwas in meinem Laufstall, der wahrscheinlich kaum größer als ein Quadratmeter gewesen sein wird. Meine Mutter kommt mit einer anderen Frau herein, die bei meinem Anblick äußerst erfreut zu sein scheint. Sie hat mir etwas mitgebracht, einen kleinen Stoffhasen von Steiff, den ich sofort ebenfalls äußerst erfreut ergreife. Wie alt mag ich da gewesen sein? An seine beiden ersten Lebensjahre soll man sich angeblich gar nicht mehr erinnern können, aber der Laufstall spricht für unter zwei Jahren. Na gut, ich will mich nicht darüber streiten, möglicherweise war ich doch schon zweieinhalb Jahre alt. Die Frau, die mir den Hasen geschenkt hat, war wohl eine Freundin oder ehemalige Kollegin oder beides meiner Mutter. Sie werden dann sicher Kaffee im Wohnzimmer getrunken haben, am Esstisch.
Das Zimmer ist mit allen möglichen Möbeln ziemlich vollgestellt: Esstisch mit vier Stühlen, Wohnzimmerschrank, Anrichte, Sofa. Dann auch noch zwei Sessel. An einen Couchtisch kann ich mich nicht erinnern, der hätte hier wahrscheinlich auch gar nicht mehr hineingepasst. Ein Teil des Raumes wird auch schon von einem gewaltigen Kachelofen eingenommen, in dem man hinter einer kleinen Gittertür auch etwas warmstellen konnte. Eventuell sogar eine Kaffeekanne.
Sämtliche Sitzmöbel sind mit einem dunkelgrün gemusterten Stoff überzogen, der an Laub erinnert. Eigentlich sieht der Stoff ziemlich scheußlich aus, jedenfalls nach heutigem Geschmack. Übrigens sind alle Möbel von einem Tischler angefertigt worden, das muss zu der Zeit geschehen sein, als meine Eltern mit meiner Schwester in die Fruerlunder Straße eingezogen waren. Im Jahre 1949, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war es bereits 1948? Egal, das tut wohl nichts zur Sache. Ich weiß nur, dass sie vorher noch keine richtige eigene Wohnung hatten, sondern zwei Zimmer im Haus einer Tante meines Vaters in der Kanzleistraße, was aber wohl nicht ganz so toll war.
Aber zurück zu unserem Wohnzimmer: Die Einrichtung wurde durch ein Möbelstück komplettiert, das man heutzutage nicht mehr auf den ersten Blick als Musikanlage identifizieren würde. Es war eine sogenannte Musiktruhe von der Firma Nordmende, mit Schiebetüren. Waren beide Türen geschlossen, war das Radiogerät nicht zu sehen. Links das Radio mit allen möglichen interessanten beleuchteten Skalen, Tasten und Knöpfen. Das magische Auge, mit dem die Senderabstimmung in dunkelgrün und hellgrün angezeigt wurde, war dabei besonders faszinierend. Aber auch die elfenbeinfarbenen Tasten, mit denen man den Klang verändern konnte: „Sprache“, „Orchester“, „Hörspiel“, „Jazz“ zum Beispiel. Im rechten Fach war ein Dual-Platten-wechsler, den man mit zehn Single-Schallplatten laden konnte. Gar nicht so unmodern, so konnte man seine eigene Playlist zusammenstellen. Über dem Plattenspieler war ein Ständer mit nummerierten Fächern für 60 kleine Schallplatten.
Wann genau dieses Wunderwerk deutscher Unterhaltungs-Elektrik Einzug in unser Zuhause fand, kann ich nicht so ganz genau sagen. Vielleicht schon 1954, eventuell aber erst ein Jahr später. Mein Vater kannte jemanden, der ein Radiogeschäft am Hafermarkt hatte, von dem hat er es wohl etwas günstiger bekommen. Derselbe gute Mann war dann auch später der Lieferant unseres ersten Fernsehers.
Noch eine kurze Bemerkung zum Radioprogramm: In meiner Erinnerung gab es eigentlich nur zwei Sender, meine Eltern sprachen von „Mittelwelle“ und „UKW“. Damit waren der NWDR (Nordwestdeutscher Rundfunk) und UKW Nord gemeint. 1956 wurden daraus NDR/WDR 1 und NDR 2. NDR/WDR 1 konnte man schließlich auch auf UKW empfangen, dadurch wurde die Qualität deutlich besser. Darüber hinaus gab es natürlich noch jede Menge anderer Sender auf Mittel-, Lang- und Kurzwelle, die man aber wegen des schlechten Empfangs meistens nicht hörte. Das erste und das zweite Rundfunkprogramm aus Hamburg bzw. Köln wurden damit zum akustischen Begleiter meiner Kindheitstage.
Doch wir befinden uns immer noch in der Zeit von 1954 bis 1955. Ich habe ein Kinderbett mit Gittern im Kinderzimmer, gegenüber, an der anderen Wand, ist das Bett meiner Schwester. Irgendwann werden die Gitter entfernt und ich genieße volle Bewegungsfreiheit. Ich erkunde die gesamte Wohnung und fühle mich dort in kürzester Zeit ganz wie zu Hause. Der Mittelpunkt des Gesamtgeschehens ist die Wohnküche, die beinahe so groß wie das Wohnzimmer ist. Es gibt auch hier einen Tisch, an dem die Mahlzeiten eingenommen werden, aber man kann auch daran bzw. darauf abwaschen, indem man zwei unter der Tischplatte versteckte Emailleschüsseln herauszieht. Das Abwaschwasser muss auf dem Gasherd gekocht werden, so etwas wie einen Boiler gibt es noch nicht. An einer Wand ist eine ziemlich große Gasuhr angebracht. Ansonsten gibt es eine abgetrennte Speisekammer und ein paar Küchenschränke.
Der Flur ist klein, das einzig Bemerkenswerte daran ist für mich die Lampe mit den bunten Gläsern an den Seiten, das sieht insgesamt wirklich sehr hübsch aus. Das Elternschlafzimmer wirkt dagegen nicht besonders einladend mit einem wuchtigen Schrank und soliden Betten aus Eichenholz. Ich glaube, das hat auch alles der Tischler angefertigt, es sieht jedenfalls wie aus einem Guss aus.
Mein Lieblingsplatz auf der Vorgarten-Mauer
(Kaum sichtbar im Hintergrund: Auf der Backsteinmauer rechts neben der Haustür sind noch die verwaschenen Reste einer Aufschrift in weißer Farbe zu erkennen: „Luftschutzraum“. Das ist mir erst sehr viel später aufgefallen, zu der Zeit, als das Foto entstand, war es für mich überhaupt noch kein Thema.)
4. Kapitel: Auf Erkundungstour
Wie jedes andere Kind, werde auch ich in meinen ersten Lebensjahren zunächst mit dem Kinderwagen, danach mit der „Sportkarre“ draußen herumgefahren. Natürlich vorwiegend von meiner Mutter, dann gibt es aber auch ein paar ältere Mädchen aus der Nachbarschaft, die sich beinahe darum reißen, mich auszufahren. Meine Schwester ist sicher auch das eine oder andere Mal dabei. Diese Touren führen dann meistens die Fruerlunder Straße entlang in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße und dann auf der Ostlandstraße nach Fruerlundhof, wo es noch einen richtigen Bauernhof gibt.
Ein Stück weiter entfernt befindet sich schon die sogenannte Nordstraße, eigentlich die B 199 von Flensburg nach Kappeln. Gerade 1954 eröffnet und zur damaligen Zeit hochmodern mit Betonbelag und Radweg an einer Seite. Der Autoverkehr fasziniert mich, obwohl er damals mit Sicherheit noch nicht so intensiv war wie heute. Mein erstes Wort soll „Auto“ gewesen sein, wenn man der Familien-Überlieferung glauben darf.
Eine meiner Sportkarren-Pilotinnen ist eine gewisse Margot Schott aus dem Nachbarhaus, etwa zehn Jahre alt und mit kräftigen Zöpfen ausgestattet. Ihre Eltern betreiben so eine Art Mini-Kiosk in ihrer Speisekammer. Man kann auch nach Feierabend bei Schotts klingeln und dort zu handelsüblichen Preisen ein paar Kleinigkeiten erwerben: Süßigkeiten, Zigaretten, aber auch Getränke. Ein Bier namens Oranjeboom Export oder eine Cola mit dem seltsamen Namen Sparta Cola. Ein kleines Blechschild im Fenster weist auf die Verkaufsstelle hin: Werner Schulze, Kiel. In späteren Zeiten wurden solche Mini-Kioske Nachbar-Shop genannt, ein anscheinend ganz einträglicher Nebenerwerb. Auch ich habe mir bei Familie Schott öfter mal ein paar Sahnebonbons gekauft, in einer kleinen Packung mit fünf Stück. Grün, gelb oder rot. Es gab aber auch die braune Packung mit Schoko-Geschmack.
Oder Ahoj-Brausepulver von Frigeo. Himbeere, Orange, Zitrone oder Waldmeister. Das Brausepulver wurde aber meist nicht mit Wasser angerührt, sondern von der Tüte direkt in die Hand geschüttet und dann langsam und genüsslich aufgeleckt.
Kinder gibt es um diese Zeit sehr viele in der Fruerlunder Straße. Allein in unserem Haus sind es schon mindestens acht, wobei natürlich auch schon ein paar eher Jugendliche dabei sind. Wenn das Wetter es erlaubt, wird draußen gespielt. Cowboys und Indianer, Verstecken, alle möglichen Ballspiele mit seltsamen Namen. Halli-Hallo zum Beispiel, dabei musste einer den Ball hochwerfen und die anderen liefen so schnell weg, wie sie konnten, bis der Werfer den Ball wieder gefangen hatte. Was danach aber genau geschah, weiß ich leider nicht mehr. Es wurde auch viel Fahrrad gefahren und Rollschuh gelaufen. Ganz Wagemutige gingen auch auf Stelzen. Sogar auf der Straße war das kein Problem, es kam nur selten mal ein Auto vorbei.
Ich lerne nach und nach unsere Nachbarn im Haus kennen. Direkt gegenüber unserer Wohnung wohnt die Familie Dobroch. Flüchtlinge, wie es heißt. Mit diesem Wort kann ich natürlich noch nichts anfangen. Ich erfahre später, dass sie aus Ostpreußen stammen. Unter welchen Umständen es sie nach Flensburg verschlagen hat und schließlich in die Fruerlunder Straße 29, ist mir bis heute nicht klargeworden. Herr und Frau Dobroch mit ihren drei Söhnen. Sie sind schon älter und gehen zur Schule, einer von ihnen macht sogar schon eine Lehre. Herr Dobroch ist beim Zoll, genaugenommen bei der „Branntweinstaffel“. In Flensburg gibt es viele Spirituosenfabriken, in denen außer Rum noch zahlreiche andere geistige Getränke hergestellt werden. Auf jeden Fall werden diese Fabriken auch irgendwie vom Zoll überwacht und das ist eben der Job von Herrn Dobroch. Er selbst scheint auch dem Branntwein nicht abgeneigt zu sein, wie seine rote Nase beweist.
Frau Dobroch ist der Inbegriff der perfekten ostpreußischen Hausfrau, die mit ihren Koch- und Backkünsten den Laden zusammenhält. Ihre besondere Vorliebe gilt dem Hefegebäck, ihr Streuselkuchen ist legendär und erweckt den Neid aller anderen Hausfrauen. Die Eltern Dobroch sprechen den gemütlich klingenden ostpreußischen Dialekt, den Söhnen kann man ihre Herkunft aber nicht mehr so deutlich anhören.
Direkt unter den Dobrochs wohnt Familie Bessen. Er ist Maler, sie wiederum Hausfrau. Ich bin von Anfang an total begeistert von Frau Bessen, sozusagen richtig verliebt in sie. Als ich mit sieben Jahren eine Ukulele habe, stehe ich draußen unter ihrem Küchenfenster und gebe das Lied „Ich möcht‘ mit dir träumen“ von Peter Kraus und Micky Main zu Gehör. Natürlich kann ich nicht wirklich Ukulele spielen, ich zupfe nur etwas laienhaft an den Saiten. Auch die Tochter Irmi, etwa so alt wie meine Schwester, hat es mir sehr angetan. Ein ganz hübsches Mädchen mit blonden Haaren und braunen Augen, diese Kombination ist ja eher selten. Irmi ist jedenfalls total nett und sagt immer „Hallo, Nicki!“ zu mir. Sie hat auch einen Bruder namens Georg, der ist schon aus der Schule, er findet aber keine Lehrstelle, was wohl ein echtes Problem für die Familie Bessen ist.
Direkt unter uns wohnen Herr und Frau Jessen. Sie haben auch Kinder, aber seltsamerweise kann ich mich gar nicht mehr an sie erinnern. Vielleicht waren sie ja auch schon etwas älter und ich habe nichts weiter mit ihnen zu tun gehabt. Herr Jessen ist Abteilungsleiter in einem großen Textilgeschäft, er hat sozusagen die Teppiche unter sich. Teppichböden sind noch kein Thema, aber es gibt echte oder nachgemachte Perser. Es heißt irgendwann, Herr Jessen würde jeden Abend eine Flasche Rum trinken. Wenn es denn stimmt, ist dies meine erste Begegnung mit einem echten Alkoholiker. Vielleicht bekommt seine Frau auch ab und zu einen Schluck Rum ab, aber auf jeden Fall raucht sie. Astor, mit Korkmundstück. Das sieht irgendwie vornehm aus.
Meine Mutter habe ich höchstens ein- oder zweimal eine Zigarette rauchen sehen, mein Vater war aber ständig am Rauchen. Ohne Filter, seine Stamm-Marke war Senoussi. Aber er rauchte auch hin und wieder mal Overstolz, Lux ohne Filter, Virginia, North State oder Pall Mall. Ich kenne meinen Vater eigentlich nur mit der Zigarette in der Hand.
Aber zurück ins Haus meiner Kindheitstage: Nachdem ich endgültig gut laufen kann und nicht mehr unbedingt nur Blödsinn anstelle, darf ich mich auch mal unbeaufsichtigt auf den Weg machen. Dieser Weg führt mich geradewegs herüber zu den Dobrochs. Einmal klingeln, dann öffnet mir Frau Dobroch die Wohnungstür und ich folge ihr in die Küche, wo sie meistens was zu tun hat und wo es oft auch ganz lecker riecht. Sie erzählt mir irgendwas und ich unterhalte sie meinerseits mit meinen kleinen Geschichten. Ich gehe auch häufig runter zu Frau Bessen, die dann so etwas ähnliches sagt wie: „Ach, mein Nickilein will mich wieder mal besuchen, dann komm‘ doch rein!“ Ich finde es richtig toll, dass ich hier überall so willkommen bin. Nur zu Frau Jessen gehe ich nicht ganz so gerne, aber es kommt doch hin und wieder mal vor.
Es wäre natürlich noch toller, wenn Kinder in meinem Alter im Haus wären. Das ist aber leider nicht so.
Autos sind noch selten in der Fruerlunder Straße. Hier ist es aber sogar ein Mercedes.