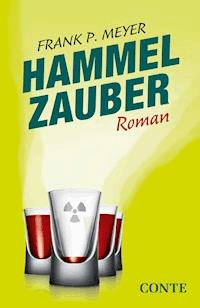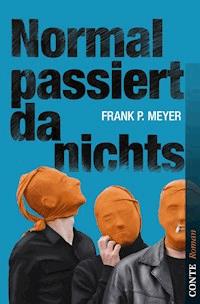
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich bin nicht sicher, ob Andi genau verstand, was wir ihm vorschlugen, als Gabriel ihm eröffnete, dass wir eine Mensa überfallen wollten, und auch Speedy starrte er verständnislos an, als der lallte: "unnischbinderfluch … der Fluchtfarra."" Rafael aus Antwerpen heuert als Pizza-Entwickler bei Tiefkühl-Wagner im Saarland an. In der WG von Mike und Gabriel ist ein Zimmer frei. Aber worauf hat er sich da eingelassen? Das Leben der beiden vaterlosen Cousins zirkuliert zwischen Partys, Trinkgelagen und einem kuriosen Wettkampf in Trier namens Mariathlon. Mike hat bei den Frauen den Dreh raus. Gabriel schreibt über das Bergwerksunglück von Luisenthal 1962, bei dem sein Vater starb. Anteilnahme findet er bei Johanna, die ihr Netz nach ihm schon längst ausgelegt hat. Eine Einkommensquelle der beiden Mittdreißiger sind Schmuggelfahrten ins benachbarte Luxemburg. Doch das Ultimatum des Dorfpolizisten und die bevorstehende Einführung des Euro - es ist das Jahr 1999 - lassen das Geld knapp werden. Die rettende Idee: bei einem Raubüberfall auf die Trierer Unimensa kann eigentlich nichts passieren. Doch damit fangen die Probleme erst richtig an … Frank P. Meyer erzählt eine turbulente Geschichte vom späten Erwachsenwerden und den überraschenden Wendungen einer außergewöhnlichen Familienkonstellation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Emotionsleserin
PrologWie Belmondo
Er schreckte hoch. Einen Moment lang wusste er nicht, wo er war. Dieses Gefühl hatte er manchmal, wenn er neben ihr aufwachte. Für einen Augenblick glaubte er dann immer, er müsse ein schlechtes Gewissen haben.
Er horchte. War etwas passiert?
Auf dem Nachttisch lag seine Uhr. Oje, schon so spät. Gleich mussten sie raus hier. Er tastete unter dem Laken, fühlte ihre Taille, glitt langsam die samtene Haut entlang.
Sie war eingenickt. Er rückte näher an sie heran, roch ihre Wärme. Sie bewegte sich sachte, murmelte: »Wie spät?« Die Frage kam instinktiv.
Er wollte nicht, dass sie schon wach wurde.
»Wir haben noch ein bisschen Zeit.«
»Nur noch sehr wenig Zeit«, hätte er eigentlich sagen müssen.
Schade, dass ich nicht rauche, dachte er. Gerne hätte er einmal die Zigarette danach geraucht. Das hätte er lässig gefunden. Vielleicht paffte er das nächste Mal ein Zigarettchen. Danach. Einfach so. Um es einmal getan zu haben. Und dabei würde er die freie Hand zwischen dem Kopfkissen und seinem Hinterkopf einklemmen. Er konnte sich vorstellen, dass er dann wie Jean-Paul Belmondo aussah. So lässig.
Heute Morgen war es schnell gegangen. Sehr schnell. Kaum war er bei ihr im Bett, ging es schon los. Sie war ungeduldig gewesen. Alles was sie tat, tat sie schnell. Sogar das Küssen. So, wie man Schokolade oder Pudding schnell aufisst, weil man Angst hat, dass die Geschwister es einem sonst wegessen. Jetzt war sie wieder eingedöst. Er mochte das: Wach neben ihr liegen, wie Belmondo, und sie schlafen lassen.
Draußen war es trübe. Tristes Februarwetter. Es nieselte. Vorhin – als sie mitten drin waren – hatte es draußen einen dumpfen Knall gegeben. Es hatte geklungen, wie wenn man zuhause die große Falltür zufallen ließ, die in den Keller führte. Die Tür war schwer, aus dickem Holz, und erinnerte ihn immer an eine Grabplatte.
Es hatte keinen Zweck, die Zeit war um. Sie musste bald nach Hause und er hatte noch einiges in Völklingen zu erledigen, bevor er zurückfuhr.
Er schaltete das kleine Kofferradio an, das auf dem Nachttisch stand.
»Dieser blöde Saarländische Rundfunk«, murmelte er, »können die nicht mal was Fetzigeres spielen?« Er wollte keine getragenen Molltöne hören. Jetzt, wo er sich fühlte wie Jean-Paul Belmondo.
Von draußen hörte er Rufe … und Gerenne. Er stand auf, nahm die Hose von der Stuhllehne. Während er sich anzog, drehte sie sich noch einmal um. Er sah durchs Fenster auf die Straße.
Die Scheibe war von innen beschlagen. Er wischte mit der Hand darüber. Ein Mann, der ein Fahrrad neben sich abgestellt hatte, gestikulierte und rief anderen Leuten etwas zu, die zusammengelaufen kamen.
»Was ist denn los?« Sie war wach geworden und sah ihn am Fenster stehen. »Oje, schon so spät, wir müssen gleich weg!«
»Komm mal rasch«, sagte er, »und schau dir an, was da unten los ist! Das bedeutet doch hoffentlich nicht, dass …«
Als er nicht weiter sprach, sprang sie aus dem warmen Bett und kam zu ihm ans Fenster.
Rafael
1Der Jugendclub
Im Jugendclub fühlte ich mich sofort zuhause – so zuhause, dass ich beschloss, Gabriel und Mike nicht zu erzählen, was mich hierher geführt hatte. Noch nicht, jedenfalls. Vielleicht auch nie. Ich musste an meinen Großvater denken: »Ruhe findest du erst, wenn du heimgegangen bist zu den himmlischen Heerscharen«, war einer seiner Lieblingssprüche. Ich schmunzelte, als ich mir vorstellte, wie er es sagte. »Im irdischen Leben«, so fügte er stets bedeutungsvoll hinzu, »gibt es keinen Ort, wo du einmal längere Zeit unbeschwert durchatmen kannst.«
Ich dachte immer: Was versteht mein Großvater schon vom irdischen Leben? Der ist doch streng katholisch.
Von der A1, Trier-Saarbrücken, nahm ich die Abfahrt Braunshausen und bog in Richtung Kastel ab, wie es auf Gabriels Wegbeschreibung stand. Nach wenigen Kilometern sah ich das Ortsschild Primstal. Da wusste ich noch nicht, dass das Haus Der Jugendclub hieß. Gabriel hatte mir nur die Adresse aufgeschrieben: Haagstraße 2.
Gleich nach der festen Zusage der Tiefkühlprodukte Wagner GmbH, dass ich den Job in der Entwicklungsabteilung hatte, fragte ich bei der Chefsekretärin nach, ob sie mir bei der Wohnungssuche helfen könne. Sie war sehr hilfsbereit, auch wenn sie sich ein bisschen wunderte, dass ich ausgerechnet in einer WG wohnen wollte. Und die sollte – wenn möglich – in Primstal sein. Das war das größte Dorf in der Gemeinde Nonnweiler. Wenn ich schon aus der Großstadt aufs Land zog, so redete ich mich bei der Sekretärin heraus, musste es ja nicht das allerkleinste Kaff sein. Das war natürlich nicht der einzige Grund, weshalb ich genau in diesem Dorf wohnen wollte, aber dieser klang wenigstens vernünftig. Dass ich von Primstal aus ein paar Kilometer zur Firma fahren musste, machte nichts. Im Gegenteil, es tat der alten Karre gut, öfter bewegt zu werden.
Bei meiner Vorgabe – Primstal und Wohngemeinschaft – konnte die freundliche Sekretärin nicht gerade eine Auswahlliste präsentieren. Es gab dort nur diese eine WG. Später konnte ich dann behaupten, es sei Schicksal gewesen, ausgerechnet bei Gabriel und Mike gelandet zu sein.
Die Sekretärin regelte das mit den beiden Jungs, die noch ein Zimmer frei hatten, und ich war wirklich verblüfft, als sie mir den Preis für die Miete nannte. Bei uns in Antwerpen konnte man froh sein, für das gleiche Geld einen Garagenplatz zu bekommen. Kurz darauf schickte mir Gabriel den Brief mit der Wegbeschreibung.
Ich fuhr langsam durchs Dorf, langsamer, als vorgeschrieben war und langsamer, als ich sonst zu fahren pflegte. Als ich an einem kleinen Supermarkt und einem Café vorbeifuhr, sahen mir die Leute hinterher, die davor standen. Oder besser gesagt: Sie sahen nicht mir hinterher, sondern dem Auto. Und das wohl nicht nur wegen des belgischen Nummernschilds, sondern vor allem wegen der Farbe. Eine so auffallende Metalliclackierung – irgendwas zwischen mintgrün und türkis – gab es hier sicher genauso selten zu sehen wie das Modell selbst, einen Mazda 818 Sedan. Sedan Deluxe, wohlgemerkt. Baujahr 1979. Es war sicher gut gemeint von meinem Großvater, mir das Auto zu geben, das immer noch auf ihn angemeldet war. Aber mir war klar, dass schon bald jeder in diesem Kaff fragen würde: »Wer ist denn der Ausländer mit dem komischen Auto?«
Ich würde damit leben müssen, so etwas wie eine lokale Berühmtheit zu werden.
Gegenüber der Apotheke hielt ich an. Ich wusste, es waren jetzt nur noch ein paar hundert Meter – ich hatte ja die Wegbeschreibung – aber mir kamen plötzlich Zweifel. Sonderbarerweise fürchtete ich mich in diesem Augenblick davor, in der Haagstraße 2 anzukommen. Wen würde ich dort antreffen? Was wäre, wenn ich anklopfte und mir würde nicht aufgetan? Dabei war das unwahrscheinlich. »Einer von uns beiden wird am 28. September auf jeden Fall da sein«, hatte Gabriel geschrieben, »einfach an die Tür klopfen, eine Klingel gibt es nicht!«
Klopt, en u zal opengedaan worden, heißt es bei Matthäus … aber ich wollte ja kein Flämisch mehr …
Mein Mobiltelefon lag neben mir auf dem Beifahrersitz. Ich tippte die Nummer ein, die Gabriel mir geschrieben hatte. Einige Klingelzeichen lang passierte nichts. Ich hielt den Atem an. Was sollte ich tun, wenn … – »Jugendclub Primstal«, meldete sich eine ruhige Stimme.
»Äh, wie bitte? Ich wollte eigentlich zu, äh, Mike und Gabriel Heck in der … «
»Ach, der Belgier!«, rief jemand vergnügt am anderen Ende der Leitung, »wo steckst du denn?«
»Ehm, ich bin fast schon da … äh, stehe hier in Primstal vor der Apotheke. Wie war das noch mal? Ich habe die Wegbeschreibung verlegt«, log ich, »wo muss ich links abbiegen?«
»Fahr einfach los«, schlug die Stimme am Telefon vor, »und lass das Handy an, ich lotse dich das letzte Stück bis vor die Haustür.«
Als ich auf den Hof vor dem Haus fuhr, stand dort ein Typ mit einem schnurlosen Telefon am Ohr.
»Willkommen im Jugendclub, neuer Mitbewohner«, klang es freundlich aus meinem Handy, gleichzeitig sah ich seine Mundbewegung. »’Tschuldigung – wir hatten dir ja nur die Adresse geschickt, also wundere dich nicht: Du wohnst jetzt im Jugendclub!«, sagte er, als ich aus dem Auto stieg. »Ach herrje, cooles Auto, damit wirst du hier sicher auffallen. Ich bin Mike.«
»Rafael. Raffi, für meine … ähm … Mitbewohner. Wieso denn eigentlich Jugendclub?«
»Das war tatsächlich einmal der Jugendclub der KJP… der Katholischen Jugend Primstal. Hat große Zeiten erlebt, dieser alte Kasten hier. Und ich dachte, Andi oder Matti ruft an … Bei den Jungs hier aus dem Dorf melden wir uns mit ›Jugendclub‹. Wirst dich dran gewöhnen.«
Wollte ich mich daran gewöhnen? Mir kam das reichlich albern vor. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich schon wenige Wochen später selber »Jugendclub Primstal« in den Hörer rufen sollte, wenn es klingelte.
»Komm erst mal rein! Sind deine Sachen im Kofferraum? Ich helfe dir. Eine irre Metalliclackierung hat dieser Mazda. Ist die original? Ich bringe die beiden Koffer schon mal hoch.«
Ich nahm ebenfalls eine Tasche aus dem Kofferraum, wartete aber, bis Mike im Haus verschwunden war. Ich brauchte noch einen Augenblick, um richtig anzukommen. Ich machte ein paar Schritte auf dem Hof. Die glatten Steine erinnerten mich an die Kopfsteinpflastersträßchen zuhause in Flandern. Wieso zuhause? Ich war jetzt nicht mehr in Flandern zuhause! Mein ehemaliges Zuhause lag etwa drei Autostunden entfernt. Zweidreiviertel vielleicht, wenn ich alles aus dem alten Mazda herausholte. Ein paar der Pflastersteine wackelten, wenn man drauftrat, was mich ein wenig beunruhigte. Aber die meisten saßen wie festbetoniert. Beton war zwischen den Fugen allerdings keiner zu sehen.
Mike kam wieder, um weiter den Kofferraum auszuräumen. »Hast du Pflastersteine aus Belgien mitgebracht?«, fragte er, als er meine Taschen raushievte. Ich grinste: »Nein, da sind Küchensachen drin. Mein Werkzeugkasten, sozusagen.« Ich ließ Mike vollbeladen mit meinem Kram ins Haus verschwinden und tat so, als ob ich im Kofferraum noch etwas suchte. Sobald er durch die Tür verschwunden war, richtete ich mich auf, drückte die Kofferraumklappe vorsichtig zu, sodass sie kaum ein Geräusch machte, und sah mir das Haus an.
Der Jugendclub war ein längliches Gebäude mit zwei Geschossen, von denen das obere direkt über den kleinen Fenstern in die Dachschräge überging. Natürlich hatte ich mich vorher über die Gegend kundig gemacht – obwohl es nicht gerade haufenweise Informationsmaterial oder gar einen ordentlichen Baedeker zum Nordsaarland gab. Aber immerhin wusste ich, dass es sich bei diesem Haus um ein Musterbeispiel für ein sogenanntes Trierer Einhaus handelte, wie sie immer seltener wurden. Wie aussterbende Tierarten. Auch hier in Primstal waren die meisten bereits abgerissen oder bis zur Unkenntlichkeit umgebaut worden. Beim Jugendclub war die traditionelle Einhausform aber noch völlig erhalten, denn es gab weder Erker noch Vorsprünge oder Anbauten, die das klare, ebenmäßige Erscheinungsbild gestört hätten. Rechts von der Eingangstür waren zwei kleine Sprossenfenster, links von der Tür nur eins. Die oberen Fenster – insgesamt vier – befanden sich exakt über den Erdgeschossfenstern und über der Haustür, sodass sich ein harmonischer Anblick ergab. Alle Fensterscheiben waren durch ein schmales Holzkreuz in vier gleichgroße Flächen geteilt.
Die rechte Gebäudehälfte diente eindeutig als Wohnteil. Die linke ließ ihre ursprüngliche Funktion ebenso unzweifelhaft erkennen: Hier waren einmal Stall und Scheune untergebracht gewesen. Durch das breite Rundbogentor, dessen Holz dunkelgrün gestrichen war, hatte sicher problemlos ein Pferdekarren gepasst – früher, als es die noch gab. Ein paar Meter links von dem runden Scheunentor gab es noch eine kleine Holztür, die in den ehemaligen Stall führte. In dieser Haushälfte gab es keine Fenster, nur eine herzförmige Öffnung oben im Mauerwerk, durch die ich Vögel rein- und rausfliegen sah.
Mir gefiel, dass man dem Haus auf den ersten Blick ansah, dass es früher einmal das ganze Leben – Wohnen und Arbeiten – in einem Haus vereint hatte: Menschen, Tiere und Arbeitsgeräte hatten ihren festen Platz, alle unter demselben Dach.
Was dem Jugendclub am deutlichsten seinen klaren, unverfälschten Charakter als Einhaus verlieh, war das lange, durchgehende Satteldach. Es war schnörkellos mit hellroten Ziegeln eingedeckt, die an vielen Stellen deutlich Moos angesetzt hatten, dessen Farbe wunderbar mit der des Scheunentors harmonierte. Keine Dachfenster oder Fenstergauben störten das beruhigende Gesamtbild. Noch nie hatte ich ein Dach gesehen, dessen einzige Aufgabe es so eindeutig und ausschließlich war, das Gebäude unter ihm zu schützen. Dass das Haus trotz der äußeren Schlichtheit eine einladende Atmosphäre ausstrahlte, kam sicher daher, dass die Fenster, der Hauseingang und das Scheunentor mit rotbraunem Sandstein eingefasst waren. Da störte es auch nicht, dass die Fassade an manchen Stellen zu bröckeln begann und das Haus den Eindruck machte, als könne ihm ein frischer Anstrich nicht schaden.
Am Scheitelpunkt des Torbogens war gut sichtbar ein trapezförmiger Stein eingebaut, der mir gleich auffiel. Es war etwas darin eingemeißelt worden, aber da die Frontseite nach Westen zeigte, hatten Wind und Regen so sehr an dem Sandstein genagt, dass man nicht mehr erkennen konnte, was dort einmal gestanden hatte. Vermutlich eine Jahreszahl. Mich faszinierte der trapezförmige Stein vor allem deshalb, weil er als einziges Element an der Hausfront ein paar Zentimeter hervorsprang und weil es den Anschein hatte, das ganze Gebäude würde zusammenfallen, wenn man diesen einen Stein herauszog.
»Noch Zeug zu schleppen?«, rief Mike. Er stand wieder in der Haustür, hatte die Sachen schon nach oben gebracht.
»Nein danke, den Rest schaffe ich selber.«
Mike machte nicht viel Aufhebens von meiner Ankunft, was mir gerade recht war. Er drückte mir einen Schlüssel in die Hand und sagte, als ob ich schon seit einer Ewigkeit zum Haus gehörte: »Muss noch mal weg. Gabriel kommt auch erst in zwei Stunden aus Luxemburg zurück. Richte dich ein. Wir sehen uns später.«
»Danke.« Ich steckte den Schlüssel ein und sah Mike hinterher, wie er über den Hof ging, die Straße überquerte und in die Richtung verschwand, aus der ich gerade gekommen war. Mike war ein gut aussehender Mann, der jünger wirkte als Mitte dreißig – Gabriel hatte in seinem Brief erwähnt, dass er selbst sechsunddreißig war und Mike zweieinhalb Jahre jünger. Mike war nicht groß, wirkte muskulös, aber nicht übertrieben muskulös – zweifellos ging er regelmäßig in ein Fitnessstudio oder machte Krafttraining. Er war jugendlich gekleidet. Verwaschene Jeans, einfaches rotes T-Shirt, aber er trug elegante, spitz zulaufende Schuhe und eine braune Wildlederjacke, die sicher nicht ganz billig gewesen war und deren Dunkelbraun zum kräftigen, klaren Braun seiner Augen passte und zu seinem vollen Haar, das er nach hinten gekämmt trug. Es war ebenfalls braun, oder eher brünett, mit einem dunkelroten Schimmer. Als ich ihn einige Tage später in Shorts und mit freiem Oberkörper im Jugendclub rumlaufen sah, musste ich unwillkürlich daran denken, dass eine professionelle Schwarz-Weiß-Fotografie von ihm prima in so einen Kalender mit Männermodels gepasst hätte, wie sie in den Neunzigern auch bei vielen Frauen beliebt wurden. Ich konnte mir gut vorstellen, dass er für die weibliche Landbevölkerung ein echter Hingucker war.
Trotz seines breiten, starken Kinns, trotz der südländisch wirkenden Augen und des Teints erschien mir Mikes Gesicht nicht sonderlich ausdrucksvoll. Es verriet nichts und wirkte weder besonders freundlich noch ablehnend. Ich sollte noch lernen, dass man Mike nicht ansah, was er fühlte oder dachte. Falls er überhaupt fühlte oder dachte. Gabriel vertraute mir schon wenige Tage später an, dass Mike für das Leben, das der führe, eigentlich kein Gehirn brauche, sondern dass man die wenigen Tätigkeiten, die Mikes Lebenswandel mit sich bringe, locker auch über das Rückenmark abwickeln könne.
Anderthalb Stunden später hatte ich mich komplett eingerichtet. Und ich hatte das Haus und vor allem mein Zimmer bereits liebgewonnen. Ich mochte den abgewetzten Holzfußboden, der einen altmodischen Geruch von Bohnerwachs verströmte, die spärliche Möblierung – was brauchte man denn auch mehr als ein Bett, einen Schrank und einen kleinen Tisch mit Stuhl – und vor allem den ungewöhnlichen Lichteinfall durch die tiefliegenden, weiß gestrichenen Sprossenfenster. In den oberen Zimmern waren die Fensterbänke nämlich nur eine Handbreit über dem Fußboden. Und die obere Fensterkante reichte mir gerade einmal bis zum Bauch, sodass ich im Stehen gar nicht hinausschauen konnte – dazu musste ich mich hinknien oder in die Hocke gehen. In der Hocke schaute ich hinunter auf den Hof und sah, wie ein alter Peugeot hinter meinem Mazda einparkte. Die Karre war beinahe so alt wie meine, aber bei weitem nicht in einem so gepflegten Zustand. Der rote Lack war stumpf, wie ausgeblichen. Nur die beiden hinteren Kotflügel waren leuchtend blau. Der Typ, der ausstieg, warf einen flüchtigen Blick auf mein Auto und sah dann hoch zu meinem Fenster. Er konnte von außen offensichtlich sehen, wie ich da am Fenster hockte, denn er winkte mir überschwänglich zu und rief etwas, das ich nicht verstand. Er machte eine Armbewegung, die bedeutete, ich solle runterkommen.
Als ich unten auf dem Hof ankam, hatte er einen Flügel des Scheunentors geöffnet und war dabei, den Kofferraum zu entladen. Während ich auf ihn zuging, stellte er einen großen Blechkanister ab, den er gerade aus dem Kofferraum gehievt hatte, strahlte mich an und streckte mir die Hand entgegen: »Hallo, ich bin Gabriel. Du bist also der neue Mitbewohner. Wir hatten dich etwas später erwartet.«
»Äh, Rafael Vanderhaeghen … äh, also Raffi, angenehm!«
»Hast du Mike schon getroffen? Hat er dich reingelassen? Wo ist der denn schon wieder? Komm, hilf mir mal die Ware ausladen.«
Er plauderte drauf los, erklärte mir rasch, er habe in Luxemburg verschiedene Sachen eingekauft – für sich und für uns, aber manches würde auch weiterverkauft. Er beklagte, dass Mike mir offensichtlich kein Begrüßungsbier angeboten habe.
»Was ist denn das für eine extravagante Autofarbe?«, fragte er, legte aber offensichtlich keinen Wert auf eine Antwort, denn er drückte mir unvermittelt etliche Stangen luxemburgische Zigaretten der Marke Ducal in die Arme. Ich trug ihm die länglichen Päckchen in die Scheune hinterher. Drinnen roch es nach Benzin und nach Kaffee. Letzteres kam von einer Kaffeemaschine und einer aufgerissenen Tchibo-Packung, die beide auf einem Regal standen. Daneben standen noch Dutzende Päckchen Kaffee verschiedener Marken. Und auf weiteren Regalen Tabak. Und Schnaps. Den Zwanzig-Liter-Kanister stellte er mitten im Raum auf dem Boden ab, wo schon mehrere dieser olivgrünen Blechdinger standen. Er nahm mir die Zigarettenstangen ab und räumte sie zu anderen bereits einsortierten Tabakwaren.
»Aber der ist für uns«, verkündete er stolz, während er aus einer der Plastiktüten eine Flasche Whiskey kramte. Er stellte die Flasche auf den Boden und räumte den Rest der Tüte aus. Es waren hauptsächlich irische Marken, von ganz billigen bis zu richtig teuren Malt-Whiskeys, die er in das Regal mit den Kaffeepäckchen einsortierte, wo auch verschiedene Cognacs standen. Dann schraubte er die auf dem Boden abgestellte Flasche Tullamore Dew auf, zauberte hinter den Flaschen auf dem Regal zwei Cognacgläser hervor, füllte beide mehr als bis zur Hälfte und verkündete – so, als ob er es selber glaubte: »Das ist was ganz Besonderes. Auf die neue Dreier-WG!«
»Zum Wohl!« Ich wusste nicht, ob man das sagte, wenn man Whiskey aus staubigen Cognacgläsern trank, und das auch noch in einem Schuppen, der sicher in den Abendnachrichten Top-Thema wäre, wenn die Polizei hier einmal die Nase reinsteckte.
Ich sah wie Gabriels Adamsapfel wippte. Er trank hastig mehrere Schlucke.
Mir fiel auf, wie sehr er sich äußerlich von Mike unterschied. Er war blond, hochgewachsen und schlaksig und hatte ein freundliches Gesicht. Seine graublauen Augen funkelten, wenn er einen ansah, und vor allem, wenn er redete. Und er redete viel, wie ich noch feststellen sollte. Anders als Mike sah man Gabriel an, dass er Mitte dreißig war. Und dennoch hatte er den Blick eines kleinen Jungen. Sein Gesichtsausdruck wechselte während des Gesprächs häufig von vergnügt zu ernsthaft, wobei die fröhlichen, lächelnden Phasen überwogen. Die Kleidung, die er trug, war vor etlichen Jahren modern gewesen: die Schuhe Ende der Achtziger und das Hemd Anfang der Neunziger. Die Haare waren recht kurz geschnitten und wirkten struppig. Eine Frisur konnte man das nicht nennen. Er machte ein paar Scherze, legte zwischendurch aber immer wieder die Stirn in Falten und gab sich nachdenklich, als er laut darüber sinnierte, ob mir nicht das ein oder andere hier sonderbar vorkommen werde und ob ich nicht vielleicht Heimweh bekäme und ob ich denn bald schon Besuch von meiner Familie bekäme, damit die sähen, wo und wie ich hier wohne. Mein Großvater hätte gesagt: »Er zerbricht sich den Kopf anderer Leute.«
Mike vertraute mir wenige Tage später an, dass Gabriel für das Leben, das er führte, eigentlich mehr als nur ein Gehirn bräuchte, nämlich mindestens ein zweites, um genügend Kapazität für die unnötigen Gedanken zu haben, die er sich machte, und für die unbrauchbaren Ideen, die er ständig ausbrütete.
»Aha, erwischt! Ihr habt also ohne mich angefangen!«
»Mike!«, rief Gabriel vergnügt, »nein, nein, wir glühen nur schon ein wenig vor! Moment!«, er füllte sein Glas wieder reichlich auf und drückte es Mike in die Hand, »Und noch mal ganz offiziell, Raffi: Herzlich willkommen!«
Zwei Gläser und eine Flasche klirrten kurz, als sie sachte aneinandergestoßen wurden.
»Prost« – »Prost« – »Prost«. Drei Kehlköpfe wippten beinahe im Takt. Gabriel war etwas langsamer, weil er aus der Flasche trank.
Nach diesem offiziellen Begrüßungsakt entstand ein Moment der Stille, dann fragte Mike vorsichtig: »Ich sehe, Gabriel, du hast unseren neuen Mitbewohner schon in unser Nebenverdienstgewerbe eingeweiht.«
Es klang nicht, als ob das so abgesprochen war, und an Mikes Gesicht war nicht abzulesen, ob er das gut fand, aber Gabriel antwortete: »Ja! Ja, natürlich. Der Junge muss doch das Tagesgeschäft kennenlernen! Keine Angst«, wandte er sich an mich, »du musst ja selbst nichts verkaufen. Aber spätestens wenn Andi oder Rolf ihre Monatsration irischen Whiskey oder Speedy seinen Diesel abholt, würdest du dich sowieso wundern, was hier läuft.«
Was hier genau lief, sagte er nicht, aber da mich Mike fragend und Gabriel auffordernd ansah, sagte ich und versuchte, es möglichst beiläufig klingen zu lassen: »Ich kenne das, ich hab einen Onkel in Arlon, der schmuggelt aus Luxemburg haufenweise Zigaretten, Kaffee und Spirituosen für die ganze Familie. Auf diese Sachen ist auch in Belgien die Steuer viel, viel höher als in Luxemburg. Wenn Onkel Guy zu Besuch kommt, stehen wir hinterm Kofferraum Schlange.« Das stimmte zwar, mein Onkel aus Arlon brachte tatsächlich alle möglichen steuergünstigen Genussmittel mit, aber eben nur als Geschenke für die Familie. Dieses Lager hier schien dagegen für ein halbes Dorf eingerichtet zu sein. Aber meine Antwort beruhigte die beiden. Das Geständnis, einen Onkel zu haben, der etwas mehr Schnaps und Zigaretten zu Familienfeiern mitbrachte, als der Zoll erlaubt, schien auszureichen, um in dieser Schmugglerhöhle als Mitwisser eingeweiht zu werden.
Während wir darauf einen weiteren Whiskey tranken, trat ein Typ ins Scheunentor, der etwa in Mikes und Gabriels Alter war und schüchtern lächelte. Meine beiden Mitbewohner begrüßten ihn beiläufig mit: »Hallo Andi, schon da?«
»Ja, ich habe nicht viel Zeit heute und wollte nur schnell … aaah, da ist er ja, der weiche Tau von Tullamore.« Er streichelte über die Whiskeyflasche, als ob er ein Kätzchen auf dem Arm hielte oder als ob ihm gerade sein Erstgeborenes von der Hebamme überreicht worden sei.
»Wie immer, vier Flaschen«, sagte Gabriel und lud die Ware in einen Pappkarton. Abgezähltes Geld wechselte von Andis in Mikes Hand, und im Weggehen fragte der stolze Whiskeybesitzer, mit einer Kopfbewegung in meine Richtung: »Der Holländer?«
»Belgier«, verbesserte ihn Gabriel.
»Von mir aus. Hauptsache, er verträgt was. Also dann bis morgen zur Begrüßungsfeier.«
Als er losfuhr, grinsten Mike und Gabriel verlegen. »Nun hat er’s schon verraten, der Idiot,« rückte Gabriel heraus, »also wir dachten, da du einen der größten gesellschaftlichen Höhepunkte des Jahres gerade um zwei Wochen verpasst hast – nämlich die Primstaler Kirmes – gibt’s immerhin ein ordentliches Begrüßungsfest für dich!«
»Ja, das ist toll«, fügte Mike hinzu, »das trifft sich gut. Unmittelbar nach der Kirmes kommen immer ein paar lahme Wochen, in denen es schwierig ist, einen offiziellen Anlass für eine Feier zu finden. Du kommst also gerade passend.«
»Eine Begrüßungsfeier? Für mich?« Ich versuchte zu verbergen, dass ich gerührt war, zumal die beiden meine Verlegenheit offensichtlich genossen. »Wo denn, und wie feiern wir? Wer kommt denn?«
»Na, hier feiern wir, hier draußen auf dem Hof. Und wie? Mit Schwenkbraten natürlich, mit was denn sonst? Und mach dir keine Sorgen, es werden schon irgendwelche lokalen Berühmtheiten aufkreuzen.«
»Da bin ich aber gespannt.« Ich war immer noch verlegen und wollte das Thema wechseln: »Was ist los, Jungs? Kriege ich noch einen Whiskey? Schaut her, mein Glas ist schon wieder halb leer.«
»Halb leer?«, lachte Gabriel, »ich würde sagen, es ist immerhin noch halb voll. Raffi, du bist doch hoffentlich nicht so ein Glas-halb-leer-Typ, oder?« Ich fühlte mich ertappt. »Ich selbst bin nämlich eher ein Halb-voll-Typ.« Ich lachte, weil mir die Zweideutigkeit auffiel, und auch Gabriel musste grinsen und korrigierte: »Also ich bin ein Typ, bei dem so ein Glas«, er hob mein Cognacglas mit dem Tullamore Dew in die Höhe, wie um uns zuzuprosten, »natürlich noch halb voll ist.«
»Was ist mit dir?«, wandte ich mich an Mike und deutete auf das Glas, das Gabriel immer noch hochhielt, »ist so ein Glas für dich halb voll oder halb leer?«
Mike schwieg eine Weile und schien ernsthaft nachzudenken, bevor er antwortete: »Das Glas ist doppelt so groß, wie es für die vorhandene Flüssigkeitsmenge notwendig wäre.«
2Das Schwenkbratenprinzip
Am nächsten Tag, dem 29. September 1999, sollte zum ersten Mal diese unglückselige Idee auftauchen, die in den Wochen und Monaten danach zu einem Plan wurde, und gut ein Jahr später zur Tat. Aber an diesem Abend, während der Begrüßungsfeier, die für mich veranstaltet wurde, erkannte ich die Idee nicht einmal als Idee, sondern hielt sie einfach nur für eine bierselige Spinnerei.
Die Leute im Dorf wunderten sich darüber, dass ich so gut Deutsch sprach. Was man von den Primstalern übrigens nicht behaupten konnte. Ihr Deutsch war praktisch frei von jeglichen Genitiven, die Hälfte der Präpositionen war falsch, der ein oder andere bestimmte Artikel wurde in einem anderen Genus benutzt, als ich es aus dem Studium kannte, und bei einigen Verben wie holen und nehmen zum Beispiel hatte ich den Eindruck, dass ich sie in einer völlig anderen Bedeutung gelernt hatte. Und von der Aussprache will ich gar nicht erst reden. Kein einziger meiner alten Lehrer hätte irgendeinen der Primstaler durchs Deutsch-Abitur gelassen. Die Leute erschraken offensichtlich vor meinem fast akzentfreien Deutsch. Deshalb sprach ich möglichst wenig in den ersten Tagen. Mein Zögern wurde häufig fehlinterpretiert, und bei meiner Begrüßungsfeier hatten Andi und Rolf meine beiden Mitbewohner gefragt: »Schwätzt der Bub kään Deitsch?«
Gabriel antwortete wahrheitsgetreu: »Doch! Und zwar besser als ihr beide zusammen«, und als ich mich nach den ersten paar Flaschen Bier traute, den Mund aufzumachen, riefen Matti und Speedy begeistert: »Dein Deutsch ist ja erstklassig für einen Franzosen.« Und der Nachbar meinte – was noch schlimmer war: »Man hört überhaupt nicht, dass du Holländer bist!« Ich fühlte mich anfangs wie Hercule Poirot, wenn ich dauernd sagen musste: »Ich bin Belgier, genauer gesagt Flame, aus Antwerpen.« Aber das war ihnen egal. Ich heimste – neben dem natürlichen Misstrauen, das Saarländer gegen alles Hochdeutschsprachige hegen – auch eine große Portion Bewunderung ein, weil ich »rischdisch schwätze« konnte. Schon wenige Wochen nach meiner Ankunft fragten mich Mike oder manche der im Jugendclub verkehrenden Kumpel des Öfteren, wie bestimmte Satzkonstruktionen auf Deutsch richtig lauteten, wenn sie zum Beispiel einen offiziellen Brief an eine Behörde schreiben mussten. Nur Gabriel war, obwohl auch er breitesten nordsaarländischen Dialekt sprach, zumindest des Schriftdeutschen mächtig. Es stellte sich nämlich heraus, dass er an einem Buch schrieb, seit einigen Jahren schon, einem historischen Buch, in dem es um die Katastrophen des Saarlandes ging.
»Die Katastrophen des Saarlandes?«, fragte ich ihn erstaunt, »ich wusste gar nicht, dass die der Rede wert wären, ich meine, ich wusste ja vorher nicht viel über die Gegend hier, aber ich hätte das Saarland jetzt nicht unbedingt mit großen Katastrophen in Verbindung gebracht.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!