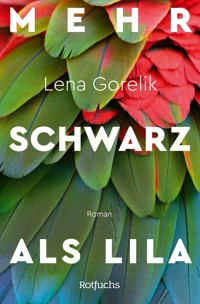Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Fünfzehn Jahre lang hat Nils Liebe nichts von Sanela Pejanovic gehört. Damals, als sie sich kennenlernten, waren beide vierzehn, Nils multipliziert vierstellige Zahlen im Kopf, Sanela kam aus Jugoslawien und hatte im Krieg ihre Eltern verloren. Zwischen den beiden Außenseitern begann eine heftige Freundschaft, vielleicht wäre es sogar mehr geworden. Aber nachdem sie zusammen ausgerissen waren und versucht hatten, in Bosnien das Grab von Sanelas Vater zu finden, eine so vergebliche wie gefährliche Reise, kam das abrupte Ende zwischen Nils und dem wilden Mädchen, das immer aus allem ausbrechen wollte. Nun erhält Nils einen Brief von Sanela, einen Brief wie früher, scheinbar zufällig. Und weiß beim ersten Treffen, wie sehr sie ihm all die Jahre gefehlt hat. Sanela hat einen kleinen Sohn, der Niels-Tito heißt, der wie Nils die Zahlen liebt und sich sofort mit diesem versteht wie mit keinem sonst. Zu dritt holen sie die gescheiterte Reise nach und werden bald zu so etwas wie einer Familie. Aber Sanela macht es Nils immer noch nicht leicht. Ihr Brief war kein Zufall, denn sie ist sehr krank ... Lena Gorelik erzählt nicht nur von drei außergewöhnlichen Menschen, von Freundschaft, Liebe und Abschied – vor allem zeigt sie, warum es gut ist, anders zu sein und seinen eigenen Weg zu finden.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lena Gorelik
Null bis unendlich
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Fünfzehn Jahre lang hat Nils Liebe nichts von Sanela Pejanovic gehört. Damals, als sie sich kennenlernten, waren beide vierzehn, Nils multipliziert vierstellige Zahlen im Kopf, Sanela kam aus Jugoslawien und hatte im Krieg ihre Eltern verloren. Zwischen den beiden Außenseitern begann eine heftige Freundschaft, vielleicht wäre es sogar mehr geworden. Aber nachdem sie zusammen ausgerissen waren und versucht hatten, in Bosnien das Grab von Sanelas Vater zu finden, eine so vergebliche wie gefährliche Reise, kam das abrupte Ende zwischen Nils und dem wilden Mädchen, das immer aus allem ausbrechen wollte.
Nun erhält Nils einen Brief von Sanela, einen Brief wie früher, scheinbar zufällig. Und weiß beim ersten Treffen, wie sehr sie ihm all die Jahre gefehlt hat. Sanela hat einen kleinen Sohn, der Niels-Tito heißt, der wie Nils die Zahlen liebt und sich sofort mit diesem versteht wie mit keinem sonst. Zu dritt holen sie die gescheiterte Reise nach und werden bald zu so etwas wie einer Familie. Aber Sanela macht es Nils immer noch nicht leicht. Ihr Brief war kein Zufall, denn sie ist sehr krank …
Über Lena Gorelik
Lena Gorelik, 1981 in Leningrad (heute St. Petersburg) geboren, kam 1992 mit ihrer Familie nach Deutschland. Mit ihrem Debütroman «Meine weißen Nächte» (2004) wurde die damals dreiundzwanzigjährige Autorin als Entdeckung gefeiert, mit «Hochzeit in Jerusalem» (2007) war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ihr Roman «Die Listensammlerin» (2013) wurde mit dem Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet.
Für Charlotte
Living comes natural to many
Love comes natural to few
John Fullbright, «High road»
Ein Dialog, später
«Sanela, ich habe mich entschieden …»
«Ja?»
«Ich habe mich entschieden, dich nicht zu lieben.»
«Du hast dich entschieden? Ist Liebe etwas, das man entscheidet?»
Eine Frage, die auch in Nils Liebes Gedankengang aufgetaucht war, naturgemäß, und die er als banal verworfen hatte. So konnte er sich jetzt freuen, dass Sanela sie stellte. Seit wann diese Schadenfreude, die dem Bedürfnis entsprang, sich überlegen zu fühlen? Seit wann das Bedürfnis?
«Ich weiß nicht, ob man. Ich jedenfalls habe diese Entscheidung getroffen.»
«Und darf man nach dem Grund fragen? Der Entscheidung werden sicher wohlüberlegte Argumente vorangegangen sein.»
Da waren sie wieder, die längeren, komplizierteren Sätze.
«Eigentlich nur ein Grund. Es tut mir nicht gut.»
«Aber das ist doch nicht neu.»
«Nein. Die Entscheidung ist es aber.»
«Wann ist denn diese Entscheidung gefallen?»
«Endgültig? Vor ein paar Tagen.»
«Und gab es einen konkreten Anlass dafür?»
Er schweigt. Weil es so banal ist, dass er nicht wüsste, wo er anfangen sollte aufzuzählen.
«Zu viele, um sie aufzuzählen?»
Er schweigt.
«Eine endgültige Entscheidung, nehme ich an?»
«Absolut.»
«Nun ja, muss ich mit leben. Wobei, leben muss ich ja nicht.»
So endet der Dialog. So endet auch die Liebe.
Und ob der Dialog tatsächlich stattgefunden hat oder nur im Kopf von Nils Liebe, ist letztendlich nicht von Bedeutung.
Null
Niels-Tito weiß bereits: Durch null darf man nicht teilen. Daran erinnert er sich, während er gerade den Kopf über die Mathematikhausaufgaben beugt, so tief, dass sein blonder, zu langer Pony beinahe das Heft streift und seine Mutter sich fragen muss, ob der Junge nicht eine Brille braucht. Und wer ihm eine Brille kaufen wird, denn sie sicherlich nicht. Beim Lösen besonders schwieriger Aufgaben kriecht seine Zunge leicht aus dem Mund, der sich dafür einen Spalt weit öffnet, eine Haltung, die ihm peinlich wäre, wäre er sich ihrer bewusst.
Nils Liebe hat ihm in diesem Moment noch nicht erklärt (wird es aber in ein paar Wochen tun), dass jede Division einer Zahl durch null gegen das Permanenzprinzip verstoße. Das Wort Permanenzprinzip wird sich Niels-Tito für immer merken. Das hat weniger mit dem Begriff an sich zu tun als vielmehr mit dem Augenblick, in dem Nils Liebe es ihm erklären wird: Es ist, während die Kiste mit den Gedichten seiner Mutter verbrennt. Die Blätter sind unter triumphierenden Flammen im Nu zu schwarzer Asche zerfallen, die Holzkiste hingegen ließ sich Zeit.
«Glaub mir, ich hab null Bock auf diese Sterbegeschichte», sagt Sanela ein paar Tage zuvor, und Nils Liebe zieht die Nase kraus, wie angewidert, und wirft ihr einen kritischen, auch erschrockenen Blick zu, der nicht dem Inhalt ihrer Mitteilung gilt, sondern ihrer Wortwahl geschuldet ist. Sanela lacht daraufhin auf eine Art, die Nils Liebe gerne auf Unsicherheit zurückführen würde, aber da sagt sie bereits: «Ich ärgere dich so gerne. Das ist meine Art zu lieben.»
«Auf solche Liebe kann ich verzichten», sagt Nils Liebe nicht.
Nils Liebe weiß selbstverständlich noch viel mehr über die Zahl Null, als er Niels-Tito erzählen wird, während die Kiste mit den Gedichten verbrennt. Er weiß zum Beispiel, dass die Zahl Null mathematisch gesprochen die Kardinalität der leeren Menge darstellt. Er weiß, dass die Null – im Gegensatz zum gängigen Sprachgebrauch – als erste Ordinalzahl gilt. Er weiß außerdem, dass sich die früheste nachweisbare Verwendung der Null in einer Inschrift in Kambodscha vom Anfang des 7. Jahrhunderts nach Christus findet. Nils Liebe weiß eine ganze Menge. Nur, wie er diesen Jungen an die Hand nehmen und von diesem Feuer und nach Hause führen soll, das weiß er nicht.
Nils Liebe. Eins
Nils Liebe schrieb sich ohne «e» und gab seinen Namen auch so an: «Nils ohne ‹e› und Liebe wie Liebe. Nils Liebe.»
Als Kind hatte ihm das «e» auf eine sehnsüchtige Weise gefehlt, und Liebe hatte er gehasst. Das Lesen und Schreiben hatte er früh gelernt und sich, seit er beides konnte, einen Buchstaben mehr gewünscht, den er hätte malen können. Der Schwung, den man beim «e» erst einmal holen musste, um ihn sogleich abzubremsen, und die Genauigkeit, mit der man diesen Schwung in ein Oval überführte, das war eine Herausforderung, die er außerordentlich genoss. Den geradlinigen Buchstaben in seinem Namen, dem «N», dem «i» und dem «l», mangelte es seiner Ansicht nach an Grazie und Spannkraft. Auch in Schreibschrift.
Er mutmaßte, seine Eltern hatten am «e» gespart. Eine Mutmaßung, die er ihnen gegenüber selbstverständlich niemals in Worte fasste. Seine Eltern sparten gern. Die Vermutung hatte sich ungefähr zum selben Zeitpunkt in seinem Kopf eingenistet, in dem er zu ahnen begann, dass er mit seinen Eltern nicht sprechen konnte. Die Ahnung des Fünfjährigen hatte sich als zutreffend erwiesen.
Und Liebe. Versuch mal, mit einem Namen wie Liebe zur Schule zu gehen und die Schulzeit zu überstehen als der, der du bist. Es war auch ohne Liebe, ohne Liebe im Namen wie im Leben, nicht einfach. In der ersten Klasse übrigens genauso schlimm wie in der siebten. Hass, das hätte ihm gefallen, Nils Hass. Oder: Nils Tod. Liebe war, als Nachname und als Zustand, peinlich und unangenehm gleichermaßen.
Nils ohne «e» also. Und Liebe wie Liebe.
Im Übrigen hatte er auch keine Geschwister.
Diesen Umstand hatten seine Eltern allen Ernstes mit Sparzwang begründet.
«Mami, ich wünsche mir einen Bruder zum Geburtstag.»
«Ach, Nils, mein Schatz, für ein zweites Kind haben Papi und ich leider kein Geld.»
Er erinnerte sich nicht an die Notwendigkeit zu sparen. Sein Vater hatte eine Stelle im Bauamt und wusste Nils’ Ansicht nach selbst nicht so genau, was er dort genau täglich von 8 Uhr 30 bis 17 Uhr 30 tat. Er ging jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr 10 aus dem Haus, und ebenso pünktlich wurde dreizehnmal im Jahr ein Gehalt überwiesen. Seine Mutter kümmerte sich nach eigener Aussage «um alles», wirkte dabei immerzu überspannt, aber womit sie sich den ganzen lieben Tag lang beschäftigte, hätte Nils Liebe nicht beschreiben können. Sie hatten ein Reihenhaus wie die, in denen seine Schulkameraden lebten – an Schulfreunde konnte er sich später nicht erinnern –, und die Absenz beider Erinnerungen legte er als Beweis für die Absenz beider Phänomene, der Notwendigkeit zum Sparen wie der Freunde, aus. Es gab Schuhe von und mit Lurchi und den obligatorischen Urlaub auf einem Campingplatz in Ligurien jedes Jahr. Taschengeld so viel, wie er alt war, sechs Mark ab dem sechsten Geburtstag, sieben ab dem siebten und so weiter, und mit acht hatte er bereits zu protestieren und zu argumentieren begonnen: Die Inflation stieg stetig an, aber sein Taschengeld proportional lediglich zu seinem Alter. Es ging ihm ums Prinzip. Das Thema – seine Eltern, die kein Geld für ein zweites Kind haben wollten, aber welches für eine türkisfarbene Ledercouch hatten – wäre ein spannendes für seinen Psychoanalytiker gewesen, aber Nils ohne «e» Liebe würde niemals einen aufsuchen. Sigmund Freud, C. G. Jung und Noam Chomsky hatte er hingegen gelesen.
Das Einzelkind Nils Liebe war immer einzeln geblieben. Es war ein Grundgefühl. Er konnte sich zum Beispiel später der Hände seiner Mutter auf seinem Rücken entsinnen, wenn er fiebrig im Bett lag, nicht einschlafen konnte und die Wand anstarrte, in der Erinnerung konnte er diese Hände beinahe wieder spüren. Weshalb er sich nicht gern daran erinnerte. Er hatte ihr den Rücken zugedreht, um diese Hände ertragen zu können. Er erinnerte sich an Wissen: Er wusste zum Beispiel, warum ihre Hände sich da befanden, was sie ihm mit ihren auf seinem Rücken liegenden Händen vermitteln wollte, wusste um ihre Mutterliebe, und von ihm aus hätte sie es nicht noch unzählige Male in Worte fassen müssen: «Ich bin ja da. Es wird bald besser, mein Schätzchen.» Stattdessen wurde es schlimmer. Diese Liebesgeschichte an sich.
Bücher waren ihm weitaus sympathischer als Menschen. Bücher waren ihm nicht unterlegen. Als er Barthaare zu zählen und zu masturbieren begann, dachte er, dass beides, das Nicht-Lesen seiner Eltern sowie seine daraus resultierende Bücherliebe, deren Provinzverwurzelung geschuldet sei, die übrigens auch seine Mitschüler und Lehrer im Griff hatte wie eine chronische Krankheit. Er schien als Einziger dagegen immun. Später hatte sich erwiesen, dass die Provinz keine Ursache dafür sein konnte. Nils Liebe hatte herausgefunden, es lag an den Menschen an sich.
Das Gefühl, nicht alleine zu sein, kannte er nicht. Aber auch nicht die Sehnsucht, diesen Zustand zu ändern.
Er las noch ein wenig mehr. Sofern das möglich war. Kämpfte sich durch Robert Musil. Auch durch den zweiten Band mit den ungeordneten Fragmenten. Und dachte beim Mann ohne Eigenschaften ein wenig an sich. Er brauchte die Worte der großen Dichter, um die um ihn herum gesprochenen ertragen zu können.
Das Alleinsein. Es war ein Zustand, sein Zustand, wie Wasser flüssig war, und Eis kalt. Zwischendrin war Sanela. Mit Sanela war Nils Liebe jemand gewesen – jemand anders als er selbst. Er war zu zweit gewesen. Aber das, hatte er auf die unangenehmstmögliche Weise herausgefunden, war wohl ein einseitiges Gefühl.
Sanela war, er konnte und würde es heute noch beschwören, aus dem Nichts aufgetaucht. Er hatte allein im Klassenzimmer gesessen und hatte die Tür angestarrt und wusste deshalb, dass sie nicht hereingekommen sein konnte, durch diese Tür jedenfalls nicht.
Plötzlich war Sanela da, dann war sie genauso plötzlich weg, es hatte überraschend geschmerzt, körperlich auch, aber zum Glück war er eines Tages dem Schmerz entwachsen, wie er auch Kleidern entwuchs: ganz plötzlich, als hätte jemand über Nacht die Hosen gekürzt. Eines Morgens blitzten seine Knöchel zwischen Schuhen und Hosensaum hervor. Eines Morgens war das Gefühl des Alleinseins, des Seins ohne Sanela, vergangen.
Er lebte dann vor sich hin. Das Leben ging irgendwie weiter.
Sanela. Zwei
Zwei Dinge hatte sie wiederholt über sich gehört, und beide hatte sie nicht einordnen können: «Kriegskind» und «Waisenkind». Sie verstand nur «Kind» und horchte deshalb zu Recht auf, sie meinte, es ging um sie. Den Rest der Konversation verstand sie nicht.
«Waisenkind» klang schöner als «Kriegskind», weicher irgendwie, mit seinem stimmhaften «s». Sie mochte es, wenn sie Waisenkind über sie sagten, eine ganze Weile. Zu ihr sagten sie es nie.
Das Verstehen war abrupt über sie gekommen, wie es mit Sprache eben geschah: Die Sprache überfiel sie, was ihr das Lernen ersparte. An manchen Tagen waren es Worte, die sie plötzlich verstand, von einer Sekunde auf die andere, an anderen Sätze. Eine Werbetafel, eine Zeitungsüberschrift, den Gruß des Busfahrers. Einen Tag wollte sie sich für immer merken: den, an dem sie das Rezept auf der Mirácoli-Packung verstand, Mittwoch, Juli, der 7. Es gefiel ihr, dass man im Deutschen das Datum nach dem Monat setzen durfte und den Wochentag davor, als herrsche man über die Zeit. Sie liebte Mirácoli: Nudeln, Tomatensoße UND Käse in einer Packung. Wegen solcher Dinge galten die Deutschen als effizient, ganz klar. Wie an jedem anderen Abend hatte sie am 7. Juli das Rezept gelesen, während sie die Nudeln, die Tomatensoße und den Käse, die sie auf der Gabel übereinanderlegte, aber nicht vermischte, in sich hineinschaufelte. An diesem Mittwoch hatte sie das Rezept aber unverhofft und schlagartig verstanden, hatte sogleich den Teller zur Seite geschoben, das eigene Verstehen noch einmal überprüft: Ja, sie begriff, nicht nur die «Minuten», sondern auch die «Zubereitung», das «heiß werden lassen», das «darüber streuen». Woraufhin sie das Datum auf die Verpackung schrieb, diese sorgfältig faltete und in ihren Koffer unter die Kleider legte.
Als sie verstand, was sie mit «Waisenkind» meinten, schnitt sie sich die Haare ab.
Es war kein großer Verlust. Die Farbe war ein Dazwischen, das sich irgendwo zwischen blond, braun und farblos tummelte, und die Haare hingen irgendwie herum und herunter, genauso halbherzig, wie sie sich eben nicht die Mühe machten, eine richtige, existierende Farbe zu generieren. Sie hatten bis zu diesem Tag eine Aufgabe zu erfüllen gehabt, was sie lustlos, aber dennoch erledigt hatten: Ihre Ohren zu verdecken. «Dumbo», hatten die anderen Kinder gerufen, auch im Kindergarten schon.
«Ja! Ich bin Dumbo und kann fliegen!», hatte sie erwidert, aber sich schon beim nächsten Mal nicht mehr die Mühe gemacht, den Mund für eine Reaktion zu öffnen.
Sie versuchte, die Schere beim Schneiden schräg zu halten, wie es ihre Tetka Marija tat, wenn sie Tetak Ivan die Haare schnitt. Wozu das wohl gut war? Sie begann links und schnitt direkt über dem linken Dumbo-Ohr. Die langen, willenlosen Strähnen fielen mit mehr Energie auf den Boden und in ihren Schoß, als sie bis dahin an den Tag gelegt hatten.
Eine Strähne ließ sie hängen, rechts. Eine, die ihr weiterhin bis über die Schulter reichte. Oben war ein Durcheinander entstanden, ein Vogelnest, das keine Geborgenheit bot, sondern soeben von einem größeren Raubvogel verwüstet worden war. Sanela war außerordentlich zufrieden, als sie die Schere zurück in die Küchenschublade legte. Zu den Messern.
Die deutschen Kinder sagten nicht «Dumbo». Sie überlegte: War es Höflichkeit? Sie wischte die Vermutung beiseite. Die Deutschen doch nicht. Auch nicht deren Kinder.
«Haben wir nicht genug Probleme? Brauchen wir auch noch das?», rief Tetka Marija in ihrer melodramatisch klingenden und genauso gemeinten Art und zeigte mit ihrem fetten Zeigefinger von oben herab auf Sanelas Kopf.
«Lass sie», erwiderte Tetak Ivan, was er meist erwiderte, aber selten passte es thematisch so gut wie an dem Abend jenes Tages, an dem sie «Waisenkind» verstand. Wobei sie sich nicht sicher war, ob Tetak Ivan die Veränderung auf ihrem Kopf überhaupt registriert hatte.
Eines der Kinder aus der Klasse, ein dickliches Mädchen mit rötlichen Haaren und mehr Sommersprossen auf der Nase als Nils, fragte: «Gefällt dir das gut mit der einzelnen Strähne, die herunterhängt?»
«Ja.»
Sie beantwortete alle Fragen mit «Ja», seit ihre quantitativ nicht umfangreiche, aber qualitativ fehlerfreie Studie ergeben hatte, dass die Menschen mehr Nachfragen stellten, wenn man ihre Fragen mit «Nein» beantwortete.
«Aha. Und das Gute ist auch: Wenn sie dir irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du sie einfach selber abschneiden. Musst nicht einmal zum Friseur.» Das rothaarige Mädchen hatte bestätigend und sehr zufrieden mit der eigenen Schlussfolgerung genickt, bevor sie sich wieder nach vorne zur Tafel umgedreht hatte.
«Margarine» als Schimpfwort war in mehrfacher Weise erniedrigender als «Dumbo». «Backfett» sagten sie auch. Das blöde Deutsch reichte ihr leider noch nicht aus, um angemessen zu kontern. Es galt, das Erlernen der Sprache zu beschleunigen.
Seit sie in Deutschland war, stellte Sanela überrascht fest, dass es manchmal besser war, nicht zu wissen und nicht zu verstehen. Das wunderte sie, weil sie, seit sie denken konnte, schon immer wissen, begreifen und lernen wollte. Ihre Großmutter hatte sich ihrer geschämt: Im Dorf las man nicht. Die Haare waren nun weg, und das Verlangen, zu wissen und zu verstehen, war ebenfalls dabei, zu verschwinden.
Sie hatte auch die Sache mit der Margarine ein paar Tage lang nicht begriffen, obwohl sie den Begriff «Margarine» verstand. Margarin, in ihrer Sprache. Warum sich deutsche Kinder wohl für Margarine interessierten, warum sie in ihre Richtung blickten, wenn sie das Wort sagten? Aber die deutschen Kinder sammelten auch Plastikpüppchen mit neonbunten Haaren. Sanela musste nicht alles auf einmal verstehen.
Nils erklärte es ihr.
«Nimm dir das nicht zu Herzen», er nickte in Richtung der Jungen, die «Margarine» gerufen hatten. «Das sind kreteni.» Sie sorgte sich inzwischen, Nils könnte Serbokroatisch schneller lernen als sie Deutsch, was nicht nur beschämend für sie gewesen wäre, sondern auch ihm nichts nutzte. Sie hatte gehört, Serbokroatisch gebe es nicht mehr, dafür Serbisch, Kroatisch und Bosnisch. Was aber Unsinn war. Weil sie es sprach, und Tetka Marija und Tetak Ivan doch auch.
Nimm dir das nicht zu Herzen, hatte er gesagt. Die Sache mit dem Herzen verstand sie auch nicht, weshalb sie fragte: «Wo ich Herzen nehmen?»
Nils lächelte dieses Lächeln, das sie schon kannte, das er immer lächelte, wenn er nicht weiterwusste, als sei es seine Schuld, dass sie ihn nicht verstand. Er ließ dem Lächeln keinen Vortrag folgen, weil er da schon eingesehen hatte, dass Vorträge sie verunsicherten. Wenn einzelne Worte schon die Macht dazu hatten. Nils Liebe lernte, mit Sanela zu sein.
«Morgen», sagte er.
Morgen brachte Nils die Plastikpackung mit, eine leere. Sanella. Liebe ist Backen. Die Margarine schrieb man mit zwei «l».
Nils hatte recht. Die Deutschen und die Jungen in ihrer Klasse waren ausgesprochene kreteni, bis auf ihn.
Nils war es natürlich auch, der ihr das Wort Krieg erklärte. Er war dazu übergegangen, weniger zu sprechen und stattdessen mehr zu zeichnen und ihr Gegenstände zu zeigen.
Sie hörten «Kriegskind», er sagte «Morgen», und am nächsten Tag brachte er winzig kleine Zinnsoldaten mit. Sie hatte auch welche gehabt, früher. Er stellte sie auf, zwei Armeen mit jeweils vier Kanonen, sechs Kavalleristen und gut zwanzig Artilleristen. Einer hielt die Tricolore.
«Napoleon?», fragte sie.
Nils schien beeindruckt. «Ja. Und das ist Krieg. Guck, wenn sie miteinander kämpfen. So.» Er ließ zwei Kavalleristen vorrücken. Sie nahm eine der gegnerischen Kanonen in die Finger. Sie spielten Krieg, bis es zur Mathematikstunde klingelte. Die Frau mit dem langen Namen, der durch einen Strich unterbrochen wurde, unterrichtete das Fach, und sie betrat das Klassenzimmer bei diesem Klingeln mit entschlossenem, strengem Schritt, weshalb sie die Soldaten schnell unter die Bank räumten. Der Krieg zu Hause war mit Napoleon übrigens nur schwer vergleichbar.
Kriegskind. Waisenkind. Na, wenn sie meinten.
Sprechen
Das Mädchen war ihm fremd auf eine verstörend vertraute Weise. Es sprach nicht. Es lächelte nicht. Letzteres zum Beispiel war ihm vertraut, er selbst verzog die Mundwinkel auch nur, wenn er tatsächlich lachen musste, was äußerst selten geschah. Die Dinge, die seine Mitschüler oder seine Eltern zum Lachen brachten, befremdeten ihn mehr, als dass sie amüsierten. Seine Mutter ermahnte ihn regelmäßig, nach dem Essen die Zähne zu putzen, beim Sitzen den Rücken durchzudrücken, und eben auch, die Nachbarin oder die Bäckereiverkäuferin aus Gründen der Höflichkeit anzulächeln. Er ging jedes Mal, wenn sie ihn zum Zähneputzen schickte, ins Bad und nahm sich auf dem Weg ein Buch mit, in dem er las, während Wasser auf die Zahnbürste tropfte, auf die er sogar Zahnpasta geschmiert und die er dann ins Waschbecken gelegt hatte. Er drückte auch den Rücken durch, nicht weil er die Ängste seiner Mutter vor einer krummen Wirbelsäule ernst nahm, sondern weil der Aufwand, aufrecht zu sitzen, geringer war als der, lange Diskussionen zu führen. Beim Lächeln aber verweigerte er sich standhaft, und das hatte noch nicht einmal mit seiner generellen Infragestellung des Höflichkeitskonzepts an sich zu tun: dass man Menschen gegenüber, denen man keinerlei Interesse oder Sympathie entgegenbrachte, verlogene Formalien einzuhalten hatte, als Schauspielkunst, die keinem ehrlichen Gefühl entsprangen. Aber auf dieser Ebene, die seine Mutter niemals verstehen würde, weigerte er sich noch nicht einmal. Nils Liebe hatte sich selbst beim von seiner Mutter verlangten Lächeln in einem Kaufhaus im Spiegel beobachtet und dabei festgestellt, dass die Art, wie er die Lippen aufeinanderpresste und die Mundwinkel auseinanderzog, so unnatürlich und gequält aussah, dass er Menschen damit unmöglich das angenehme Gefühl vermitteln konnte, das diese Art von Mundgebärde ja hervorrufen sollte. Er tat den Mitmenschen, die es laut seiner Mutter zu hofieren galt, den Gefallen und lächelte nicht.
Das Mädchen lächelte ebenfalls nicht. Es sprach auch nicht, und es verstand nicht, das musste Nils Liebe sich immer wieder in Erinnerung rufen, weil die großen braunen Augen, mit denen es die Welt um sich herum aufnahm, jedes Detail, auch jedes Wort, das sie nicht verstehen konnte, aber offensichtlich dennoch beurteilte, zu keinem Zeitpunkt verständnislos oder gar verunsichert aussahen. Nils Liebe mochte das Mädchen.
Man hatte sie zu ihm gesetzt, natürlich.
«Nils, das ist Sanela. Sanela kommt aus Jugoslawien zu uns. Sie spricht unsere Sprache nicht, noch nicht, und sie wird Hilfe brauchen. Mit der Sprache und auch in den anderen Fächern. Es wäre schön, wenn du dich ihrer annehmen und ihr helfen würdest. Den Unterrichtsstoff kannst du ja schon. Du kannst ja alles», sagte die Lehrerin und lachte auf. In dieser unsicheren Art.
Dinge, auf die Nils Liebe die Lehrerin nicht aufmerksam machte:
Jugoslawien war dabei auseinanderzufallen. Erst vor ein paar Tagen hatten die meisten europäischen Staaten Kroatien und kurz darauf Slowenien anerkannt.
Das Mädchen war nicht «zu uns gekommen». Es war in eines der wenigen Länder geflohen, die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet aufnahmen.
«Sich jemandes annehmen» war ein herablassender Begriff, der Überlegenheit offenbarte. Das Mädchen zeigte sehr deutlich, dass man besser nicht den Versuch wagte, sich ihrer anzunehmen.
Er konnte bei weitem nicht alles. Dass sie ihm hier auf der Schule dennoch nicht viel beibringen konnten, war in diesem Zusammenhang äußerst bedauernswert.
Das Mädchen saß also neben ihm. Es rechnete schnell und fehlerfrei. Es hatte eine ausladende Schrift und auffallend große Ohren. Mit diesen Ohren saugte es die Sprache auf. Nils Liebe hatte nicht die geringste Ahnung, wo er beginnen sollte, weshalb er nachmittags in die Buchhandlung am Marktplatz radelte und ein deutsch-serbokroatisches Wörterbuch besorgte. Am nächsten Tag begannen sie, miteinander zu sprechen.
«Ja sam Nils.»
«Ich sein Sanela.»
«Zdravo.»
«Hallo.»
«Das Stol. Tisch.»
«Tisch.»
«Das Stolica. Stuhl.»
«Stuhl.»
«Sad Geographie.»
«Ja. Geographie.»
Es war ein Gespräch.
Nils Liebe las nicht ein Buch nach dem anderen wie die meisten Menschen. In der Regel begleiteten ihn mehrere Bücher gleichzeitig: zwei bis drei Romane unterschiedlicher Epochen, ein Fachbuch und für den Fall, dass er nur ein paar Minuten zum Lesen hatte, wenn er beispielsweise an der Bushaltestelle wartete, dazu noch ein Gedichtband, eine Sammlung von Kurzgeschichten, ein Theaterstück. Sanela gewöhnte sich an, morgens in seinem Schulranzen zu kramen und sich die Titel der Bücher, die er dabeihatte, anzusehen. Sie kommentierte nicht – Nils Liebe führte das Schweigen besser auf mangelnde Sprachressourcen zurück –, aber zweimal hatte sie genickt. Einmal bei Kafka, einmal bei Byron. Morgens, während seine Klassenkameraden vor dem Spiegel standen und Hemden zu Jeans anprobierten und sich Gel in die Haare schmierten, stand Nils Liebe vor seinem Bücherregal und überlegte, ob Anna Seghers zu Vargas Llosa passte. Oder doch besser zu Ovid.
Eines Tages – sie hatten die Fünf-Wort-Satz-Grenze passiert, Sanela hatte angefangen, das Verb, das sie manchmal sogar richtig beugte, an die zweite Stelle zu stellen: «Ich finde nicht gut, dass Schwerkraft gibt» – nahm Nils Liebe seinen gesamten Mut zusammen und setzte eine Idee um, die ihm eines Nachts, er schlief in letzter Zeit nicht mehr so traumlos und tief wie früher, gekommen war. Auf einen Zettel schrieb er, da er wusste, dass Sanela sich mit ausgesprochenen Zahlen aufgrund der Eigenheit der deutschen Sprache, die zweite Ziffer vor der ersten auszusprechen, schwertat, «16 Uhr» und «Marktplatz». Und schob den Zettel mitten in der Mathematikstunde zu ihr hinüber. In der Mathestunde musste sie sich nicht besonders konzentrieren.
Ein Nicken ist unbestreitbar auch eine Antwort.
Am Nachmittag bremste er bei jeder gelben Ampel und wartete jede Rotphase geduldig ab, und so gelang es ihm, erst fünf vor vier am Marktplatz zu sein. Sanela allerdings war schon da, hatte die beigefarbene Hose an, die sie auch sonst immer trug, ihre Jeansjacke, keinen Rucksack.
«Hallo.»
«Hallo. Zdravo.»
«Zdravo.»
Bevor es unangenehm wurde, erledigte er mit einer Gewissenhaftigkeit, die er sonst nur bei chemischen Experimenten an den Tag legte, die Aufgabe, sein Fahrrad anzuschließen, und lotste sie anschließend in den Buchladen. Für die bescheidene Größe und die schlechte Sortierung der einzigen Buchhandlung der Stadt schämte er sich, als habe er die Bücher selbst ausgesucht und, Epochen und Genres vermischend, alphabetisch in die Regale sortiert. Die ganze Idee kam ihm plötzlich äußerst dämlich vor.
Ein Blick zu ihr. Sie trug so etwas wie ein Lächeln im Gesicht. Irgendwie auch ein Anfang.
Nils Liebe nickte der Buchhändlerin zur Begrüßung zu, beeilte sich, zu den Romanen zu kommen, verharrte kurz vor dem Regal und zog dann Ernest Hemingway heraus. Hielt ihr das Buch hin. Sanela las den Titel, lachte auf, nickte.
Er nickte auch, presste die Lippen aufeinander, stellte das Buch zurück. Suchte die Reihen ab, a, b, k, l, m, da war es, er zeigte ihr «Die folgende Geschichte», Cees Nooteboom. Sanela zuckte fragend die Schultern. Natürlich, eine Neuerscheinung, er schämte sich für seine Wahl, womöglich hatte man in Jugoslawien in den letzten Monaten nicht viel Zeit oder Muße für Übersetzungen gehabt. Er blätterte das Buch auf, zeigte ihr den ersten Satz. «Meine eigene Person hat mich nie sonderlich interessiert, doch das hieß nicht, dass ich auf Wunsch einfach hätte aufhören können, über mich nachzudenken – leider nicht.»
Sanela las leise, langsam, und bewegte dabei die Lippen. Als sie fertig war, verzog sie die Augenbrauen in etwas, das Nils Liebe als Anerkennung zu deuten wagte. Also versuchte er es mit Gabriel García Márquez und Milan Kundera.
Sanela hatte längst verstanden. Sie warf einen vorsichtigen Blick zur Buchhändlerin, bevor sie sie endgültig vergaß. Die Buchhändlerin beachtete die beiden nicht, sie kannte Nils als einen guten Kunden. Sanela suchte nun ihrerseits die Regale mit Blicken ab.
«Lirika?» Es war das erste Wort, das zwischen den beiden seit der Begrüßung gefallen war, und deshalb klang es zu laut und unangebracht, sogar die Buchhändlerin zuckte zusammen, blickte auf und zu den Kindern. Ach was, Kinder, Jugendliche waren das inzwischen. Nils Liebe kannte sie, seit er als verrotzter und verstrubbelter Vierjähriger seine Mutter angeschleppt hatte, die äußerst unwillig das Geld über den Kassentresen geschoben hatte. So anders als andere Kinder, dieser Nils. Aber trotzdem schon ein Mädchen gefunden, wie bezaubernd. Und sie seufzte, dieses Seufzen, das nur zum Teil herablassende Überheblichkeit einer Erwachsenen ausdrückte. Da war auch Neid, der der Kenntnis entsprang, dass dieses zarte erste Mal niemals, niemals wieder … Und sie erinnerte sich: Horst Weiler, zehnte Klasse, 1958.
Im Jahr 1992 und an jenem Nachmittag dachten aber Nils Liebe und Sanela in der Buchhandlung der ersten Liebe von Horst Weiler, der an ebendiese erste Liebe bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gedacht hatte, nicht im Entferntesten an Gefühle. Da hatten zwei gerade ihre Sprache gefunden und mit Herzensangelegenheiten nichts am Hut. Nils Liebe hatte eine Frage gestellt, und Sanela hatte sie beantwortet, indem sie zuerst Samuel Beckett aus dem Regal zog, darin blätterte, dann auf Seite 36 fand, was sie gesucht hatte, und das Buch Nils Liebe reichte, der ihr für die Antwort dankte, indem er nur einen Blick auf die Buchstaben warf, vor sich hin lächelte, nicht ihr zu, sondern, ohne dieses Lächeln auch nur zu registrieren, zielsicher nach «Der gute Mensch von Sezuan» griff und das Stück ungeduldig nach einem Zitat durchforstete.
Es fiel kein weiteres Wort an diesem Nachmittag. Es war die spannendste und ergreifendste Unterhaltung, die Nils Liebe in seinem vierzehnjährigen Leben bislang geführt hatte. Ein Dialog ist sachlich gesehen eine von zwei oder mehreren Personen abwechselnd geführte Rede mit Gegenrede.
Sanela war, so hätte es ihre Lehrerin formuliert, an diesem Nachmittag ein Stückchen mehr in diesem Land angekommen. Sanela selbst hätte das weder an diesem Nachmittag noch jemals später so formuliert, aber beim Heimweg fühlte sie, dass ihre Schritte auf dem Asphalt fester waren. Als hätte sie etwas mehr Recht, über den deutschen Boden zu wandeln.
Zum Abschied hatte Nils Liebe Sanela die Hand gereicht und kaum merklich gelächelt. Sanela hüpfte vom Bürgersteig, als sie an dieses Lächeln dachte, und lief ein paar Schritte auf der Straße, bevor das erste Auto hupte und sie wieder zurück auf den Fußgängerweg sprang.
Man
Sanela selbst ging es zwar viel zu langsam, die Lehrer jedoch sprachen im Lehrerzimmer darüber, was für ein Wunder es sei, wie schnell dieses Mädchen sich die Sprache aneigne, und das, obwohl beide Eltern, wobei die Mutter doch schon vor dem Krieg gestorben war, oder nicht. Ja, es sei auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, sie zu Nils Liebe zu setzen, auch dem Jungen tue es gut, endlich könne er mal seine Begabung einsetzen. Sanela musste das alles zum Glück nicht hören.
Sanela war auch viel zu beschäftigt: Sie saugte die Sprache auf. Sie lauschte ihr wie später der Musik. Den Klang der Worte nahm sie mit dem ganzen Körper auf. Weiche Konsonanten, lange Vokale, Pausen, Stimmführung, die deutsche Sprache als Partitur. Worte aneinanderzuhängen bereitete ihr Freude. «Kann ich auch Deutschunterrichtsheft sagen?», fragte sie Nils und merkte, dass sie ihm damit eine Freude machte. Seine Freude, ein positiver Nebeneffekt, und das würde für immer so bleiben. Autotüröffner, Kellertreppenstufe, Mauerspaltloch, Herbstmorgenspaziergang.
Nils Liebe spürte, wie sie die Sprache aus ihm herauszog, er war verwirrt und stolz, er wollte ihr alles geben, was er über grammatikalische Konstruktionen wusste, und der Gedanke, sie presse ihn aus wie eine Zitrone, kam ihm nicht. Die Zitronenschale schmeißt man nach dem Auspressen in den Müll.
Manchmal wollte er sie trösten. Sanela kannte Wut nur als Gefühl der Maßlosigkeit, wenn sie wütend wurde, waren es sogar ihre Haare, die abstehenden Ohren liefen rot an, ihre Stimme musste die Welt übertönen, ihr Herz hämmerte, ihr Blut pulsierte, dass die Finger zitterten. Meistens war diese Wut nach innen gerichtet, Sanela hasste sich selbst. Auch für alles, was andere taten.
Das wird mit der Zeit vergehen. Gefühle lassen sich umkehren. Man kann zum Beispiel auch andere hassen für alles, was man selbst tut.
Damals aber war Sanela noch wütend auf die deutsche Sprache. Die Artikel wirbelten in ihrem Kopf und weigerten sich standhaft, sich vor das richtige Wort zu setzen, Sanela erkannte, obwohl sie genau lauschte, keine Logik, nach der sie die Artikel in ihrem Kopf hätte ordnen können, es war ihr schon immer schwergefallen, nicht zu können. Nils Liebe sah die Wut zuerst an ihren Oberschenkeln: Sie spannte den gesamten Körper an, und die Oberschenkel schnellten nach oben und knallten gegen die Schulbank, als drücke sie sich mit den Füßen vom Boden ab. Dann waren da Fäuste auf der Tischplatte, dann war da dieser wilde Blick. Es machte ihm Angst, er wollte sie trösten. In grammatikalischen Fragen würde sein Trost reichen. Er erklärte ihr, dass die Genusbestimmung wortabhängig und mitunter sprachgeschichtlich begründet sei, aber wie immer, wenn Sanela wütend war, war sie des Zuhörens nicht in der Lage.
«Warum männlich? Ein Rock ist für Frau. Ein Rock ist ‹sie› wie Frau. Aber Mädchen auch ‹das› in Deutsch.» Sie zischte jedes Wort.
Manchmal musste Nils Liebe lachen. Wochenlang fragte sie ihn jedes Mal, wenn er eine man-Konstruktion verwendete (man beginnt Fragen immer mit einem Fragewort, man geht an Weihnachten in die Kirche, man liest in Deutschland nicht viel): «Wer ist dieser Mann? Welcher Mann?»
«Man ist irgendjemand. Oder niemand», versuchte sich Nils Liebe an einer Erklärung. Selbst er bekam Kopfschmerzen von diesen grammatikalischen Fragen.
«Ein Mann ist ein Niemand», folgerte Sanela, und Nils Liebe, der eigentlich wusste, dass diese Folgerung ein zufälliges Nebenprodukt des Spracherlernungsprozesses war, liebte diesen Satz.
Nachts fragte Nils Liebe sich, ob er Sanela liebte. Er wusste nicht viel über die Liebe, nur das, was er in Büchern gelesen hatte, seine Eltern waren ihm kein Vorbild. Wenn deren allabendlicher trockener Begrüßungskuss Liebe sein sollte, dann wollte er auf Liebe verzichten. Nils Liebe schloss wieder die Augen und drehte sich zur Wand, vielleicht würde die Frage verschwinden.
Brief I
«Sag mal, Junge, bist du vielleicht verliebt?»
Nils verschluckte sich zwar nicht an dem Stück Schnitzel, das er just in jenem Moment mit seinen Backenzähnen zermalmte, dachte aber sofort daran, dass sich die Schlüsselfigur in einem Roman an dieser Stelle wahrscheinlich verschluckt hätte.
Zäh, das Fleisch. Er musste an Jona denken, den vom Wal Verschluckten, dann an Moby Dick, an das Walfangschiff Essex, das im Jahre 1820 durch Rammstöße eines Pottwals versenkt wurde, und daran, dass dessen Fünf-Mann-Besatzung nur überlebt hatte, weil sie sich von ihren verstorbenen Kameraden ernährt hatten, an den Begriff Kannibalismus, an den Begriff Kannibalismus in der Astronomie, wo er den Umstand definierte, dass kleinere Galaxien von größeren verschluckt werden, daraufhin dachte er an Dunkle Materie und folgerichtig an Neutrinos, aus denen diese, wie man vermutete, zu einem kleinen Teil bestand, an die Frage, ob sich zuerst Galaxien oder Sterne gebildet hatten –
«Nils?»
«Ja?»
«Hast du mir überhaupt zugehört?»
«Ja.» Er hatte sich gerade gedanklich der Modifizierten Newton’schen Dynamik widmen wollen.
«Den Eindruck habe ich nicht. Was habe ich gerade gefragt?»
«Ob ich verliebt sei.»
«Und, bist du es?»
Die Frau las doch Erziehungsratgeber. Sie hatte auch ein Buch über hochbegabte Kinder gelesen und es in der Schublade ihres Nachttisches unter den Erziehungsratgebern versteckt. Er hatte sich auf Seite zwei zum ersten Mal wiedergefunden, dann auf Seite vier, auf Seite sieben und eigentlich auf jeder weiteren.
Die Bratkartoffeln bereitete seine Mutter mit Speck und nur wenigen braun gerösteten Zwiebeln zu. Das liebte er an ihr.
«Die Bratkartoffeln schmecken vorzüglich.»
«Nils», ein Seufzen, «kannst du nicht ‹lecker› sagen wie jedes normale Kind?»
Konnte er nicht, sonst hätte er es höchstwahrscheinlich getan. Warum hatten sie es heute eigentlich alle mit der Liebe? Julius hatte Sanela und ihn bei der Briefübergabe erwischt, ihm den Brief entwendet und ihn laut der kichernden Klasse vorgelesen, wobei er «Molière» selbstverständlich falsch ausgesprochen hatte.
«Na und», hatte Nils Liebe auf einen Zettel geschrieben und ihn zu Sanela hinübergeschoben. Sanela hatte ihn gelesen und in ihrer ausladenden Schönschrift, die er für die in die Buchstaben gelegte Sorgfalt bewunderte, auf die Rückseite ebenfalls ein «Na und» geschrieben. Er hatte den Zettel gefaltet und ihn in die Hosentasche gesteckt.
Gleichschenklige Dreiecke, Orthogonale und Winkelhalbierende. In der Pause lachten die anderen wieder, dann klingelte es endlich zur Stunde, Geschichte.
Nils Liebe kippelte mit dem Stuhl. Jeder Schultag nahm irgendwann ein Ende. Er musste nur warten. Am liebsten begründete die Geschichtslehrerin Geschichte. Zehn Gründe, wie es zum Ersten Weltkrieg kommen konnte. Vier Gründe, warum Kaiser Wilhelm II. Otto von Bismarck entlassen hatte. Sie begründete Judenhass im Mittelalter, die Erfindung der Druckerpresse und die Kolonisierung Amerikas.
An jenem Tag hatte die Lehrerin den Entschluss gefasst, dem vergangenheitsorientierten Unterrichtsfach Aktualität zu verleihen und einen momentan tobenden Konflikt auf dem europäischen Kontinent in eine Aufzählung von Gründen zu pressen: Die Spiegelstriche malte sie an die Tafel, sobald sie das Klassenzimmer betrat. Die Kreide quietschte bei ihr häufiger als bei anderen Lehrern.
Nils Liebe ahnt nichts. Er kippelt mit dem Stuhl, wartet, glaubt, Sanelas Zettel in seiner Hosentasche spüren zu können, und schreckt erst mitten in der Entwürdigung auf.
«Ich kann nicht so sagen. Nicht einfach erklären, wie Krieg begonnen.»
Nils Liebe lässt den Stuhl auf den Boden knallen. Ein Blick zur Seite. Sanela sieht aus wie ein angegriffenes Raubtier kurz vor dem Sprung. Er wird sich diesen Gesichtsausdruck merken. Folgenden Gedanken wird er hingegen vergessen: Hoffentlich blickt sie mich niemals so an. Warum sollte sie auch.
Die Lehrerin, untersetzt, dynamisch, kompetitiv und stets geblümt gekleidet, suchte sich zu Beginn jeder Stunde mit einer beinahe magischen Zielsicherheit den Schüler aus, der am schlechtesten vorbereitet war, rief ihn an die Tafel, fragte Gründe ab. Lachte, wenn sich die Wissenslücken im lautstarken Schweigen, in auf und ab wippenden Füßen, in um den Finger gedrehten Locken offenbarten. Das Lachen wussten die Schüler, sie waren noch Kinder, nicht als Unsicherheit zu entlarven. Sie ahnten, hätten das aber nicht in Worte fassen können, dass es um nichts anderes ging als darum, die eigene Macht zu zelebrieren.
Sanela aber, Sanela ist nicht schlecht vorbereitet!, hätte Nils Liebe einwenden können, aber was kann man von ihm erwarten, bei all seiner Intelligenz ist auch er ein der Schulhierarchie ausgeliefertes Kind, Sanela ist nicht schlecht vorbereitet. Was Sanela ist, müsste doch eigentlich nicht erwähnt werden.