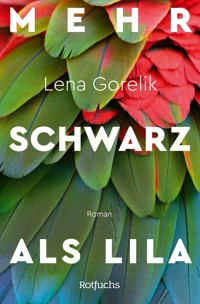17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Wie Migranten Deutschland verändern und warum das gut ist
Lange hat man hierzulande so gut wie gar nicht über Integration diskutiert. Dann lösten Thilo Sarrazins umstrittene Thesen über Migranten heftige Reaktionen aus. Was viele vergessen, so Lena Gorelik – die selbst Kind russischer Einwanderer ist –, wir leben längst in einer ethnisch gemischten Gesellschaft. Wir müssen nur dahin kommen, es als Stärke zu begreifen und davon zu profitieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Ähnliche
Für M. und E.
Inhaltsverzeichnis
Deutschland 2.0
Ein Kapitel, in dem das Wörtchen »eigentlich« häufiger auftaucht, als mir recht ist
Lange bevor ich Deutsch konnte, hatte ich Schwäbisch gelernt. Ich war überzeugt davon, dass Weckle Weckle heißen, Fleischküchle Fleischküchle und Kehrwoche ein feststehender bundesdeutscher Begriff ist, der zu Deutschlands – in meinen Augen oft sonderbaren – Ritualen ebenso dazugehört wie Tatort-Schauen am Sonntagabend. Ich lernte nicht nur Schwäbisch, ich lernte Schwäbischland kennen. Ich war zudem ein Besserwisserkind und dabei, mich in diesem Land – das ich mit der schwäbischen Kleinstadt, in der meine Familie zufällig gelandet war, gerne verwechselte – zurechtzufinden und zu behaupten. Und gleichzeitig so zu tun, als wüsste ich bereits Bescheid. Über Deutschland an sich. Also erklärte ich meinen Eltern, während ich ihnen Teile der Tagesschau ins Russische übersetzte – Kinder lernen Sprachen schneller als Erwachsene –, welche Wörter die Tagesschau-Sprecher meiner Meinung nach falsch aussprachen. »Das hätte«, fügte ich zum Beispiel unnötigerweise hinzu, während ich etwas zum Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Bolivien übersetzte, »›die hä’n b’schlossa‹ statt ›es wurde beschlossen‹ heißen müssen.« Fragten meine Eltern nach, was ein Doppelbesteuerungsabkommen sei, belehrte ich sie, den politischen Inhalt mit meinen elf Jahren und dem Problem im Kopf, morgen möglicherweise eine zu russische Jacke in die Schule anziehen zu müssen, nicht nur nicht verstehend, sondern auch nicht besonders spannend findend: »Das weiß doch jeder, lernt doch Deutsch! Das lässt sich auf Russisch nicht erklären!«
Wir, meine Großmutter, meine Eltern und ich saßen zu viert in unserem Asylantenwohnheimzimmer vor dem Sperrmüll-Fernseher gedrängt auf braunen Stahlhochbetten. Das Asylantenwohnheim, ebenfalls braune Holzbaracken hinter Stacheldraht, ein Zuhause, für das ich mich bis auf die Knochen schämte.
Später lernte ich, dass Weckle auch Schrippen heißen können, oder schlimmer noch Semmeln, und kriegte mich vor Lachen nicht mehr ein. Noch später fuhr ich nach Hamburg, wo Backsteinbauten statt Fachwerkhäusle standen, die Menschen sich mit »Moin« begrüßten und auf mein »Grüß Gott« mit einem »Mache ich, wenn ich ihn sehe« reagierten, und fühlte mich, als sei ich im Ausland gelandet, unsicher und fremd. So lernte ich Deutschland nach und nach kennen, das mit meinem neuen schwäbischen Zuhause häufig erstaunlich wenig gemein hatte.
Zu einer Zeit, als ich Deutschland bereits zu kennen meinte, mein Russisch längst schlechter war als mein Hochdeutsch und ich den schwäbischen Dialekt bereits bewusst abzulegen begann, um weltkundiger zu wirken – ich wollte immerhin Journalistin werden –, nahm mich mein damaliger Freund und späterer Ehemann in seine Heimat mit, an die schleswig-holsteinische Ostseeküste. Als wir ankamen – ich war sehr aufgeregt, zum ersten Mal sollte ich das deutsche Meer sehen, das früher mein russisches Meer gewesen war, die Ostsee –, trafen wir einen Nachbarn der Familie. Mein zukünftiger Mann sprach plattdeutsch angehauchtes Norddeutsch mit ihm, machte ein wenig Small Talk, ja, wir sind für ein paar Tage da, lange Anfahrt, kalter Seewind. Ich stand beeindruckt daneben und dachte mir: Ich wusste gar nicht, dass er so gut Niederländisch spricht. Ich verstand kein Wort. Es war Winter und kalt. Und später in jenem Winter fuhren wir zusammen Langlaufski – Langlauf, weil man im Norden Deutschlands eher selten Ski fährt, wo denn auch?, und mein Freund es nie gelernt hatte – und übernachteten in einer kleinen, netten Pension irgendwo im südlichen Schwarzwald. Die Pension wurde von einer kleinen, dicklichen Frau geführt, die mich an die Großmutter aus Rotkäppchen erinnerte und wahnsinnig besorgt war, ob wir auch genug zu essen bekämen. Mehrmals wollte sie bei der Anreise wissen, welchen Aufschnitt und Käse wir zum Frühstück bevorzugten. Am ersten Tag in dieser Pension ging mein zukünftiger Ehemann erst einmal alleine zum Frühstücken hinunter, während ich noch duschte. Kaum zehn Minuten später, ich war noch dabei, mich fertig zu machen, kam er wieder ins Zimmer gestürmt und verlangte: »Du musst runterkommen. Jetzt sofort. Sie redet permanent auf mich ein, und ich verstehe nicht, was sie von mir will!« Ich musste lachen, ich fand das süß, und ich sagte mir, welt- und vor allem deutschlandgewandt wie ich inzwischen war: Das ist die Bundesrepublik Deutschland. Das ist mein Land.
Wir leben in einem Land, das von seinen historisch bedingten regionalen Unterschieden geprägt ist wie kaum ein anderes. Seien diese nun dialektaler, kultureller, traditioneller, politischer, geschichtlicher, religiöser oder sogar kulinarischer Natur: Im Norden liebt man Grünkohl, im Süden Spätzle. Die Münchner nehmen sich für die Wiesn frei, die Kölner fiebern dem Karneval entgegen. Die Amerikaner – in ihrer großen Mehrheit zumindest – hissen am 4. Juli ihre Flaggen und werfen ihr Fleisch auf den Grill, die Franzosen – in ihrer großen Mehrheit zumindest – freuen sich auf den bal populaire am 14. Juli, und die Deutschen? Wie viele der 80 Millionen Einwohner wissen, welche Bedeutung der 3. Oktober für die gemeinsame Geschichte hat? Gibt es auch nur einen Brauch, den die Mehrheit der hier lebenden Menschen, wenn auch nicht die große, an diesem Tag pflegt? Und wenn nicht an diesem, dann an einem anderen? Isst man in Deutschland nun Labskaus, grüne Soße, Kässpätzle, Käsespätzle oder Kasspatzen? Warum müssen die Menschen in Sachsen-Anhalt arbeiten, während die Glückspilze in Bayern aufgrund eines nur dort gültigen gesetzlichen Feiertags frei haben? Wie sagt man denn nun zu Brötchen? Und sind die Preußen deutscher als die Westfalen?
Wir leben in einem Land, zu dem die Vielfalt per Historie dazugehört, in einem Land, das sich nicht zuletzt durch diese zahlreichen Unterschiede wirtschaftlich, kulturell und sozial zu dem entwickelt hat, was es ist. Ein Sven aus Dänischenhagen mag mit einem Alois aus Bayrischzell ebenso wenig zu tun oder gemein haben – all die Klischees, die mit diesen Vor- und Ortsnamen einhergehen, für einen Augenblick übernommen – wie mit einer Doreen aus Meuselwitz, aber alle drei gehören zweifelsfrei zu diesem Land. Sie müssen einander nicht mögen, sie müssen auch kein Verständnis füreinander haben, ihre Zugehörigkeit zweifelt aber niemand an.
Selbiges gilt nicht nur für regional bedingte Unterschiede, sondern – wie in jedem anderen Land – auch für Menschen aus unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Milieus, unterschiedlichen Vereinen sogar. Nehmen wir kurz mal an und bleiben wir dabei, dass Klischees nur für den Augenblick dieser Annahme in Ordnung sind: Prof. Dr. h.c. Arthur Schmid, benannt nach Arthur Schopenhauer, den sein Vater sehr verehrte, sitzt im selben Zug wie Uschi Müller aus Günstedt, die so heißt, weil ihre Mutter gerne Unterhaltungsserien im Fernsehen schaut, in denen Uschi Glas mitspielt. Nehmen wir mal an, auch wenn das eher unrealistisch ist, die beiden sitzen sich tatsächlich gegenüber, weil sie dieselbe (Preis-)Klasse gebucht haben. (Nehmen wir, damit es realistischer wird, an, Frau Müller hat heute ausnahmsweise nicht den Regionalexpress genommen, während Herr Prof. Dr. h.c. Schmid nicht wie sonst erster Klasse fahren konnte, weil diese ausgebucht war, und ja, auch diese Klischees lassen wir für den Augenblick einfach so stehen.) Was haben sich die beiden zu sagen? Er, der gerade von einer internationalen Konferenz an der Sorbonne kommt und die Fahnen seiner neuen Monographie Korrektur lesen muss, und seine Sitznachbarin, die ihren Zweitgeborenen Kevin zu dessen Erzeuger bringt und hofft, dass der Ex sie am Bahnhof abholen und Windeln besorgt haben wird, so dass sie pünktlich wieder nachhause kommt, um ihre Lieblings-TV-Gerichtsshow (nur dass Uschi Müller nicht ahnt, dass es sich in dieser um Laiendarsteller handelt und nicht um »wahre Fälle«) ja nicht zu verpassen? Oder was verbindet den Berliner Hausbesetzer mit Punkfrisur und Sperrmüll-Fahrrad, der die Grünen für konservativ hält, und den Oberarzt, der sich endlich seinen Porsche geleistet hat, für den er seit seinem Studium gearbeitet hat?
Nichts, so scheint es auf den ersten Blick. Aber: Sie sind Deutschland, um einmal eine gut gemeinte, aber wenig gelungene Kampagne zu zitieren. Und das Schöne ist: Das sprechen sie sich trotz der Unterschiede, trotz des wechselseitigen Gefühls, jeweils von einem anderen Planeten zu stammen bzw. auf einem solchen zu leben, trotz der zahlreichen Vorurteile, die die meinen möglicherweise sogar noch übersteigen, einander nicht ab. Die Diversität, die Heterogenität dieses Landes, die nicht in Frage gestellt wird, weil man es einfach nicht anders kennt, ist nicht zuletzt ein Merkmal Deutschlands. Die Tatsache, dass wir mit dieser Vielfalt nicht nur leben, sondern auf so vielen Ebenen von ihr profitieren, ist etwas, worauf wir stolz sein können. Weil wir uns von den vielen regionalen, kulturellen, auch religiösen Unterschieden nicht auseinandertreiben lassen, nicht feindliche Lager bilden, sondern ein großes Etwas, eine funktionierende Demokratie, eine zivilisierte Gesellschaft, eine international angesehene Wirtschaftsmacht bilden. Eine Art Dach, unter dem wir alle, so unterschiedlich wir sind, jeder auf seine eigene Weise, leben können, es auch gerne tun, dabei einander akzeptieren und respektieren, ohne uns gegenseitig missionieren zu wollen. Die Fähigkeit zu dieser Art des Zusammenlebens, diese Vielfalt ist eine Stärke Deutschlands, und gerade sie macht dieses Land so schön. Eine Vielfalt, die von außen nicht einfach zu verstehen ist: Haben Sie schon einmal versucht, Menschen aus anderen Ländern zu erklären, warum Filme, in denen bayerischer Dialekt gesprochen wird, in Frankfurt am Main mit Untertiteln gezeigt werden müssen?
Wir in Deutschland beherrschen von Haus aus einen Umgang mit Vielfalt, von dem viele lernen könnten. Warum aber schaffen wir es dann nicht immer, diesen Umgang auch auf »die andere« Vielfalt zu übertragen? Deutschland ist schon lange mehr als Prof. Dr. h.c. Arthur Schmid und Uschi Müller. Deutschland sind all die Menschen mit den teilweise fremd klingenden Namen, die ich jetzt nicht aufzählen werde, weil es kaum etwas Platteres, Herablassenderes und Naiveres gibt, als zu sagen: Deutschland ist auch: Mohammed, Giovanni und Fatema. Denn das versteht sich (eigentlich) von selbst.
Ein Nachtrag in eigener Sache: Mehrmals habe ich diesen letzten Satz hingeschrieben. Das Wörtchen »eigentlich« – ein unwichtiges, unnötiges Füllwörtchen – wieder gelöscht, bin noch einmal in mich gegangen, habe es wieder hinzugefügt, den gesamten Satz getilgt und ohne »eigentlich« noch einmal getippt, laut vorgelesen und dann doch wieder das »eigentlich« hinzugefügt, nur um alles wieder zu löschen. Und warum? Weil sich der Satz im deutschen Sprachgebrauch ohne »eigentlich« unpassend, nicht relativierend genug anhört? Noch einmal der Versuch ohne »eigentlich«: Denn, dass Mohammed und Giovanni und Fatema zu Deutschland gehören, versteht sich von selbst. Ist das Gefühl, mein angebliches Gefühl für die deutsche Sprache, nicht nur für ihre Grammatik, sondern auch für ihren Gebrauch, das Gefühl, dass in diesem Satz etwas, nämlich das Wörtchen »eigentlich«, fehlt, nur in meinem Kopf, mein eigenes, falsches Gefühl? Würden Sie denn, ohne zu zögern, sagen: Dass Mohammed und Giovanni und Fatema zu Deutschland gehören, versteht sich von selbst?
Zu Deutschland gehören, und jetzt könnte ich aus meiner eigenen Sicht ein »leider« einfügen, auch diejenigen, die diese Entwicklung – nämlich dass all diese Menschen mit den »komischen« oder »Wie-spricht-schreibt-man-das?«-Namen oder auch ohne, auf jeden Fall aber mit dem berühmt-berüchtigten Migrationshintergrund hier leben – nicht gutheißen. Die diese Tatsache verdächtig finden und beängstigend und falsch und vor allem höchst gefährlich. Ob ich das wiederum nun gut heiße oder nicht, auch diese Menschen gehören zu Deutschland, ja, sie sind Deutschland. Das darf ich ihnen nicht absprechen. Aber sie mir meine Zugehörigkeit bitte auch nicht.
Die Patentante meines Sohnes kommt aus Jugoslawien. Meine beste Freundin ist Russin und ihr Mann Österreicher. Der älteste Freund meines Mannes ist Schwede und seine Frau Schweizerin. Die Freundin, die am selben Tag Geburstag hat wie er, Argentinierin. (Nein, es kommen nicht alle aus der Türkei »und anderen arabischen Ländern«, würde ich gerne hinzufügen, aber eigentlich – schon wieder eigentlich – versteht sich das von selbst.) In unserem Haus leben Amerikaner und Franzosen. Die Frauen, in die sich mein Sohn – mit sieben Monaten – zum ersten Mal und auf den ersten Blick verliebte, waren eine Griechin und eine Pakistanin. Die Mutter des Kindes, mit dem mein Sohn in der Krippe spielt, ist Engländerin.
Und ja, ich weiß: Die Menschen, mit denen man sich umgibt, die sucht man sich selbstverständlich aus.
Deshalb: Jemand, der sich Uwe und Ute und Ulf und Ulrike und (nein, nicht Uschi) Peter zu Freunden aussucht, lässt sich möglicherweise von einem albanischen Busfahrer zur Arbeit fahren, kauft seinen Kaffee vielleicht bei einem afrikanischen Bäckereiverkäufer, arbeitet womöglich mit einem Italiener zusammen (oder nimmt spätestens sein Mittagessen bei einem ein), lässt seine Mutter im Altersheim von einer polnischen Krankenschwester pflegen und sich selbst abends in der Kneipe von einer chilenischen Kellnerin bedienen.
Ups, kann es sein, dass ich jetzt nur »niedere« Jobs aufgezählt habe, »nieder« in dem Sinne, dass wir sie als solche abgestempelt haben? Sind das denn nun diejenigen Jobs, die sie »uns« deshalb wegnehmen dürfen oder die gerade nicht?
Nun ja, jedenfalls lässt sich dieser Jemand den ganzen Tag zudem von türkischstämmigen Politikern im Parlament vertreten, liest in der Zeitung Artikel von einem kroatisch-stämmigen Journalisten, lässt sich im Autoradio das Wetter von einem in Spanien geborenen Moderator vorhersagen, fährt zudem ein von indischen, amerikanischen, japanischen, russischen, französischen, türkischen, italienischen, tschechischen Ingenieuren entwickeltes Auto und, ach ja, ist die Mutter seines Chefs nicht Iranerin »oder so was Ähnliches« gewesen?
Ob wir es wollen oder nicht, ob wir es gutheißen oder nicht, gehören sie, nein, gehören wir zu Deutschland. Wir, mit unserem zweiten (russischen) Pass oder der italienischen Großmutter oder den türkischen Eltern, dem albanischen Geburtsort, der französischen Muttersprache, den südafrikanischen Vorfahren und so weiter. Diese Aufzählung ist so banal wie unnötig, das sollte sie – eigentlich – sein.
Wir sind schon lange Teil des deutschen Alltags. Wir kommen nicht erst wie eine große, schwarze, gefährliche Wolke, die langsam aufzieht und uns warnt, sich warm anzuziehen, sonst … (nehmen sie uns die Jobs weg, führen die Scharia ein, verpesten alles mit Knoblauchgeruch, stoßen unsere Rentner auf die U-Bahn-Gleise, treiben die Kriminalitätsrate nach oben, sprechen Sprachen, die fremd in unseren Ohren klingen, bringen ihre eigene Mafia mit …). Nein, wir sind schon da, wie bunte oder auch graue Farbkleckse in der Landschaft, so unterschiedlich, wie Menschen nur sein können, ohne dass wir uns automatisch alle leiden könnten, denn das Einzige, was uns miteinander verbindet, ist, dass wir nicht Urdeutsche sind. Die andere Eigenschaft, die uns untereinander, aber auch mit all den »Urdeutschen« verbindet, ist, dass wir Teil Deutschlands sind.
So ist das nun mal.
So sehr sich unsere Frühstücksgewohnheiten, unsere Begrüßungsrituale, unsere Geschichten, auch der Grad unserer Verbundenheit zu diesem Land, die Bereitschaft, dieses Land kennenlernen zu wollen, die Fähigkeit, aktiv an seiner Gestaltung mitzuwirken, voneinander unterscheiden – diese Vielfalt ist Reichtum, der anstrengend und nervenaufreibend, problematisch und großartig zugleich sein kann. Dies ist – und das ist, ohne »eigentlich«, eine unumstrittene Tatsache – unser aller Deutschland.
Name gesucht
»Such was Neues!«, sagte sie zu mir. Sie war eine von den vielen, mit denen ich über dieses Buch, über dieses Thema sprach, in dem Versuch zu verstehen, wie andere ticken, was sie denken. Wie die Realität jenseits meines Kopfes ist.
Wir liefen durch die Innenstadt Stuttgarts, wichen den konsumierenden Menschenmassen aus, ich nahm sie kaum wahr. Wie viele Kopftuch-Trägerinnen waren darunter? Wie viele blonde, blauäugige Männer? Es war die Innenstadt einer deutschen Großstadt, es war Alltag, es hätte auch Köln sein können oder Hamburg. »Such was Neues, ein neues Wort!«, sagte sie, nachdem ich irgendeine Frage im Zusammenhang mit Migranten gestellt hatte. Die Frage hatte komplizierter geklungen, als sie tatsächlich war. Kompliziert formuliert deshalb, weil ich Begriffe wie Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund und Ausländer zu vermeiden versuchte. »Ich finde diesen Migrationshintergrund schrecklich!«, fügte sie hinzu, womit sie nicht die Tatsache an sich meinte, sondern den Begriff, der sie umschrieb. Sie sprach mir aus dem Herzen.
Sie war eine von denen, die sich auskennt, weil sie mittendrin lebt, mittendrin arbeitet, mittendrin ihren Alltag verbringt. Sich mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund befasst, selbst türkischstämmig ist – und schon wieder habe ich zwei dieser Begrifflichkeiten verwendet, scheinbar unreflektiert. Zu Letzterem sagte sie: »Wenn man türkischstämmig sagt und damit auch Kurden meint, sind die Kurden beleidigt. Wie aber sagt man dann?«
»Such was Neues!«, sagte sie, sie war die Erste, die mich darum bat, aber nicht die Letzte.