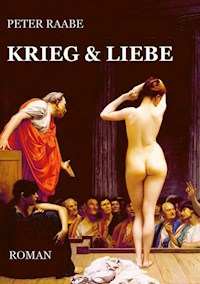Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe ist Glücksache Eine amour fou im politischen Milieu der Bonner Republik der 1980er Jahre. Die Personen und Ereignisse bilden eine Melange aus Dichtung und Wahrheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PROLOG
Ehrlicherweise muß man zugeben, daß alles schon einmal gesagt worden ist. Die Weltliteratur beweist es; man muß sie nur lesen. Und obwohl es genügend literarische Werke gibt, die längst noch nicht ihre Halbwertzeit erlangt haben - und allzu viele, die nicht einmal ihr verlegerisches Verfalldatum erreichen -, gebärden sich Schriftsteller so, als müßten sie das Rad ständig aufs Neue erfinden.
Erlebnis hat, Auch die Veränderungen durch Raum und Zeit, gesellschaftliche Umstände und technische Entwicklungen rechtfertigen kaum den literarischen Aufwand, der ständig betrieben wird - zumal Romane gern ihre Zeit verleugnen und in historischem Gewand einherschreiten oder gar ihrer Zeit voraus zu eilen versuchen.
Was also treibt die Literaten an und warum so viel Neu-Gier der Leserschaft?
Nur weil jedes Schicksal, weil jeder Phall anders ist? Oder weil man das eigene Schicksal auf den bedruckten Seiten gespiegelt zu finden hofft, das eigene Leben gar geläutert und gerechtfertigt? Ist es die abergläubische Suche nach einer geheimen Ordnung, die man in den Ereignissen des persönlichen Lebens nicht zu erkennen vermag? Oder ist es die Suche nach Leben überhaupt - mangels eines eigenen?
Da trifft es sich gut, daß jeder Roman auch ein Stück Autobiographie und unterdrücktes Ich ist, d. h. Fragmente nicht ausgelebter Biographie enthält, angereichert mit Wunsch- und Alpträumen - und immer auch ein Stück Exhibitionismus ihres Verfassers.
Schriftsteller beanspruchen längst nicht, Dozenten einer moralischen Anstalt zu sein, sondern weit eher Botschafter ihrer eigenen unmoralischen Lasterhöhlen - begierig bereit, einer lüsternen Menge von ihren erotischen Wachträumen zu berichten und sie an ihren vermeintlichen Abenteuern teilhaben zu lassen.
Die Sprache, versteht sich, darf dabei nicht zu direkt sein, um nicht dem Verdikt der Pornographie zu verfallen, aber dennoch deutlich genug, damit der Leser das Schlüsselloch-Erlebnis findet, das er von der Lektüre eines Romans nun mal erwartet.
Die Komplizenschaft zwischen Autor und Leser ist also perfekt - eine Kumpanei der literarischen Exhibitionisten mit den Voyeuren. Und zum Glück braucht sich in unserer Zeit niemand mehr moralisch zu entrüsten, denn jeder zivilisierte Staat hat dafür seine spezielle, volkseigene - selbstverständlich unabhängige - Behörde, deren Beamte nichts weiter zu tun haben, als sich jeden Tag aufs Neue über neue Werke der darstellenden, abbildenden oder literarischen Kunst moralisch zu entrüsten - stellvertretend für „die Gesellschaft“, der selbst die erforderliche Zeit und die notwendige Kompetenz fehlt, sich durch eigenen Augenschein oder eigene Lektüre über jedwede von Staatswegen als unsittlich erkannte Veröffentlichung angemessen zu empören. Demokratien lösen dies Problem besonders demokratisch durch Einrichtungen der vorauseilenden „freiwilligen Selbstkontrolle“.
Und „die Kirche“ – bei uns vor allem die katholische - nimmt der Gesellschaft sogar den Ballast des Gewissens ab - dankbar dafür, auf diese Weise sich und ihr Vorhandensein noch ein wenig legitimieren zu können, als Nachweis ihrer Existenzberechtigung.
Erfreulicherweise erfährt in unserem Land der einzelne Staatsbürger wenigstens noch, worüber er sich hätte angemessen empören sollen; anders als in Diktaturen, die diese Art von Skandalen per Zensur völlig abgeschafft haben - was Diktaturen so anstrengend langweilig macht, weil man sich dort ständig auf den Skandal ihrer Existenz konzentrieren muß.
Bei uns hingegen ist das moralische Verdikt der beste Garant für Publizität und Auflagensteigerung - gewissermaßen das Regulativ (vielleicht auch die ausgleichende Gerechtigkeit) für die offizielle Verurteilung eines Oeuvres.
Sie fragen sich vielleicht, was das alles mit diesem Buch zu tun hat. Nun, Sie sollen nicht im Unklaren gelassen werden, worauf Sie sich bei dessen Lektüre einlassen und Sie sollen vorgewarnt sein auf Ihrer Suche nach Wahrheit und Wirklichkeit des Erzählten.
Der Roman gibt seinem Autor ohnehin die legitime Möglichkeit und Macht, seine Opfer typischer zu zeichnen, als sie in Wirklichkeit schon sind und ohne daß sie sich ihrer Haut wehren können; darum Gnade jedem, der der Feder eines Schriftstellers ausgeliefert ist. Manchmal aber verselbständigen sich die Figuren eines Romans und beginnen, unabsichtlich oder auch gewollt, ein Eigenleben zu führen - und es bleibt das Geheimnis des Verfassers, was wahre Wirklichkeit, was wirkliche Wahrheit ist.1
Die Sprache ist der Sündenfall der Wahrheit. Sie vermag weder den Dingen gerecht zu werden noch dem Denken hinreichend Ausdruck zu verleihen. Sie ist nicht fähig, die Fülle und Vielfalt des Lebens zu erfassen, Ereignisse zutreffend zu beschreiben, noch Konflikte zu verhindern - weder individuelle noch universelle. Mit der Sprache kam die Lüge in die Welt, weil sie vergiftet ist von dem Denken, das sie hervorbringt.
Fragen Sie auch bitte nicht nach dem Ende und nach der Moral dieser Geschichte, denn sie hat weder das eine noch das andere. Es wird von Schmerz und Bitterkeit, von Zorn und Haß, von Mutlosigkeit und Verzweiflung zu berichten sein und wenig Erbauliches und Erfreuliches stattfinden, obwohl sich in dieser Geschichte eigentlich alles um die Liebe dreht.
Aber Liebe ist Glücksache; sie hat nun mal viele Farben, und Liebesgeschichten haben ihre Tücken: Jene, die tatsächlich stattfinden, sind meist unbrauchbar für die Literatur, weil zu banal oder trivial. Und solche, die der Muse abgerungen wurden, taugen wenig als Vorlage für das Leben, weil zu dramatisch oder elegisch. Und den Liebesdramen, die das sogenannte Leben schrieb, fehlt es meist an Glaubwürdigkeit; ihr Mangel an Überzeugungskraft macht sie bei Literaten wie Lesern suspekt, die die reine Wahrheit oder die wahre Reinheit suchen.
Die Menschen, um die es hier geht, haben mit ihrer Liebe wenig anzufangen gewußt und auch Schindluder mit ihr getrieben, wie man zu sagen pflegt. Konfrontiert mit ihr, haben sie sie entweder nicht erkannt oder nicht erkennen wollen, was die schlimmste Form der Unmenschlichkeit sein kann.
Aber Sie werden auch erfahren, wie unerwartete Ereignisse Menschen verändern können und wie ihre Berechenbarkeit verloren geht, sobald das Leben aus den Fugen der Normalität gerät.
Dabei waren sie allesamt erwachsene Leute in den sogenannten „besten Jahren“ und darüber hinaus menschlich fast untadelig, soweit man das von außen zu beurteilen vermag. Und sie waren anfangs besten Willens, soweit es in ihrem Ermessen stand. Es wäre daher vermessen, im Nachhinein Urteile über ihr Verhalten und ihre Reaktionen zu treffen, ohne die positiven Charaktereigenschaften zu berücksichtigen, von denen jeder zu berichten wußte, der mit ihnen bekannt war.
1 Die Kunst der Literaturwissenschaft ist es, dieses Geheimnis des Schriftstellers zu lüften - gewissermaßen per geistiger Anatomie. So ist es noch heute eines der ungelösten Rätsel, ob Goethe mit Charlotte von Stein geschlafen hat oder nicht - für jeden Germanisten reizvoller als die berühmtere Gretchenfrage.
Wie üblich, endeten bei Claus Lehmann und Marta die Vorbereitungen für den Besuch einer der zahlreichen Parties in der zahlreichen Nachbarschaft mit einem Ehekrach. Robert, der diese Parties haßte, brachte seinen Missmut in betont salopper Kleidung zum Ausdruck, während seine Frau sich chic machte und seinen „Aufzug“ begreiflicherweise „unmöglich“ fand, was ihn mit grimmiger Freude erfüllte. Und wie üblich, gab er schließlich wutschnaubend nach und warf sich „in Schale“, wie er es verächtlich nannte. Nachdem dieser Programmpunkt abgearbeitet war, der jedes Mal aufs Neue zum Prüfstein über Macht und Ohnmacht zwischen den beiden Eheleuten wurde, marschierten sie los, schweigsam und übel gelaunt – sie in einem gewagten Partykleid und wütend wegen ihrer bereits chronischen Verspätung, er im dunklen Anzug und verdrossen wegen seiner neuerlichen Kapitulation.
Ort des heutigen Geschehens war diesmal der bescheidene, aber gepflegte Bungalow von Manfred Küster und Ehefrau Sabine – beide in den vierziger Jahren wie Claus und Marta – im selben Hypothekenviertel vor den Toren von Bonn, und nur wenige Schritte entfernt von der eigenen „Datscha“, wie Claus Lehmann seine Villa nannte.
Auf ihr Klingeln öffnete ihnen Michael, der neunjährige Sohn. Aus dem Partykeller scholl ihnen bereits Tanzmusik und lärmende Fröhlichkeit entgegen, als sie die Treppe hinabstiegen. Beim Eintreten wurden sie mit dem üblich vielstimmigen Hallo von den schon anwesenden Gästen empfangen. Da Claus wie üblich vergessen hatte, daß es sich um eine Geburtstagsparty handelte und daher auch nicht wußte, wer das Geburtstagskind war, ließ er seiner Frau den Vortritt beim viel zu herzlichen Begrüßungs- und Glückwunschzeremoniell, das diesmal dem glatzköpfigen Hausherrn galt, der – ebenfalls wie üblich – sich hinter seinem Bar-Tresen als Schankwirt, Barkeeper und Kellner betätigte, während seine Frau, blond und üppig, von ihrem Barhocker aus die Honneurs machte.
Der Partyraum war von Kerzen auf den Clubtischen und der Bar nur spärlich beleuchtet. Entlang von drei Wänden gab es kleine Kojen mit niedrigen Polsterbänken, auf denen dicht gedrängt die übrigen Paare aus der Nachbarschaft saßen. Bei seiner Begrüßungsrunde musste Claus feststellen, daß er und seine Frau overdressed waren, was seiner zur Schau getragenen guten Laune nicht gerade förderlich war.
Während Marta noch irgendwie Platz zwischen den übrigen Gästen fand, machte es sich Claus an der Bar bequem, direkt an der Seite der Gastgeberin, die ihn, bereits leicht angeheitert, ihre Dankbarkeit für seine Gesellschaft spüren ließ. Ihr sinnlicher Körper machte ihn an, schon seit langem, und sie wusste es, auch schon seit langem. Claus ließ sich Wein einschenken und holte Sabines Vorsprung mühelos auf. Mit lüsternen Blicken tastete er ihren Körper ab, während er mit ihr small talk machte, was wegen der lauten Musik nicht leicht war. Aber die Musik musste auf Verlangen der Tanzenden so laut spielen, um den Gesprächslärm zu übertönen, was wiederum der Lärmpegel der Unterhaltungen steigerte, um gegen die Lautstärke der Musik anzukommen. Um bei Sabine Gehört zu finden, musste Claus sich also dicht an Sabines Ohr beugen und den Arm um ihre Schulter legen, wie das unter guten Freunden üblich ist. Und hier waren alle gute Freunde, denn alle waren per Du.
Claus Lehmann tanzte hin und wieder mit Sabine, und wenn ihm die Hausherrin entführt wurde, auch mit anderen Frauen, oder genoß mit dem Glas in der Hand seine splendid isolation auf seinem Barhocker. Da die Musik anschmiegsam und die Beleuchtung intim waren, schmiegte er sich beim Tanzen entsprechend eng an seine Partnerinnen und es schien sie nicht zu stören, wenn er sie die Erektion in seiner Hose spüren ließ: sei es, daß es sie erregte oder daß es sie stolz machte, erregend auf den Mann in ihren Armen zu wirken – oder gar beides; sei es, daß sie sich oder ihn erregen wollten – oder beide. Und auch der Alkohol leistete seinen gewünschten Beitrag zur Lösung von Problemen und Hemmungen.
Fast dreitausend Jahre alte Rituale brachen an diesem Abend wieder aus den Tiefen des kollektiven Ungewußten hervor: Die Heroen zechten beim Gelage, um im Rausch Dionysos, Eros und anderen Göttern des Symposions Tribut zu zollen. Nur die halbnackten Hetären waren vertrieben worden von den eifersüchtigen Ehefrauen, die nun selbst in deren Rollen schlüpften und sich den Männern hingaben, um zu verhindern, daß es die anderen taten.
Mitten in das Partytreiben platzte als Überraschungsgast „der Minister“ mit seiner Gattin, um dem Hausherrn zu gratulieren. Auch er hatte sich in einem Bungalow nicht weit von dem Hypothekenviertel angesiedelt und ließ sich gerne zu solch volkstümlichen Vergnügungen einladen. Während seine Frau an der Bar von der Gastgeberin vereinnahmt wurde, fand der Minister einen freien Platz neben Petra Müller, der Frau eines Finanzbeamten, dem man die Ärmelschoner ansah, obwohl er keine trug. Seine Frau passte gut zu ihm: knöchern und etwas vertrocknet.
Claus Lehmann nutzte die Gelegenheit, da sich die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Neuankömmlinge konzentrierte, und verschwand mit seiner letzten Tanzpartnerin in ein dunkles Zimmer im Erdgeschoß, wo sie sich heftig umarmten und küssten, während er ihren Busen knetete und sie sich an seinem Hosenschlitz zu schaffen machte. Gerade, als er ihr unter den Rock fassen wollte, ging das Licht an und neugierig schaute der kleine Michael herein. Erschrocken ließen die beiden von einander ab. Claus hätte den Kleinen am liebsten georfeigt.
„Verschwinde!“, zischte er ihn wütend an, der ebenfalls erschrocken, wegrannte.
Claus und seiner Tanzpartnerin war die Lust auf mehr Lust vergangen. Doch auf dem Rückzug ins allgemeine Getümmel versäumte er nicht, mit ihr noch hastig einen Hausbesuch zu verabreden:
„Morgen?“
„Ja“.
„Wann?“
„Nach neun“.
„Ich komme“.
Ihr Mann würde dann bereits im Wirtschaftsministerium seinen dortigen Amtspflichten nachgehen. Als Journalist mit unregelmäßigen Arbeitszeiten konnte Claus sich solche Eskapaden zeitlich leisten. Er kehrte allein in den Partyraum zurück, während sie zunächst in die Gästetoilette verschwand, um erst später, getrennt von ihm, wieder aufzutauchen.
Sabine Küster saß auf ihrem Barhocker und hatte Claus schon vermisst.
„Ich musste deinen Platz bereits verteidigen!“, meinte sie vorwurfsvoll mit beschwipster Stimme. Claus nutzte die Gelegenheit, sie leutselig in die Arme zu nehmen, um ihr mit gespielter Dankbarkeit einen Kuß zu geben, den er jedoch in einen endlosen Zungenkuß umfunktionierte, dem sie sich ohne Zögern aktiv und lustvoll hingab. Nachdem er wieder seinen Platz neben ihr auf dem Barhocker eingenommen und ein weiteres Glas Wein geleert hatte, fasste er sie freundschaftlich um die Hüfte und ließ seine Hand allmählich unter ihren hochgeschlitzten Rock gleiten, bis seine Finger ihre Schamhaare berührten. Zu seiner Überraschung stellte er fest, daß sie keinen Slip anhatte und zu seiner Verblüffung ließ sie ihn gewähren. Und so wagte er es, sich weiter vorzutasten, bis er mit seinen Fingern ihre Scheide berührte. Sie hielt ganz still, als er mit dem Zeigefinger ihren Kitzler streichelte und ihn schließlich in ihre Vagina steckte, die sich ihm warm, weich und feucht entgegen bog. Schweigend schauten beide in ihre Gläser, um ihre aufkommende Erregung zu verbergen. Nach einer Weile zog Claus seine Hand zurück und hielt sich die Finger an die Nase, um den Duft ihrer Möse einzuatmen. Als er merkte, dass sie ihn dabei beobachtete, hielt er ihr seine nassen Finger ebenfalls an die Nase. Begierig sog sie ihren eigenen Geruch ein, dabei lächelte sie ihn an.
„Wollen wir tanzen?“, fragte sie mit gespielter Harmlosigkeit.
Sie zog ihn auf die winzige Tanzfläche, zwischen die übrigen Tanzpaare, und schmiegte sich eng an ihn. Doch statt den Arm um seinen Nacken zu legen, schob sie ihn vorn in seine Hose, bis sie seinen steifen Penis in der Hand hielt, der unter den sanften Liebkosungen ihrer Finger zu nässen begann. Das alles geschah wortlos, während sie tanzten und ihre Gesichter glühten. Die Musik endete.
„Ich muß mal auf die Toilette“, flüsterte sie ihm zu und ließ seinen Penis los.
„Ich komme gleich nach!“, erwiderte er reflexartig und grinste dabei unverschämt.
Sabine verschwand und Claus kehrte an die Bar zurück, um sich vom Hausherrn, der von allem anscheinend nichts mitbekommen hatte, ein weiteres Glas Wein einschenken zu lassen. Aus irgend einer Ecke hörte er das lustvolle Gelächter seiner Frau, wenn einer der Männer um sie her eine frivole Bemerkung machte oder körperliche Annäherung versuchte, deren sie sich nur halbherzig erwehrte.
Claus trank sein Glas leer und verließ den Raum. Er ging die Treppe hoch und suchte das Badezimmer. Die Tür war nur angelehnt. Als er leise eintrat, stand Sabine über das Waschbecken gebeugt und wusch sich die Hände. Claus schloß die Tür von innen ab und zog, ohne ein Wort zu sagen, von hinten Sabines Rock hoch und öffnete seine Hose. Sie spreizte leicht ihre Schenkel, so daß sein Glied sofort die nasse Öffnung ihrer Muschi fand und tief in sie eindringen konnte. Schweigend fickte er sie von hinten, während sie sich mit beiden Händen auf dem Beckenrand abstützte. Das Wasser lief weiter und sein Rauschen übertönte ihr Ächzen unter seinen heftiger werdenden Stößen.
Nachdem er sich mit einem Stöhnen in sie entleert hatte, blieb er noch einen Moment keuchend über sie gebeugt, um sich ein wenig zu erholen. Dann packte er seine Genitalien ein und verließ Sabine und den Raum – ebenso wortlos, wie er gekommen war, während sie sich erneut wusch, diesmal auch ihr erhitztes Gesicht.
Claus kehrte an die Bar zurück. Der Hausherr hatte inzwischen sein Weinglas nachgefüllt und Robert prostete ihm zu. Kurz danach tauchte auch Sabine wieder auf. Sie blieb an der Bar neben Claus stehen und lächelte ihm vielsagend zu. Beide schwiegen. Nach einer Weile schaute sie ihn erneut lächelnd an und dirigierte seinen Blick hinab zu ihren Füßen. Auf dem Fußboden schimmerten ein paar Tropfen Flüssigkeit im Kerzenlicht. Claus traute seinen Augen nicht, doch ihr amüsierter Blick bestätigte seinen Verdacht: es tropfte aus ihrer Scheide und es schien ihr zu gefallen.
Der Minister hatte sich inzwischen bei Petra Müller häuslich eingenistet. Nachdem er seinen linken Arm um ihre Schulter gelegt hatte, dauerte es nicht lange, bis seine Hand den Weg in ihr Dekolleté fand, wo sie nun auf ihrem flachen Busen mehr oder weniger ruhte, während seine Rechte den Bierkrug festhielt, aus dem er sich von Zeit zu Zeit bediente. So waren seine beiden Hände auf verschiedene Weise beschäftigt, ihn auf unterschiedliche Weise zu befriedigen. Petra Müller hingegen saß wie versteinert und wagte kaum zu atmen angesichts der unfassbaren Ehre, die ihr zuteil wurde. Sie fühlte sich geschmeichelt von so viel ministerieller Zudringlichkeit und verging fast vor Stolz – und Scham.
Die Frau des Ministers stand nach wie vor an der Bar und warf wütende Blicke auf die beiden, ohne den Mut aufzubringen, etwas gegen den Freimut ihres Mannes zu unternehmen. Stattdessen empörte sie sich beim Gastgeber, der seine Barkeeperpflichten vergaß, um zu retten was nicht zu retten war:
„Ich versichere Ihnen, ich werde nicht zulassen, daß etwas hier geschieht, was Sie kompromittieren könnte!“, raunte er ihr zu. Sein mißglückter Versuch einer Schadensbegrenzung verschlimmbesserte nur die Laune der Ministersgattin, die zornbebend die Stätte ihrer Schmach verließ und nicht mehr zurückkehrte.
Auch der Mann von Petra Müller schien wenig amused. Hektische Flecken röteten sein Gesicht, während er mit Clausens Frau so ausdrucksvoll wie möglich tanzte, um die Aufmerksamkeit der übrigen Partygäste auf sich umzulenken und dabei so tat, als sähe er nichts und niemand außer seiner Tanzpartnerin.
Mit schwankendem Gang kam ein anderer Nachbar auf die Hausherrin zu, um sie zum Tanzen aufzufordern. Er war von riesiger Statur, Ende fünfzig, Geschäftsführer einer örtlichen Brauerei und hatte dem Hausherrn das Bier zum Geburtstag gestiftet. Müde und erschöpft von ihren vorausgegangenen Ausschweifungen, folgte Sabine ihm artig aber widerwillig. Es galt, Dankbarkeit zu beweisen. Mühsam versuchte der Mann mit ihr ein paar offene Tanzschritte, doch er war zu betrunken und kam ins Torkeln. Sabine hielt ihn fest und mit glasigen Augen presste er sie daraufhin an seinen massigen Körper. Mit beiden Händen packte er ihren Hintern und begann, stimuliert von den sinnlichen Gerüchen, die ihr Körper verströmte, seinen Unterleib in schnellem Rhythmus gegen den ihren zu stoßen, bis er sich erleichtert hatte.
Claus hatte ihnen gleichgültig zugesehen. Auch die anderen hatten es verstohlen beobachtet, doch niemand sagte etwas. Schließlich stand seine Ehefrau auf, eine kleine, zierliche Person, und unterbrach seinen Begattungstanz.
„Komm, wir gehen jetzt“, sagte sie zu ihm, ohne Vorwurf in der Stimme. Widerstandslos folgte er ihr und beide verließen grußlos den Raum. Auch Claus ging zu seiner Frau, die auf dem Schoß eines anderen Nachbarn saß und sich nur wenig gegen dessen Bemühungen zur Wehr setzte, sie zu küssen.
„Ich gehe jetzt; kommst du mit oder willst du noch bleiben?“, fragte er sie emotionslos.
„Ich gehe mit“, entschied sie nach kurzem Überlegen und rutschte vom Schoß ihres Verehrers.
Unauffällig verließen sie die Party, deren Musik sie noch bis zur Haustür begleitete. Draußen regnete es. Unentschlossen blieben sie unter dem Vordach vor der Haustür stehen. Schließlich rannten sie los. Doch es half nichts: obwohl es nur zirka fünfzig Meter bis zu ihrem Haus waren, kamen sie dort klitschnaß an.
Das ist die Strafe Gotte für unser lasterhaftes Verhalten heute Abend, dachte Claus, denn er wusste: Kleine Sünden bestraft der Liebe Gott sofort.
Alle beide hatten mit sich zu tun, aus den durchnässten Sachen heraus zu kommen und sie zum Trocknen aufzuhängen. Nachdem dies erledigt war und sie sich abgetrocknet hatten, ließen sie sich in die Betten fallen. Es war schon weit nach Mitternacht.
„Es war eigentlich eine gelungene Party“, fand sie abschließend.
Das fand er auch. Dennoch wollte er auch künftig seinem Grundsatz treu bleiben, daß er solche Parties haßte. Dabei dachte er mit Grausen daran, daß in wenigen Wochen ihm eine solche im eigenen Haus anläßlich des 50. Geburtstages seiner Frau bevorstand, wobei ihm die Gastgeberpflichten nicht erspart blieben .
*
Zufrieden betrachtete Claus Lehmann die gedeckte Tafel, die sich im Schutze der ausgefahrenen Markise fast über die gesamte Länge der Terrasse erstreckte. Unter dem fast zehn Meter langen Tischtuch verbarg sich das Resultat seines zweiwöchigen abendlichen Heimwerkelns.
Seit Wochen schon drehte sich im Haushalt der Lehmanns alles um den bevorstehenden 50. Geburtstag seiner Frau Marta, den sie am heutigen Sonntag mit einer Party feiern wollte. Eine stechende Vormittagssonne versprach mehr Hitze für diesen Junitag als draußen erträglich.
Je mehr der eingeladenen Bekannten zugesagt hatten, um so nervöser wurde Marta und entsprechend gereizter war ihr Umgangston gegenüber ihrem Ehemann geworden. Wenn Claus Lehmann an den letzten Abenden aus dem Büro heimkam, fand er seine Frau in der Küche mit Kuchenbacken beschäftigt oder bei der Herstellung von Soßen und der Vorbereitung von Salaten.
Überall stapelten sich Geschirr, Gläser, Bestecke und sonstige Utensilien, zusammengetragen aus der Nachbarschaft. Auf der Terrasse versammelten sich immer mehr Gartenmöbel der unterschiedlichsten Art aus Holz und Plastik in braun und weiß.
Clausens Vorschlag, die gesamten Vorbereitungen einem Party-Service zu übertragen, hatte Marta ausgeschlagen, weil das zu teuer sei. In Wahrheit hatte sie das uneingestandene Bedürfnis, konzentriert in diesem einmaligen Ereignis, ihre gesamten hausfraulichen Fähigkeiten als Gastgeberin in dermaßen strahlendem Licht aufleuchten zu lassen, daß es alle bisherigen und künftigen Bemühungen der Bekannten in den Schatten stellen sollte.
Fragte Claus seine Frau, ob er ihr „irgendwie behilflich“ sein könne, bekam er meist in gereiztem Ton zur Antwort, er möge sich lieber um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Machte er konkrete Vorschläge und Angebote, waren sie mit ziemlicher Sicherheit entweder abwegig oder schon erledigt oder auf andere Weise unerwünscht.
Solcherart eingeschüchtert und für überflüssig erklärt, zog sich Claus grollend zurück und dachte mit wachsendem Zorn daran, daß sein 50. Geburtstag vor drei Jahren nicht stattfinden durfte, weil es damals nur „seine“ Freunde waren, die er einladen wollte - zumeist Journalisten, einige Politiker, Diplomaten und Ministerialbeamte, mit denen er als Pressereferent eines Interessenverbandes am Regierungssitz häufig zu tun hatte.
Marta hatte es damals als Zumutung abgelehnt, sich Arbeit zu machen für „diese Leute“, die sie samt und sonders für Schnorrer und Schmarotzer hielt, da sie von ihnen ja auch nicht eingeladen würden. Clausens Argument, daß er aus beruflichen Gründen den Kontakt mit „diesen Leuten“ pflegen müsse, die er insgeheim ebenfalls für Schnorrer und Schmarotzer hielt, und nur jene einzuladen gedenke, an denen er auch ein persönliches Interesse habe, wurde von ihr nicht akzeptiert.
Martas Bildung war mangels Möglichkeiten unterentwickelt, doch dank ihrer Intelligenz und Lernfähigkeit holte sie dies im Umgang mit Clausens Bekanntenkreis und aufgrund seiner kulturellen Interessen auf, so daß sie im Laufe der Jahre gesellschaftsfähig und parkettsicher wurde. Ihr sicherer Geschmack und ihre natürliche Fröhlichkeit halfen ihr dabei. Inzwischen hatte sie sich dermaßen emanzipiert, daß sie Clausens Meinung bestenfalls duldete, wenn sie sie nicht ablehnte.
Viele der Leute aus Clausens Bekanntenkreis gehörten nunmehr auch zu Martas Freundeskreis - zumindest die Ehefrauen, nachdem man sich auf irgendwelchen Empfängen und Parties unter der Bonner Dunstglocke des öfteren begegnet war, woraus sich im Laufe der Zeit zum Teil auch private Kontakte entwickelten.
Zu Martas Geburtstagsparty leistete Claus in aller Stille seinen Beitrag, indem er nach sorgfältigem Vermessen aller verfügbaren Gartentische Holzplatten einkaufte, sie auf das rechte Maß zuschnitt und mit den notwendigen Halterungen versah, so daß am Ende eine durchgehende Tafel entstand, an der bis zu dreißig Personen Platz finden konnten.
Nachdem diese Eigenmächtigkeit von seiner Frau mißbilligend zur Kenntnis genommen war und auch eine Probevorführung keine Zustimmung fand, entschied Marta sich dann doch kurzfristig für diese Lösung des personellen Parkproblems, so daß noch am Vortag der Party ein passendes Tischtuch gekauft werden mußte, was die Gardinenabteilungen der großen Kaufhäuser am Ort überforderte. Schließlich fand man kurz vor Geschäftsschluß doch noch ein akzeptables Tuch, eigentlich ein Vorhangstoff, für Martas Zwecke aber wegen seiner Dimensionen um so geeigneter und zudem preiswert.
Claus war erleichtert, letztendlich doch einen nützlichen Beitrag zur Gestaltung der Party geleistet zu haben. Mit neuem Selbstwertgefühl besserte sich auch seine Laune. Er begann sich sogar wieder auf den gemeinsamen Opernbesuch zu freuen, der im Anschluß an die Party den krönenden Abschluß des Geburtstages bilden sollte. Er war glücklich gewesen, daß es ihm gelungen war, Karten für diesen Tag zu bekommen, da das Opernhaus fast ständig ausverkauft war. An diesem Abend stand „Tristan und Isolde“ auf dem Spielplan. Stolz hatte Claus die Karten seiner Frau am Morgen als Geburtstagsgeschenk überreicht und war etwas enttäuscht, als er feststellte, daß sich Martas Begeisterung in Grenzen hielt, gemessen daran, wie zurückhaltend ihr Dank ausgefallen war.
Bei Anlässen wie diesem ertappte sich Claus Lehmann seit Jahren immer öfter bei der Frage, warum er diese Frau geheiratet habe. Und die Antwort fiel stets gleichermaßen unbefriedigend aus. Der einzige Grund, der ihm nach zwanzig Ehejahren noch einfiel war, daß er damals, 25-jährig und am Ende seines Germanistik-Studiums, des Alleinseins überdrüssig gewesen war. Und von den wenigen Frauen, die er bis dahin kannte, schien sie am geeignetsten als Mutter seiner künftigen Kinder. Dabei war sein Kinderwunsch eher unterentwickelt; der allzu bald geborene Sohn genügte ihm völlig, und seine Entwicklung verfolgte er mit geringer Zuneigung und wenig Engagement. Er hatte den Kontakt zu seinem Sohn stets gemieden, um Konflikte zu vermeiden - also aus Feigheit und Bequemlichkeit. Später behauptete er - und glaubte es auch - , sein Verhalten sei bewußt und von dem Vorsatz bestimmt gewesen, seinen Sohn nicht zu gängeln und seine eigenständige Entwicklung so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.
Claus Lehmann sehnte sich zwar nach Sozialprestige, aber ohne viel dafür zu tun und hielt die gelegentlichen „Bordfeste“ wie das heutige für Triumphe einer erfolgreichen Karriere. Und so dümpelte sein Leben vor sich hin wie ein angeketteter Kahn, auf dem er sich häuslich eingerichtet hatte - beladen mit allerlei Talenten, aber ohne den Mut und den Ehrgeiz, zu anderen Ufern aufzubrechen, mit einer Frau und einem Sohn an Bord, die beide zu sehr mit sich und ihren kleinen Alltagsinteressen unter Deck beschäftigt waren, um einen gelegentlichen Blick über die Reling zu werfen, während der Kapitän in seiner Kajüte sich auffressen ließ vom bürokratischen Einerlei seines Jobs und nicht wagte, an den Ketten zu zerren, die ihn und seine kleine Welt am sicheren Ufer festhielten. Aber sein Blick folgte sehnsüchtig dem Flug der Möwen am Himmel.
Während Claus Lehmann noch selbstgefällig das Resultat seiner handwerklichen Anstrengungen betrachtete, klingelten an der Haustür pünktlich um elf Uhr die ersten Gäste - mehrere Nachbarn, alle wie sie selbst Eigenheimbesitzer in dem gemeinsamen Wohnviertel, das die Einheimischen des kleinen Ortes das Hypothekenviertel nannten. Claus pflegte sich damit zu revanchieren, daß er die Dorfbewohner als Ureinwohner und Eingeborene bezeichnete.
Die Ortschaft, angelehnt an einen Naturpark vor den Toren Bonns, war zu einem Magneten für Häuslebauer geworden, nachdem Regierung und Parlament dort ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Die persönlichen Kontakte innerhalb des Hypothekenviertels verdichteten sich mit der Verdichtung seiner Bebauung und es gab kein Entrinnen davon. Innerhalb kürzester Zeit wurde jeder Neusiedler vereinnahmt und zum privaten Du verurteilt, und schließlich gehörte es zum guten Ton, sich gegenseitig zu allen privaten Anlässen einzuladen - ein Automatismus, gegen den sich Claus zum Verdruß seiner Frau immer wieder aufzulehnen versuchte, allerdings mit geringem Erfolg, während Marta ganz in dieser Nachbarschaftsharmonie aufging und sie zum Leidwesen ihres Mannes nach Kräften förderte. So veranstaltete sie beispielsweise zu jedem in der Nachbarschaft anstehenden Geburtstag große Sammelaktionen für aufwendige, gemeinsame Geschenke und verbrachte ganze Tage in der Stadt mit der Suche, Auswahl und dem Einkauf des ihrer Meinung richtigen Präsents. Im Laufe der Zeit hatte sie sich auf diesem Gebiet so viel Erfahrung angeeignet und Instinktsicherheit entwickelt, daß man ihr diese, den meisten Nachbarn zunehmend lästige Pflichtübung dankbar überließ, zumal sie diese freiwillig übernommene Aufgabe mit größter Hingabe erledigte.
Claus horchte, ob seine Frau auf das Klingeln reagierte. Als sich nichts tat, ging er, um die Gäste in Empfang zu nehmen, die mit schriller Fröhlichkeit eindrangen und nach dem Geburtstagskind riefen. Claus hetzte durch alle Räume, ohne Marta zu entdecken, bis er sie aus dem Keller rufen hörte.
Er stürzte ihr entgegen: „Meine Güte, wo steckst du denn? Deine Gäste kommen schon!“
Das hätte er nicht sagen dürfen. Ein wütender Blick war ihre Antwort, dann rannte sie an ihm vorbei in die Diele und warf sich in ein heftiges Getümmel mit Umarmungen, Gratulationen, Blumen, Geschenken und viel Lärm.
Die nächsten Gäste klingelten bereits.
Marta rannte zwischen Garderobe, Küche, Haustür und Wohnzimmer hin und her und versuchte hektisch, alles gleichzeitig zu tun: Vasen für die Blumen suchen, Gäste empfangen, Geschenke entgegennehmen, Gläser holen, Getränke holen, Gläser einschenken, Gäste begrüßen, Blumen in die Vasen, Gläser verschütten, Blumen von Papier befreien, Gäste empfangen, Küßchen empfangen, Geschenke empfangen.
Das Chaos wuchs.
Claus versuchte, etwas Ruhe in das Geschehen zu bringen, indem er unentwegt Gläser mit Sekt füllte und an die Neuankömmlinge austeilte.
Zum Glück strebten die Gäste allmählich Richtung Terrasse, wo allerdings ein neuer Stau an der Terrassentür entstand, weil die Biertrinker sich um das Fäßchen stauten, das, unwillig bedient von Sascha, dem halbwüchsigen Sohn, mehr Schaum als Bier in die Gläser ausspie.
Marta arbeitete sich durch die Ansammlung zu der Zapfstelle vor, um auch hier einzugreifen. Doch es gelang ihr lediglich, Sascha noch mehr einzuschüchtern, nachdem schon zwei erfahrene Biertrinker ihn abgelöst und die Sache zu ihrer eigenen gemacht hatten, aber beim Zapfen ebenso erfolglos blieben.
Allmählich entspannte sich die Lage. Das kalte Buffet lockte an und die Gäste, Teller und Gläser in Händen, verteilten sich auf der Terrasse und im Garten. Gruppen und Grüppchen bildeten sich und blinzelten in die heiße Mittagssonne, Gespräche kamen in Gang.
Besonders der chinesische Militärattaché, der wie immer heftig nach Mottenkugeln roch, und sein sowjetischer Amtskollege, ein untersetzter, unter seinem Gewicht keuchender Weltkrieg-II-General - beide mit ihren Frauen - zogen das Interesse der anwesenden Journalisten auf sich.
Der Bundestagsabgeordnete Jakob-Maria Mierscheid, ein sozialdemokratischer Hinterbänkler aus dem Hunsrück und Intimus des Hausherrn, unterhielt eine andere Gruppe mit Witzen über den christdemokratischen Bundeskanzler, dessen geistige wie sprachliche Hausbackenheit in hohem Maße mit der gegenwärtigen Gartenzwerg-Kultur im Lande harmonierte, was mit zur Ablösung seines intellektuell zu anstrengenden sozialdemokratischen Vorgängers beigetragen hatte.
Mierscheid gab gerade zum besten, angesichts des Staatsbesuches des Bundeskanzlers in Nepal habe man auch in Neapel vorsichtshalber geflaggt, als sich unbemerkt der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Dieter Würzburg der Gruppe näherte. Mierscheid schwadronierte weiter, bis es zu spät war und ein verlegenes Schweigen entstand.
Zum Glück tauchte sein Parteigenosse Peter Büx auf, dem Mierscheid Sitz und Stimme im höchsten deutschen Parlament verdankte. Nachdem sich beide mit überschwänglicher Höflichkeit begrüßt hatten – gerade so, als würden sie sich zum ersten Mal gegenüberstehen -, nutzte der Staatssekretär die Situation, die beiden Oppositionsabgeordneten zu einem vertraulichen Gespräch beiseite zu nehmen.
Es ging um einen Kuhhandel, der den neuen Verteidigungsminister aus den politischen Turbulenzen retten sollte, in die er sich allzu forsch aus der Fülle seiner professoralen Selbstgewißheit als Staatsrechtler, jedoch bar jeglichen politischen Fingerspitzengefühls, selbst hinein manövriert hatte. Wegen einer Katastrophe mit über sechzig Toten während einer militärischen Flugschau wollte die Opposition einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß im Bundestag beantragen, um den Verteidigungsminister für die Genehmigung des Militärspektakels zur Verantwortung zu ziehen. Die Sozialdemokraten wollten damit zugleich an ihm Rache üben für seine Genehmigung eines amerikanischen Luftwaffen-Stützpunktes nahe Wiesbaden, dessen Inbetriebnahme Stadt und Land trotz unterschiedlicher politischer Couleur gemeinsam mit rechtlichen Mitteln zu verhindern suchten. Unter massivem Druck der amerikanischen Schutzmacht hatte das Verteidigungsministerium jedoch Einspruch eingelegt und Gegenklage erhoben.
Angesichts des drohenden parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der sich zu einem lang andauernden Schauprozeß gegen den Minister entwickeln konnte, wenn die Oppositionspartei dies wollte, bot Würzburg den Rückzug seines Ministers in Sachen US-AirBase an, wenn die Opposition ihrerseits auf den Untersuchungsausschuß verzichten würde. Da die Sozialdemokraten bereits am kommenden Vormittag offiziell die Einsetzung des Ausschusses in ihrer Fraktion zur Abstimmung stellen wollten, war Eile geboten.
Würzburg handelte und verhandelte in dieser Angelegenheit auf eigene Faust, um auch seinen eigenen Kopf zu retten; im Rahmen der ressortinternen Zuständigkeiten trug er nämlich Mitverantwortung für die Durchführung der verunglückten Flugschau, da ihm deren Programm vor der Ministergenehmigung zur Prüfung vorgelegen hatte, was inzwischen auch schon ruchbar und von der Presse aufgegriffen worden war.
Die beiden Abgeordneten waren ernst geworden. Nach kurzem Nachdenken erklärten sie sich bereit, das informelle Angebot umgehend ihrer Fraktionsführung zur Kenntnis zu bringen. Man war sich einig, daß die Opposition eine schriftliche Garantie des Ministers brauche, wenn sie ihre Absicht aufgeben sollte.
Claus Lehmann trat zu der Gruppe, um seiner Gastgeberrolle Genüge zu tun. Als er leutselig nach dem Grund für die ernsten Gesichter fragte, wurde er – unter dem Siegel der Verschwiegenheit – ins Vertrauen gezogen.
Lehmann fand den geplanten Handel politisch ebenso gekonnt wie raffiniert; die Opposition wurde auf diese Weise zu einer Entscheidung zwischen großem Schauprozeß und Wahrung von Bürgerinteressen gezwungen.
Dem Staatssekretär tat das Lob seiner politischen Klugheit gut, die beiden Abgeordneten nickten etwas bedrückt angesichts der Zwangslage, in die sie und ihre Fraktion plötzlich manövriert waren. Lehmann führte die beiden in sein Arbeitszimmer, damit sie ungestört mit ihrem Fraktionschef telefonieren konnten.
Als er zurückkehrte, faßte Würzburg ihn am Ärmel: „Was macht denn der Marschenko hier?“
Gemeint war der sowjetische Luftwaffenattaché, der als einziger der anwesenden Militärs Uniform trug, weil er wußte, wie gut er darin aussah.
Lehmann schaute sich um nach ihm: „Wieso?“, fragte er, „was ist mit ihm?“.
„Weißt du nicht, daß der ein Spion ist?“, fragte Würzburg zurück.
„Das ist doch die Hauptaufgabe aller Militärattachés. Und wenn du es weißt, warum weist ihr ihn dann nicht aus?“
„Wir haben noch nicht genügend Beweise“, erwiderte Würzburg. „Na prima“, konterte Claus, nicht ohne Ironie, „dann gibt es ja an seinem Besuch hier auch nichts auszusetzen – oder?“. Würzburg blieb die Antwort darauf schuldig.
Clausens Verhalten war alles andere als geschickt, hatte er doch den ihm befreundeten Staatssekretär vor allem deshalb eingeladen, um ihn für die Unterstützung seiner Bewerbung bei einer vom Ministerium herausgegebenen Zeitschrift zu gewinnen, deren Chefredakteurposten demnächst vakant wurde, wie Lehmann erfahren hatte.
Claus Lehmann informierte den Staatssekretär über sein Begehr und den Stand der Vorgespräche. Würzburg versprach ihm Unterstützung, nicht ohne sich vorsichtshalber zu vergewissern: „Du bist doch hoffentlich kein Sozi?“.
Lehmann lachte: „Nein, allerdings stehe ich bei etlichen Schwarzen in diesem Ruf“.
*
Lehmann bezeichnete sich gern als „Generalist“ und meinte damit seine uneingestanden vielseitige Halbbildung. Er hatte von jedem und allem etwas Ahnung, aber auf keinem Gebiet genügend, um sich als Fachmann ausweisen zu können. Für diese Art von Intellektuellen gab es im praktischen Berufsleben so gut wie keine Verwendung - nicht einmal in der Politik, da ihm hierfür wiederum die nötige Leutseligkeit, Hemdsärmeligkeit und Ellenbogenkraft fehlte. Deshalb war er Journalist geworden - voller Verachtung für den Journalismus. Seinen Mangel an Wissen kompensierte er mit Schlagfertigkeit und Humor. In Diskussionen mußte er nach Anfangserfolgen meist schon bald die Waffen strecken und brach geistreiche Duelle deshalb gern mit Hilfe einer witzigen Bemerkung ab, damit sein Selbstwertgefühl nicht mehr Schaden erlitt als ein paar vergängliche blaue Flecken. Dennoch nahm er immer wieder jede sich bietende Herausforderung an in der zähen Hoffnung auf einen geistigen Punktsieg über den jeweiligen Diskussionspartner. Doch ehrliche Erfolgserlebnisse waren ihm nur selten beschieden, also überhöhte er in der Nachbetrachtung gerne argumentative Teilerfolge im Streitgespräch zu einem Gesamtsieg.
Sein Aufstieg zum Pressesprecher eines Berufsverbandes und Chefredakteur der Verbandszeitschrift hatte sich - mangels beruflichem Ehrgeiz - langsam, redlich und lustlos vollzogen. Es war ihm nie gelungen, sich mit seinem Job zu identifizieren, da er die Arbeit als das auffaßte, was sie war: Arbeit. Er bemühte sich lediglich, beruflich so gut wie möglich zu funktionieren. Doch auch das fiel ihm schwer, weil es ihm selten gelang, widerspruchslos zu akzeptieren, was man von ihm verlangte.