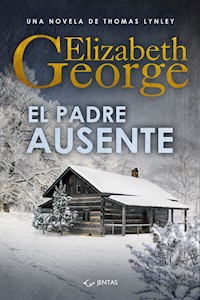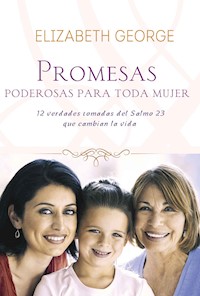9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
Barbara Havers und Inspector Lynley vor ihrer größten menschlichen Herausforderung.
Barbara Havers macht sich große Sorgen um ihren Freund Taymullah Azhar. Denn nachdem ihn seine Freundin Angelina aus heiterem Himmel verlassen und auch die gemeinsame Tochter mitgenommen hat, ist er völlig verzweifelt. Erst nach Wochen bangen Wartens steht Angelina plötzlich wieder vor Azhars Tür, allerdings ohne die kleine Hadiyyah, denn die ist in Italien, wohin sich Angelina abgesetzt hatte, spurlos verschwunden. Als der Fall des vermissten Mädchens auch in der britischen Presse Schlagzeilen auslöst, muss die Polizei reagieren – und Inspector Lynley reist in die Toskana, um die Ermittlungen in dem kleinen Ort Lucca zu begleiten. Doch alsbald gerät Azhar selbst in den Verdacht, in die Entführung des Kindes verwickelt zu sein. Barbara ist fassungslos und kämpft mit allen Mitteln darum, die Unschuld ihres Freundes zu beweisen. Bis sie einen Schritt zu weit geht…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1235
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Eines Abends versucht Barbara Havers verzweifelt, Inspector Thomas Lynley zu erreichen. Sie benötigt dringend seinen Rat, denn für ihren Nachbarn und Freund Taymullah Azhar ist eine Welt zusammengebrochen: Seine Freundin Angelina hat ihn verlassen und ihre gemeinsame Tochter Hadiyyah mitgenommen. Als Barbara ihren Kollegen Lynley endlich erreicht, kann der sie nur wenig beruhigen. Er macht ihr klar, dass sie nicht viel für Azhar tun kann. Fünf lange Monate vergehen, bis Angelina plötzlich wieder vor Azhars Wohnungstür steht. Es stellt sich heraus, dass sie sich in der Zwischenzeit in Italien aufgehalten hat, wo sie mit ihrem neuen Liebhaber Lorenzo zusammenlebt. Wutentbrannt beschuldigt sie Azhar, die kleine Hadiyyah entführt zu haben, die seit ein paar Tagen vermisst wird. Barbara würde am liebsten sofort selbst nach Italien aufbrechen, um vor Ort zu ermitteln. Stattdessen wird Lynley geschickt, der dort schnell eine Spur entdeckt …
Weitere Informationen zu Elizabeth George sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Elizabeth George
Nur eine böse Tat
Ein Inspector-Lynley-Roman
Ins Deutsche übertragen von Charlotte Breuer undNorbert Möllemann
Für Susan Berner –die eine wunderbare Freundin,ein Vorbild in allemund seit fünfundzwanzig Jahrendie beste Leserin überhaupt ist
Die Welt wird immerdar durch Zier berückt.Im Recht, wo ist ein Handel so verderbt,Der nicht, geschmückt von einer holden Stimme,Des Bösen Schein verdeckt?
William Shakespeare, Der Kaufmann von Venedig
15. November
________________________
EARLS COURTLONDON
Thomas Lynley hätte sich nie träumen lassen, dass er einmal mitten unter zweihundert kreischenden Menschen – alle mit einem eher unkonventionellen Kleidergeschmack – in der Brompton Hall auf einem Plastikstuhl sitzen würde. Heavy Metal wummerte aus Lautsprechertürmen von der Größe eines Hochhauses am Strand von Miami. An einem Imbissstand hatte sich eine lange Schlange für Hotdogs, Popcorn, Bier und Erfrischungsgetränke gebildet. Eine Ansagerin rief in Abständen mit schriller Stimme über den Lärm hinweg den Spielstand und die Fouls aus. Und in der Mitte, auf einer mit Klebestreifen auf dem Betonboden markierten ovalen Bahn, rasten zehn behelmte Frauen auf Rollschuhen herum.
Angeblich war es nur ein Schauwettbewerb, dazu gedacht, die breite Öffentlichkeit mit den Feinheiten des Flat Track Roller Derby als Frauensportart vertraut zu machen. Aber offenbar hatte man es versäumt, das den Spielerinnen mitzuteilen, denn die legten sich ins Zeug, als ginge es um Leben und Tod.
Sie hatten interessante Namen. Sie waren mit den dazugehörigen, angemessen furchteinflößenden Fotos in dem Programm ausgedruckt, das unter den Zuschauern verteilt worden war. Lynley hatte sich beim Lesen der Kampfnamen ein Grinsen nicht verkneifen können: Vigour Mortis, The Grim Rita, Grievous Bodily Charm.
Er war hier wegen einer der Spielerinnen, Kickarse Electra. Sie spielte allerdings nicht bei den Electric Magic aus London, sondern gehörte zum Team aus Bristol, einer Gruppe ziemlich wild aussehender Frauen, die sich den hübsch alliterierenden Namen Boadicea’s Broads gegeben hatten. Die Frau, die mit bürgerlichem Namen Daidre Trahair hieß, arbeitete als Großtierärztin im Zoo von Bristol, und sie hatte keine Ahnung, dass Lynley sich mitten unter den johlenden Zuschauern befand. Er wusste noch nicht, ob er es dabei belassen sollte. Vorerst verließ er sich ausschließlich auf sein Bauchgefühl.
Da es ihm am Mut gemangelt hatte, sich allein in diese unbekannte Welt vorzuwagen, hatte er einen Begleiter mitgenommen. Charlie Denton, der Lynleys Einladung, sich im Earls Court Exhibition Centre aufklären, fortbilden und unterhalten zu lassen, gern angenommen hatte, stand gerade im Gedränge am Imbissstand.
»Das geht auf mich, M’lord«, hatte er gesagt und dann hastig »Sir« hinzugefügt, eine Korrektur, die eigentlich längst nicht mehr nötig sein sollte. Denn Charlie Denton stand seit sieben Jahren in Lynleys Diensten, und wenn er nicht gerade seiner Leidenschaft für das Theater frönte und an Bühnen im Großraum London Vorsprechproben absolvierte, fungierte er als Butler, Koch, Flügeladjutant und Faktotum in Lynleys Leben. Er hatte an einem Theater im Norden von London den Fortinbras gegeben, aber das nördliche London war eben nicht das West End. Und so führte er tapfer sein Doppelleben fort, überzeugt, dass sein Durchbruch kurz bevorstand.
Jetzt amüsierte er sich gerade über irgendetwas, das sah Lynley ihm an, als er sich seinen Weg zurück zu der Stuhlreihe bahnte, in der sie saßen. Vor sich her trug er ein volles Papptablett.
»Nachos«, verkündete Denton, als Lynley stirnrunzelnd etwas betrachtete, das aussah wie orangefarbene Lava auf einem Berg Tortilla-Chips. »Für Sie ein Hotdog mit Senf, Zwiebeln und Relish. Kein Ketchup, das sah mir ein bisschen verdächtig aus, aber das Lager-Bier ist gut. Lassen Sie’s sich schmecken!«
All das sagte Denton mit einem Funkeln in den Augen, aber es konnte auch das Licht sein, das sich in seinen runden Brillengläsern spiegelte, dachte Lynley. Denton wartete darauf, dass Lynley den angebotenen Imbiss ablehnte und sein wahres Gesicht zeigte. Und es amüsierte ihn, dass sein Arbeitgeber wie ein alter Kumpel neben einem Typen saß, dem der Bauch über die weite Jeans quoll und die Dreadlocks bis auf den Rücken reichten. Lynley und Denton waren auf den Mann angewiesen, der sich Steve-o nannte, denn der wusste alles über Flat Track Roller Derby – zumindest alles, was sich zu wissen lohnte.
Er sei mit Flaming Aggro liiert, hatte er ihnen strahlend erklärt. Und seine Schwester Soob gehöre zu den Cheerleadern, die sich in Lynleys Nähe in Stellung gebracht hatten und wesentlich zu der allgemeinen Kakophonie beitrugen. Die Damen waren ganz und gar in Schwarz gekleidet, aufgepeppt mit grell pinkfarbenen Tutus, Haarspangen, Kniestrümpfen, Schuhen oder Westen. Sie schrien ohne Unterlass »Break’em baby!« und wedelten mit ihren pink- und silberfarbenen Pompons.
»Toller Sport, was?«, sagte Steve-o immer wieder, während Electric Magic Punkte einheimste. »Die meisten Punkte macht Deadly Deedee-light. Solange sie keine Strafpunkte sammelt, haben wir den Sieg in der Tasche.« Dann sprang er auf und brüllte: »Gib Gas, Aggro!«, als seine Freundin inmitten des Pulks vorbeiraste.
Lynley zog es vor, sich Steve-o gegenüber nicht als Fan der Boadicea’s Broads zu erkennen zu geben. Es war purer Zufall gewesen, dass er und Denton unter den Fans von Electric Magic gelandet waren. Die Anhänger der Boadicea’s Broads saßen auf der gegenüberliegenden Seite des mit Klebeband markierten Rings. Auch sie wurden von Cheerleadern angefeuert, die ebenso wie ihre Kontrahentinnen ganz in Schwarz gekleidet waren, allerdings mit knallroten Accessoires. Sie schienen mehr Erfahrung im Geschäft zu haben, denn zur Untermalung ihrer Schlachtrufe warfen sie eindrucksvoll ihre Beine in die Luft und vollführten akrobatische Tanzfiguren.
Eigentlich mied Lynley derartige Veranstaltungen wie die Pest. Hätte sein Vater ihn begleitet – natürlich piekfein gekleidet, mit ein bisschen Hermelin oder Samt am Kragen, um keinen Zweifel an seiner gesellschaftlichen Position zu lassen –, er hätte nicht länger als fünf Minuten durchgehalten. Beim Anblick der Frauen auf Rollschuhen hätte er einen Herzinfarkt erlitten, und wenn er gehört hätte, wie Steve-o die englische Sprache malträtierte, wäre ihm das Blut in den Adern gefroren. Aber Lynleys Vater lag schon lange im Grab, und Lynley amüsierte sich derart köstlich, dass ihm vom vielen Grinsen schon die Wangen wehtaten.
Als er den Handzettel mit der Einladung zu dem Spiel vor ein paar Tagen zwischen seiner Post gefunden hatte, hätte er sich nicht träumen lassen, dass er in so kurzer Zeit so viel lernen würde. Er wusste mittlerweile, dass man die Jammerinnen der beiden Teams im Auge behalten musste, erkennbar an dem Stern auf dem Helm. Die Jammerin konnte als Einzige punkten, und die meisten Punkte wurden während eines Power Jams erzielt, wenn die Jammerin des gegnerischen Teams auf der Strafbank saß. Steve-o hatte ihm Sinn und Zweck des Packs begreiflich gemacht und was es bedeutete, wenn die Lead-Jammerin sich im vollen Lauf aufrichtete und mit den Händen auf die Hüften klopfte. Was es mit der Spielposition auf sich hatte, die Pivot genannt wurde – die jeweilige Spielerin war an dem gestreiften Helm zu erkennen –, erschloss sich ihm immer noch nicht ganz, aber es bestand kein Zweifel daran, dass es beim Roller Derby sowohl auf Strategie als auch auf Geschicklichkeit ankam.
Während des Spiels London gegen Bristol hatte er hauptsächlich Kickarse Electra beobachtet. Sie war eine durchsetzungsfähige Jammerin und fuhr ausgesprochen offensiv, als wäre sie auf Rollschuhen geboren. Das hätte er der stillen nachdenklichen Tierärztin, die er sieben Monate zuvor an der Küste von Cornwall kennengelernt hatte, nie zugetraut. Dass sie beim Dartspielen unschlagbar war, wusste er. Aber das hier? Das hätte er nie vermutet.
Einmal, während eines Power Jams, war sein Vergnügen an dem wilden Sport unterbrochen worden. Sein Handy hatte in seiner Brusttasche vibriert, und er hatte nachgesehen, wer ihn anrief. Zuerst dachte er, die Met würde ihn zum Dienst zurückbeordern, denn die Anruferin war seine Partnerin Detective Sergeant Barbara Havers. Aber sie rief von zu Hause aus an, es war also vielleicht doch nichts vorgefallen, um das er sich würde kümmern müssen.
Er hatte das Gespräch angenommen, bei dem infernalischen Lärm allerdings kein Wort von dem verstanden, was Havers sagte. Also hatte er nur in den Hörer geschrien, er würde sie so bald wie möglich zurückrufen, das Handy wieder eingesteckt und die Sache vergessen.
Zwanzig Minuten später gewann Electric Magic das Spiel. Die Teams gratulierten sich gegenseitig. Dann liefen alle durcheinander in der Halle herum, Rollschuhläuferinnen, Zuschauer, Cheerleader und Schiedsrichterinnen. Niemand schien es eilig zu haben zu gehen, was Lynley gerade recht war, denn er hatte vor, sich ebenfalls ein bisschen unters Volk zu mischen.
Er wandte sich an Denton. »Von jetzt an kein ›Sir‹ mehr.«
»Wie bitte?«, fragte Denton.
»Wir sind als Kumpel hier. Alte Schulfreunde. Das kriegen Sie doch hin, oder?«
»Wer, ich? Eton?«
»Der Rolle dürften Sie doch gewachsen sein, Charlie. Und nennen Sie mich entweder Thomas oder Tommy, suchen Sie sich’s aus.«
Dentons Augen weiteten sich. »Ich soll … Ich ersticke bestimmt schon bei dem Versuch.«
»Charlie, Sie sind doch Schauspieler, oder?«, sagte Lynley. »Die Rolle ist oscarverdächtig. Ich bin nicht Ihr Arbeitgeber, Sie sind nicht mein Angestellter. Wir werden uns jetzt gleich mit jemandem unterhalten, und Sie werden in der Rolle meines alten Freundes brillieren. Das nennt man …« Lynley suchte nach dem richtigen Wort. »… Improvisation.«
Charlies Miene hellte sich auf. »Darf ich mich richtig reinhängen?«
»Wenn’s sein muss. Gehen wir.«
Gemeinsam näherten sie sich Kickarse Electra. Sie unterhielt sich gerade mit einer Spielerin des Londoner Teams, Leaning Tower of Lisa, einer Amazone, die auf Rollschuhen mindestens eins neunzig groß war. Die Frau wäre überall aufgefallen, aber neben Kickarse Electra, die selbst auf Rollschuhen einen Kopf kleiner war, wirkte sie besonders beeindruckend.
Als Leaning Tower of Lisa die beiden Männer erblickte, rief sie aus: »Da kommen ja zwei richtige Leckerbissen! Ich nehme den Kleineren.« Sie rollte auf Denton zu, legte ihm einen Arm um die Schultern und drückte ihm einen Kuss auf die Schläfe. Denton lief puterrot an.
Daidre Trahair drehte sich um. Sie hatte ihren Helm abgenommen und sich ihre Schutzbrille auf den Kopf geschoben. Aus ihrem französischen Zopf hatten sich einige aschblonde Strähnen gelöst. Die Brille, die sie unter der Schutzbrille getragen hatte, war völlig verschmiert, was ihre Sicht jedoch nicht zu behindern schien, wie Lynley aus der Farbe schloss, die ihr Gesicht annahm, als sie ihn sah. Allerdings konnte er die Röte unter der bunten, glitzernden Kriegsbemalung, die sie ebenso wie ihre Teamkolleginnen dick aufgelegt hatte, nur gerade so erahnen.
»Mein Gott«, sagte sie.
»Man hat mich schon mit schlimmeren Namen bedacht.« Er hielt den Handzettel hoch. »Wir haben die Einladung angenommen. Großartig, übrigens. Hat uns gut gefallen.«
Leaning Tower of Lisa sagte: »Ist das euer erstes Mal?«
»Ja«, sagte Lynley. Dann wandte er sich wieder Daidre zu. »Sie haben mir gar nicht erzählt, was Sie für ein As sind. Wie ich sehe, brillieren Sie in dieser Disziplin ebenso wie beim Darts.«
Daidres Röte wurde noch intensiver. Leaning Tower of Lisa fragte sie: »Du kennst die Typen?«
»Ihn«, nuschelte Daidre. »Ihn kenne ich.«
Lynley streckte seine Hand aus. »Thomas Lynley«, stellte er sich vor. »Und der, dem Sie da Ihren Arm um die Schulter legen, ist mein Freund Charlie Denton.«
»Charlie, aha«, sagte Leaning Tower. »Der sieht ja zum Anbeißen aus. Bist du auch so nett, wie du aussiehst, Charlie?«
»Ich würde sagen, ja«, sagte Lynley.
»Und steht er auf kräftige Frauen?«
»Ich schätze, er nimmt sie, wie sie kommen.«
»Er ist nicht besonders gesprächig, was?«
»Sie wirken vielleicht etwas einschüchternd auf ihn.«
»Ach, es ist doch immer wieder dasselbe.« Leaning Tower ließ Denton lachend los und gab ihm noch einen Schmatzer auf die Schläfe. »Falls du’s dir anders überlegst, du weißt ja, wo du mich findest«, sagte sie zu ihm, dann gesellte sie sich zu ihren Mitspielerinnen.
Daidre Trahair hatte das kurze Gespräch offenbar genutzt, um ihre Fassung wiederzugewinnen. Sie sagte: »Sie sind wirklich der Allerletzte, den ich bei einem Roller-Derby-Bout erwarten würde, Thomas.« Dann streckte sie Denton ihre Hand entgegen. »Charlie, ich bin Daidre Trahair. Wie hat Ihnen das Spiel gefallen?« Die Frage war an beide Männer gerichtet.
»Ich hatte keine Ahnung, dass Frauen so gnadenlos sein können«, sagte Lynley.
»Denken Sie an Lady Macbeth«, sagte Denton.
»Hm. Stimmt auch wieder«, sagte Lynley.
Sein Handy vibrierte in seiner Tasche. Er nahm es heraus und warf einen Blick darauf. Es war wieder Barbara Havers. Er überließ den Anruf der Mailbox, während Daidre fragte: »Ruft die Arbeit?« Ehe er antworten konnte, fügte sie hinzu: »Sie sind doch wieder im Dienst, oder?«
»Ja«, sagte er, »aber heute Abend nicht. Heute Abend würden Charlie und ich Sie gern zu einem Gläschen … oder was auch immer einladen. Falls Ihnen der Sinn danach steht.«
»Oh.« Sie schaute sich zu den auf dem Track herumwuselnden Rollschuhläuferinnen um. »Eigentlich«, sagte sie, »gehen wir nach einem Spiel immer alle was zusammen trinken. Das gehört dazu. Würden Sie sich uns gern anschließen? Die Mädels da drüben …«, sie zeigte auf die Spielerinnen von Electric Magic, »gehen ins Famous Three Kings in der North End Road. Es wird ziemlich laut zugehen.«
»Ah«, sagte Lynley. »Ich – das heißt, wir – hatten eigentlich an etwas gedacht, wo man sich gepflegt unterhalten kann. Könnten Sie vielleicht ausnahmsweise mal von der Tradition abweichen?«
»Ich wünschte, ich könnte«, erwiderte sie bedauernd. »Aber wir sind mit dem Bus hier. Es wäre ziemlich kompliziert. Ich muss ja wieder nach Bristol zurück.«
»Heute Abend noch?«
»Äh, nein. Wir übernachten in einem Hotel.«
»Wir könnten Sie zu Ihrem Hotel bringen«, erbot er sich. Und als sie immer noch zögerte, fügte er hinzu: »Wir sind wirklich ganz harmlos, Charlie und ich.«
Daidre schaute erst Lynley, dann Denton, dann wieder Lynley an. Sie schob sich ein paar Strähnen aus dem Gesicht, die sich aus ihrem Zopf gelöst hatten. »Ich fürchte, ich habe nichts Richtiges … Na ja, normalerweise machen wir uns nicht ausgehfein nach einem Spiel.«
»Wir werden schon einen Ort finden, wo es nicht darauf ankommt, wie Sie gekleidet sind«, sagte Lynley. »Sagen Sie ja, Daidre«, fügte er leise hinzu.
Vielleicht lag es daran, dass er ihren Namen benutzt hatte. Vielleicht lag es an seinem veränderten Ton. Jedenfalls willigte sie nach kurzem Überlegen ein. Aber sie würde sich umziehen müssen, und vielleicht sollte sie auch besser ihre Kriegsbemalung entfernen?
»Mir gefällt die Kriegsbemalung durchaus«, sagte Lynley. »Was meinst du, Charlie?«
»Sie steht für eine klare Aussage«, bemerkte Denton.
Daidre lachte. »Sagen Sie mir lieber nicht, welche. Ich brauche nur ein paar Minuten. Wo finde ich Sie?«
»Vor dem Gebäude. Ich hole nur eben meinen Wagen.«
»Woran erkenne ich denn Ihren Wagen?«
»Sie werden ihn erkennen«, versicherte ihr Denton.
CHELSEALONDON
»Jetzt verstehe ich, was Ihr Freund gemeint hat«, sagte Daidre, als Lynley ausstieg. »Was ist das für ein Auto? Wie alt ist es?«
»Das ist ein Healey Elliott«, erklärte er ihr und hielt ihr die Tür auf. »Baujahr neunzehnhundertachtundvierzig.«
»Seine große Liebe«, bemerkte Denton vom Rücksitz aus, als Daidre einstieg. »Ich hoffe, dass er mir den Wagen mal vererbt.«
»Keine Chance«, sagte Lynley. »Ich habe vor, dich um Jahrzehnte zu überleben.« Er legte einen Gang ein und fuhr zur Ausfahrt des Parkplatzes.
»Woher kennen Sie beide sich?«, wollte Daidre wissen.
Lynley antwortete erst, nachdem er in die Brompton Road eingebogen war und sie am Friedhof vorbeifuhren. »Von der Schule her«, sagte er.
»Er war bei meinem älteren Bruder in der Klasse«, sagte Denton.
Daidre drehte sich kurz zu Denton um, dann schaute sie Lynley stirnrunzelnd an. »Ach so«, sagte sie, und Lynley hatte das Gefühl, dass sie mehr sah, als ihm lieb war.
Er sagte: »Er ist zehn Jahre älter.« Dann warf er Denton im Rückspiegel einen Blick zu. »Stimmt’s, Charlie?«
»In etwa«, sagte Denton. »Hör mal, Tom, würde es dir was ausmachen, wenn ich mich für heute verabschiede? Ich habe einen verteufelt langen Tag hinter mir, und wenn du mich am Sloane Square rauslässt, kann ich von dort zu Fuß nach Hause gehen. Ich muss morgen ganz früh in der Bank sein. Vorstandssitzung. Der Chef ist völlig aus dem Häuschen wegen einer chinesischen Übernahme. Wir wissen ja, wie das ist.«
Verteufelt?, sinnierte Lynley. Tom? Bank? Vorstandssitzung? Fehlte nur noch, dass Denton sich vorbeugte und ihm verschwörerisch zuzwinkerte. Er sagte: »Bist du dir wirklich ganz sicher, Charlie?«
»Absolut. Heute war ein langer Tag, und der morgige wird noch länger.« Zu Daidre sagte er: »Der schlimmste, anspruchsvollste Arbeitgeber, den man sich vorstellen kann. Er erwartet, dass man ständig auf Abruf ist.«
»Ah, verstehe«, sagte sie. »Und Sie, Thomas? Es ist ja schon spät, und wenn Sie lieber …«
»Ich würde gern noch ein Stündchen oder zwei mit Ihnen verbringen«, sagte er. »Also am Sloane Square, Charlie. Sicher, dass du zu Fuß gehen willst?«
»An so einem lauen Abend gibt’s doch nichts Schöneres«, erwiderte Denton. Dann sagte er nichts mehr – Gott sei Dank, dachte Lynley –, bis sie zum Sloane Square kamen. Dort rief er: »Also dann: hipp, hipp!«, worauf Lynley die Augen verdrehte, froh, dass Denton sich das Hurrah gespart hatte. Er würde ein Wörtchen mit ihm reden müssen. Sein Akzent war schon schlimm genug. Doch das Vokabular war wirklich grenzwertig.
»Ein lieber Kerl«, bemerkte Daidre, als sie Denton nachschaute, der den Platz überquerte und auf den Venusbrunnen zusteuerte. Von dort aus war es ein kurzer Spaziergang zu Lynleys Villa in Eaton Terrace. Denton schien regelrecht zu hüpfen. Offenbar, dachte Lynley, vor lauter Begeisterung über seine kleine Vorstellung.
»Als lieb würde ich ihn nicht unbedingt bezeichnen«, sagte Lynley. »Er wohnt bei mir. Ich habe ihm seinem Bruder zuliebe ein Zimmer vermietet.«
Vom Sloane Square aus war es nicht mehr weit zu ihrem Ziel, einer Weinstube am Wilbraham Place, drei Häuser entfernt von einer teuren Boutique an der Straßenecke. Der einzige freie Tisch stand gleich neben der Tür, was Lynley in Anbetracht der Kälte nicht besonders gefiel, aber daran ließ sich nichts ändern.
Sie bestellten Wein. Ob sie eine Kleinigkeit essen wolle, erkundigte Lynley sich bei Daidre. Sie verneinte. Er selbst hatte auch keinen Appetit. Nachos und Hot dogs, sagte er, hielten erstaunlich lange nach, das müsse er wirklich zugeben.
Sie lachte und befühlte den Stiel einer einzelnen Rose, die in einer Vase auf dem Tisch stand. Sie hatte Hände, wie man sie bei einer Ärztin erwarten würde, dachte er. Ihre Fingernägel waren sehr kurz geschnitten, und ihre Finger wirkten kräftig, nicht feingliedrig. Er konnte sich denken, wie sie ihre Hände beschreiben würde. Bauernhände würde sie sagen. Oder Zigeunerhände. Oder die Hände eines Goldwäschers. Aber nicht die Hände einer Aristokratin, die sie ja auch nicht war.
Plötzlich schien es, als wüssten sie nach all der Zeit, die vergangen war, seit sie sich das letzte Mal gesehen hatten, nicht, worüber sie reden sollten. Er schaute sie an. Sie schaute ihn an. Er sagte: »Tja«, und dachte, was für ein Idiot er war. Er hatte sie unbedingt wiedersehen wollen, und jetzt saß sie vor ihm, und das Einzige, was ihm zu sagen einfiel, war, dass er sich nie ganz sicher war, ob ihre Augen hellbraun, dunkelbraun oder grün waren. Seine eigenen Augen waren braun, sehr dunkelbraun, ein starker Kontrast zu seinem Haar, das im Sommer strohblond, aber jetzt, im Herbst, einen ganzen Tick dunkler war.
Sie lächelte ihn an und sagte: »Sie sehen richtig gut aus, Thomas. Ganz anders als an dem Abend, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind.«
Wie recht sie hatte, dachte er. Denn an jenem Abend war er bei ihr eingebrochen, dem einzigen Haus auf der Klippe bei Polcare Cove, von der ein achtzehnjähriger Kletterer in den Tod gestürzt war. Lynley war auf der Suche nach einem Telefon gewesen. Daidre war nach Cornwall gefahren, um sich ein paar Tage lang von ihrer anstrengenden Arbeit zu erholen. Er erinnerte sich an ihre Empörung, als sie ihn in ihrem Haus erwischt hatte. Und er erinnerte sich daran, wie schnell diese Empörung umgeschlagen war in Sorge um ihn. Sie hatte ihm nur ins Gesicht schauen müssen.
Er sagte: »Es geht mir auch gut. Natürlich gibt es gute und schlechte Tage, aber inzwischen mehr gute als schlechte.«
»Das freut mich«, sagte sie.
Wieder schwiegen sie eine Weile. Er hätte alles Mögliche sagen können. Zum Beispiel: »Und Sie, Daidre? Wie geht es Ihnen? Und Ihren Eltern?« Aber das konnte er nicht, denn sie hatte zwei Paar Eltern, und es wäre taktlos gewesen, das Thema anzuschneiden. Ihre Adoptiveltern hatte er nie kennengelernt. Ihre leiblichen Eltern dagegen schon – in ihrem alten Wohnwagen an einem Bach in Cornwall. Ihre Mutter war todkrank gewesen und hatte auf ein Wunder gehofft. Womöglich war sie inzwischen gestorben, aber er wollte lieber nicht nachfragen.
Plötzlich fragte sie: »Seit wann sind Sie eigentlich wieder zurück?«
»Im Dienst?«, sagte er. »Seit dem Sommer.«
»Und wie gefällt es Ihnen?«
»Anfangs war es schwierig«, sagte er. »Aber damit war zu rechnen.«
»Natürlich.«
Wegen Helen blieb unausgesprochen. Der Gedanke an seine Frau, die vor zwei Jahren Opfer eines Mordanschlags geworden war, war ihm unerträglich, über sie zu reden undenkbar. Ein Thema, an das Daidre nicht zu rühren wagte. Und er auch nicht.
Er sagte: »Und bei Ihnen?«
Sie zog die Brauen zusammen, wusste nicht, was er meinte. Dann sagte sie: »Ah! Meine Arbeit. Es läuft ganz gut. Zwei unserer Gorillaweibchen sind trächtig, aber das dritte nicht, da müssen wir aufpassen. Wir hoffen, dass es keine Probleme gibt.«
»Wäre denn normalerweise in so einer Situation mit Problemen zu rechnen?«
»Das dritte Weibchen hat kürzlich ein Junges verloren. Gedeihstörung. Das könnte zu Schwierigkeiten führen. Wir müssen abwarten.«
»Klingt traurig«, sagte er. »Gedeihstörung.«
»Ja.«
Wieder schwiegen sie. Schließlich sagte er: »Ihr Name stand auf dem Handzettel. Ihr Derbyname. Haben Sie vorher schon mal in London gespielt?«
»Ja«, sagte sie.
»Ah.« Er ließ den Wein im Glas kreisen. »Es hätte mich gefreut, wenn Sie mich angerufen hätten. Sie haben doch noch meine Karte, oder?«
»Ja, die hab ich noch«, sagte sie, »und ich hätte natürlich anrufen können. Aber … Ich hatte einfach das Gefühl …«
»Ich kann mir vorstellen, was Sie für ein Gefühl hatten«, sagte er. »Dasselbe wie damals, wage ich mal zu sagen.«
Sie schaute ihn an. »Leute wie ich sagen nicht ›wage ich zu sagen‹, verstehen Sie.«
»Ah«, sagte er.
Sie trank einen Schluck Wein. Dann betrachtete sie das Glas, anstatt ihn anzusehen. Er dachte, wie anders sie doch war, wie vollkommen anders als Helen. Daidre besaß weder Helens unbefangenen Humor noch ihre Unbekümmertheit. Und doch besaß sie etwas Unwiderstehliches. Vielleicht, dachte er, war es ihre Lebensgeschichte, die sie so lange geheim gehalten hatte.
Er sagte: »Daidre«, als sie gleichzeitig »Thomas« sagte.
Er ließ ihr den Vortritt. »Könnten Sie mich vielleicht zu meinem Hotel fahren?«, fragte sie.
BAYSWATERLONDON
Lynley war nicht dumm. Er wusste, dass es genau das hieß, nämlich, sie zu ihrem Hotel zu fahren. Das war ein Zug an Daidre Trahair, den er schätzte. Dass sie sagte, was sie meinte.
Sie dirigierte ihn zur Sussex Gardens, nördlich vom Hyde Park. In der verkehrsreichen Straße, die auch nachts stark befahren war, gab es zahlreiche Hotels, die nur durch ihre Namen auf den scheußlichen Leuchtreklamekästen zu unterscheiden waren, von denen London zunehmend verschandelt wurde. Sie warben für Hotels, die zwischen annehmbar und abscheulich rangierten, mit schmuddeligen weißen Gardinen an den Fenstern, schlecht beleuchteten Eingangsbereichen und angelaufenen Messingbeschlägen an den Türen. Als Lynley vor Daidres Hotel hielt, glaubte er zu wissen, an welchem Ende der Skala von annehmbar bis abscheulich es einzuordnen war.
Er räusperte sich.
Sie sagte: »Ich nehme an, es entspricht nicht ganz Ihren Ansprüchen. Aber ich habe ein Bett, und es ist ja auch nur für eine Nacht. Das Zimmer hat ein eigenes Bad, und die Kosten für das Team halten sich in Grenzen. Also … Sie wissen schon.«
Er schaute sie an. Das Licht einer Straßenlaterne in der Nähe seines Wagens ließ ihr Haar schimmern wie einen Heiligenschein, was ihn an Renaissancegemälde von Märtyrerinnen erinnerte. Es fehlte nur der Palmzweig in ihrer Hand. Er sagte: »Es widerstrebt mir, Sie hier aussteigen zu lassen, Daidre.«
»Es ist ein bisschen muffig, aber ich werd’s überleben. Glauben Sie mir, es ist viel besser als das letzte Hotel, in dem wir abgestiegen sind. Um Klassen besser.«
»Das meinte ich nicht«, sagte er. »Jedenfalls nicht nur.«
»Ich weiß.«
»Wann reisen Sie morgen früh ab?«
»Um halb neun. Aber wir schaffen es eigentlich nie, pünktlich loszufahren, weil alle total verkatert sind. Ich bin wahrscheinlich die Erste, die auf den Beinen ist.«
»Ich habe ein Gästezimmer«, sagte er. »Wollen Sie nicht da übernachten? Wir könnten zusammen frühstücken, und ich würde Sie pünktlich hier abliefern, damit Sie mit Ihren Teamkolleginnen nach Bristol fahren können.«
»Thomas …«
»Charlie macht übrigens Frühstück. Er ist ein ausgezeichneter Koch.«
Sie antwortete nicht gleich. Schließlich sagte sie: »Er ist Ihr Hausdiener, nicht wahr?«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Thomas …«
Er wandte sich ab. In einiger Entfernung stritt sich ein junges Paar auf dem Gehweg. Sie hatten Händchen gehalten, jetzt jedoch schüttelte die Frau die Hand des Mannes ab wie ein klebriges Bonbonpapier.
Daidre sagte: »Kein Mensch sagt mehr verteufelt. Wenn er nicht zufällig bei den Drei Musketieren mitspielt.«
Lynley seufzte. »Er übertreibt es manchmal ein bisschen.«
»Er ist also Ihr Hausdiener?«
»O nein, er ist absolut sein eigener Herr. Ich versuche seit Jahren, ihn davon abzubringen, aber er geht voll in der Rolle des Dieners auf. Ich glaube, er hält es für ein ausgesprochen gutes Training. Wahrscheinlich hat er sogar recht.«
»Er ist also kein Diener?«
»Gott, nein. Ich meine, ja und nein. Er ist Schauspieler, oder wäre es zumindest, wenn es nach ihm ginge. Bis sein Traum in Erfüllung geht, arbeitet er für mich. Ich habe kein Problem damit, wenn er zu Vorsprechterminen fährt, er hat kein Problem damit, wenn ich nicht zu einem Abendessen erscheine, an dem er den ganzen Nachmittag in der Küche gearbeitet hat.«
»Hört sich an, als würden Sie zusammenpassen wie Topf und Deckel.«
»Eher wie die Faust aufs Auge.« Lynley wandte den Blick von den sich streitenden jungen Leuten ab, die jetzt einander mit ihren Handys vor der Nase herumfuchtelten. Er schaute Daidre an. »Er wird also da sein, Daidre. Er wird den Anstandswauwau spielen. Und, wie gesagt, wir könnten beim Frühstück noch ein bisschen miteinander plaudern. Und auch während der Fahrt hierher. Natürlich könnte ich Ihnen auch ein Taxi bestellen, falls Sie das vorziehen.«
»Warum?«
»Ein Taxi?«
»Sie wissen schon, was ich meine.«
»Ich habe einfach das Gefühl … dass zwischen uns noch etwas offen ist. Oder noch nicht abgeschlossen. Oder einfach nur ungeklärt. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, was es ist, aber ich denke, Sie spüren es genauso wie ich.«
Sie schien darüber nachzudenken, und ihr Schweigen ließ Lynley Hoffnung schöpfen. Doch dann schüttelte sie langsam den Kopf und legte die Hand auf den Türgriff. »Lieber nicht«, sagte sie. »Außerdem …«
»Außerdem?«
»Ich bin nicht so, Thomas. Ich kann das nicht mal eben so locker.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Doch«, sagte sie. »Sie verstehen das schon.« Sie beugte sich zu ihm herüber und gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Aber ich möchte nicht lügen. Ich habe mich sehr gefreut, Sie wiederzusehen. Vielen Dank. Ich hoffe, das Spiel hat Ihnen gefallen.«
Ehe er antworten konnte, war sie schon ausgestiegen. Sie eilte ins Hotel. Sie drehte sich nicht noch einmal um.
BAYSWATERLONDON
Er saß immer noch vor dem Hotel in seinem Wagen, als sein Handy klingelte. Er spürte immer noch ihre Lippen an seiner Wange und die Wärme ihrer Hand auf seinem Arm. Er war so tief in Gedanken versunken gewesen, dass er beim Klingeln des Handys zusammenzuckte. Im selben Augenblick fiel ihm ein, dass er Barbara Havers nicht wie versprochen zurückgerufen hatte. Er warf einen Blick auf seine Uhr.
Ein Uhr. Das konnte nicht Barbara sein. Und wie Gedanken es so an sich haben, dachte Lynley in der Zeit, die er brauchte, um das Handy aus der Tasche zu holen, an seine Mutter, an seinen Bruder, an seine Schwester, und er dachte an nächtliche Notfälle, denn um diese Zeit rief niemand irgendjemanden an, nur um zu plaudern.
Als er das Handy endlich herausgefischt hatte, war er davon überzeugt, dass sich in Cornwall, wo sich sein Familiensitz befand, eine Katastrophe ereignet hatte, wahrscheinlich durch die Hand einer ihm unbekannten Bediensteten namens Mrs Danvers, die das Haus in Brand gesteckt hatte. Doch dann sah er, dass es Barbara war, die ihn anrief. Hastig sagte er ins Handy: »Barbara, es tut mir leid.«
»Verfluchter Mist«, schrie sie. »Warum rufen Sie mich nicht zurück? Ich sitze hier, und er ist allein da drinnen. Und ich weiß nicht, was ich tun soll oder was ich ihm sagen soll, denn das Schlimmste ist, dass kein Schwein ihm helfen kann, was ich von vornherein wusste. Aber ich hab ihn angelogen und ihm versprochen, dass wir irgendwas unternehmen würden, und jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben …«
»Barbara.« Sie klang vollkommen aufgelöst. Es musste etwas Schlimmes vorgefallen sein, denn es passte nicht zu ihr, so herumzustammeln. »Barbara. Beruhigen Sie sich. Was ist los?«
Es sprudelte nur so aus ihr heraus, ohne Sinn und Verstand. Sie sprach so schnell, dass Lynley kaum mitkam. Und ihre Stimme klang merkwürdig. Entweder hatte sie geweint – was ihm unwahrscheinlich erschien –, oder sie war betrunken. Letzteres jedoch war wenig plausibel in Anbetracht der Dringlichkeit dessen, was sie ihm berichtete. Aus den hervorstechendsten Details reimte Lynley sich Folgendes zusammen:
Die Tochter ihres Nachbarn und Freundes Taymullah Azhar war verschwunden. Als Azhar, Professor für Mikrobiologie am University College in London, nach Feierabend nach Hause kam, hatte er festgestellt, dass fast alle Habseligkeiten sowohl seiner Tochter als auch seiner Frau aus der Wohnung verschwunden waren – nur die Schuluniform seiner Tochter, ein Stofftier und ihr Laptop lagen noch auf ihrem Bett.
»Alles andere ist weg«, sagte Havers. »Als ich nach Hause kam, saß Azhar auf der Türschwelle. Mich hatte sie auch angerufen, also Angelina, irgendwann am frühen Nachmittag. Ich hatte eine Nachricht auf dem AB. Ob ich mich heute Abend um ihn kümmern könnte, wollte sie wissen. ›Hari wird sehr unglücklich sein‹, meinte sie. Das hat sie genau richtig gesehen. Nur dass er nicht unglücklich ist, er ist am Boden zerstört. Der ist fix und fertig, ich weiß gar nicht, was ich tun oder sagen soll, und Angelina hat sogar dafür gesorgt, dass Hadiyyah diese Giraffe dagelassen hat, und wir beide wissen auch ganz genau, warum. Die ist nämlich ein Andenken an einen Urlaub mit ihrem Vater. Die beiden waren am Meer, und Azhar hatte die Giraffe an einer Bude auf dem Vergnügungspier gewonnen. Und dann hat jemand versucht, sie ihr wegzunehmen …«
»Barbara«, sagte Lynley streng. »Barbara.«
Sie war völlig außer Atem. »Sir?«
»Ich bin schon unterwegs.«
CHALK FARMLONDON
Barbara Havers wohnte in Nordlondon nicht weit vom Camden Lock Market entfernt. Um ein Uhr nachts kam es nur darauf an, den Weg zu kennen, denn es herrschte so gut wie kein Verkehr. Aber um in Eton Villas einen Parkplatz zu finden, brauchte man viel Glück. Da mitten in der Nacht, wenn alle zu Hause in ihren Betten lagen, nicht einmal das Glück half, parkte Lynley kurzerhand in der Einfahrt.
Hinter einer gelben Edwardianischen Villa, die Ende des zwanzigsten Jahrhunderts in ein Mietshaus mit mehreren Wohnungen umgewandelt worden war, befand sich Barbaras Bleibe, ein Holzhäuschen, das früher einmal Gott weiß welchem Zweck gedient hatte. Es besaß einen kleinen offenen Kamin, was vermuten ließ, dass es zu Wohnzwecken errichtet worden war, allerdings war es offenbar nur für eine Person gedacht, und zwar für eine, die sehr wenig Platz brauchte.
Als er auf dem mit Steinplatten ausgelegten Weg um die Villa herumging, warf Lynley einen Blick in die Erdgeschosswohnung, wo Barbaras Freund Taymullah Azhar wohnte. Durch die Glastüren fiel helles Licht auf die Terrasse. Aus dem Telefongespräch hatte Lynley geschlossen, dass Barbara ihn von zu Hause aus angerufen hatte, und als er den Garten erreichte, sah er, dass auch in ihrem Häuschen noch Licht brannte.
Er klopfte leise an. Er hörte, wie ein Stuhl verrückt wurde. Dann wurde die Tür aufgerissen.
Auf den Anblick, der sich ihm bot, war er nicht vorbereitet. Er sagte: »Gütiger Himmel. Was haben Sie denn gemacht?«
Alte Trauerriten kamen ihm in den Sinn, bei denen Frauen sich das Haar abschnitten und sich Asche aufs Haupt streuten. Ersteres hatte sie getan, auf Letzteres jedoch hatte sie verzichtet. Dafür lag auf ihrem Küchentisch jede Menge Asche verstreut. Anscheinend saß sie schon seit Stunden da, und das Glasschälchen, das ihr als Aschenbecher diente, quoll von Kippen über.
Barbara sah aus wie ein emotionales Wrack. Sie stank wie ein kalter Kamin. Sie trug einen uralten, erbsengrünen Morgenmantel aus Chenille, und ihre nackten Füße steckten in ihren knallroten Turnschuhen.
»Ich hab ihn allein gelassen«, sagte sie. »Ich hab ihm versprochen zurückzukommen, aber ich bring’s einfach nicht über mich. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Ich dachte, wenn Sie hier wären … Warum haben Sie mich denn nicht zurückgerufen? Haben Sie nicht gemerkt … Verdammt noch mal, Sir, wo zum Teufel … Warum haben Sie nicht angerufen?«
»Es tut mir sehr leid«, sagte er. »Ich konnte Sie am Telefon nicht verstehen. Ich war … Spielt keine Rolle. Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
Lynley nahm ihren Arm und führte sie zurück an den Tisch. Er sammelte den überquellenden Aschenbecher, eine unangebrochene Packung Players und eine Schachtel Streichhölzer ein und legte alles auf die Anrichte. Dann setzte er Teewasser auf. Im Küchenschrank fand er Teebeutel und Süßstoff. Aus der mit schmutzigem Geschirr gefüllten Spüle förderte er zwei Henkeltassen zutage. Er spülte sie und trocknete sie ab. Dann öffnete er den kleinen Kühlschrank, der wie erwartet vollgestopft war mit Schachteln aus Schnellimbissketten und Fertiggerichten, aber es gab auch eine Tüte Milch, die er auf den Tisch stellte.
Währenddessen saß Barbara stumm am Tisch, was vollkommen untypisch für sie war. Seit er Barbara Havers kannte, war sie nie um einen Kommentar verlegen gewesen, ganz besonders in einer Situation wie dieser, als er nicht nur Tee zubereitete, sondern auch noch in Erwägung zog, ihr ein paar Scheiben Toastbrot zu servieren. Ihr Schweigen irritierte ihn.
Er stellte die Teekanne auf den Tisch. Stellte eine Henkeltasse vor Havers hin. Eine volle Tasse mit kaltem Tee, der längst mit einem Film überzogen war, räumte er weg.
Havers sagte: »Das war seine. Ich hab dasselbe gemacht. Wieso fällt uns eigentlich nie was Besseres ein, als Tee zu kochen?«
»Es ist eine Beschäftigung«, erwiderte Lynley.
»Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, mach Tee«, sagte sie. »Ich könnte einen Whisky gebrauchen. Oder einen Gin. Gin wär gut.«
»Haben Sie welchen?«
»Natürlich nicht. Ich will nicht so werden wie all die alten Damen, die ab fünf Uhr nachmittags Gin trinken, bis sie ins Koma fallen.«
»Sie sind keine alte Dame.«
»Noch nicht, aber bald.«
Lynley lächelte. Ihre selbstironische Bemerkung war schon ein kleiner Fortschritt. Er setzte sich zu ihr an den Tisch. »Schießen Sie los.«
Barbara erzählte ihm von einer Frau namens Angelina Upman, die anscheinend die Mutter von Azhars Tochter war. Lynley hatte sowohl Azhar als auch dessen Tochter kennengelernt, und er wusste, dass die Mutter des Kindes, bevor Barbara in ihr Häuschen eingezogen war, eine Zeitlang verschwunden gewesen war. Er wusste jedoch nicht, dass Angelina Upman im vergangenen Juli wieder bei Azhar und Hadiyyah aufgetaucht war, und er hatte erst recht keine Ahnung davon gehabt, dass Azhar und die Kindsmutter nicht verheiratet waren und Azhars Name in der Geburtsurkunde des Mädchens nicht erwähnt war.
Lynley bemühte sich, Barbaras Schilderungen zu folgen. Dass Azhar und Angelina Upman nicht geheiratet hatten, war keineswegs dem Zeitgeist geschuldet. Azhar hatte seine Ehefrau wegen Angelina verlassen, und die hatte sich geweigert, in eine Scheidung einzuwilligen. Mit seiner Ehefrau hatte Azhar bereits zwei Kinder. Wo die alle wohnten, wusste Barbara nicht.
Sie wusste allerdings, dass Angelina Azhar und Hadiyyah vorgegaukelt hatte, sie sei zurückgekehrt, um ihren rechtmäßigen Platz in deren Leben wieder einzunehmen. Sie habe das Vertrauen von Azhar und Hadiyyah gewinnen müssen, um ihre Pläne zu schmieden und schließlich in die Tat umzusetzen.
»Deswegen ist sie zurückgekommen«, sagte Barbara. »Um sich das Vertrauen von uns allen zu erschleichen. Auch meins. Ich bin schon immer ’ne Hohlbirne gewesen. Aber diesmal … hab ich mich selbst übertroffen.«
»Warum haben Sie mir nie von alldem erzählt?«, wollte Lynley wissen.
»Wovon genau?«, fragte Havers. »Denn dass ich ’ne Hohlbirne bin, wissen Sie ja bereits.«
»Von Angelina«, sagte er. »Von Azhars Ehefrau und den anderen Kindern, von der Scheidung oder vielmehr von der nicht erfolgten Scheidung. Von allem, was damit zu tun hat. Warum haben Sie mir das nie erzählt? Denn das alles hat Sie doch bestimmt zutiefst …« Er brach ab. Barbara hatte noch nie über ihre Gefühle für Azhar oder für dessen kleine Tochter gesprochen, und Lynley hatte sich auch nie danach erkundigt. Aus Höflichkeit, wie er fand, aber jetzt musste er sich eingestehen, dass es schlichtweg so am einfachsten gewesen war.
»Tut mir leid«, sagte er.
»Tja. Sie waren halt ziemlich beschäftigt. Sie wissen ja.«
Er wusste, dass sie auf seine Affäre mit ihrer beider Chefin bei der Met anspielte. Er hatte sich sehr diskret verhalten. Isabelle ebenfalls. Aber Barbara war nicht dumm, sie war nicht von gestern, und sie bekam alles mit.
Er sagte: »Ja. Nun, das ist vorbei, Barbara.«
»Ich weiß.«
»Hm. Ja. Das dachte ich mir.«
Havers drehte mit beiden Händen ihre Teetasse, die eine Karikatur von Camilla zierte, mit Betonfrisur und breitem Grinsen. Unbewusst bedeckte sie die Karikatur mit einer Hand, als täte die Duchess of Cornwall ihr leid. Sie sagte: »Ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte, Sir. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, hockte er vor meiner Tür. Ich glaub, er hatte da schon seit Stunden gesessen. Nachdem er mir erzählt hatte, was passiert war, hab ich ihn in seine Wohnung gebracht und mich umgesehen, und ich schwöre Ihnen, als mir klar wurde, dass sie alles mitgenommen hatte, wusste ich einfach nicht, was ich tun sollte.«
Lynley dachte über die Situation nach. Sie war mehr als kompliziert, und das wusste auch Barbara. Deswegen war sie so paralysiert. Er sagte: »Gehen wir zu ihm, Barbara. Ziehen Sie sich an, dann gehen wir rüber.«
Sie nickte. Sie kramte ein paar Sachen aus ihrem Kleiderschrank und hielt sie sich vor die Brust. Auf dem Weg zum Bad drehte sie sich zu ihm um und sagte: »Danke, dass Sie keinen Kommentar zu meinen Haaren gemacht haben, Sir.«
Lynley betrachtete ihren kurzgeschorenen Kopf. »Ah ja«, sagte er. »Ziehen Sie sich an.«
CHALK FARMLONDON
Jetzt wo Lynley da war, ging es Barbara Havers schon wesentlich besser. Eigentlich hätte sie in der Lage sein müssen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, aber Azhars Kummer war zu viel für sie gewesen. Azhar war ein verschlossener Mann, und in den knapp zwei Jahren, die sie ihn kannte, hatte sie ihn nie anders erlebt. In der Tat hatte er sich so wenig in die Karten sehen lassen, dass sie sich manchmal gefragt hatte, ob er überhaupt welche hatte. Ihn jetzt so am Boden zerstört zu erleben machte Barbara fix und fertig.
Wie die meisten hatte auch sie bei Angelina Upman nur das gesehen, was sie sehen wollte, und alle Warnsignale ignoriert. Derweil hatte Angelina Azhar wieder in ihr Bett gelockt. Sie hatte ihre Tochter dazu verführt, sie abgöttisch zu lieben. Sie hatte Barbara dazu verführt, über alles, was mit Angelina selbst zu tun hatte, bereitwillig Stillschweigen zu wahren, und sie damit zur unwissentlichen Komplizin gemacht. Und dass Angelina jetzt mitsamt ihrer Tochter verschwunden war, war das Ergebnis.
Barbara zog sich an. Sie schaute in den Spiegel. Sie sah furchtbar aus. Vor allem ihr Kopf. Keine Spur mehr von dem teuren Haarschnitt, den sie sich erst kürzlich gegönnt hatte, nur kahle Stellen und unkrautartige Büschel. Das katastrophale Ergebnis dieser Selbstverstümmelung würde sich nur beheben lassen, indem sie sich den Kopf kahl rasierte, aber dazu hatte sie jetzt leider keine Zeit. Sie ging zurück ins Wohnzimmer und wühlte in ihrer Kommode, bis sie eine Skimütze fand. Die setzte sie auf, und dann machte sie sich zusammen mit Lynley auf den Weg zum Vorderhaus.
In Azhars Wohnung hatte sich nichts verändert. Nur dass Azhar, anstatt reglos dazusitzen und ins Leere zu stieren, jetzt ziellos hin und her lief. Als er sie hohläugig anschaute, sagte Barbara: »Azhar, ich habe DI Lynley von der Met mitgebracht.«
Azhar kam gerade aus Hadiyyahs Zimmer, die Stoffgiraffe an die Brust gedrückt. Er sagte zu Lynley: »Sie hat sie mitgenommen.«
»Barbara hat mir alles erzählt.«
»Man kann nichts tun.«
»Man kann immer irgendwas tun, Azhar«, sagte Barbara. »Wir werden sie finden.«
Sie spürte, wie Lynley ihr einen Blick zuwarf, der ihr sagte, dass sie Versprechungen machte, die weder er noch sie würde halten können. Aber Barbara sah das anders. Wenn sie diesem Mann nicht helfen konnten, dachte sie, welchen Sinn hatte es dann noch, Polizist zu sein?
Lynley sagte: »Dürfen wir uns setzen?«
Ja, ja, selbstverständlich, sagte Azhar, und sie gingen ins Wohnzimmer, das Angelina erst kürzlich renoviert hatte. Jetzt fiel Barbara auf, was ihr gleich hätte auffallen müssen, als Angelina ihr stolz das Ergebnis ihrer Anstrengungen vorgeführt hatte: Es sah aus wie aus einer eleganten Wohnzeitschrift – alles passte perfekt zusammen, wirkte jedoch unpersönlich und seelenlos.
Sie nahmen Platz. »Nachdem Sie weg waren, habe ich bei ihren Eltern angerufen«, sagte Azhar.
»Wo wohnen die denn?«, fragte Barbara.
»In Dulwich. Natürlich wollten sie nicht mit mir reden. Ich habe das Leben einer ihrer beiden Töchter ruiniert. Sie wollen nichts mit einem ›Dreckskerl‹ wie mir zu tun haben.«
»Nette Leute«, bemerkte Barbara.
»Sie wissen nichts«, sagte Azhar.
»Sind Sie sich da ganz sicher?«, fragte Lynley.
»Nach dem zu urteilen, was sie gesagt haben, und wie ich sie kenne, bin ich mir sicher. Sie wissen nichts über Angelina. Mehr noch, sie wollen nichts wissen. Sie haben gesagt, sie hat sich die Suppe vor zehn Jahren selbst eingebrockt, und wenn sie ihr jetzt nicht schmeckt, können sie nichts daran ändern.«
»Sie haben noch eine andere Tochter?«, sagte Lynley, und als Azhar ihn verwirrt anschaute und Barbara fragte: »Was?«, fügte er hinzu: »Sie sagten eben, Sie hätten das Leben einer der beiden Töchter dieser Leute ruiniert. Kennen Sie die Schwester? Und könnte Angelina sich vielleicht bei ihr aufhalten?«
»Ich weiß nur, dass sie Bathsheba heißt«, sagte Azhar. »Ich bin ihr nie begegnet.«
»Könnten Angelina und Hadiyyah bei ihr sein?«
»Soweit ich weiß, sind die beiden verfeindet«, sagte Azhar. »Ich bezweifle es also.«
»Hat Angelina Ihnen das mit der Feindschaft erzählt?«, fragte Barbara scharf. Lynley und Azhar wussten beide, worauf ihre Frage abzielte.
»Wenn ein Mensch verzweifelt ist«, sagte Lynley, »wenn jemand so etwas plant – und diese Sache muss sehr gut geplant gewesen sein, Azhar –, kommt es oft vor, dass alte Feindschaften begraben werden. Haben Sie bei der Schwester angerufen? Haben Sie ihre Telefonnummer?«
»Ich kenne nur ihren Namen. Bathsheba Ward. Mehr nicht. Tut mir leid.«
»Kein Problem«, sagte Barbara. »Damit können wir schon mal was anfangen. Das ist eine Spur, die wir …«
»Barbara, Sie sind sehr liebenswürdig«, fiel Azhar ihr ins Wort. »Und Sie ebenfalls«, sagte er zu Lynley. »Dass Sie mitten in der Nacht hierhergekommen sind … Aber ich bin mir der Aussichtslosigkeit meiner Situation bewusst.«
»Ich habe Ihnen gesagt, dass wir sie finden«, sagte Barbara aufgebracht. »Und das werden wir auch.«
Azhar schaute sie mit seinen ruhigen, dunklen Augen an. Dann wandte er sich Lynley zu. An seinem Gesichtsausdruck ließ sich ablesen, dass ihm etwas klar war, was Barbara nicht zugeben und womit sie ihn auf keinen Fall konfrontieren wollte.
Lynley sagte: »Barbara hat mir erklärt, dass Sie und Angelina nicht geschieden sind.«
»Da wir nie geheiratet haben, kann es auch keine Scheidung geben. Und da ich von meiner ersten Frau nie geschieden wurde, hat Angelina mich nicht als Hadiyyahs Vater angegeben. Was natürlich ihr gutes Recht war. Ich habe das akzeptiert als Konsequenz dafür, dass ich mich von Nafeeza nie habe scheiden lassen.«
»Wo wohnt Nafeeza?«, fragte Lynley.
»In Ilford. Nafeeza und die Kinder wohnen bei meinen Eltern.«
»Könnte es sein, dass Angelina dorthin gefahren ist?«
»Sie weiß nicht, wo sie wohnen, sie kennt ihre Namen nicht. Sie weiß nichts über sie.«
»Könnten sie denn hierhergekommen sein? Könnte es sein, dass sie sie ausfindig gemacht haben? Dass sie sie von hier fortgelockt haben?«
»Zu welchem Zweck?«
»Um ihr zu schaden, zum Beispiel.«
Das war ein Gedanke, den Barbara gar nicht so abwegig fand. Sie sagte: »Das wäre durchaus möglich, Azhar. Es ist doch denkbar, dass die beiden entführt wurden. Dass hier was ganz anderes passiert ist. Vielleicht sind sie gekommen, um sich Angelina zu schnappen, und haben Hadiyyah gleich mitgenommen. Dann haben sie alles eingepackt und Angelina gezwungen, bei mir anzurufen. Wär doch möglich.«
»Klang sie wie jemand, der unter starkem Stress steht?«, wollte Lynley von Barbara wissen.
Natürlich nicht, dachte Barbara. Sie hatte so geklungen wie immer, nämlich ausnehmend höflich und zuvorkommend. »Sie könnte sich ja verstellt haben«, sagte sie, obwohl sie selbst hörte, wie verzweifelt das rüberkam.
»Ich weiß nicht«, sagte Azhar. »Wenn man sie gezwungen hätte, diesen Anruf zu tätigen, wenn sie entführt worden wäre – zusammen mit Hadiyyah –, hätte sie bei ihrem Anruf irgendetwas durchblicken lassen. Sie hätte Ihnen ein Zeichen gegeben. Aber das hat sie nicht getan. Sie hat ganz bestimmte Dinge zurückgelassen – Hadiyyahs Schuluniform, ihren Laptop, die kleine Giraffe. Das heißt doch, dass die beiden nicht zurückkommen.« Seine Augen waren feucht geworden.
Barbara fuhr zu Lynley herum. Er war der mitfühlendste Polizist der gesamten Metropolitan Police, vielleicht sogar der mitfühlendste Mann, dem sie je begegnet war. Doch sie sah ihm an, was in ihm vorging. Trotz des tiefen Mitgefühls, das er für Azhar empfand, wusste er, wie die Realität aussah, mit der sie konfrontiert waren.
»Sir«, sagte sie. »Sir.«
Er sagte: »Wir können natürlich bei Angelinas Verwandten anrufen. Aber abgesehen davon … Sie ist die Mutter des Kindes, Barbara. Sie hat nichts verbrochen. Es gibt kein Scheidungsurteil und keine Sorgerechtsregelung, wogegen sie verstößt.«
»Was ist mit einem Privatdetektiv?«, entgegnete Barbara. »Wir können vielleicht nichts tun, aber ein privater Ermittler schon.«
»Wo finde ich denn so jemanden?«, fragte Azhar.
»Ich kann das übernehmen«, erklärte Barbara.
16. November
________________________
VICTORIALONDON
»Auf gar keinen Fall«, lautete Isabelle Arderys Antwort auf Barbaras Bitte um ein paar Tage Urlaub. Als Nächstes verlangte sie eine Erklärung für Barbaras Kopfbedeckung, bei der es sich um eine gestrickte Pudelmütze handelte. Die Mütze war ein modischer Fauxpas und für eine Polizistin ein Ding der Unmöglichkeit. Die schicke Frisur, die vor dem Kahlschlag ihr Haupt geziert hatte, hatte sie sich auf dringendes Anraten – besser gesagt, auf Befehl – ihrer Chefin hin zugelegt, weswegen Isabelle Ardery jetzt einen Fall von offenem Ungehorsam witterte.
»Nehmen Sie die Mütze ab«, sagte Ardery.
»Was die Urlaubstage betrifft, Chefin …«
»Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie gerade erst Urlaub hatten?«, fauchte Ardery. »Wie viele Tage lang haben Sie sich von Inspector Lynley herumkommandieren lassen, als er seinen kleinen Ausflug nach Cumbria gemacht hat?«
Das konnte Barbara nicht leugnen. Sie hatte Lynley tatsächlich bei einer privaten Ermittlung unterstützt. Assistant Commissioner Sir David Hillier hatte ihn in geheimer Mission in die Nähe von Lake Windermere geschickt, und Ardery hatte Wind davon bekommen, dass er Barbara um Hilfe gebeten hatte. Sie war nicht gerade begeistert gewesen. Folglich fand sie die Vorstellung, dass Detective Sergeant Havers erneut außerplanmäßige Ermittlungen anstellte, etwa so reizvoll wie einen Wiener Walzer mit einem Stachelschwein.
»Nehmen Sie die Mütze ab«, wiederholte Ardery. »Auf der Stelle.«
Barbara wusste, dass das nur zu noch mehr Stress führen würde. Sie sagte: »Chefin, es handelt sich um einen Notfall. Etwas Persönliches. Eine Familienangelegenheit.«
»Und welchen Teil Ihrer Familie betrifft das? Soweit ich informiert bin, haben Sie eine einzige nahe Verwandte, Sergeant, und die wohnt in einem Pflegeheim in Greenford. Sie wollen doch nicht im Ernst behaupten, dass Sie für Ihre Mutter polizeiliche Ermittlungen durchführen sollen, oder?«
»Das ist kein Pflegeheim, sondern ein privates Seniorenheim.«
»Gibt es dort Pflegepersonal? Braucht sie Pflege?«
»Selbstverständlich gibt es dort Pflegepersonal, und selbstverständlich braucht sie Pflege«, erwiderte Barbara. »Aber das wissen Sie ja.«
»Um was für eine Art polizeiliche Ermittlung hat Ihre Mutter Sie denn nun gebeten?«
»Also gut«, sagte Barbara. »Es geht nicht um meine Mutter.«
»Sagten Sie nicht, es handle sich um eine Familienangelegenheit?«
»Okay, das stimmt nicht ganz. Es geht um einen Freund, der in großen Schwierigkeiten steckt.«
»Da hat er ja etwas mit Ihnen gemeinsam. Muss ich Sie noch einmal auffordern, diese lächerliche Mütze abzunehmen?«
Es führte kein Weg daran vorbei. Barbara zog sich die Mütze vom Kopf.
Ardery starrte sie an. Sie hob eine Hand, wie um eine apokalyptische Vision abzuwehren. »Was«, sagte sie gepresst, »hat das zu bedeuten? Ist etwa jemandem die Schere ausgerutscht? Oder handelt es sich eher um eine unausgesprochene Botschaft an Ihren Vorgesetzten, in dem Fall also an mich?«
»Nichts würde mir ferner liegen, Chefin«, entgegnete Barbara. »Und es ist nicht der Grund, warum ich mit Ihnen reden möchte.«
»Das ist mir klar. Aber ich möchte mit Ihnen darüber reden. Und wie ich sehe, kleiden wir uns auch wieder wie eh und je. Ich frage Sie noch einmal: Was wollen Sie mir mit diesem Aufzug sagen, Sergeant? Denn meine Interpretation lautet, dass es etwas mit Ihrer Zukunft als Verkehrspolizistin auf den ShetlandInseln zu tun hat.«
»Sie wissen genau, dass Sie mir nicht vorschreiben können, welche Frisur ich trage und wie ich mich anzuziehen habe«, erwiderte Barbara. »Was interessiert Sie das alles überhaupt, solange ich meine Arbeit ordentlich mache?«
»Genau das ist der springende Punkt«, konterte Ardery. »Wenn Sie Ihre Arbeit ordentlich machen. Was man in letzter Zeit weiß Gott nicht behaupten kann. Und was Sie ja offenbar auch in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar Wochen nicht vorhaben. Derweil Sie, wie ich annehme, allerdings Ihr Gehalt beziehen wollen, um das private Seniorenheim zu bezahlen, in dem Sie Ihre Mutter untergebracht haben. Was genau also wollen Sie, Sergeant? Bei der Met angestellt bleiben und ein regelmäßiges Gehalt beziehen, oder einem nichtexistenten Verwandten zuliebe auf Schnitzeljagd gehen wegen eines Problems, über dessen Natur Sie sich bisher auf bemerkenswerte Weise ausgeschwiegen haben?«
Sie saßen einander an Arderys Schreibtisch gegenüber. Durch die Tür zum Korridor drangen Geräusche herein. Kollegen gingen vorbei und unterhielten sich. Hin und wieder wurde es still, woraus Barbara schloss, dass man ihren Streit mit Superintendent Ardery bis nach draußen hörte. Nachschub für die Gerüchteküche, dachte sie. DS Havers kriegt mal wieder ihr Fett weg.
Sie sagte: »Hören Sie, Chefin. Ein Freund von mir sucht seine Tochter. Das Kind wurde von seiner Mutter abgeholt und …«
»Das Mädchen befindet sich also nicht direkt in Gefahr, oder? Und wenn die Mutter, indem sie ihre Tochter mitgenommen hat, gegen einen Gerichtsbeschluss verstößt, dann kann Ihr Freund ja seinen Anwalt oder das nächste Polizeirevier oder was weiß ich wen um Hilfe bitten, denn es ist nicht Ihre Aufgabe, in der Gegend herumzufahren und Menschen in Not beizustehen, es sei denn, Ihr Vorgesetzter erteilt Ihnen den Auftrag dazu. Habe ich mich klar genug ausgedrückt, Sergeant Havers?«
Barbara schwieg. Innerlich kochte sie vor Wut. Am liebsten hätte sie geschrien: »Bist du vom wilden Affen gebissen, du blöde Kuh!«, aber sie wusste, wo sie mit so einer Bemerkung landen würde. Dagegen wären die Shetland-Inseln das reinste Paradies. Zögernd sagte sie: »Ja, haben Sie.«
»Schön«, sagte Ardery. »Dann gehen Sie jetzt an die Arbeit. Und die besteht in einer Sitzung mit der Staatsanwaltschaft. Reden Sie mit Dorothea. Sie hat den Termin vereinbart.«
VICTORIALONDON
Dorothea Harriman war nicht nur die Sekretärin der Abteilung, sondern auch das modische Vorbild, an dem Barbara sich orientieren sollte. Aber Barbara hatte noch nie verstanden, wie Dee Harriman es schaffte, bei ihrem mageren Gehalt immer wie aus dem Ei gepellt auszusehen. Dee hatte ihr mehr als einmal erklärt, es komme nur darauf an, seine Farben zu kennen – was auch immer das bedeutete – und ein Händchen für die richtigen Accessoires zu haben. Außerdem schade es nicht, sich über die besten Outlet-Läden auf dem Laufenden zu halten. Das ist kinderleicht, Detective Sergeant Havers. Wirklich. Ich bring’s Ihnen bei, wenn Sie wollen.
Barbara wollte nicht. Sie vermutete, dass Dee Harriman jede freie Minute damit zubrachte, die Straßen Londons auf der Suche nach Klamotten abzuklappern. Wer zum Teufel wünschte sich so ein Leben?
Als Barbara auf dem Weg zu Isabelle Ardery Dorotheas Zimmer durchquert hatte, war diese so taktvoll gewesen, nichts zu der Pudelmütze zu sagen. Sie war ganz entzückt gewesen von der modischen Frisur, die einer der Starfrisöre von Knightsbridge Barbara vor einiger Zeit verpasst hatte. Aber nach einem entgeisterten »Detective Sergeant Havers!« hatte ein Blick von Barbara genügt, um sie verstummen zu lassen.
Zwischenzeitlich hatte Dorothea sich wohl irgendwie mit Barbaras Erscheinung abgefunden. Zweifellos hatte sie den Streit im Chefzimmer mitgehört und hielt die Informationen, von denen Ardery gesprochen hatte, schon bereit.
Sie reichte Barbara einen Zettel mit einer Telefonnummer. Diese Nummer solle sie anrufen, erklärte sie ihr. Der Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, mit dem sie zu tun gehabt habe, als sie sich abgesetzt habe, um Detective Inspector Lynley oben in Cumbria zu helfen …? Er warte bereits auf sie. Es gehe um die Zeugenaussagen, die abgeglichen werden müssten. Sie erinnere sich doch sicherlich?
Barbara nickte. Natürlich erinnerte sie sich. Der Mann war Staatsanwalt mit Büro im Justizpalast Middle Temple. Sie werde den Mann anrufen, sagte sie, und sich unverzüglich an die Arbeit machen.
»Tut mir leid«, sagte Harriman mit einer Kopfbewegung zu Arderys Tür. »Sie ist heute nicht gut drauf. Ich weiß auch nicht, warum.«
Barbara kannte den Grund. Weiß der Kuckuck, wie oft Isabelle Ardery und Thomas Lynley sich zu einem Schäferstündchen getroffen hatten. Jetzt, wo es damit vorbei war, würden sie sich im Yard alle warm anziehen müssen.
Sie ging zu ihrem Schreibtisch und ließ sich auf den Stuhl fallen. Sie betrachtete die Telefonnummer, die Harriman ihr gegeben hatte. Just in dem Moment, als sie die Nummer eintippen wollte, hörte sie, wie über ihr jemand ihren Namen sagte, ein simples »Barb«. Sie schaute hoch und direkt ins Gesicht ihres Kollegen Detective Sergeant Winston Nkata. Er betastete gerade die Narbe an seiner Wange, ein Andenken an seine Jugend als Gangmitglied in den Straßen von Brixton. Wie immer war er tadellos gekleidet. Als würde er nur in Begleitung von Dee Harriman einkaufen gehen. Barbara fragte sich, ob er alle halbe Stunde in irgendeinem Hinterzimmer verschwand, um sein Hemd heimlich aufzubügeln. Nicht eine einzige Falte, keine schief sitzende Naht.
»Ich hab gefragt.« Seine Stimme war weich, sein Akzent eine Mischung aus seinen karibischen und afrikanischen Wurzeln.
»Was?«
»DI Lynley. Er hat mir erzählt … was … dein neuer Stil. Du weißt schon, was ich meine. Mir ist das eigentlich egal, aber ich dachte mir, dass irgendwas passiert sein musste, also hab ich ihn gefragt. Außerdem« – er machte eine Kopfbewegung in Richtung Arderys Zimmer – »war das nicht zu überhören.«
»Ah. Okay.« Er redete offenbar von ihrem Haar. Tja, das würden alle tun, entweder offen oder hinter ihrem Rücken. Zumindest war Winston wie immer so anständig, sie direkt darauf anzusprechen.
»Der Inspector hat mir erzählt, was los ist«, sagte er. »Mit Hadiyyah und ihrer Mutter. Ich weiß, dass sie … was sie dir bedeutet, Barb. Ich hatte mir schon gedacht, dass die Chefin dir keinen Urlaub geben würde, also …« Er legte ein Blatt eines Abreißkalenders auf ihren Schreibtisch und schob es ihr zu. Es stammte von einem dieser Schreibtischkalender mit irgendeinem Sinnspruch für jeden Tag. Auf dem Blatt stand: »Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, unterbreite Ihr deine Pläne.« Der Spruch, dachte Barbara, passte perfekt zu der Situation. Unter dem Spruch stand in Winstons gestochen sauberer Handschrift ein Name. Dwayne Doughty, samt Anschrift in der Roman Road im Stadtteil Bow. Sie schaute Winston an. »Ein Privatdetektiv«, sagte er.
»Wo hast du denn den so schnell aufgetrieben?«
»Wo man alles findet: im Internet. Auf seiner Homepage gibt es eine Seite mit Kommentaren von zufriedenen Kunden. Die kann er natürlich selbst da reingeschrieben haben, aber ich würde sagen, es lohnt sich vielleicht, dir das mal anzusehen.«
»Du hast gewusst, dass sie mich zum Innendienst verdonnern würde, was?«, sagte Barbara mit zusammengekniffenen Augen.
»Hab’s zumindest geahnt«, sagte Winston. Auch diesmal verkniff er sich netterweise jeden Kommentar zu Barbaras Äußerem.
19. November
________________________
BOWLONDON
An den folgenden beiden Tagen konzentrierte Barbara Havers sich voll und ganz darauf, bloß nicht in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Das bedeutete Stunden tödlicher Langeweile mit dem Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, die nur einmal unterbrochen wurde, als ihr Gegenüber sie zum Mittagessen im eindrucksvollen Speisesaal von Middle Temple einlud. Sie hätte das Essen vielleicht genießen können, wenn der Typ nicht angefangen hätte, den Fall bis ins kleinste Detail mit ihr zu diskutieren, aber sie machte gute Miene zum bösen Spiel und bemühte sich sogar, ein bisschen Humor in das Gespräch einfließen zu lassen, das ihr in Wirklichkeit nur auf die Nerven ging. So einen Job hasste sie wie die Pest, und sie vermutete, dass Superintendent Ardery ihr diese Aufgabe absichtlich aufs Auge gedrückt hatte, um sie für das zu bestrafen, was sie sich angetan hatte.
Ihr war nichts anderes übrig geblieben, als sich den Schädel kahl zu rasieren. Mit den winzigen Stoppeln, die jetzt nachwuchsen, sah sie aus wie irgendetwas zwischen einem Skinhead und einer Boxerin. Sie verbarg ihre »Frisur« unter wechselnden Wollmützen, von denen sie sich auf dem Berwick Street Market einen Vorrat zugelegt hatte.
Derzeit gab es zwei Fälle, an denen sie hätte mitarbeiten können, wenn es Ardery denn in den Kram gepasst hätte. Eine Ermittlung wurde von DI Philip Hale geleitet, die andere von DI Lynley. Aber Barbara wusste, dass ihr, bis Isabelle Ardery zu dem Schluss gelangte, dass sie für ihre Sünden genug Buße getan hatte, nichts anderes übrig blieb, als sich mit dem Kerl von der Staatsanwaltschaft herumzuschlagen.
Zwei Tage nach Barbaras Streit mit Ardery war die Arbeit am frühen Nachmittag erledigt. Barbara witterte ihre Chance und ergriff sie beim Schopf. Sie rief Azhar am University College an und teilte ihm mit, dass sie ihn aufsuchen würde. Wo sind Sie?, fragte sie ihn. Bei einer Besprechung mit vier Examenskandidaten im Labor, erwiderte er. Bleiben Sie, wo Sie sind, sagte sie, ich komme. Ich habe etwas herausgefunden.
Das Labor war leicht zu finden. Lauter Leute in weißen Kitteln, überall Computer, Dunstabzugshauben und Warnungen vor Biogefährdung, eindrucksvolle Mikroskope, Petrischalen, Schachteln mit Objektträgern, Glasvitrinen, Kühlschränke sowie alle möglichen rätselhaften Apparaturen und Gegenstände. Als Barbara eintrat, stellte Taymullah Azhar sie höflich seinen Studenten vor. Ihre Namen hatte sie schon wieder vergessen, kaum dass er sie ausgesprochen hatte, und das lag vor allem an Azhar.