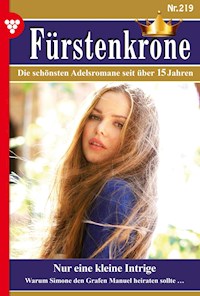
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürstenkrone
- Sprache: Deutsch
In der völlig neuen Romanreihe "Fürstenkrone" kommt wirklich jeder auf seine Kosten, sowohl die Leserin der Adelsgeschichten als auch jene, die eigentlich die herzerwärmenden Mami-Storys bevorzugt. Romane aus dem Hochadel, die die Herzen der Leserinnen höherschlagen lassen. Wer möchte nicht wissen, welche geheimen Wünsche die Adelswelt bewegen? Die Leserschaft ist fasziniert und genießt "diese" Wirklichkeit. "Fürstenkrone" ist vom heutigen Romanmarkt nicht mehr wegzudenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fürstenkrone – 219 –Nur eine kleine Intrige
Warum Simone den Grafen Manuel heiraten sollte...
Liselotte Immenhof
Leichtfüßig lief Prinzessin Teresa von Stackenburg die Treppe der Terrasse hinauf, die sich an der ganzen rückwärtigen Front des Hauptgebäudes von Schloß Stackenburg entlangzog.
Dunkles Haar umrahmte ein ovales Gesicht mit feinen, edel geschnittenen Zügen. Das jugendlich-frische Antlitz der Prinzessin wurde durch ein weiches Lächeln verschönt und erhielt dadurch den Ausdruck innerer Beseeltheit.
Teresa trug ein schlichtes, tief ausgeschnittenes Sommerkleid aus türkisfarbenem Leinen, das sie noch jünger und mädchenhafter erscheinen ließ, als sie mit ihren neunzehn Jahren war.
Alle auf dem Schloß liebten die heitere und anmutige Prinzessin, die für jeden ein freundliches Wort hatte und selbst mit den niedrigsten Schloßangestellten wie mit ihresgleichen sprach.
Auch Franz Schott, der Gärtnermeister, hatte Teresa ins Herz geschlossen. Er schaute ihr nach, als sie mit beschwingten Schritten, den Arm voll frisch geschnittener Sommerblumen, hinter der breiten Glastür verschwand, die in den Wohnsalon des Schlosses führte.
Der große, lichtdurchflutete Raum mit der langen Fensterfront war mit besonders schönen Barockmöbeln eingerichtet und ganz in blauer Farbe gehalten. Über dem breiten Kamin hing ein wertvolles Gemälde eines alten Meisters, das Teresas Großvater für einen schwindelnd hohen Preis auf einer Gemäldeauktion erworben hatte.
Der angrenzende kleinere Salon, der »Teesalon« genannt wurde, hatte goldgelbe Vorhänge, und auch die Barocksesselchen und das verschnörkelte Sofa, das die verstorbene Fürstin so geliebt hatte, waren mit kostbarem Damast von der gleichen goldgelben Farbe bezogen.
Während Prinzessin Teresa mit künstlerischem Geschick die Blumen in die verschiedenen Porzellan- und Glasvasen ordnete, die die Wohn- und Empfangsräume des unteren Stockwerks zierten, summte sie eine heitere Melodie.
Teresa war glücklich, weil ihr Vater schon einen Tag früher als beabsichtigt aus der Stadt zurückgekommen war. Und sie war glücklich über den wundervollen Sonnentag, den sie bis zum Mittagessen mit ihrer Stute Bella draußen auf den Wiesen und im nahegelegenen Forst und später bei Franz Schott und dessen Helfern im riesigen Garten des fürstlichen Besitzes verbracht hatte.
Draußen sangen die Vögel, die Bienen summten, es roch nach dem betäubenden Duft der Rosen, des Jasmins und der Lindenbäume. Doch bald erfüllte auch zarter Blütenduft die Räume des Schlosses, die Teresa mit der Pracht leuchtender Blumenarrangements geschmückt hatte.
Während Teresa durch die hohen, stuckverzierten Torbögen, die die Wohn- und Empfangsräume des unteren Stockwerks miteinander verbanden, von einem Salon in den anderen eilte, dachte sie an die Reise, die sie in zwei oder drei Monaten mit ihrem Vater machen würde. Sie wollten in den Süden fahren, nach Sizilien, Ägypten und Griechenland und zuletzt in die Türkei.
Schon seit Wochen freute sie sich darauf. Sie hatte sich alle verfügbaren Bücher, die über diese fernen Länder Auskunft gaben, aus der Bibliothek geholt und außerdem dazugekauft. Sie las in jeder freien Minute und träumte oft genug von dem verführerischen Zauber des Orients, der sie lockte und mit gespannter Erwartung erfüllte.
Die Prinzessin war gerade damit beschäftigt, den herrlichen Strauß dunkelroter und weißer Rosen in der hohen venezianischen Bodenvase zu ordnen, als ihr Vater, Fürst Maximilian von Stackenburg, den gelben Salon betrat.
Teresa flog ihm mit einem freudigen Ausruf um den Hals.
»Papa, liebster Papa! Ich bin so froh, daß du wieder da bist!« rief sie und küßte den grauhaarigen Fürsten, der gutmütige helle Augen hatte, auf die Wangen. »Diese drei Tage ohne dich waren einfach schrecklich!« fügte sie halb lachend, halb ernsthaft hinzu und ließ sich mit einem Seufzer auf eines der Barocksesselchen fallen.
Fürst Maximilian, ein mittelgroßer, vollschlanker Mann von imponierendem Äußeren, liebte seine Tochter innig, seit ihm ein grausames Geschick seine geliebte Frau genommen hatte. In Gedanken verglich er Teresa immer wieder mit ihrer Mutter, der sie auf erstaunliche Weise ähnlich sah.
Auch diesmal blickte er sie einen Moment an, wie sie in anmutiger Haltung vor ihm saß, eine dunkelrote Rose, die sie in die Vase stecken wollte, als er eingetreten war, noch in der Hand haltend. Jetzt muß ich es ihr sagen! dachte er. Wie wird sie es aufnehmen? Eine unerklärliche Beklemmung befiel ihn. Noch während der Fahrt nach Stackenburg war er sich seiner Sache so sicher gewesen.
Teresa richtete sich ein wenig auf und blickte ihren Vater forschend an.
»Was hast du, Papa? Du machst so ein ernstes Gesicht.« Sie sprang auf und trat zu ihm, eine Hand zärtlich auf seine Schulter legend, mit der andern sorgsam die halb erblühte Rose umschließend.
»Du hast doch hoffentlich keinen Ärger in der Stadt gehabt?« fragte sie besorgt.
Das Lächeln, mit dem der Fürst ihr antwortete, wirkte angestrengt.
»Nein, Teresa – im Gegenteil!« Er sog hörbar die Luft ein und wippte einige Male auf den Zehenspitzen. »Komm, setzen wir uns, Liebes! Ich möchte etwas Wichtiges mit dir besprechen.«
Teresa lachte über den ungewohnt feierlichen Ton ihres Vaters zuerst belustigt auf. Aber als sie den gespannten Zug um die Mundwinkel des Fürsten sah, wurde sie ernst.
»Nanu – so feierlich, Papa? Willst du mir jetzt etwa vorhalten – wie es auch die Eltern aller meiner Freundinnen tun –, daß ich nicht länger das unbekümmerte Leben eines ›Landedelfräuleins‹ führen darf, sondern mich ernsthaft in den entsprechenden Kreisen nach einem Ehekandidaten umsehen soll?«
Der Fürst hatte sich Teresa gegenübergesetzt und verschränkte unruhig die Finger ineinander.
Teresa streckte eine Hand aus und legte sie auf den Arm ihres Vaters.
»Wenn du das mit mir besprechen willst, Papa, dann fang lieber gar nicht erst an!« sagte sie voll zärtlichem Spott. »Es paßt einfach nicht zu dir.«
Ihr Lächeln war voll kindlicher Liebe und in seiner heiteren Unbekümmertheit einfach entwaffnend.
»Ich weiß, ich bin fast zwanzig Jahre, und du möchtest gern, daß ich heirate und glücklich werde. Aber ich kann nur dann glücklich werden, Papa, wenn ich den Mann heiraten darf, den ich liebe. Und du hast mir versprochen, daß ich meine Wahl selbst treffen darf.«
Ihre blauen Augen waren ernst und eindringlich auf den Vater gerichtet.
Fürst Maximilian räusperte sich. »Nicht darüber wollte ich mit dir sprechen, Teresa«, erwiderte er zögernd. »Aber es handelt sich auch um eine Heirat.«
Er wich dem forschenden Blick der Tochter beinahe verlegen aus.
»Um wessen Heirat?« Teresas Stimme war plötzlich nicht mehr sicher und fest wie zuvor. »Will Ekkehard von Dux etwa heiraten und uns verlassen?«
Der Fürst winkte flüchtig ab.
»Ich glaube, für ihn gibt es nur die Arbeit, an Liebe denkt er nicht«, erwiderte er. »Manchmal ist mir das beinahe unheimlich.«
Er lächelte und sah seine Tochter mit einem unsicheren Blick an. Wieder räusperte er sich und suchte sekundenlang nach Worten.
»Tessa, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, damit du mich richtig verstehst…« Er fuhr sich durch das dichte graue Haar. Dann wandte er sich der Prinzessin zu, die ihn unverwandt ansah. »Tessa, ich – ich möchte wieder heiraten. Verstehst du?« Seine Stimme war leise und bittend. Er ahnte, was dieses Bekenntnis für Teresa bedeuten würde. »Du bist sehr überrascht, ja?« setzte er verwirrt hinzu.
Teresa hob mit flatternden, hilflosen Gebärden die Hand. Die dunkelrote Rose, die sie eben noch behutsam wie ein Kleinod zwischen ihren schlanken Fingern gehalten hatte, fiel achtlos auf den Boden, Tessa merkte es nicht.
Sie saßen einige Sekunden ganz still, wie gelähmt. Sie schloß die Augen und bemühte sich, nachzudenken, um das, was sie eben gehört hatte, zu begreifen.
Aber es gelang ihr nicht. Die Gedanken liefen ihr davon. Sie fuhr sich mit der Hand über die Stirn, als wollte sie diese dumpfe Bedrückung, die plötzlich auf ihr lag, fortwischen.
»Du – du willst heiraten?« fragte sie dann mit ausdrucksloser Stimme. Ihr Gesicht war blaß geworden, nur die Augen brannten in dunkler Angst.
»Ja, Teresa«, antwortete Fürst Maximilian, »bitte, Liebes, versuche, mich zu verstehen! Schau, ich bin soch noch kein alter Mann mit meinen fünfundfünzig Jahren.« Er sprach immer schneller und nervöser. »Seit so vielen Jahren lebe ich allein…«
»Ich war doch bei dir!« fiel sie mit zitternder Stimme ein. »Waren wir beide nicht immer sehr glücklich miteinander?« Tränen standen in ihren Augen.
»Doch, mein Liebes«, antwortete Fürst Maximilian gequält. »Ich war sogar sehr glücklich in den vergangenen Jahren, weil du es mit deiner zärtlichen Liebe verstanden hast, mir über den Schmerz und die Leere nach dem Tod deiner Mutter hinwegzuhelfen, obwohl du damals erst zehn Jahre alt warst und selbst kaum begreifen konntest, daß der Tod uns das Liebste genommen hatte.«
Sein Blick blieb an einem ovalen goldgerahmten Bild hängen, das eine zarte junge Frau mit fülligem Goldhaar zeigte.
»Hast du sie denn jetzt ganz vergessen – meine liebe Mama?« Schluchzend kamen die Worte von Teresas Lippen.
Maximilian von Stackenburg lächelte voll Wehmut.
»Ich werde sie niemals vergessen können, Tessa. Und trotzdem ist in meinem Herzen noch Platz für eine andere Frau – für die Frau, die ich jetzt heiraten will.«
»Wer – wer ist es?« entrang es sich stockend der Prinzessin.
»Es ist Prinzessin Olivia von Birkenau.«
In die Augen des Fürsten kam ein warmes Leuchten, und ein kleines, glückliches Lächeln begleitete seine Worte.
Teresa sah es, und es schmerzte sie fast noch mehr als die Tatsache, daß der Vater noch einmal heiraten wollte. Sie spürte in diesem Moment, daß sie den Menschen, der ihr bisher am nächsten gestanden und der ihr alles bedeutet hatte, verlieren würde – ja, vielleicht hatte sie ihn sogar schon verloren.
»Olivia von Birkenau!« wiederholte sie und versuchte sich das Gesicht der schönen dunkelhaarigen Prinzessin vorzustellen.
Vielleicht wäre alles leichter für sie gewesen, wenn der Vater eine Frau gewählt hätte, die in seinem Alter gewesen wäre, und mit der sie eine zweite Mutter gefunden hätte.
»Ist sie nicht viel…viel zu jung für dich, Papa?« stammelte Teresa mit belegter Stimme.
Die Miene des Fürsten spannte sich unmerklich.
»Olivia ist fünfunddreißig«, antwortete er. »Sie ist eine reife Frau, die niemals zu einem gleichaltrigen Mann passen würde.« Es kam rascher und schärfer, als es sonst die Art des Fürsten war.
»Aber du – du kennst sie doch kaum«, fuhr Teresa verwirrt fort. »Du bist ihr nur einige Male auf Einladungen und Festen begegnet…« Die Stimme versagte ihr.
Der Fürst lachte leise und wirkte plötzlich sehr jung und froh.
»Nein, Tessa, ich habe Olivia jedesmal getroffen, wenn ich in der Stadt war, und in dieser Zeit habe ich sie sehr gut kennen- und liebengelernt.«
Die Prinzessin zuckte zusammen und senkte den Kopf. Sie fühlte sich leer, ausgebrannt und unendlich einsam.
Das Glück, das bisher in ihrem Leben gewesen war, hatte sie verlassen, und sie hatte das Gefühl, als ob sich plötzlich sogar die Sonne verdunkelt hätte.
Langsam hob sie den Kopf und starrte auf das Fenster, das vor ihrem tränenden Blick verschwamm. Sie hörte nur das monotone Summen einer Wespe, die immer wieder gegen die geschlossene Scheibe flog. Dieses Summen schwoll für Teresa zu einem Geräusch voll unheimlicher Drohung an.
Maximilian von Stackenburg ergriff beide Hände seiner Tochter.
»Sei nicht traurig, Liebes! Ich bin erleichtert, daß du es jetzt weißt«, sagte er behutsam. »Natürlich wird es dich im Augenblick schmerzen, aber sobald du Olivia besser kennengelernt hast, wirst du wissen, was für ein wundervoller und liebenswerter Mensch sie ist. Du wirst an ihr eine gute Freundin gewinnen, die viel Freude und Leben in unser ein wenig vereinsamtes Schloß bringen wird.«
»Ich habe mich hier nie einsam gefühlt«, flüsterte die Prinzessin. Sie sah ihren Vater mit einem Blick an, aus dem ihr ganzes Herzeleid sprach. Ein trauriges Lächeln flog über die blassen Züge. »Ich glaube nicht daran, daß wir je wieder so glücklich sein werden wie bisher«, murmelte sie. Dann stand sie auf. Ihre Glieder waren schwer wie Blei.
Sie war nur einen Schritt von ihm entfernt und hatte doch das schmerzliche Gefühl, ihm nie mehr so nahe sein zu können wie früher.
»Wann wirst du die Prinzessin heiraten?« fragte sie mit gebrochener Stimme.
»Bald, Teresa. Wir wollen jetzt nicht mehr lange warten. Vielleicht in drei oder vier Monaten.«
Sie entzog ihm ihre Hände.
»Also unmittelbar nach unserer Reise?«
Fürst Maximilian erhob sich ebenfalls.
»Auch das wollte ich dir noch sagen, Teresa. Aus unser geplanten Reise wird vorläufig nichts werden. Schau, die Hochzeitsvorbereitungen erfordern allerhand Aufwand. Einige Zimmer im Schloß sollen für Olivia umgebaut werden, und sie soll sich vor der Heirat mit dem Schloß und dem gesamten Besitz so vertraut machen, daß ihr Stackenburg schon zur Heimat geworden ist, wenn sie als meine Frau hier einzieht.« Flehend sah Fürst Maximilian seine Tochter an. »Deshalb kann ich unmöglich für mehrere Wochen wegfahren. Das verstehst du doch, nicht wahr?«
»Ja, natürlich, ich verstehe es«, murmelte Tessa. Mit steifen Schritten ging sie beiseite und zertrat dabei die rote Rose, die die schönste unter allen Blumen gewesen war.
Tessa, für die jede Blume ein Lebewesen war, das sie liebte, merkte es nicht einmal.
Fürst Maximilian blickte ihr nach, als sie den gelben Salon ohne ein weiteres Wort verließ. Bestürzt fragte er sich, ob es falsch gewesen war, ihr so unvorbereitet die Wahrheit zu sagen.
*
Teresa vergrub sich nicht in ihrem Zimmer, wie es andere Mädchen ihres Alters getan haben würden, wenn sie Kummer hatten.
Mechanisch streifte die Prinzessin das türkisfarbene Leinenkleid ab und zog ihren rehbraunen Reitanzug an, während ihre Gedanken unablässig um das bevorstehende Ereignis der Hochzeit kreisten.
Schon wenige Minuten später stand sie unten im Stall und legte mit zitternden Händen ihrer Lieblingsstute Bella den Sattel auf.
Der Schimmel wandte den Kopf zur Seite und sah Teresa aus großen schwarzen Augen an. Behutsam stieß er mit dem Maul gegen den Hals seiner Herrin, als wollte er ihr damit zu verstehen geben, daß er ihren Kummer fühlte.
Teresa sprach die Schimmelstute mit zärtlichen Worten an, obwohl ihre Stimme heiser war von ungeweinten Tränen und die Worte ihr kaum von den Lippen kommen wollten.
»Soll ich helfen, Hoheit?« fragte Jimmy, ein junger Stallbursche, der erst seit kurzem auf Schloß Stackenburg war. Diensteifrig kam er herbeigerannt.
»Danke, Jimmy«, erwiderte Teresa mit einem angestrengten Lächeln, »ich sattle mein Pferd immer allein, bevor ich ausreite.«
Etwas unbeholfen stand der große, schlaksige Junge neben der Box und sah zu, wie die Prinzessin die Schimmelstute durch den langen Gang der Stallung führte.
Auf dem Hof fiel ihr der Schein der schrägstehenden Sonne gleißend entgegen. Teresa schloß einen Moment geblendet die Augen.
Deshalb sah sie nicht, daß sich der Verwalter der fürstlichen Besitzungen, Baron Ekkehard von Dux, mit raschen Schritten näherte.
»Wollen Sie ausreiten, Teresa?« fragte er erstaunt. Seine grauen Augen hefteten sich forschend auf das ernste Gesicht der Prinzessin. Dann warf er einen raschen Blick auf seine Armbanduhr. »Sie wollen den Tee heute nicht mit uns nehmen?«
»Nein, Ekkehard«, antwortete Teresa hastig. Sie wich dem forschenden Blick des sympathischen Verwalters aus, der als junger Mann von dreiundzwanzig Jahren nach Schloß Stackenburg gekommen und nun schon fast zehn Jahre lang die rechte Hand des Fürsten war.
Ekkehard von Dux war bekannt für seine Bescheidenheit und Zurückhaltung. Deshalb erstaunte es Teresa, daß er sie nach einem langen Schweigen, das sie verwirrte und nervös machte, mit besorgter Stimme fragte: »Ist etwas geschehen, Teresa?«
Die Prinzessin warf den Kopf zurück. Es kostete sie Mühe, ihre Beherrschung zu bewahren und sich ihre Verzweiflung und die hilflose Schwäche, die sie erfüllte, nicht anmerken zu lassen.
»Nein – nichts ist geschehen, Ekkehard«, entgegnete sie ein wenig schroff, um sich gegen die aufsteigenden Tränen zu wehren. Sie fühlte sich nicht berechtigt, dem Baron das geheimnis ihres Vaters zu entdecken.
Sie mochte Ekkehard sehr gern, denn er kannte sie schon, als sie noch ein Kind gewesen war. Damals war er ihr großer Freund und Vertrauter gewesen. Doch dann war sie erwachsen geworden, und Ekkehards Gegenwart verwirrte sie. Sie errötete, wenn er mit ihr sprach, und sie fand nicht mehr den richtigen Ton unbekümmerter Kameradschaft. Da zog sie sich unmerklich vor ihm zurück, und alle ihre geheimsten Gedanken und Empfindungen verschloß sie vor dem Freund ihrer Kindheit.
»Entschuldigen Sie, Teresa, aber kann ich Sie wirklich jetzt allein fortreiten lassen?« fragte der Verwalter.
Teresa spielte ungeduldig mit den Zügeln.
»Was ist los mit Ihnen, Ekkehard?« Es klang gereizt. »Sie tun ja so, als wäre ich eine Anfängerin, die nur mit ihrem Lehrer ausreiten darf.«
»Ich weiß, daß Sie reiten können, Teresa«, sprach Ekkehard in seiner ruhigen und bestimmten Art, »aber ich merke auch, daß Sie jetzt in einer aufgewühlten, verzweifelten Stimmung sind.«
Teresa lehnte verwirrt ihren Kopf gegen den Hals des Pferdes, das leise schnaubte und aufmerksam mit den Ohren spielte.
Kannte Ekkehard sie so genau, daß er jede Gefühlsschwankung spürte?
Teresa lachte nervös auf.
»Sie sind ein Narr, Ekkehard!«
»Vielleicht«, antwortete er leise und sah an ihr vorbei. »Ich dachte nur daran, daß ich Ihnen früher helfen durfte, wenn Sie Kummer hatten…«
Wieder warf sie mit dieser trotzigen Bewegung, die ihre ganze Unsicherheit verriet, den Kopf zurück.
»Ich bin kein Kind mehr, Ekkehard!« sagte sie mit Nachdruck.
Der Baron biß sich auf die Lippen.
»Sie haben recht«, entgegnete er dann. »Bitte, verzeihen Sie! Ich werde in Zukunft vergessen, daß wir einmal sehr gute Freunde waren.«
Teresa hob eine Hand und legte sie flüchtig auf Ekkehards Arm.
»Seien Sie mir nicht böse, Ekkehard – bitte!« murmelte sie. Ihre Augen waren flehend und in hilflosem Schmerz auf ihn gerichtet.
Er fühlte, daß er nicht weiter in sie dringen durfte. Ein Lächeln flog über seine wettergebräunten Züge.
»Wie könnte ich Ihnen böse sein, Tessa.«
Nur selten hatte er sie in den letzten Jahren so genannt. Seit sie ein bildschönes junges Mädchen geworden war, das die Herzen aller Männer höher schlagen ließ, wagte er nicht mehr, sie mit ihrem Kosenamen anzureden.





























