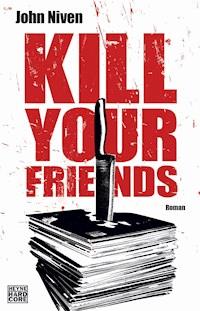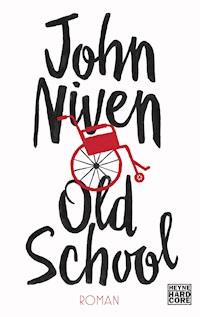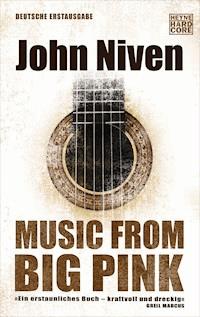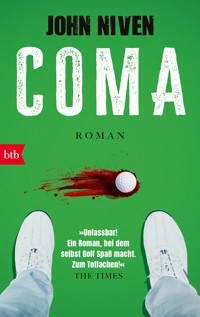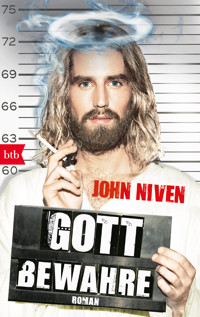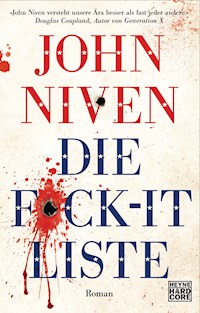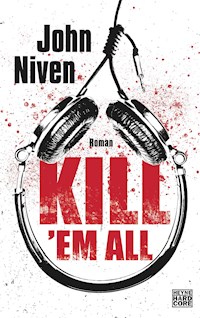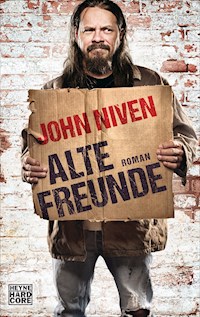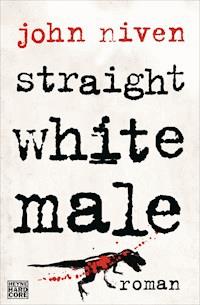10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die ergreifende Geschichte zweier Brüder - die literarischen Erinnerungen vom SPIEGEL-Bestsellerautor John Niven
In seinem persönlichsten Buch erzählt John Niven zum ersten Mal über ein dunkles Kapitel in seiner Familie: Den jahrelangen Drogenkonsum und Selbstmord seines Bruders. Während sich John aus der schottischen Provinz herausarbeitet, in Bands spielt, einen gutdotierten Job bei einer angesagten Plattenfirma findet und erfolgreicher Romanautor wird, bricht Gary die Schule ab, verliert den Halt, wird drogenabhängig und begeht 2010 im Alter von zweiundvierzig Jahren Selbstmord. Fortan lebt John mit der quälenden Frage, warum er seinem Bruder nicht helfen konnte. John Niven zeichnet die Lebenswege von sich und seinem Bruder nach. Eine herzergreifende Spurensuche, eine Liebeserklärung an das Leben und einen Bruder, der diesem Leben nicht gewachsen war. Geschrieben voller Empathie und gleichzeitig im subversiv-humorvollen John-Niven-Sound, den seine Fans so lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
Um kurz nach sieben Uhr erreicht mich der Anruf. »Es geht um deinen Bruder …«
Ach, Gary, was hast du nun schon wieder angestellt? Diese Frage begleitet die Brüder John und Gary Niven seit ihrer Kindheit. Anfangs geht es um Steinewerfen und Schuleschwänzen, später um Drogendealen und schließlich, mit zweiundvierzig Jahren, um die unbegreifliche Tragödie: In der Nacht des 31. August 2010 erhängt sich Gary in einem Krankenhauszimmer.
Während John längst erfolgreicher Romanautor in London ist, hatte Gary bis zuletzt zwischen Bergen von Rechnungen in der schottischen Provinz gelebt, geplagt von Drogen- und Alkoholproblemen. Wie konnten die Lebenswege der beiden Brüder so unterschiedlich verlaufen?
Psychologisch feinfühlig, unterhaltsam und herzergreifend zeichnet John Niven die Lebenswege der beiden Brüder zwischen schottischer Kleinstadt, Punkmusik und ecstasygetränkten Raves nach und versucht, mit den eigenen Schuldgefühlen ins Reine zu kommen.
Zum Autor
John Niven, geboren 1966 in Schottland, spielte in den Achtzigerjahren Gitarre bei der Indieband The Wishing Stones und arbeitete nach dem Studium der Literatur als A&R-Manager einer Plattenfirma, bevor er sich 2002 dem Schreiben zuwandte. 2006 erschien sein erstes Buch »Music from Big Pink«. 2008 landete er mit dem Roman »Kill Your Friends« einen internationalen Bestseller, der auch fürs Kino verfilmt wurde. Es folgten zahlreiche weitere Romane, darunter Kultklassiker wie »Coma« oder »Gott bewahre«. Neben Romanen schreibt John Niven Drehbücher. Er wohnt in der Nähe von London.
JOHN NIVEN
O BROTHER
Aus dem schottischen Englisch von Stephan Glietsch
Die Originalausgabe O BROTHER erschien 2023 bei Canongate Books Ltd., EdinburghDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Zitat aus Untold Stories von Alan Bennett (© Forelake Ltd 2005) mit freundlicher Genehmigung von United Agents (unitedagents.co.uk) im Namen von Forelake Ltd. und Faber and Faber Ltd.»Safe European Home«: Words and Music by Joe Strummer, Mick Jones, Paul Gustave Simonon and Topper Headon. Copyright © 1978 NINEDENLTD. All Rights for NINEDENLTD. Administered by UNIVERSAL – SONGSOFPOLYGRAMINTERNATIONALPUBLISHING, INC. All Rights Reserved. Used by Permission. Reprinted by Permission of Hal Leonard Europe Ltd.
Copyright © der Originalausgabe 2023 by John Niven
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München unter Verwendung eines Motivs von John Niven
Redaktion: Thomas Brill
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30601-4V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Robin, Lila, Alexandra und Morty
»Für einen Autor ist eigentlich kaum ein Ereignis so schlimm wie für andere Menschen, denn fast immer lässt sich daraus etwas machen. Egal, wie schlimm es auch ist.«
Alan Bennett
»Einer Autobiografie ist nur zu trauen, wenn sie auch etwas Beschämendes enthüllt. Ein Mann, der nur Gutes über sich preisgibt, enttarnt sich eher als Lügner.«
George Orwell
TEIL EINS
Dienstag, 31. August 2010
Um kurz nach sieben Uhr erreicht mich der Anruf. Ein Anruf, mit dem ich im Grunde zeit meines Lebens gerechnet habe. Zumindest seit ich erwachsen bin. Als ich in die Küche komme, streckt mir meine damalige Frau Helen das Telefon entgegen. Auf dem Arm hält sie unsere zweijährige Tochter Lila. Hinter ihr reflektiert der große Edelstahl-Kühlschrank die Spätsommersonne, durch die Fenster fällt das Licht auf die salbeigrüne Tapete.
»Mum ist dran«, sagt Helen. »Es geht um deinen Bruder …« Sie reicht mir den Hörer mit diesem merkwürdig prüfenden Blick, der gewöhnlich den Empfängern sehr schlechter Nachrichten vorbehalten und der Angst vor meiner Reaktion geschuldet ist. Im Stillen spreche ich jene Worte, die mir über die Jahre fast zur Gewohnheit geworden sind. Worte, die ich auch meine Eltern oft sagen hörte.
Ach, Gary, was hast du nun schon wieder angestellt?
»Sheila, hallo, was ist los?«
Mein Verhältnis zu Helens Mutter ist sehr gut. Wir haben fast vier Jahre bei ihr gewohnt, während ich an meinen ersten beiden Romanen Music from Big Pink und Kill Your Friends schrieb.
»John, hör zu …« Sheila ist Ärztin im Ruhestand. Obwohl hörbar aufgewühlt und nervös, bleibt sie sachlich und professionell. Mein Handy war wohl ausgeschaltet, weshalb meine Mutter, der auf die Schnelle keine andere Festnetznummer einfiel, kurzerhand bei ihr angerufen hat. Sheila erzählt mir, dass mein Bruder auf der Intensivstation des örtlichen Krankenhauses liegt. Meine Mum sei bereits vor Ort, und ich solle umgehend dort anrufen. Sheila gibt mir die Durchwahl der Station, wo ich erfahre, dass Gary in den frühen Morgenstunden versucht hat, sich zu erhängen. Er lebt, wurde aber in ein künstliches Koma versetzt. Die Stationsleitung kann meine Mum nicht finden, weiß jedoch zu berichten, dass meine jüngere Schwester Linda ebenfalls informiert wurde und sich bereits auf dem Weg von Glasgow nach Ayrshire befindet. Mein Blick wandert durch die gläserne Küchentür zu meinem Büro am anderen Ende des Gartens, wo meine Arbeit auf mich wartet, und dabei denke ich so etwas wie: Jetzt ist es so weit. Oder: Das musste ja so kommen.
Ich buche einen Flug, packe eine Tasche und reserviere einen Mietwagen. Dann gebe ich Helen und Lila einen Abschiedskuss und fahre mit dem Taxi nach Heathrow. Es ist der letzte Augusttag, und der Himmel erstrahlt in diesem leuchtenden Blau, bei dem New Yorker manchmal von 9/11-Wetter sprechen. Gegen vierzehn Uhr komme ich im Ayrshire District General Hospital an. Das Krankenhaus liegt in Crosshouse, ganz in der Nähe von Kilmarnock. Bei seiner Eröffnung im Jahr 1984 bereitete ich mich gerade auf meinen Schulabschluss vor. Einer meiner Freunde wurde nach einem schweren Autounfall hier behandelt. Und mein Vater, nachdem er seinen ersten Herzinfarkt erlitten hatte. In diesem Krankenhaus habe ich Onkel und Tanten an Krebs sterben sehen. Die Einheimischen und das Personal nennen es schlicht »Crosshouse« oder »NADGE«.
Durch dieselben weiß gestrichenen Gänge laufe ich nun zur Intensivstation, vor der meine Mutter und meine Schwester im Wartebereich sitzen. Mum wirkt verhärmt, beinahe wie ausgewrungen und viel älter als ihre siebenundsechzig Jahre. Schluchzend fällt sie mir in die Arme. Meine kleine Schwester Linda – dank ihrer offenherzigen und kontaktfreudigen Art das mit Abstand unkomplizierteste der drei Niven-Kinder – hat bereits einen guten Draht zu den Pflegekräften hergestellt. Linda ist siebenunddreißig, glücklich verheiratet und ebenfalls Mutter einer kleinen Tochter. Wir beide standen uns schon immer sehr nahe. Aufgrund des Altersunterschieds von sieben Jahren kam es zwischen uns nie zu Rivalitäten und Reibungen, wie sie unter gleichaltrigen Geschwistern an der Tagesordnung sind.
»Was ist passiert?«, frage ich.
Passiert war Folgendes:
In den frühen Morgenstunden um dreizehn Minuten nach vier – zu dieser Jahreszeit in Schottland die dunkelste Stunde der Nacht – hatte Gary die 999 angerufen und erklärt, er sei depressiv und habe versucht, sich umzubringen. Alles dokumentiert in der Mitschrift seines Notrufs, auf die ich allerdings erst sehr viel später Zugriff bekommen sollte, nachdem mein dritter Antrag auf Einsicht endlich von Erfolg gekrönt war.
Vierzehn Minuten nach Garys Anruf traf der Rettungswagen ein. Dessen zwei Besatzungsmitglieder verbrachten ungefähr eine Viertelstunde in seiner Wohnung, bevor mein Bruder schließlich einwilligte, mit ihnen nach Crosshouse zu kommen – eine Fahrt von zehn Minuten. Vor meinem inneren Auge sehe ich ihn im Rettungswagen: Bei klarem Verstand und vollem Bewusstsein – die Verletzungen an seinen Armen waren nur »oberflächlich« – plaudert er mit den Sanitätern.
Es muss kurz vor fünf gewesen sein, als sie durchs ländliche Ayrshire nach Osten fuhren, rechts der Straße funkelte der Firth of Clyde vermutlich bereits im Licht der aufgehenden Sonne. Der neue Tag versprach genauso schön zu werden wie der vorige. Ob Gary das registrierte? Im Krankenhaus behandelte die diensthabende Schwester die Schnitte an seinen Unterarmen. Er erzählte ihr von seinem Clusterkopfschmerz – eine seltene neurologische Erkrankung, unter der rund 0,1 Prozent der Bevölkerung leiden – und davon, dass er in letzter Zeit einige heftige Schübe gehabt habe. Um die Schmerzen zu lindern, musste er während dieser Attacken reinen Sauerstoff inhalieren. Auch auf der Fahrt ins Krankenhaus hatte er einen Schub erlitten und war von den Sanitätern beatmet worden. In Crosshouse sah man allerdings keinen dringenden Handlungsbedarf. Die Tür seines Zimmers blieb zwar offen, um ihn im Auge behalten zu können, doch irgendwann, noch während er auf einen Arzt wartete, gelang es ihm, sie zu schließen und sich mit Hilfe seines Pullovers am Türrahmen aufzuhängen. Gary war nicht sofort tot, aber sein Gehirn blieb »eine geraume Zeit« ohne Sauerstoffversorgung. Deshalb hatte man ihn für vierundzwanzig Stunden in ein künstliches Koma versetzt. Das ist die Standardprozedur bei einem Hirntrauma, wie es durch den gescheiterten Versuch, sich zu erhängen, verursacht wird – so erklärt man es uns zumindest.
Nach einer Weile erscheinen ein Arzt und eine Mitarbeiterin der Krankenhausverwaltung, um uns zu Gary zu führen. Ihre Nervosität, eine elektrisch knisternde Anspannung, ist deutlich spürbar. Kaum verwunderlich angesichts des Umstands, dass mein Bruder in ihrer Obhut einen Suizidversuch unternommen hat.
Als wir die Intensivstation betreten, liegt er vor uns: mit nacktem Oberkörper, intubiert. Im fahlblauen Licht einer Phalanx von Monitoren hebt und senkt sich sein Brustkorb zum rhythmischen Brummen und mechanischen Zischen des Beatmungsgeräts. Gary war immer schon schlank, jetzt wirkt er schmerzhaft dünn, seine Wangen und Schläfen sind hohl und eingefallen, sein Gesicht gerötet. Auf der Stirn glänzt ein dünner Schweißfilm. Er hat sich seit Tagen nicht rasiert. Aber er sieht friedlich aus, als würde er schlafen. Erst als mein Blick an ihm herabwandert, offenbart sich die wahre Geschichte. Die roten Striemen des Würgemals um seinen Hals. Die Bandagen um beide Unterarme. Sie verbergen das Gitterwerk der Schnitte, die er sich an diesem Morgen zugefügt hat. Die verschorften Wunden auf seinen zerschrammten Knöcheln sind kein ungewöhnlicher Anblick. Meistens verdankte er sie seiner Arbeit als Tischler oder dem Zorn, der immerzu in ihm brodelte und – wenn er überkochte – Wände, Garderoben oder Türen in Mitleidenschaft zog. Die Schrammen erinnern mich an den Weihnachtsmorgen 1993, das erste Weihnachtsfest nach Dads Tod. Wutentbrannt und in Tränen aufgelöst, schlug Gary auf die Holzwand der Garage neben unserem Elternhaus ein, bis das spröde, vom Teeröl schwarze Holz unter seinen Fäusten splitterte.
Auf der Intensivstation informiert uns der Arzt über Garys Wert auf der Glasgow-Skala. Drei Punkte, das sei gar nicht gut. Doch wenn es mit Hilfe des künstlichen Komas gelingen sollte, den Grad der zerebralen Durchblutung zu verringern, dann – so der Mediziner – wäre es unter Umständen möglich, dass sich die Blutgefäße wieder verengten, der intrakraniale Druck nachließe und das Trauma abklänge.
Mum starrt den Arzt an wie ein kleines Kind, dem man die Quantenphysik zu erklären versucht. Sie zieht einen Stuhl ans Bett ihres Sohnes und beginnt mit der Krankenwache. Gary wird das überstehen. Er wird leben. Punkt. Es mag absurd klingen, aber ich verspüre den starken Drang, laut aufzulachen. Denn die Glasgow-Skala und das Thema Koma sind mir nicht fremd. Dass mein Bruder im Koma liegt, und zwar ausgerechnet in diesem Krankenhaus, ist ein perfektes Beispiel für Oscar Wildes These, das Leben würde die Kunst weitaus mehr imitieren als die Kunst das Leben.
Ein Jahr zuvor, im Sommer 2009, wurde mein dritter Roman veröffentlicht, im Original unter dem Titel The Amateurs, auf Deutsch heißt er tatsächlich Coma. Ein Buch über Golf, Gangster und Untreue, angesiedelt in einer Kleinstadt in Ayrshire. Es erzählt die Geschichte zweier Brüder: Gary und Lee Irvine. Gary ist ein hoffnungslos dilettantischer Golfer und Lee ein hoffnungslos dilettantischer Gangster. Gary Irvine, der mit Nachnamen wie das Städtchen heißt, in dem wir aufgewachsen sind, und mit Vornamen wie mein Bruder, wird von einem Golfball am Kopf getroffen und fällt ins Koma. Als er Wochen später erwacht, beherrscht er zu seiner Überraschung den perfekten Golfschwung. Die Nebeneffekte sind weniger erfreulich: Tourette-Syndrom und chronischer Priapismus. Während der fiktionale Gary Irvine in ebendiesem Krankenhaus im Koma liegt, wacht seine Mutter Cathy an seinem Krankenbett. Diese Situation schildere ich im Buch mit folgenden Worten:
Cathy konnte ihre Gefühle nur in Kitschpostkarten-Poesie, Kühlschrankmagneten-Philosophie, in Plattitüden und Gemeinplätzen ausdrücken. Aber bloß, weil sie sich in Klischees äußerten, waren sie nicht weniger wert. Das Ausmaß der Liebe zu begreifen, die sie für ihren Sohn empfand, war dem kinderlosen, bewusstlosen Gary noch lange nicht gegeben. Als sie mit einem feuchten Tuch den verkrusteten Speichel in seinen Mundwinkeln abtupfte und sein Dreitagebart dabei an der Unterseite ihres Handgelenks kratzte, wurde Cathy bewusst, was sie darum geben würde, den Platz mit ihm zu tauschen. Denn ihre Liebe für den Jungen war unermesslich, und der Wunsch, ihn leben zu sehen, wog schwerer als ihre eigene Seele. Also redete Cathy, redete und redete. Und wich nur von seiner Seite, um den lebensnotwendigen Bedürfnissen nachzukommen: Nikotin, Koffein und dem Gang zur Toilette.
Drei Jahre nachdem ich diese Szene niedergeschrieben habe, durchlebe ich sie nun am eigenen Leib. In dem Krankenhaus aus meinem Roman sitze ich am Bett meines Bruders und sehe zu, wie meine Mutter den echten Gary mit denselben Gesten umsorgt, mit der ich meine Cathy den fiktionalen Gary umsorgen ließ: Sie streichelt seine Hand und flüstert sanft auf ihn ein. Dabei starrt sie auf die Monitore wie ein Schiedsrichter in Wimbledon auf die Kreidelinie, damit sie ja kein Piepen oder ein Ausschlagen der Kurve verpasst, das auf eine Regung ihres Sohnes hinweisen könnte. Ein erstes Anzeichen dafür, dass er sich jeden Moment aufsetzen wird. Um sich mit großen Augen umzusehen und zu fragen: »Wo bin ich?«
Oder: »Was ist passiert?«
Oder typisch Gary: »WASSOLLDASGANZEZEUG? MACHTDENVERDAMMTENSCHEISSAB!«
»Es könnte helfen, wenn Sie mit ihm reden«, hat man uns gesagt. Und Mum ist schon dabei. Schluchzend und mit leiser Stimme redet sie auf ihn ein. Fragt, was er getan hat und warum er es getan hat. Linda und ich wechseln betretene Blicke, beide noch viel zu gehemmt, um es ihr gleichzutun.
Später werden wir herausfinden, dass Gary keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat.
Einen sauberen Abschluss sollte es nicht geben.
Die letzte Seite des Buchs war herausgerissen. Die letzte Filmrolle verbrannt. Bei Nabokov heißt es: »Ein Mensch, der die Selbstvernichtung beschlossen hat, ist den Dingen dieser Welt weit entrückt, und sich hinzusetzen und sein Testament zu machen, wäre in diesem Augenblick so absurd, wie die Uhr aufzuziehen, da zusammen mit ihm doch sowieso die ganze Welt untergehen würde; der letzte Brief und mit ihm alle Briefträger auf der Stelle zu Staub verwandelt wären.« Doch wie jeder bestätigen kann, der es erlebt hat, facht der fehlende Abschiedsbrief die Feuersbrunst, das Inferno der Selbstzerstörung nur weiter an. Er verlängert dessen Halbwertszeit, die Kettenreaktion unbeantworteter Fragen, die nicht enden wollenden »Vielleichts« und »Was-wäre-Wenns«. Wenn das eigene Kind sich das Leben nimmt, zerbrechen die Eltern an der Frage: Was habe ich falsch gemacht? Oder wenn das Kind eines von zwei oder drei Geschwistern ist: Warum er? Warum sie? Was ist bei ihnen schiefgelaufen?
Quälende Gedanken, die sie nie wieder in Frieden lassen. Suizid ist ein Tschernobyl der Seele.
Diese Gedanken werden meine Mutter auch noch zehn Jahre danach bis in den Schlaf verfolgen. Und am nächsten Morgen lauern sie ihr geduldig auf. Ich werde mich nach dem Freitod meines Bruders immer wieder dabei ertappen, wie ich meinen eigenen Kindern beim Spielen oder beim Essen zusehe und mir unwillkürlich ausmale, wie sie eines fernen Tages völlig verloren auf den letzten Ausweg zutaumeln, ohne dass ihnen jemand die rettende Hand reicht, denn ich bin schon lange tot. Ich sehe Robin, Lila, Alexandra, selbst den kleinen Morty, wie sie in der Badewanne sitzen und sich – um zu testen, ob sie scharf genug ist – mit der Rasierklinge über die Fingerkuppe fahren. Wie sie einsam am Kanalufer stehen und den feuchten moosbewachsenen Stein in ihren Händen wiegen, wie sie auf den Stuhl steigen und den Hals durch die …
Man schreckt unwillkürlich davor zurück, diese Gedanken zu Ende zu führen, nicht wahr? Wenn man Kinder hat, fühlt man sich in solchen Momenten, als würde man Richtung Abgrund stürmen und im allerletzten Augenblick zum Stehen kommen. Die Zehen ragen bereits über die Klippe. Während man mit schwindelndem Kopf und rudernden Armen zurückweicht, lösen sich Steinchen und Geröll, um Hunderte von Metern in die Tiefe zu stürzen. Meine Tante Bell, die verstorbene Schwester meiner Mutter, war eine wahre Meisterin der Verballhornung und genoss in unserer Familie zu Recht den Ruf, nie um einen schrägen Spruch verlegen zu sein. Auf eine drastische Schilderung eines Unfalls meiner jüngeren Schwester, die über die Betonstufe zur Haustür meiner Oma gestolpert war und dabei ihre Milchzähne zu »Tic-Tac-Stückchen zersplittert« hatte, reagierte Bell, indem sie ihre Fäuste gegen die Ohren presste und lauthals schrie: »Seid still! Davon wird mir ja ganz schummrig zwischen den Beinen!«
So ist es richtig, Bell! Man schüttelt den Kopf, hält sich die Ohren zu, bläst die Backen auf und verjagt diese düsteren Gedanken. Auf die Erkenntnis, dass es wirklich nicht mehr war als ein schlechter Traum, folgt eine Welle der Erleichterung, tröstlich wie Heroin, und verjagt die Realität. Doch die grausame Wirklichkeit hat Mum fest im Griff. Sie sitzt an Garys Bett und hält zärtlich seine Fingerspitzen zwischen ihren.
»Warum, mein Sohn? Warum?«, fragt sie und streichelt seine Hand. »Hättest du nicht mit mir reden können? Ich hätte dir geholfen …«
Linda und ich haben selbst viele Fragen und einige aufkeimende Theorien zu diesem »Warum«. Aber mich beschäftigt vor allem das »Wie«. Und nachdem ich die Monitore, den Tropf mit der Salzlösung und das zischende Beatmungsgerät so lange mit respektvollem Blick gemustert habe, wie es mir angemessen erscheint, bitte ich den Arzt und die Verwaltungsmitarbeiterin, uns das Zimmer zu zeigen, in dem Gary versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Anfangs sträuben sie sich, drucksen herum, bevor sie Linda und mich dann doch in den entsprechenden Bereich der Notaufnahme führen. Mit Entsetzen stellen wir fest, dass das fragliche Zimmer keine fünf Meter vom Schwesternzimmer entfernt ist. Beim Betreten des kleinen Raums, kaum größer als eine Besenkammer, springt mir sofort ins Auge, dass er geradezu dafür prädestiniert ist, sich darin zu erhängen. Sogar an einen Hocker wurde gedacht. Ein merkwürdiger Ort, um einen suizidgefährdeten Patienten unterzubringen. Allerdings ist die ganze Geschichte merkwürdig: Gary wählt die Notrufnummer, weil er Selbstmordgedanken hat, und im Krankenhaus beschließt er dann tatsächlich, Suizid zu begehen.
»Können wir seinen Notruf hören?«, frage ich. »Oder die Abschrift sehen?«
Die Verwaltungsmitarbeiterin hält kurz Rücksprache und teilt uns dann mit, dass diese Informationen leider der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen.
»Soweit ich weiß«, sagt sie dann, »hat bisher auch noch nie jemand danach gefragt.« Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir unterstellt, ich sei morbide. Oder bloß, dass ich mich verrannt habe. Dabei finde ich meine Frage völlig naheliegend. Warum sollten wir nicht alles über Garys Gemütszustand an diesem Morgen wissen wollen? Ich nehme mir fest vor herauszufinden, wie man an die Abschrift eines Notrufs kommt. Auch die Verwaltungsmitarbeiterin scheint aus unserem kleinen Wortwechsel eine Erkenntnis gewonnen zu haben: Der Typ macht nichts als Ärger.
»Wie lange kann er in diesem Zustand bleiben?«, frage ich den Arzt.
»Vierundzwanzig Stunden. Morgen früh beginnen wir mit dem Absetzen der Sedativa.«
»Und was passiert dann?«
»Dann sehen wir weiter …«
Hinter mir redet meine Mutter mit Gary, mit Dad, mit Gott. Meine Mutter, in deren eigenem Leben es endlich wieder aufwärtsgeht. Fünfzehn Jahre nach Dads Tod hat sie ihren neuen Lebensgefährten Eddie kennengelernt. Eine »Herbstromanze« nannte man das früher.
Auf den Monitoren tanzen die Frequenzkurven im fahlblauen Licht – das gleiche kalte Blau wie die Verpackung der Icebreaker-Riegel, die Dad so gerne gegessen hat.
Die ersten bohrenden Fragen.
Wie konnte es so weit kommen?
Wenn wir uns anschicken, den eigenen Lebensweg umzugraben, erleben wir so etwas wie eine polizeiliche Gegenüberstellung früherer Ichs. Eines nach dem anderen schlurfen sie in den weiß gekalkten Raum und bauen sich vor den horizontal verlaufenden schwarzen Linien auf, unterschiedlich gekleidet – zumindest bis zum Alter von etwa vierzig Jahren –, alle mit unterschiedlichen Vorstellungen vom Leben, mit leicht variierenden Frisuren. Während sie nacheinander ihre Plätze in der Reihe einnehmen, blinzeln sie unbehaglich in den Einwegspiegel. Die üblichen Verworfenen. Um zu dem zu werden, was wir heute sind, war es nötig, bestimmte Aspekte unserer selbst über Bord zu werfen. Manche dieser ausrangierten Persönlichkeiten sind uns vertrauter als andere, aber auffällig viele machen einen nervösen Eindruck. Schuldig. Wie sollen wir über diese ausgemusterten Ichs urteilen? Blicken wir zehn oder fünfzehn oder auch zwanzig Jahre zurück und fragen uns, wie wir damals getickt haben. Welchen Rang würde unser damaliges Ich heute im Pantheon ehemaliger Egos einnehmen? Denn wir sind nicht die eine Person, unveränderlich von der Wiege bis zur Bahre, sondern eine Abfolge von Charakteren. Und wie in jedem anständigen Thriller sollte unser Misstrauen immer denen gelten, die am unverdächtigsten erscheinen. Mein dreizehnjähriges Ich trägt Uniform, denn es hat sich gerade dem Air Training Corps angeschlossen, einer Jugendorganisation der Royal Navy. Ungelenk versucht es, das vier Kilo schwere Lee-Enfield-Gewehr zu schultern und dabei gleichzeitig zu salutieren. Wider Erwarten ist mir dieser Kadett heute vertrauter als der siebenundzwanzigjährige John, der zugekokst auf der Terrasse des Chrysler Buildings herumtanzt, mit der Champagnerflasche wedelt und den Mond über Manhattan anheult.
Nun stehen sie einträchtig in einer Reihe, blinzeln ins Licht und treten dann nacheinander vor.
»Also gut, ihr Versager. Macht den Mund auf.«
Einigen von ihnen wollen wir einfach nur eine warme Tasse Tee bringen. Den guten Cop markieren. Diesen netten Kerl, der Sachen sagt wie: »Du warst noch so jung, Kleiner. Geh nicht zu hart mit dir ins Gericht.« Doch es gibt auch andere Kaliber, die wahren Übeltäter. Die möchten wir am Kragen packen und sie anbrüllen: »Erzähl mir gefälligst keine Scheiße!« Am liebsten würden wir sie in eine der Zellen im Keller zerren, das Aufnahmegerät ausschalten, um dann zum Gummischlauch und dem zusammengerollten Telefonbuch zu greifen.
Denn genau so fühlt sich diese Autobiografie an.
Wie ein erzwungenes Geständnis.
1973
»Zu kratzig«
»Händchen in die Höh’ …«
Das ist das Mantra, mit dem Mum uns dazu bringen will, die Arme nach oben zu strecken, damit sie uns das Unterhemd oder den Pullover über den Kopf ziehen kann. Ein Mantra, das ein halbes Leben später bei meinen eigenen Kindern immer noch zur Anwendung kommt. »Na mach schon, Gary, Händchen in die Luft.« Aber Gary will nicht. Stattdessen versucht er mit aller Kraft, sich freizustrampeln. »Nein … nein … NEIN«, heult er. Mit einer plötzlichen Drehung entwindet er sich ihrem Zugriff, taumelt schwankend durchs Zimmer – wie ein betrunkener Kneipenbesucher in einem winzigen Leibchen – und reißt sich das verhasste Kleidungsstück vom Leib.
Gary und ich teilen uns das Zimmer mit dem orange und schokoladenbraun gemusterten Teppich, dem Hochbett aus Kiefernholz und der lilafarbenen Nylonbettwäsche. Die Drei-Zimmer-Wohnung in der Martin Avenue wurde 1966 erbaut, dem Jahr meiner Geburt, und wir sind die ersten Bewohner. Sie liegt im Erdgeschoss, hat einen winzigen Vorgarten, und alles an ihr erscheint mir brandneu und modern. Also völlig anders, als ich die Sechzigerjahre bis dahin erlebt habe. Aber noch im selben Sommer, kurz nach der Geburt meiner Schwester Linda – in jenem Augenblick kaum größer als eine Apfelsine in Mums Bauch –, werden wir in ein eigenes Haus ziehen.
»Bitte, Gary, jetzt komm schon«, probiert es Mum erneut, doch er sprintet davon und macht einen auf Steve McQueen. Kurz vor der Tür stolpert er. Sie schnappt ihn sich und versucht, eins seiner Beine zu erwischen, um ihm eine Socke anzuziehen. Aber es hat keinen Zweck. Gary strampelt wie wild mit den Füßen, seine Fersen trommeln gegen den Teppich, Tränen steigen ihm in die Augen, und er brüllt wie am Spieß.
»NEIN! NEIN! ICHWILLNICHT!«
Sie bekommt eins seiner Beine zu fassen und versucht wiederholt, ihm das Unterhemd anzuziehen, während er sich windet wie eine Schlange. Mum hält ihn mit dem rechten Arm fest, um die Operation einhändig zu beenden. Ich sitze derweil vollständig angekleidet auf dem unteren Bett und sehe zu. Gary ist fünf Jahre alt. Ich bin sieben, muss zur Schule und bin jetzt schon spät dran. In meinem Hirn, irgendwo tief im Labyrinth der Erinnerungen, erklingt »Where’s Your Mama Gone« – ein Lied, das mir Anfang der Siebziger schreckliche Angst einjagte. Der Refrain ließ mich vor Entsetzen erstarren: »Woke up this morning and my mama was gone.« Um Himmels willen! Warum singt jemand so etwas? Wie kommt man darauf? Die bloße Vorstellung … Gott sei Dank ist meine Mutter mit anderen Dingen beschäftigt. Gary grunzt und zappelt, sein Rücken biegt sich wie ein Flitzebogen, die Füße bohren sich in den Teppich.
Viele Jahre später wird mich das Plattencover von Big Blacks Songs About Fucking an meinen kleinen Bruder in Momenten wie diesen erinnern: die Zähne gefletscht, die Halsschlagadern angeschwollen und Schweißperlen auf der Stirn. Es hilft alles nichts. Gary kämpft wie ein Berserker, doch Mum ist größer und stärker als er. Schließlich gelingt es ihr mit einem kräftigen Ruck, ihm die Socke anzuziehen. Der Triumph ist allerdings nur von kurzer Dauer. Auf Knien fischt sie hinter sich nach der zweiten Socke und kann den bockenden Gary deshalb nur mit einer Hand festhalten. Der wird erst dann richtig gefährlich, wenn er in die Enge getrieben ist und zu einem letzten Gegenschlag ausholt. Sie umklammert seinen Knöchel, während er sich dreht und windet wie ein Schwertfisch am Haken. Als Mum nach der Socke greift, tritt er aus und befreit sich ein weiteres Mal. Er rollt sich über den Teppich und zerrt an dem verhassten Stück Stoff an seinem Fuß, als wäre es eine Schlange, die sein Bein verschlingen will. Er reißt es herunter und wirft damit nach Mum, die erschöpft und geschlagen am Boden liegt. Schnaufend und schluchzend vergräbt Gary sein Gesicht im Teppich zu meinen Füßen. Schließlich wirbelt er herum und hebt den zitternden Finger, um mit der dramatischen Geste eines Anklägers, der vor Gericht den Mörder identifiziert, auf die weggeworfene Socke zu zeigen. Vom Schreien ganz heiser, erklärt er mit bebender Stimme, in der alles Leid dieser Welt liegt: »… zu kratzig!«
»Und das war ›Chirpy Chirpy Cheep Cheep‹ von Middle of the Road«, verkündet Radiomoderator Tony Blackburn. »Es ist 8:30 Uhr und Zeit für die Nachrichten …« Mum gibt auf und holt ein schmutziges, aber bewährtes Paar nicht kratzender Socken aus der Wäschetonne.
Später, sehr viel später, wird sie sagen, dass Gary schon als Kleinkind so gewesen sei. Wenn ihm das Unterhemd, die Socke oder der Pulli missfielen, ließ er sich durch nichts bewegen, sie anzuziehen. Konnte er sein Lieblingsspielzeug nicht finden, schüttete er die Spielzeugkiste bis auf den letzten Steckbaustein aus und verwüstete bei der Suche das ganze Haus, während er immer hysterischer wurde. In Mums Worten: »Wenn Gary was wollte … dann wollte er es.«
Der David-Copperfield-Scheiß
Ich war ein dickes, gieriges Baby, als ich am 1. Mai 1966 um achtzehn Uhr zur Welt kam. An einem Sonntag! Zur besten Cocktail-Zeit! Verfressen bin ich immer noch, doch obwohl Sonntagskinder bei uns in Schottland in dem Ruf stehen, »hübsch, unbekümmert, lieb und lebenslustig« zu sein, kann ich von diesen Qualitäten nur zwei für mich in Anspruch nehmen: Ich bin unbekümmert bis zur Schamlosigkeit und eigentlich immer gut drauf. Kein Wunder, ist der 1. Mai doch in vielen Kulturen ein Fest- und Freudentag. Wie der Zufall es will, ist er außerdem der Geburtstag meiner Mutter. Als ihr größtes Geschenk sich blinzelnd und quäkend aus ihrem Schoß befreite, beendeten Bob Dylan & The Hawks gerade ihren Soundcheck in Kopenhagen, wo sie das zweite Europa-Konzert ihrer Electric-Tour spielten. Etwas früher an diesem Nachmittag eröffneten die Beatles im Wembley-Stadion ihre letzte offizielle Liveshow auf britischem Boden, bevor sie in die Abbey-Road-Studios zurückkehrten, wo sie bei der Arbeit an Revolver zu einem neuen Teamgeist fanden. Die englische Fußballnationalmannschaft trainierte gerade für die Weltmeisterschaft im Sommer, die sie tatsächlich gewann. Exakt am Tag meiner Geburt beschwor das Time Magazine auf seinem Cover »LONDON, THESWINGINGCITY!«. Irvine war von Swinging London so weit entfernt wie irgend möglich, aber so kleinlich bin ich nicht: Ich nehme jedes gute Omen, das ich kriegen kann.
Gary kommt am 31. Juli 1968 und damit gut zwei Jahre nach mir zur Welt, an einem Mittwoch um drei Uhr morgens. Drei Uhr früh im Juli: die dunkelste Stunde der Nacht. Am Tag seiner Geburt läuft im britischen Fernsehen zum ersten Mal die beliebte Weltkriegs-Sitcom Dad’s Army. Am selben Abend zerstreiten sich die Beatles bei den Aufnahmen zum White Album während einer nervenaufreibenden Overdubbing-Session für »Hey Jude«, nachdem sie tags zuvor ihre Apple Boutique auf der Baker Street geschlossen haben. Und was das Jahr 1968 angeht … Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei der Tet-Offensive? Den tödlichen Attentaten auf Robert F. Kennedy und Martin Luther King? Aufstände und Erhebungen rund um den Globus? Mittwochskinder gelten bei uns als Sorgenkinder.
Aber natürlich gibt es so gut wie nichts, in das sich nicht alles Mögliche hineininterpretieren ließe.
Und von all diesen Ereignissen – egal ob musikalischer, kriegerischer, revolutionärer oder mörderischer Natur – war der Sendestart der Serie um Captain Mainwaring und seine Truppe vermutlich das Einzige, was auf das Kleinstadtleben meiner Eltern in Irvine einen großen Einfluss hatte.
Irvine liegt an der schottischen Westküste in der Grafschaft Ayrshire, rund dreißig Meilen südwestlich von Glasgow. Es gibt dort einen Hafen, einen Strand und einen Landschaftspark. Das älteste Gebäude im Stadtzentrum stammt aus dem 16. Jahrhundert. Bewegt man sich von der High Street in konzentrischen Kreisen stadtauswärts – wie in diesen Grafiken vom Explosionsradius einer Atombombe, die während meiner Jugend im Kalten Krieg allgegenwärtig waren –, dann verändert sich die Architektur. Die großen alten Kaufmannshäuser innerhalb des ersten Rings sind georgianisch, innerhalb des zweiten bestimmen viktorianische Gebäude das Bild, und innerhalb des dritten dominiert zunehmend der Waschbeton der Sozialbausiedlungen aus der Nachkriegszeit. Der vierte Ring beginnt kurz vor der Stadtgrenze und ist am weitesten vom Explosionspunkt entfernt. Dort liegen die neueren Siedlungen wie Castlepark und Bourtreehill, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren angelegt wurden, um die überquellenden Vororte von Glasgow zu entlasten.
Denn neben meiner Geburt hinterließ im Jahr 1966 ein zweites Großereignis seine Spuren in der Stadt: Im Rahmen eines staatlichen Siedlungsbauprojekts, das dem rapiden Wachstum der Elendsviertel und der Überbevölkerung in den Großstädten entgegenwirken sollte, wurde Irvine als fünfte und letzte schottische Gemeinde zu einer der sogenannten New Towns erkoren. Mit einem Mal floss Geld in die darbende Infrastruktur, und im vierten Zirkel erhoben sich reihenweise neue Häuser, um all diejenigen zu beherbergen, die in Scharen aus den baufälligen Mietskasernen der schottischen Hauptstadt an die Westküste flohen, um hier ein besseres Leben zu beginnen. Viele der Einheimischen, auch meine Mum, betrachteten die Zugezogenen aus der Großstadt als ernstzunehmende Bedrohung. Sie waren fest davon überzeugt, dass ein besseres Leben für die Menschen aus den berüchtigten Glasgower Elendsvierteln Govan und Ibrox das ihre zwangsläufig verschlechtern würde. Und das Leben in diesen neuen Siedlungen war wirklich besser. Auf den frisch angelegten Straßen von Castlepark, nur fünf Minuten von unserer Wohnung entfernt, glitzerten die Schottersteinchen im schwarzen Teer des Makadam-Belags wie winzige Kristalle. Die Häuser waren strahlend weiß wie Pfefferminzdragees, und überall wimmelte es von jungen Familien.
Die Grundschule von Castlepark öffnete 1970 erstmalig ihre Türen. Als ich dort ein Jahr später die erste Klasse besuchte, roch es noch immer nach Farbe und neuem Teppichboden. An heißen Sommertagen vermischte sich der scharfe Teeröl-Geruch von frisch imprägnierten Holzzäunen mit dem süßen Duft von gemähtem Gras. Wer sich einen visuellen Eindruck von den schottischen New Towns und diesen aufstrebenden Siedlungen zu Beginn der Siebzigerjahre verschaffen will, der sollte sich Michael Coulters Verfilmung von Bill Forsyths Roman Gregory’s Girl ansehen, die in Irvines Schwesterstadt Cumbernauld gedreht wurde. Die marmeladenfarbigen Sonnenuntergänge, deren Licht von den Baumkronen gefiltert wird, das satte Grün des Rasens, die leuchtenden Häuser und das blubbernde Saxofon, mit dem diese Bilder untermalt sind – das alles deckt sich genau mit meiner Erinnerung an diese Zeit.
1973 ging es uns gut. Dad hatte eine Anstellung als Hauselektriker auf der Baustelle für das neue Einkaufszentrum ergattert. Ein gewaltiges, umstrittenes Prestigeprojekt, das den Abriss der viktorianischen Brücke über den River Irvine erforderte, die bis dahin die Stadtmitte mit dem Bahnhof und dem Hafen verband. Nach ihrer Fertigstellung würde die neue Rivergate Mall den Fluss überspannen, mehr als fünfzig Geschäfte beherbergen und – als zentraler Knotenpunkt – an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr geöffnet sein. Es war das größte Bauvorhaben, das Irvine je gesehen hatte, und manchen war es Beweis genug, dass die Vorzüge der Neustadt vor allem zulasten der Altstadt gingen. Wir sahen das anders: Wir fanden es großartig, dass Dad Teil von etwas so Bedeutendem war.
Nach Abschluss der Bauarbeiten Ende 1975 erwartete uns eine weitere Überraschung: Dad war mit den 28 000 Quadratmeter Verkabelung so vertraut, dass der Bauherr, die Land Securities Group, ihm den Posten des Center-Managers anbot. Ein riesiger Schritt auf der Karriereleiter und überhaupt im Leben meines Vaters: Statt im Blaumann unter den Fußbodenbrettern herumzukriechen und Häuser zu verkabeln, verfügte er plötzlich über ein eigenes Büro, eine Sekretärin, einen Assistenten, einen Sicherheitsdienst und eine Putzkolonne. In den Anfangsjahren hielt ihn das Einkaufszentrum rund um die Uhr auf Trab. Ständig klingelte mitten in der Nacht das Telefon, weil der Alarm ausgelöst wurde; bei starkem Regen drang Wasser ein, es kam zu Stromausfällen und Störungen, laufend gingen Dinge kaputt. Manchmal nahm Dad uns mit, und wir stiegen mit ihm »das Rückgrat rauf«, den Zugangskorridor für die Hauselektrik, der unter der gesamten Länge des Dachs verlief, direkt über der Shoppingmeile. Es war ein enger Gang, etwa 1,80 Meter hoch, 1,20 Meter breit und gut 400 Meter lang. Jeder Quadratzentimeter Wand war vollgepackt mit Drähten, Kabeln, Röhren und Verteilerkästen. Alle paar Meter sorgte die funzelige Birne einer Gitterlampe für trübes Licht. Als ich einige Jahre später zum ersten Mal Alien sah, erschienen mir die unheimlichen und beklemmenden Korridore der Nostromo seltsam vertraut. Es erfüllte uns mit Stolz, dass Dad einen solch wichtigen Job für die Gemeinde innehatte. Und es sollte nicht mehr lange dauern, bis wir uns ein Häuschen in der Neubausiedlung leisten konnten, im Urlaub ins Ausland fahren und Dads alten Vauxhall Viva durch einen schicken marineblauen Ford Cortina ersetzen würden. Unsere Eltern legten jetzt Wert darauf, dass ihre Kinder ein »gesittetes« Englisch sprachen. Dad, der Chef des Einkaufszentrums, ging nicht mehr in den Pub. Kneipen wie The Turf oder Three Caws ließ er links liegen und verkehrte stattdessen in der Bar seines Golfclubs, in dem er neuerdings Mitglied war. Dort trank er niemals Bier, sondern stets Schnäpse, Whisky oder Limonade. Rückblickend mag es lächerlich wirken, aber es lässt sich nicht leugnen: Wir teilten ein diffuses Gefühl – sanft eingeimpft von meiner Mutter –, etwas Besseres zu sein als unsere Nachbarn aus Glasgow.
Die schottischen Frank und Mia
Unsere Eltern wurden in Irvine geboren. John, unser Dad, kam dort 1924 zur Welt und Jeanette, unsere Mum, fast zwanzig Jahre später, 1943. Um es frei nach Bob Dylan zu sagen: Als Mum sich auf die Welt kämpfte, war John gerade auf dem besten Weg, diese zu verlassen. Zumindest bemühte er sich nach Leibeskräften. Er war von dem Wunsch, Pilot zu werden, so besessen, dass er sich mit achtzehn Jahren bei der Royal Air Force meldete und dort sogar als Tail-End-Charlie diente. So nannten die Besatzungen der schweren Bomber die Männer am hinteren Bordgeschütz, von denen damals, Ende 1944, nur einer von zehn überlebte.
Hatte sie über dem Ärmelkanal ein deutscher Messerschmitt-Jäger erwischt, wurden die Überreste dieser armen Teufel einfach mit dem Wasserschlauch aus der Glaskugel im Heck der Lancaster gespritzt. Zum Glück machte Dads Farbenblindheit seinen Traum vom Fliegen zunichte, und er musste sich mit einem Posten beim Bodenpersonal begnügen, wo er das Elektrikerhandwerk erlernte und sich bis zum Unteroffizier hocharbeitete. Noch keine zwanzig, führte ihn der Militärdienst in die Maghreb-Staaten, nach Italien und Ägypten. In meiner Kindheit vermittelte er mir dennoch den Eindruck, als sei der Krieg für ihn größtenteils ereignislos verlaufen. Erst Jahre später erfuhr ich, dass mein Vater zu jener Zeit mit einem Mädchen verlobt war, das in der Munitionsfabrik von Ardeer – vom Hafen in Irvine nur ein kleines Stück die Küste runter – bei einer Explosion getötet wurde. Wie es für Männer seiner Generation nicht untypisch war, verlor er nie ein Wort darüber. Ende der Vierzigerjahre kam er nach Hause zurück und nahm eine Arbeit als Elektrotechniker an, um in den Fünfzigern – soweit es die Fotos aus dieser Zeit und auch alle sonstigen Hinweise vermuten lassen – ein von Golf, Scotch und glamourösen Urlaubstrips geprägtes Junggesellendasein zu führen, das Frank Sinatra zur Ehre gereicht hätte.
Er war ein stämmiger, klein gewachsener Kerl mit einem Golf-Handicap von zwei, einem heiseren, ansteckenden Lachen und einem Händchen für alle Arten von Schreiner-, Mechaniker- und Elektrikerarbeiten. Dass er gerne auf Tuchfühlung ging und seine Zuneigung auch körperlich mitteilte, unterschied ihn vermutlich von vielen Männern dieser Zeit. Er küsste und umarmte uns auch noch, als wir schon Teenager waren, und kam er am Samstagabend vom Golf nach Hause, liebte er nichts mehr als eine kleine Kabbelei auf dem Wohnzimmerteppich. Wenn Gary und ich mit ihm rangen, tauchten wir in eine Wolke aus Wohlgerüchen ein: Daddys Duft verband das Orangen-Aroma des Industrie-Handreinigers mit dem Odeur von Whisky, Zigaretten, Old Spice und dem leichten Gummigeruch, den die Griffe der Golfschläger auf seinen Handflächen hinterließen.
Mum ging mit fünfzehn von der Schule ab, um im benachbarten Saltcoats bei Boots zu arbeiten. Folgt man ihren Schilderungen, war die dortige Filiale der Drogeriemarktkette in den späten Fünfzigern das örtliche Äquivalent zu einem Luxuskaufhaus wie Harvey Nichols. Ihr älterer Bruder – unser Onkel Bob – war ein Golfkumpel unseres Dads, der im Laufe des Jahres 1964 sein Herz an unsere Mum verlor. Obwohl er zwanzig Jahre älter war, erwiderte sie seine Liebe, und 1965 heirateten die beiden. Für uns Kinder war der Altersunterschied nie ein Thema, auch dann nicht, wenn Dad beim Elternabend wieder mal als »euer Opa« bezeichnet wurde. Sehe ich mir heute die Fotos von ihrer Hochzeit an, fällt es mir schwer, dabei nicht an die junge Elizabeth Taylor zu denken, wie sie den gar nicht mehr so jungen Sidney James anhimmelt. Ich kann förmlich hören, wie mir Dads gackerndes Lachen aus den verblassenden Schwarz-Weiß-Bildern entgegenschallt. Doch was Mum an ihm so anziehend fand, liegt auf der Hand: Er hatte die Welt gesehen! Er besaß ein Auto! Er flog mit dem Flugzeug in den Urlaub! Einer 21-jährigen Verkäuferin aus der schottischen Provinz muss er erschienen sein wie Ol’ Blue Eyes, der sich geradewegs aus dem Sands Hotel & Casino hergebeamt hatte. Für meine Eltern, wie für viele andere aus ihrer Generation, war Frank Sinatra ein kultureller Fixstern. Es gibt einen bestimmten Schlag Schotten, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er zur musikalischen Untermalung seiner Beerdigung auf »My Way« besteht. Diese Menschen begreifen ihr Leben als tragische Odyssee, eine Reise epischen Ausmaßes, in deren Verlauf sie geliebt und gelitten, Eroberungen gemacht und Verluste erfahren haben, obwohl sie in Wirklichkeit niemals weiter als fünf Straßenzüge von ihrem Geburtsort entfernt lebten und sich dreißig Jahre lang jedes Wochenende im selben Pub betranken. Die schottische Kultur pflegt einen ausgeprägten Hang zur Selbstmystifizierung, wie ihn später auch mein Bruder an den Tag legen sollte. Was das Ehelichen jüngerer Frauen anging, wurde mein Vater von seinem Idol schon bald auf die Plätze verwiesen, als Sinatra 1966 Mia Farrow heiratete, die ganze dreißig Jahre jünger war als er. Im Gegensatz zu Frank und Mia, deren Ehe keine achtzehn Monate währte, liebten meine Eltern sich auch nach dreißig Jahren noch voller Leidenschaft – das kann ich mit Gewissheit sagen, denn ungeachtet unseres demonstrativ bezeugten Ekels wälzten die beiden sich am Samstagabend regelmäßig wie die Teenager auf dem Wohnzimmerteppich herum. Sehr viel besser gefiel es Gary und mir, wenn Dad sich mit uns auf dem Boden balgte. Wir kletterten auf diesem Bergmassiv von einem Leib herum, während er sich schlafend stellte, um uns dann einen mordsmäßigen Schrecken einzujagen, wenn er urplötzlich wieder zum Leben erwachte. Rückblickend bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich nur vorgetäuscht war: Als überaus talentiertem Schlummerkünstler gelang es ihm tatsächlich, ein kurzes Nickerchen einzulegen, während Gary und ich auf ihm herumkraxelten. Dann packte er uns, kitzelte uns kräftig durch und grub seine Finger – so kräftig wie unsere Handgelenke – gnadenlos in unsere Bäuche und Oberschenkel. Wir quietschten vor Vergnügen, während er unsere Gesichter aneinanderdrückte, Wange an Wange, um uns beide gleichzeitig zu »bartbürsten«. Seine Stoppeln kratzten wie Sandpapier, bis schließlich aus dem Fernseher die Grandstand-Melodie ertönte. Die Trickfilmzeit war vorbei, und mit dem Sport begann das Abendprogramm.
Staunend studierten wir seine Haut, untersuchten die Falten und die tiefen, offenen Poren, wie Risse und Krater in einer steinzeitlichen Felswand. Fast ein halbes Jahrhundert später werde ich beim Betrachten meines eigenen Gesichts mit dem gleichen Teint konfrontiert. Wenn ich im Bad eines Hotels einen dieser höllischen Kosmetikspiegel mit Teleskoparm vorfinde, die aussehen, als würden sie eigentlich in einen Operationssaal gehören, komme ich seit einiger Zeit in den fragwürdigen Genuss eines Anblicks, der mir stets von Neuem in Erinnerung ruft, was uns an Dads Haut so fasziniert hat: gullygroße Poren und ganze Galaxien geplatzter Blutgefäße. In den zahlreichen Gräben und Winkeln meines Gesichts spukt der Geist eines Elektrikers.
Die früheste Erinnerung, die ich von Gary und mir habe, ist ihm sicher nicht im Gedächtnis geblieben, dafür war er einfach zu jung: Ich stehe auf dem Fenstersims der Wohnung in der Martin Avenue, hinter mir liegt Gary in den Armen meines Vaters. Dad hat uns aus dem Bett geholt, um in den nächtlichen Himmel über uns zu blicken, wo in diesem Moment Geschichte geschrieben wird. Es ist der 21. Juli 1969. Neil Armstrong tritt von der Leiter der Mondfähre. Seine bleibeschwerten Stiefel sinken sanft in den grauen Staub.
In der Literatur herrscht weitgehend Einigkeit, dass sich unsere frühesten Erinnerungen ungefähr im Alter von dreieinhalb bilden. Ich bin damals drei Jahre und drei Monate alt. Gary feiert in zehn Tagen seinen ersten Geburtstag. Wie jede frühe Erinnerung wirft sie die Frage auf, ob ich sie tatsächlich selbst gebildet habe oder ob mir die Szene durch die Erzählungen meiner Familie nachträglich ins Gedächtnis implantiert wurde. Erst eingepflanzt, dann jahrelang gewienert und poliert, bis ich mich ein halbes Jahrhundert später so exakt daran erinnere wie daran, was ich heute Morgen gefrühstückt habe: zwei kleine Jungs – ein Kleinkind und ein Baby –, hinter ihnen ihr Dad. Zärtlich drückt er Gary an sich, und seine freie Hand liegt stützend in meinem Kreuz, damit ich nicht versehentlich vom Fenstersims falle. »Da oben laufen Menschen herum. Jetzt, in diesem Augenblick«, beschreibt Dad das Ereignis, das gleichzeitig im Schwarz-Weiß-Fernseher hinter uns übertragen wird, und tippt gegen die Fensterscheibe, als er auf den blass leuchtenden Zinnteller am Himmel zeigt. Die Aufregung in seiner Stimme ist absolut nachvollziehbar: Sein eigener Vater war Hufschmied und erblickte das Licht der Welt im Jahr 1898, als die gepflasterten Straßen von Irvine noch vom Klappern der Pferdehufe widerhallten. Fünf Jahre bevor sich die Gebrüder Wright in Kitty Hawk in die Luft erhoben.
Ein Freitagabend im Oktober 1971. Die Uhren sind noch nicht auf Winterzeit umgestellt. Sogar nach einundzwanzig Uhr sind die Abende an der schottischen Westküste so lau, dass Dad noch auf dem Golfplatz ist. Mum, mein Bruder und ich sitzen in der Martin Avenue vor dem Fernsehapparat. Denn 1971 halten die Abendstunden ein ganz besonderes Vergnügen bereit …
Gary ist drei, ich bin fünf. Wir haben uns beim Eiswagen mit Leckereien eingedeckt – Fry’s Pfefferminzeis, Fry’s Schokoriegel und eine ganze Flasche Currie’s Red Kola – und warten auf unsere neue Lieblingssendung: Die Zwei. John Barrys majestätische und elegante Titelmelodie untermalt den Vorspann, der uns mit den beiden Helden bekannt macht: Lord Brett Sinclair – gespielt von Roger Moore, dessen James-Bond-Zeit noch vor ihm lag – ist ein feiner Pinkel, der die besten Schulen und Universitäten des Landes besucht hat. Sein Kompagnon heißt Danny Wilde und wird verkörpert von Tony Curtis, der am Set als unnachgiebiger Dickkopf verschrien war – was Danny wollte, das wollte er nun mal –, der immer Probleme machte. Danny ist den Slums der Bronx entkommen, indem er zur Navy ging, um später eine große Nummer im Ölgeschäft zu werden. Wie man das eben so macht. Beide sind millionenschwere Playboys, und gemeinsam – na klar – lösen sie Verbrechen. Gary und ich sitzen rechts und links von Mum auf der Couch, naschen Schokolade und nuckeln Red Kola. Hingerissen starren wir auf die Bilder von exotischen Orten wie Monaco und Saint-Tropez. Wir sehen zu, wie sich Dom Perignon schäumend in Pyramiden aus Champagnerkelchen ergießt, staunen über rotierende Roulette-Räder, rasante Wasserski-Einlagen und andere Dinge, die den Horizont des beschaulichen Ayrshire weit übersteigen.
Wenn wir anschließend im Kinderzimmer mit unseren Spielzeugpistolen Die Zwei spielen, habe ich ein Taschentuch um den Hals geknotet – eine Art behelfsmäßige Krawatte – und bestehe darauf, Brett Sinclair zu sein. Diese Rolle beflügelt offenbar jene alberne Vorstellung, die sich bereits damals in meinem Köpfchen einnistet: dass Champagner, Auslandsreisen und Roulette für mich womöglich nicht gänzlich unerreichbar sind. Tony Curtis’ Figur überlasse ich stets Gary. Gewöhnlich dauert es nicht lange, dann geht es los …
»Nee, tu ich nicht! Halt die Klappe! Lass mich! Ich will das nicht!«
Mum schreitet ein, um die Kabbelei zu beenden.
Gary macht immer Probleme am Set.
Welche Dynamiken prägen das Verhältnis zwischen Geschwistern? Ein Thema, mit dem man sich ewig beschäftigen und zu dem man viele Regalmeter Fachliteratur studieren kann.
Als Erstgeborener bekomme ich zwei Jahre lang Mums ganze, ungeteilte Aufmerksamkeit. Mein erstes Wort spreche ich laut Familienüberlieferung im Alter von sechs Monaten: »Benzin«. Ich bin noch kein Jahr alt, da artikuliere ich bereits in ganzen Sätzen. Mum sitzt im Sessel am Wohnzimmerfenster und ich auf ihren Knien. Gary gluckst in seinem Gitterbettchen, während sie mir immer wieder aus Struppi an der See vorliest. Der Duft ihres Haars. Im Alter von vier Jahren kann ich alleine lesen. Mum besorgt mir einen Büchereiausweis, und das erste Buch, das ich mir ausleihe, ist ein Abenteuerschmöker über Militärflieger. Denn wenn ich groß bin, will ich zur Royal Air Force, genau wie mein Dad.
Mein Bruder braucht länger, bis er spricht … weil ich ihm alles abnehme. Wenn ihn Besucher, Freunde meiner Eltern oder unsere Großeltern etwas fragen, springe ich für ihn ein, während er noch über die Antwort nachdenkt. Ich spreche für ihn. Jede Frage, die an uns beide gerichtet ist, wird von mir schneller beantwortet. Nach einer Weile lässt Gary es einfach geschehen.
Im Sommer 1973 wird unsere Schwester Linda geboren. Auf der Straße bleiben wildfremde Menschen stehen, um dieses blonde, engelsgleiche Wesen zu bewundern. Sie reden girrend und glucksend auf Linda ein, und manchmal werfen sie ein paar Kupfermünzen in ihren Silver-Cross-Kinderwagen. Sie macht Gary zum Sandwich-Kind.
Und da wartet auch schon das nächste Bücherregal: Theorien über Sandwich-Kinder. Bevor wir dieses Thema vertiefen, gilt es allerdings zu betonen, dass sie genau das sind: nämlich Theorien. Nicht wenige davon sprechen dem ältesten Kind die besten Chancen zu, dass die Eltern ihm Verantwortung übertragen und es in den Genuss von Privilegien kommt, wodurch es an Selbstbewusstsein und Durchsetzungsfähigkeit gewinnt. Das jüngste der Geschwister wird dagegen verhätschelt und verwöhnt. Nur dem mittleren Kind bleibt keine klare Rollenzuordnung. Es muss selbst eine entwickeln. Linda kann gurren und brabbeln, ich kann Monologe halten.
Gary findet andere Wege, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Die Macht des Mumms
Unsere liebste Kinderserie ist Mary, Mungo and Midge. Die Zeichentrickserie, deren grober Strich an sowjetische Propagandafilme erinnerte, war einer der ersten Versuche des Kinderprogramms der BBC, sich mit dem modernen Großstadtleben auseinanderzusetzen. Mary wohnt zusammen mit ihrem Hund Mungo und ihrer Maus Midge im obersten Stock eines Londoner Hochhauses. Als ich mir kürzlich noch mal eine Folge auf YouTube anschaute, fiel mir auf, dass das Haus südlich der Themse in Battersea direkt am Flussufer stand, sodass der Wert der Wohnung heute vermutlich im siebenstelligen Bereich läge. In jeder Episode verließ das Trio sein Zuhause, um irgendeine Besorgung zu machen. Alleine fuhren sie im Lift nach unten und zogen los. Dass sie ohne die Begleitung Erwachsener durch die Straßen von London streiften, erfüllte mich damals mit einem ähnlichen Unbehagen wie »Chirpy Chirpy Cheep Cheep«. Die Serie brachte es nur auf eine einzige, dreizehn Folgen umfassende Staffel, erstmals ausgestrahlt im Oktober 1969, als ich dreieinhalb und Gary gerade mal fünfzehn Monate alt war. Ein paar Jahre später bekam mein Bruder zum Geburtstag einen Hund mit Rädern: ein schwarzbrauner Plastik-Beagle mit roten Lenkergriffen über den Schlappohren und einem Rad unter jeder Pfote. Gary taufte ihn auf den Namen Mungo und liebte ihn mehr als alles auf der Welt.
Ein Teil der Martin Avenue war Fußgängerzone, mit Reihenhäusern auf beiden Seiten und von niedrigen Schutzgittern aus Metall umsäumten Bäumen in der Straßenmitte. Bei schönem Wetter spielten die Vorschulkinder den ganzen Tag an der frischen Luft. Hielten sich die Mütter nicht in ihren gepflegten Vorgärten auf, sahen sie durch die Stores oder die damals als sehr viel schicker geltenden Jalousien vor den Küchenfenstern zu. Die Straße verlief von Nord nach Süd einen sanften Hang hinunter. Das Gefälle war gering, aber es reichte aus, um Mungo zu beschleunigen. Unter den bewundernden Blicken der anderen Kinder bestieg Gary sein Gefährt, rollte bergab, holte mit seinen Füßchen Schwung, wurde immer schneller, bis er sich früher oder später zu weit nach vorn lehnte und mit lautem Geheul über den Lenker flog. Das Ergebnis: blutige Lippen, aufgeschlagene Knie, blaue Flecken, Beulen und Tränen. Wie alle kleinen Kinder brauchte er eine Schrecksekunde, um mit großen Augen und stockendem Atem das Ausmaß der Verletzungen und des damit einhergehenden Schmerzes zu registrieren, bevor das große Wehklagen begann. Dann eilte Mum herbei, half ihm auf die Füße, hielt ihm eine Standpauke, beorderte den derart blamierten Helden nach Hause zurück und beschwor ihn, diesen Unsinn künftig zu unterlassen. Aus gutem Grund, denn an ihrem unteren Ende traf die Martin Avenue auf die Patterson Avenue, den Ozean, in den unser kleiner Nebenfluss mündete. Und die Patterson Avenue war das Gegenteil einer Fußgängerzone. Hier hatten die spritfressenden Monster der frühen Siebzigerjahre das Sagen. Sie wurde beherrscht vom Ford Zephyr, Ford Zodiac, Austin Allegro und Hillman Hunter. Senfgelb, leuchtend blau und knallorange lackiert, die chromglänzenden Kühler wie Reißzähne fletschend, rasten sie mit jaulenden Motoren vorbei. Was Gary nie davon abhielt, am nächsten Tag wieder vor seinen begeisterten Fans auf der Martin Avenue zu erscheinen, im Schlepptau den quietschenden Mungo mit seinen Gummirädern. Erneut schwang er sich in den Sattel, abermals rumpelte sein treues Reittier bergab, ein nachsichtiges Lächeln auf den Lefzen des bunt bemalten Hundegesichts mit den ausdruckslosen Augen. Staunend verfolgten die anderen Kinder seine Talfahrt (»Schau mal, der Gary!«), während ihre nervösen Blicke immer wieder zu den Gärten, Vorhängen und Jalousien wanderten, in banger Erwartung einer Standpauke – die dann gewöhnlich auch erfolgte.
»GARY! GARYNIVEN! SCHLUSSDAMIT! LASSDASSEIN! HALTSOFORTAN!«
Aber auf die Bremse zu treten, entsprach so gar nicht Garys Naturell. Er rumpelte weiter den Hügel hinunter, schneller und immer schneller, quietschend und lachend, das dunkelblonde Haar vom Fahrtwind zerzaust.
Heißa!
Wieder spielen Gary und ich bei uns im Vorgarten. Wie Brummkreisel drehen wir uns im Kreis. Aus Gründen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, will oder jemals werde, halten wir beide Steine in unseren Fäusten. Mum ist mit dem Abwasch beschäftigt und sieht durchs Küchenfenster zu uns herüber, als Gary ohne jede Vorwarnung eine seiner Fäuste öffnet und der Schwung der Drehung den Kiesel geradewegs in die Fensterscheibe befördert. Ist ihm der Stein aus der Hand gerutscht? Hat er ihn absichtlich geworfen? Kann ein fünfjähriges Kind verstehen, was es tut, und dafür zur Verantwortung gezogen werden? Was auch immer der Grund gewesen sein mag, das Geräusch der splitternden Scheibe und den darauffolgenden Schrei habe ich heute noch in den Ohren.
Zum Glück bleibt meine Mutter unversehrt. Gary bekommt sein Fett weg. Vor allem später, nachdem Dad heimgekommen ist und die Worte ausstößt, die wir an diesem Abend nicht zum ersten Mal hören: »Was zum Teufel hast du jetzt wieder angestellt?«
Und dann bezieht er Prügel.
Wie viele andere aus ihrer Generation wurden meine Eltern bei der Erziehung hin und wieder handgreiflich. Dad legte uns übers Knie und versohlte uns den Hintern. Wenn Mum sich nicht anders zu helfen wusste, griff sie zur Leine unseres Cockerspaniels Candy und schlug uns mit dem dünnen roten Lederriemen auf die Beine. Häufig vergoss sie Tränen, während oder nachdem sie uns auf diese Weise diszipliniert hatte. Als wir größer und die Schläge weniger effektiv wurden, mussten wir uns manchmal zusammenreißen, um nicht zu lachen, wenn sie uns verdrosch.
»Warum?«, frage ich meinen Bruder, als wir dank seines Steinwurfs beide bei strahlendem Sonnenschein im Bett liegen. Von draußen dringen der Lärm spielender Kinder und das Bimmeln des Eiswagens in unser Gefängnis, während im Wohnzimmer die Erkennungsmelodie der Sketch-Show The Goodies und Dads Gelächter ertönen. Gary zuckt bloß mit den Schultern.
Der heiße Sommer des Jahres 1976 scheint niemals enden zu wollen. Gary und ich sind jetzt acht beziehungsweise zehn Jahre alt. Wir spielen am Foxes Gate im Wald am nördlichen Stadtrand. Einem Teich, der sich in den letzten Frühlings- und ersten Sommertagen bei den Kindern von Irvine besonderer Beliebtheit erfreut, die sich im dunklen Wasser drängen, um Frösche zu sammeln. Unter den fleißigen Jägern, von denen jeder versucht, möglichst viele der begehrten Amphibien zu erwischen, sind an jenem Tag auch ein paar größere Jungs, darunter Steven Parker, der nicht weit von uns wohnt. Steven ist etwas älter als alle anderen. Wir sprechen hier von den Siebzigern, Begriffe wie »neurodivergent« gibt es damals noch nicht. Also ist Steven einfach »Trottel-Steven«, ein älterer Junge, der gerne mit kleineren Kindern abhängt.
Die meisten von uns haben sich ihrer Schuhe und Socken entledigt. Wir waten immer tiefer ins Wasser, denn die Froschkonzentration wird höher, je weiter man hineingeht. Ich stehe bereits bis zu den Schenkeln im Teich, als ich spüre, wie etwas über mich hinwegfliegt. Irgendwo vor mir platscht es, und sofort ertönt lautes Gejohle. Ich drehe mich um und sehe, dass mein Bruder von den anderen Kindern bejubelt wird. In meiner Erinnerung heben sie ihn sogar auf ihre Schultern – wie einen Fußballer, der seinen Verein zum Pokalsieg geschossen hat.
Gary hat Stevens Schuhe mitten in den Teich geworfen.
Sofort bricht Steven in Tränen aus.
Wir sind Arbeiterkinder. Schuhe sind teuer. Seine Mum wird ihn umbringen. Einen Augenblick später schwimme ich deshalb in dem trüben braunen Wasser und versuche panisch, die Schuhe zu bergen. Ich zittere und weine vor Angst. Meine Landsleute im Alter zwischen fünfundvierzig und sechzig Jahren wissen genau, warum: Die Mittsiebziger waren die Ära von The Spirit of Dark and Lonely Water, diesem furchteinflößenden Aufklärungsfilm, bei dessen Fernsehausstrahlung eine ganze Generation schreiend aus dem Zimmer rannte. In dem neunzigsekündigen Meisterwerk spielt eine Gruppe Kinder ausgelassen am Wasser, ohne die teuflische, gesichtslose Gestalt in der braunen Kutte zu bemerken, die im Hintergrund lauert und der niemand Geringeres als Donald Pleasence seine sanfte, unheilvolle Stimme lieh. Eine Stimme, die Gary und mich ein paar Jahre später in John Carpenters Film Halloween noch einmal zu Tode erschrecken sollte. Sie warnt die Kinder vor den Gefahren des Spielens am Wasser, davor, in ungesicherten Seen und Bächen zu schwimmen, und damit genau vor dem, was ich gerade mache. Todesmutig bewege ich mich auf das Schilf in der Teichmitte zu. Jeden Moment – davon bin ich überzeugt – wird die düstere Gestalt hinter den größeren Jungs am Ufer auftauchen, und dann hat mein letztes Stündlein geschlagen. Ich meine zu spüren, wie mein Fuß sich an einem versunkenen Bettgestell verfängt, wie eine Strömung mich mitreißt, wie knochige Finger nach meinem Knöchel greifen …
»Der dumme Junge will sich vor seinen Kameraden aufspielen. Nach den Schuhen zu suchen, die sein kleiner Bruder in den Teich geworfen hat, ist blanker Irrsinn …«, kommentiert Donald Pleasence mein nahendes Verhängnis. Doch wider Erwarten ertrinke ich nicht, und – kaum zu glauben – beim dritten oder vierten Tauchgang finde ich die Schuhe. Zu meiner Überraschung brandet lauter Jubel auf, als ich klitschnass aus dem Teich steige. Die anderen Jungs umringen mich, strecken mir ihre Hände entgegen, wollen mich berühren. Und das alles nur, weil ich Stevie Parkers Kunstledertreter gerettet habe? Nein, natürlich nicht.
Ich bin von oben bis unten mit Fröschen bedeckt; als trüge ich einen bizarren Froschanzug. So eine Art Kampfrüstung, wie Stammeskrieger sie aus der Haut und den Knochen ihrer Feinde anfertigen. Warlords wie der Kurgan im Film Highlander – wenn der Kurgan ein Zehnjähriger mit einem Faible für Frösche wäre. Die Erinnerung an die Frösche, die sich an meinem T-Shirt und sogar in meinem T-Shirt festklammerten, und an die glibberigen, sagopuddingartigen Laichstränge lässt mich heute noch mit den Zähnen knirschen. Die Jungs fallen über mich her und pflücken die glücklosen Amphibien von meinem Körper. Glücklos, weil die Aussichten dieser bemitleidenswerten Wesen in der Regel nicht gerade rosig waren. Ein langsamer, sanfter Tod in einem Eimer mit Leitungswasser war nur manchen vorbehalten. Die kurze Lebenszeit, die denen blieb, die in die Fänge der Raufbolde aus Glasgow oder von der Winton Road gerieten, hielt in der Regel unerfreuliche Begegnungen mit Feuerwerkskörpern und Kricket- oder Tennisschlägern bereit: Das Letzte, was die meisten dieser Frösche von der Welt erhaschten, war ein verschwommener Panoramablick auf Ayrshire. Nachdem sie zwanzig Meter hoch in die Luft geworfen wurden, ereilte sie der sofortige Tod. Doch selbst dieses Schicksal war dem jener Zeitgenossen vorzuziehen, die das schrecklichste Ende von allen erwartete: langsames Aufblasen mit einem durchs Rektum eingeführten Strohhalm.
Gary und ich treten den langen Heimweg an. Durch die Eglinton Woods, die dank zahlreicher zerfledderter Penthouse- und Playboy