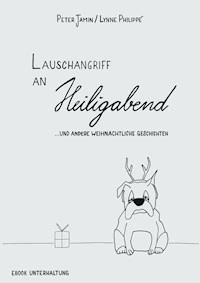9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein hochspannender Blick auf spektakuläre Kriminalfälle – Peter Jamin beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Vermisstenfällen und hat die eindrücklichsten Schicksale und dramatischsten Geschichten zusammengetragen. Ein Student verschwindet, taucht 15 Jahre später in New York als Bäckereiaushilfe wieder auf – und stirbt, bevor ihn seine Eltern besuchen können. Ein junger Mann bittet im Fernsehen um Unterstützung bei der Suche nach seiner Ehefrau. Was erst später bekannt wird: Er hat die Frau erschlagen und im Keller seines Hauses einbetoniert. Ein Lehrling verschwindet, macht in Asien Karriere, heiratet mehrmals – und kehrt schließlich nach 30 Jahren schwer erkrankt zu seinen Eltern zurück, um zu Hause zu sterben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Peter Jamin
Ohne jede Spur
Wahre Geschichten von vermissten Menschen
Über dieses Buch
Ein hochspannender Blick auf spektakuläre Kriminalfälle – Peter Jamin beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Vermisstenfällen und hat die eindrücklichsten Schicksale und dramatischsten Geschichten zusammengetragen. Ein Student verschwindet, taucht 15 Jahre später in New York als Bäckereiaushilfe wieder auf – und stirbt, bevor ihn seine Eltern besuchen können. Ein junger Mann bittet im Fernsehen um Unterstützung bei der Suche nach seiner Ehefrau. Was erst später bekannt wird: Er hat die Frau erschlagen und im Keller seines Hauses einbetoniert. Ein Lehrling verschwindet, macht in Asien Karriere, heiratet mehrmals – und kehrt schließlich nach 30 Jahren schwer erkrankt zu seinen Eltern zurück, um zu Hause zu sterben.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2019 by Peter Jamin
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Umschlaggestaltung zero-media.net, München
Umschlagabbildung Michael Seelbach
ISBN 978-3-644-40546-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Was fühlt eine Mutter, die Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr im Kinderzimmer auf die Rückkehr ihrer einzigen Tochter wartet? Was macht es mit einer Familie, die verzweifelt ihr 16-jähriges Mädchen im Internet sucht? Und wer ist dieser Mann im Anzug, der mit seiner Aktentasche an der Autobahn steht und schließlich mit einem Lkw in Richtung Spanien trampt?
In diesem Buch erzähle ich Geschichten von Menschen, die, ohne eine Spur zu hinterlassen, verschwunden sind. Und ich erzähle von denjenigen, die sie vermissen und auf die Suche gehen.
Es sind wahre Geschichten. Schicksale, die mich in den vielen Jahren meiner Arbeit besonders berührt und bis heute nicht losgelassen haben.
Einige dieser Geschichten gehen gut aus, andere nicht.
Peter Jamin
Vorworte von Leser*innen
«Diese Geschichten haben mich sehr berührt und aufgewühlt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas tatsächlich passiert.»
Jürgen Schneider, Lehrer, Düsseldorf
«Die spannend erzählten Einzelschicksale zeigen eindrucksvoll die verzweifelte Suche nach vermissten Menschen. Absolut lesenswert.»
Kai Winckler, Chefredakteur, Hamburg/Offenburg
«Packende Geschichten. Mitreißende Emotionen. Erschreckend wahre Einblicke in das Schicksal vieler Familien.»
Nicole Niewiadomski, Autorin und Marketing-Expertin, Düsseldorf
«Kein Mensch weiß, was mit den Angehörigen passiert, wenn ein Mensch verschwindet. Der Autor erzählt uns das eindrucksvoll. Jeder denkt, dass die Polizei hilft – dabei macht sie in den meisten Fällen nichts.»
Nicola Manns, Lifecoach, Düsseldorf
«Diese Geschichten haben ungewöhnliche Wendungen. Aus einer harmonischen Situation wird zum Beispiel ein totales Chaos.»
Tamar Mandaria, Literaturwissenschaftlerin und Lehrerin, Düsseldorf/Tbilisi
«Sehr greifbare und bewegende Kurzgeschichten mit Platz für Kontemplation.»
Pauline Merzenich, Merchandise-Controllerin Mode, Düsseldorf
«Der Autor macht mit seinen Kurzgeschichten auf dunkle Seiten unserer Gesellschaft aufmerksam, die die meisten von uns nicht kennen.»
Jürgen Spreemann-Michaelsen, Fernsehjournalist, Pulheim
«Wahre Geschichten von verschwundenen Menschen, berührend und manchmal einfach unglaublich.»
Lydia Gruber, Vertriebsreferentin, Leipzig
Zur Rolle des Autors
Vor 25 Jahren las ich in einer Tageszeitung eine Polizeistatistik. In Deutschland wurden jedes Jahr rund 100000 Menschen bei der Polizei als vermisst registriert. Was steckt hinter diesen Fällen, fragte ich mich. Warum verschwinden Menschen?
Mit der WDR-Fernsehdokumentation «Vermisst – Über Menschen, die verschwinden, und jene, die sie suchen» und dem Hintergrundbericht «Das Schlimmste ist die Ungewissheit» in der Wochenzeitung Die Zeit fand ich großes öffentliches Aufsehen. Erstmals wurden die Probleme der jährlich rund 500000 betroffenen Angehörigen von Vermissten umfassend und mit ihren sozialen Aspekten zur Sprache gebracht. Beeindruckt von der Fülle der Erfahrungen, entwickelte ich anschließend eine Fernsehreihe, «WDR – Vermisst», die mehrere Jahre lang wöchentlich ausgestrahlt wurde.
Aber auch danach ließ mich das Thema nicht los. Weil ich feststellte, dass Behörden wie Politik, Helfer-Initiativen wie Wissenschaft die Vermissten und ihre Angehörigen weitgehend sich selbst überließen und das Thema allein auf die Polizei abschoben, gründete ich ein Vermisstentelefon.
Die Polizei registriert zwar die Vermisstenfälle, aber hilft den Angehörigen in der Regel nicht. Fortan beriet ich Betroffene ehrenamtlich. In mehr als 2000 Fällen konnte ich bislang helfen und erfuhr dabei von Schicksalen, die für Außenstehende kaum vorstellbar sind.
Die Geschichten von Vermissten spiegeln die meisten Probleme der Menschen in unserer Gesellschaft wider: Versagensängste, Mobbing, Verschuldung, Eheprobleme, Schwierigkeiten in Schule, Studium und Beruf, Demenz, Depressionen und andere Krankheiten, Missbrauch und Misshandlung, Gewalt in der Familie und vieles mehr. Die Geschichten der Angehörigen von Vermissten zeigen, wie hilflos und verzweifelt sie sind – sie gehen buchstäblich durch die Hölle. Ein Prozent der Vermisstenfälle, also etwa tausend im Jahr, sind Gewalttaten – Entführung, Mord oder Totschlag. Doch verständlicherweise gehen Angehörige oft direkt vom Schlimmsten aus.
In diesem Buch möchte ich den Betroffenen eine Stimme geben. Die Geschichten sind wahr, aber sie geben die Wirklichkeit natürlich aus einem besonderen Blickwinkel wieder. In manchen Geschichten stelle ich besonders intensive Momente in den Mittelpunkt der Handlung.
Meine Arbeitsweise entspricht etwa der des Schriftstellers und Rechtsanwalts Ferdinand von Schirach, der über seine eigenen Kurzgeschichten sagt: «Die Geschichten sind nicht eins zu eins eine Wiedergabe der Wirklichkeit. Sie müssen sich das so vorstellen, vielleicht wie in einer alten Druckerei, Sie erinnern sich, da gibt es so schöne Setzkästen aus Holz, und in denen ist dreißig Mal das A und zehn Mal das E. Als Strafverteidiger habe ich in fünfundzwanzig Jahren eben viele Menschen kennengelernt und viele Situationen erlebt, und die setze ich in den Geschichten neu zusammen. Sie geben nicht die Wirklichkeit wieder, aber die einzelnen Teile sind vollkommen wahr.»
Dieses Buch ist aber auch Faction – Fakten und Fiktion ganz dicht an der Wahrheit entlang geschrieben. Die Basis der folgenden Short Storys sind reale Fälle, wobei ich mich in die Protagonisten hineinversetze und das Geschehen teilweise aus ihren Blickwinkeln – im erzählenden Stil des amerikanischen «Literary Journalism» – beschreibe. So ist es möglich, das Handeln und Tun wie auch die Emotionen und Beweggründe von Angehörigen wie Vermissten intensiver zu vermitteln.
Die Identität der Betroffenen wurde selbstverständlich anonymisiert.
EinsVon Abschied und Verzweiflung
«Jeder Mensch ist sehr allein.»
Marcel Proust
Legt mir ihre Leiche vor die Tür
Maria Kramer sagte einmal zu mir: «Es überfällt mich immer wieder ein fürchterlicher Schmerz und eine Trauer, und ich denke, dass es einfach unmenschlich ist, was da passiert ist. Und dann entwickelt sich ein Zorn auf den Täter, der dafür gesorgt hat, dass Annegret nie wieder nach Hause kommt.»
Solche Sätze sind immer in Marias Kopf. Sie sitzt im Zimmer ihrer Tochter auf dem Bett, starrt in den Spiegel neben der Tür. Sie schaut in ihre eigenen Augen und erschrickt. Ihr Blick ist voller Trauer, hart und leer.
Sie sieht sich um. Nichts hat sie verändert. Alles ist wie früher. Wie vor fünf Jahren. Keinen Gegenstand hat sie weggeworfen. Die Schranktür ist noch immer halb geöffnet, die Kleidung darin geordnet. Die Bücher für das Studium stehen im Regal und auf dem kleinen Schreibtisch unterm Fenster. Bleistift, Radiergummi, Kugelschreiber, gelber Marker und ein kleiner Zettel mit der handschriftlichen Notiz «Montag Reinigung» liegen in einer kleinen schwarzen Schale. Alles ordentlich und abgestaubt.
Maria blickt an sich hinunter. Ihr Körper ist ihr so fremd geworden wie ihr Leben, das sie seit dem Verschwinden ihres kleinen Mädchens führt. Mit den Jahren und den ständigen Gedanken an ihre Tochter hat sie an Gewicht zugenommen. Ihre weiße Bluse mit den kleinen roten Rosen ist schmutzig. Am Bauch klafft ein breiter Riss. Sie ist gerade von einem Spaziergang aus dem nahegelegenen Wald heimgekehrt. Wieder hat sie keinen Blick für die Schönheit der Natur gehabt. Wieder ist sie abseits des Wegs gegangen. Wieder ist sie durch dichtes Gestrüpp, durch Kornfelder und über sumpfige Wiesen gestapft. Hat hinter Bäume und Büsche geschaut und sich ihre Bluse zerrissen, als sie eine Böschung hinuntergestürzt ist.
Maria Kramer kann nicht mehr wie andere Menschen ganz normal spazieren gehen. Nicht mehr wie früher unbeschwert durch die Natur wandern. Das flirrende Spiel der Vögel beobachten. Die Pflanzen am Wegrand betrachten. Den Duft von Gras und Blumen tief einatmen. Wenn Maria in den Wald geht, ist sie immer auf der Suche.
Maria sucht ihre Tochter. Die Überreste ihres toten Körpers. Vertrocknete, bröselnde Knochenstücke vielleicht. Oder einen verblichenen Fetzen Kleidung. Irgendetwas, das noch da ist von ihrer Annegret, die ihr nach so langer Zeit noch immer so nah und doch so fern ist. Nach der sie sich so unendlich sehnt, um die sie aus tiefstem Herzen trauert. In manchen schwachen, besonders verzweifelten Stunden sagt Maria: Legt mir doch endlich ihre Leiche vor die Tür!
An einem Juliabend vor fünf Jahren verlässt Annegret Kramer ihr Elternhaus, um ihre Freundin Emma zu besuchen. Die beiden jungen Frauen studieren gemeinsam Theaterwissenschaften, haben sich in der Mensa der Universität kennengelernt. Emma besorgt eine Flasche Weißwein, Annegret bringt spanische Tapas mit.
«Wir hatten uns an diesem Abend vorgenommen, nicht so lang zu machen», erinnert sich Emma später bei der Befragung durch die Polizei. «Wir wollten früh am nächsten Tag miteinander telefonieren, um uns für einen Ausflug mit dem Fahrrad zu verabreden. Es war doch so schönes Wetter.»
Das Dunkel der Nacht hat sich gerade erst über Büsche und Bäume und Gassen gelegt, als sich Annegret Kramer um 22 Uhr auf den Weg nach Hause macht. Es sind nur zehn Minuten Fußweg. Die 20-Jährige wohnt noch bei ihren Eltern. Ihr ehemaliges Kinderzimmer ist jetzt ihre Studentenbude, wie sie sagt.
Fünf Jahre später sitzt Maria Kramer wieder einmal, wie so oft, in diesem Zimmer. Vom Flur im Erdgeschoss des Einfamilienhauses führt eine schmale Treppe hinauf in den ersten Stock. Eine Couch, ein Bett mit einer braunen Wolldecke, ein Schrank aus den fünfziger Jahren, von der Oma geerbt, einige Poster mit Theaterszenen an der Wand, ein Ohrensessel – auch von der Oma –, eine Stereo-Anlage, viele Bücher. Die Mutter sitzt auf der Couch und überlegt, wie sie das Zimmer verändern könnte. Schon seit Monaten hat sie sich immer wieder mit diesem Gedanken beschäftigt. Welche Sachen sollte sie aufbewahren? Was könnte sie wegwerfen?
Woche für Woche, Monat für Monat immer die gleichen Gedanken. Immerhin kann sie inzwischen hinaufsteigen in das Zimmer der Tochter. Die ersten zwei Jahre nach dem Verschwinden von Annegret kann Maria das Zimmer nicht betreten. Jeder Schritt, jede Stufe ist eine seelische Qual. Sobald sie einen Fuß über die Schwelle setzt, bricht sie in Tränen aus.
Irgendwann schafft sie es dann doch. Sie beschließt sogar, einige von Annegrets Sachen zu verschenken. Doch die Freundinnen ihrer Tochter wollen die Sachen nicht. Sie können sich nicht vorstellen, Annegrets Kleidung zu tragen, weil ihnen das Verschwinden der Freundin so nahegeht. Jedes Stück würde sie tagtäglich an die verschwundene Freundin erinnern. Und diese Erinnerungen sind laut und schmerzhaft.
Die Eltern, Maria und Heinz, waren für eine Woche bei Verwandten zu Besuch. So fiel nicht auf, dass die Tochter in der Nacht zum Samstag nicht nach Hause kam. Am nächsten Tag versuchte Emma sie telefonisch zu erreichen. Doch Annegret meldete sich nicht. Nicht am Morgen. Nicht am Mittag. Nicht am Abend und auch an den nächsten Tagen nicht. Schließlich ging Emma zur Polizei.
Für die heimkehrenden Eltern steht sofort fest, dass etwas Schreckliches passiert ist. Das unangenehme Gefühl beginnt bereits, als sie mit ihren Koffern das Haus betreten. Wenn sie sonst von Reisen zurückkehren, hat Annegret das Haus aufgeräumt und empfängt die Eltern schon an der Tür. Diesmal ist die Haustür verschlossen, und es gibt auch keine Nachricht von der Tochter. Dreckiges Geschirr türmt sich in der Spüle. Unterlagen für Annegrets Studium liegen im Wohnzimmer auf dem Boden verstreut, Kleidungsstücke achtlos auf Tischen und Stühlen. Und auch im Zimmer der Tochter herrscht ein Durcheinander, sodass die Mutter erst einmal ein wenig Ordnung schafft. So ein Verhalten kennen die Eltern nicht von Annegret.
Auf die Vermisstenanzeige reagiert die Polizei schnell. Der Leiter der schon bald eingerichteten Sonderkommission, Kriminalhauptkommissar Dieter Herber, ist ein erfahrener Beamter. Einer, der weiß, dass die Zeit drängt und dass jetzt die Spuren zusammengetragen werden müssen, um Aussicht auf Erfolg zu haben. Die Suchmeldung der Polizei beschreibt die Vermisste so genau wie möglich: 20 Jahre alt. Schlanke Statur. Rundliches Gesicht. 170 Zentimeter groß. Etwa 65 Kilo schwer. Blonde, mittellange Haare. Bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, einem roten T-Shirt, knöchelhohen, weißen Nike-Turnschuhen. Eine braune Damenarmbanduhr, eine kleine braune Geldbörse. Die wichtigste Frage an die Medien, an die Bevölkerung: Wer hat Annegret Kramer in der Nacht ihres Verschwindens gesehen?
Herber und seine Kollegen geraten bei ihren Ermittlungen bald in eine Sackgasse. Nach intensiven Gesprächen mit den Verwandten, Freunden und Bekannten sind sie sicher, dass die Studentin nicht freiwillig fortgeblieben ist. Doch es gibt zu diesem Zeitpunkt nicht einen einzigen ernst zu nehmenden Hinweis, was mit der Vermissten geschehen sein könnte.
Die Ermittlungen der Polizei werden in viele Richtungen geführt. Das Gelände um den letzten bekannten Aufenthaltsort der Vermissten wird von Hundertschaften der Bereitschaftspolizei abgesucht. Hubschrauber überfliegen unwegsames Gelände. Leichenspürhunde schnüffeln sich durch Parks und Wälder und durchforsten mit ihren sensiblen Spürnasen sogar eine Müllkippe.
Immer wieder wendet sich Herber an die Öffentlichkeit. «Selbst Hinweise, von denen der Hinweisgeber gar nicht annimmt, dass sie uns helfen können, werden von uns überprüft. Die Akte wird nicht geschlossen», verspricht der Kriminalbeamte und appelliert an Mitwisser einer möglichen Gewalttat, sich zu offenbaren: «Geben Sie uns einen Hinweis auf den Verbleib der Vermissten. Wir sichern Ihnen Vertraulichkeit zu, denn wir möchten nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Angehörigen das Verschwinden der jungen Frau endlich aufklären.»
Der Weg, den Annegret Kramer vermutlich gegangen ist, die Strecke von der Wohnung der Freundin zum Elternhaus, ist nicht lang. Er führt ein paar Minuten an einem Bach entlang. Die Leichenspürhunde schnüffeln intensiv an der Uferböschung. Polizisten stochern mit langen Stäben im Bachbett und in den Büschen. Der Bach ist viel zu schmal und zu flach, und die Strömung zu träge, als dass sie einen Menschen hätte fortreißen können.
Maria Kramer steht manchmal stundenlang an diesem Bach. Sein Wasser umspült sanft die Pflanzen und Baumwurzeln am Ufer. Manches Grün zieht das Wasser mit sich fort. Sie stiert ins Wasser, und dabei gehen ihr Tausende Gedanken und Bilder über Gewalt und Blut und Hilfeschreie durch den Kopf.
Annegret ist wie von Geisterhand aus dem Leben der Eltern gerissen worden. Ihre Mutter weiß nicht von wem und nicht warum. Aber sie glaubt fest daran, dass der Tochter Gewalt angetan wurde. Wahrscheinlich ein Triebtäter. Ein frustrierter Mann. Vielleicht aber auch ein heimlicher Verehrer, der die Grenze zwischen Leidenschaft und Verbrechen überschritten hat. Obgleich die Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen hat, versucht sich Maria mit diesen Überlegungen das Verschwinden der Tochter zu erklären. Trost findet sie dadurch nicht.
Sie steht vor dem Kleiderschrank ihrer Tochter und überlegt erneut, was sie mit den Sachen machen könnte. Oft sind ihre Gedanken wirr, ohne Ziel, wenn sie in Annegrets Zimmer sitzt und nachdenkt. Es sind Gedanken, die Maria in den letzten Jahren oft gehabt hat: Ihre Tochter ist weg, fortgerissen aus ihrem Leben, ohne Hilferuf, ohne Chance auf Rettung. Dann wechseln die Gedanken die Richtung: Ist Annegret vielleicht doch freiwillig gegangen, aufgebrochen in ein neues Leben?
Aber warum? Warum hat sie nie darüber gesprochen, dass ihr die Welt im Elternhaus nicht mehr reichte? Dass sie sich nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, nach der Ferne sehnte? Kann das ein Grund sein, so wortlos zu verschwinden und Vater und Mutter allein zurückzulassen? Die Angehörigen von Vermissten sind oft hin und her gerissen zwischen den unterschiedlichen möglichen Motiven für das Verschwinden des geliebten Menschen.
Diese Ungewissheit! Diese schreckliche Ungewissheit!
Wie Schlaglichter blitzen die möglichen Szenarien auf: Ist sie freiwillig fort? Lebt sie fröhlich irgendwo im Ausland? Wurde sie ermordet? Wurde sie vielleicht irgendwo eingesperrt? Die Bilder von Gewalt und Tod und Aufbruch in ein neues Leben wechseln mit den Stimmungen der Angehörigen. Und manchmal ist die Verzweiflung so groß, dass die Zurückgelassenen selbst dafür dankbar wären, wenn man ihnen die Leiche des geliebten Menschen nach Hause bringen würde. Es wäre – so glauben manche Angehörige – eine Erlösung von den Qualen der Ungewissheit.
«Bleibt ein Mensch verschwunden, dann geht das Leben für Hinterbliebene nicht irgendwann weiter, sondern es bleibt stehen, genau an dem Tag, an dem der teure Mensch nicht mehr zurückgekehrt ist», sagt Kriminalhauptkommissar Dieter Herber während einer Pressekonferenz. «Die aufgerissene Wunde wird für lange Zeit bluten, vielleicht zeitlebens. Denn die Trauerarbeit kann nicht begonnen werden, weil man hofft, der Verschwundene könnte plötzlich vor der Tür stehen und den Albtraum beenden.»
Dabei ist es so wichtig, um den Vermissten zu trauern, genau wie um einen verstorbenen Menschen. Das Leben ist voller Abschiede. Sie gehören einfach dazu, so schwer uns das auch fällt. Der Psychotherapeut Dietmar von Wiese gibt zum Verschwinden von Menschen zu bedenken: «Wenn wir unser Leben einmal in Ruhe betrachten, dann entdecken wir, dass es voller Abschiede ist, voller Trennungen und Verluste: Abschied von einer Hoffnung, Abschied von der Heimat, Abschied von Gesundheit, auch Abschied von Jugend und Schönheit, Abschied vom Beruf. Der letzte Abschied ist die Trennung von der Welt, ist der Tod.»
Die meisten Angehörigen verdrängen die Trauer, schlucken die Tränen herunter, lassen Gefühle nicht zu. Doch Gefühle, die nicht nach außen dringen dürfen, sind Gift für den Körper. Erstickte Gefühle versuchen immer – auch gegen unseren Willen – sich Luft zu verschaffen. Und sei es durch Krankheiten: Angehörige von Vermissten leiden oftmals unter Angstzuständen, hegen Selbstmordgedanken, haben Atembeschwerden, Herzschmerzen oder Depressionen. Erst wenn sich die Bande zu dem Menschen, um den sie trauern, allmählich lösen, wenn sie die Gefühle, die zu diesem Prozess gehören – also Wut, Verzweiflung, Mitleid, Vorwürfe oder sogar Hass –, wenn sie all das zulassen, wird es ihnen besser gehen. Erst dann werden sie wieder fähig sein, echte Freude und Liebe zu empfinden – und auch Trauer.
Verwandte, Freunde und Bekannte wissen oft nicht mit der neuen Situation umzugehen, in die sie plötzlich geraten sind. Emma kann nicht vergessen, gar nichts: «Wenn ich an Annegret denke und an die Zeit, die wir zusammen verbracht haben und die wir uns gekannt haben, bin ich immer wieder sehr verzweifelt.»
In Annegrets Zimmer ist die Freundin seit damals nicht mehr gewesen. Gelegentlich trifft sie die Eltern. Sie kennt die Gedanken der Mutter, von der sie weiß, dass sie inzwischen fast täglich im Zimmer der Tochter sitzt. Und sich wieder und wieder fragt: Warum kann ich hier nicht endlich Schluss mit diesem Zimmer machen? Es leer räumen? Ein Gästezimmer daraus machen?
Marias Blick fällt wieder einmal auf einen Gegenstand im Zimmer, etwa die Schultüte in der Ecke am Fenster. Annegret hat sie aufbewahrt. Die Mutter erinnert sich: Er war schön, der erste Schultag. Später irgendwann das Abitur, ein großer Erfolg. Dann das Studium. In der Mensa der Universität haben die Erstsemester mittags eine Party gefeiert. Bier eingeschmuggelt, dazu Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen. Sie haben sich gleich am ersten Tag bei der Hochschulleitung unbeliebt gemacht. Polizei. Hausverbot. Maria kennt das. Sie ist eine Alt-Achtundsechzigerin. Damals gehörte die Besetzung von Hörsälen zum Uni-Alltag.
Damals. Als sie selbst studierte. Theater spielte. Ihre Tochter hat ihr nachgeeifert. Manchmal, wenn sie guter Dinge ist, fragt sich Maria: Wird Annegret den Anschluss schaffen, wenn sie heimkehrt? Nach fünf Jahren Pause? Aber vielleicht studiert sie ja auch irgendwo?! In England vielleicht. Oder in Amerika. Wollte das Kind nicht immer nach Hollywood? Manchmal hat sie auf Familienfeiern davon erzählt, dass sie in Amerika Schauspielerin werden will.
Warum hat sie aber nicht gesagt, dass sie nach Übersee will? Sich ihren Traum erfüllen möchte? Warum hat sie nicht wenigstens einen Abschiedsbrief geschrieben, ein paar Worte, einen lieben Gruß nur? Etwas Trost. Warum ist Annegret so wortlos gegangen?
Maria Kramer greift nach dem Lieblingskleid ihrer Tochter und will es in die Plastiktüte werfen, die neben ihr auf dem Boden steht. Sie hält inne. Ihre innere Stimme sagt ihr: Ich kann Annegret doch nicht sterben lassen, auch wenn ich glaube, dass sie tot ist.
Maria weiß, dass die Möbel und Kleidungsstücke und alle anderen Dinge die Erinnerung an ihr Kind nur konservieren. Der Anblick des trostlos-leblosen Mädchenzimmers macht das Bemühen um ein Vergessen zu einer nie enden wollenden Qual.
Sie wacht morgens mit den Erinnerungen auf und schläft abends mit der Hoffnung ein, dass morgen endlich die Erlösung kommt: der Fund der Leiche oder das Geständnis ihres Mörders oder wenigstens eine neue Spur, die die Leere ihrer Tage mit Spekulationen nähren kann. Doch seit langem wird Maria jeden Tag aufs Neue enttäuscht. Ihre Tochter bleibt spurlos verschwunden.
«Kommst du zum Abendessen?»
Ihr Mann Heinz ruft aus der Küche. Wie in Trance geht Maria auf die Zimmertür zu, wischt mit dem Staubtuch im Vorübergehen über den Tisch, als könnte sie so die düsteren Gedanken fortwischen. Ein letzter Blick. Alles ist gut. Alles aufgeräumt für die Rückkehr ihrer Tochter. Maria lächelt. Vielleicht kommt Annegret ja doch bald heim. Sie verlässt das Zimmer, schließt die Tür.
Mit Rike in der Talkshow
Glauben Sie, dass Ihr Kind noch lebt?»
Was soll sie auf diese Frage antworten? Sie wird unsicher. Die Frage macht ihr Angst. Mit zittriger Hand versucht sie das Wasserglas auf dem Tisch vor sich zu erreichen. Sie muss vor dem unbequemen Sessel ein wenig in die Hocke gehen. Noch schlimmer: Sie sieht sich selbst auf dem Monitor. Die Kamera registriert jede Regung. Sie trinkt einen Schluck.
«Wie war die Frage noch?»
«Lebt Ihr Kind, lebt Rike noch?»
Claudia Schamel will nicht hier sein. Hier im grellen Scheinwerferlicht des Fernsehstudios. Sie sieht in die Runde. Da sitzt die Moderatorin der Talkshow, Sarah Sommerwald, und fünf andere Frauen, die ihre Kinder vermissen. Warum hat sie sich darauf eingelassen?!
Schon wieder eine Talkshow, schon wieder Seelenstriptease, schon wieder Fragen, Fragen und noch mehr Fragen. Fragen, auf die Claudia keine Antwort hat.
«Frau Schamel?!»
Stille.
«Frau Schamel?! Ich sehe Ihnen an, dass es Ihnen schwerfällt, darüber zu sprechen. Lassen Sie sich Zeit.»
Die Moderatorin lächelt in die Kamera. Sie zeigt Mitgefühl: «Wenn ein Kind verschwindet, dann sind ganz besonders die Mütter betroffen. Sie haben das Kind neun Monate lang in ihrem Bauch getragen. Es ist die engste Bindung, die es zwischen zwei Menschen gibt.»
Claudia Schamel hört nicht auf die Worte der Moderatorin. Sie ist wieder da, wo alles begann – in ihrer Küche.
«Rike ist weg!»
«Wie weg?»
«Sie ist weg. Nicht nach Hause gekommen.»
Das Entsetzen steht Claudia ins Gesicht geschrieben. «Rike ist nicht nach Hause gekommen. Ich bin los, hab sie gesucht. Sie ist weg. Einfach weg! In der Schule ist sie los. Hat mir die Klassenlehrerin gesagt. Ich bin den ganzen Weg ein paar Mal abgelaufen. Hab in Geschäften gefragt. Leute auf der Straße …»
Kai Schamel ist gerade von der Frühschicht nach Hause gekommen. Er ist Straßenbahnfahrer. «Hast du bei den Eltern von Pia angerufen? Vielleicht ist sie mit zu ihr nach Hause?»
«Natürlich!» Claudia Schamel sitzt am Küchentisch und weint. Ein Heulkrampf schüttelt ihren Körper. Sie ist eine Frau, die weiß, was sie will. Die Mann und Kind versorgen kann. Die ihre Arbeit als Krankenschwester gut macht. Das sorgsam aufgetragene Make-up verläuft unter den Tränen. «Sie ist weg. Einfach weg.»
Die Wohnung von Claudia und Kai Schamel befindet sich nur wenige hundert Meter von der Schule entfernt. Auf dieser Strecke muss die siebenjährige Rike jemandem begegnet sein, der sie mitgenommen hat. Als das Kind zwei Stunden nach Schulschluss noch nicht zu Hause ist, beginnt eine große Suche. Die Eltern rufen Freunde und Verwandte an, die Polizei startet eine Suchaktion mit Hundestaffeln, Hubschrauber und Polizeihundertschaft. Eine vierzigköpfige Sonderkommission wird gegründet, doch es findet sich keine Spur. Niemand hat das Kind gesehen. Auch in den folgenden Tagen meldet sich niemand. Aus Tagen werden Wochen der Suche, des Hoffens, des Wartens, des Bangens. Aus Wochen werden quälende Monate. Aus Monaten viele Jahre des Leidens. Jetzt sind es schon 20 Jahre, und der Schmerz endet einfach nicht. Rike bleibt verschwunden.
Die Moderatorin unterbricht Claudias Gedanken: «Damals haben Sie gesagt, Sie glauben, dass Rike noch lebt. Denken Sie das immer noch? Heute, nach 20 Jahren?»
Claudia Schamel sieht zum roten Lämpchen der Kamera hinüber, so als wäre sie allein im Studio und würde den Millionen Menschen da draußen an den Fernsehgeräten ihre Geschichte erzählen. «Ich habe nach dem Verschwinden von Rike zwei Wochen lang wahnsinnige körperliche Schmerzen gehabt. Mir war, als leide ich mit der Rike mit. Und als dann die Schmerzen weg waren, musste ich einfach davon ausgehen, dass sie tot ist, dass sie dann gestorben ist. Obwohl ich heute immer noch hoffe, dass sie zurückkommt und immer noch daran glaube. Das ist so eine ganz komische, sehr widersprüchliche Gefühlslage.»
«Sie sind also hin und her gerissen in Ihrer Annahme? Sie lebt, sie lebt nicht?»
Claudia spürt die Übelkeit, die immer dann in ihr aufsteigt, wenn sie sich dieser Frage stellt. Ihr ist dann schlecht. Ihr Herz rast vor Trauer und Aufregung. «Ich glaube, dass Rike lebt», sagt sie schließlich. «Es ist mein Gefühl, dass sie irgendwann wiederkommen wird. Das ist so ein Instinkt, ich kann es nicht besser beschreiben. Sie ist vielleicht sogar im Ausland. Es kann auch möglich sein, dass sie missbraucht wird. Dass sie dieses grausame Spiel mitmacht, weil sie keinen Ausweg sieht. Kann sein, dass sie viel reifer ist, als ich denke. Kann alles möglich sein. Vielleicht wird sie sich eines Tages aus eigener Kraft daraus befreien. Ich habe meinem Mann schon damals gesagt: ‹Rike ist verschleppt worden. Irgendwo wird sie festgehalten.› Und mein Mann sagte damals: ‹So was gibt’s nicht, das tun die Menschen nicht.›»