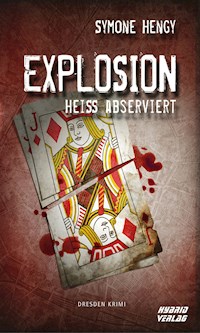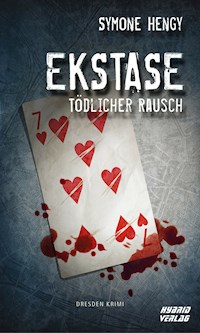2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hybrid Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Leichen, deren Körper sich in kürzester Zeit auflösen, und ein Klient mit unglaubwürdiger Geschichte. Welche Ziele verfolgt ein Bund aus ehemaligen Ostblock-Agenten? Und was verbirgt sich hinter dem Unglück in den Österreichischen Alpen? Völlig unvermittelt geraten die Hauptkommissarin Marlies Bender und der Privatermittler Alexander Buschbeck ins Dickicht geheimdienstlicher Aktionen. Scheinbar zufällige Ereignisse folgen einem ausgeklügelten Konzept, einem ungeheuerlichen Plan tödlicher Selbstjustiz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
HYBRID VERLAG
Vollständige Ebook-Ausgabe
11/2019
© by Symone Hengy
© by Hybrid Verlag, Homburg
Umschlaggestaltung: © 2019 by Hygin Graphix
Lektorat: Paul Lung, Matthias Schlicke
Korrektorat: Tina Winderlich
Buchsatz: Petra Schütze
Autorenfoto: Michael Hengy
ISBN 978-3-96741-012-9
www.hybridverlag.de
www.hybridverlagshop.de
Symone Hengy
Operation Gay Bomb
Thriller
Ich widme diesen Roman
Anja
Karin
Nicole
Ramona
Susanne
Vorwort
Was ist eine Gay Bomb?
Chemische Substanzen sollen gegnerische Soldaten in sexuelle Ekstase versetzen und sie am Weiterkämpfen hindern. Feindliche Truppen wären leicht zu überwältigen, ohne Todesopfer zu riskieren.
Soweit der Plan.
Die Gay Bomb gilt als fiktiv, ein diffuser Plan der US-Streitkräfte, schnell ad acta gelegt, eine chemische Waffe, deren Wirkung nie offiziell nachgewiesen wurde.
Dennoch gelangte sie im Jahr 2007 zur zweifelhaften Ehre des Ig-Nobelpreises, des Anti-Nobelpreises, obwohl das Konzept es angeblich nicht über das Stadium des Gedankenspiels hinausbrachte. Die Chemiewaffenkonvention verbietet sowohl Herstellung als auch Besitz.
Was aber, wenn ebenso kranke Hirne wie jene, in denen die Idee zur Gay Bomb entstand, mit ganz anderem Prinzip den Geschlechtstrieb zur Waffe erheben? Wenn längst vergessen geglaubte Strukturen im Untergrund weiter operieren und daran arbeiten, ein früheres Machtgefüge wiederherzustellen?
Eine Vorstellung, die ebenso unwirklich wie gefährlich erscheint.
Die Personen und Ereignisse des Buches sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Prolog
Militärisches Sperrgebiet
Michael Groth betrachtete stirnrunzelnd das alte, von der Witterung gezeichnete Schild, das an einer locker über den Wanderweg gezogenen Kette hing. Die Umgebung sah nicht so aus, als ob das hier ein Truppenübungsplatz wäre. Ein Relikt der Vergangenheit, vermutete er, während sein schweifender Blick nur Berge, Bäume und karge Wiesen einfing.
Nirgendwo Anzeichen menschlicher Präsenz.
Auf seiner Karte fand sich ebenfalls keinerlei Hinweis auf ein militärisches Sperrgebiet, sie zeigte nur eine geschotterte Straße an, die nicht weit entfernt den Wanderweg kreuzte.
Warum einen Umweg in Kauf nehmen? Wegen eines wahrscheinlich seit Ewigkeiten vergessenen Schilds? Kurz entschlossen setzte er einen Schritt über die niedrige Absperrung hinweg.
Die Herbstsonne streichelte sanft über seine nackten Unterarme und das Gesicht, als er wenig später das Ende eines Waldstücks erreichte. Mit der Nase zum Licht blieb er stehen.
Was für eine Wohltat nach einem Sommer brütender Hitze daheim in Dresden. Vom Gletscher am gegenüberliegenden Horizont wehte klare Frische wie eine Verheißung herüber. Aromen von Heuwiesen, getrockneten Kräutern, vergorenem Obst und verblühten Stauden beflügelten seine Sinne und brachten ihn zum Träumen.
Im selben Moment, in dem Groth berauscht die Nasenflügel blähte, zogen sich seine Mundwinkel selig in die Breite. Vergessen waren die nebulösen Seelenfresser, die ihn seit über zwanzig Jahren auf Schritt und Tritt verfolgten. Körperlose Kreaturen der Vergangenheit, die aus lauter Missgunst in jeden noch so unscheinbaren Anflug von Optimismus hineingrätschten, um ihn auch nach so langer Zeit noch zu Fall zu bringen.
In der Tat hatte er kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, seinen bereits vor Monaten gebuchten Urlaub in Österreich zu stornieren. Dieser Tapetenwechsel war aber dringend notwendig gewesen. Wie dringend, das spürte er jetzt, da er zum ersten Mal seit langem wieder frei durchatmen konnte.
Seit fünfzehn Jahren fuhr er nun schon zum Wandern hierher. Trotzdem vermochte es dieses paradiesische Fleckchen Erde, ihn immer wieder in Erstaunen zu versetzen.
Schmunzelnd setzte er den Weg fort, konzentrierte sich jedoch mehr und mehr auf seine Schritte. Rechts von ihm stieg das Terrain inzwischen sehr steil an, während es auf der linken Seite beinahe senkrecht abfiel.
Groth musste aufpassen, der Schwerkraft, die mit aufgerissenem Maul am Abgrund neben ihm lauerte, nicht zum Opfer zu fallen. Bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit blieb er stehen. Mit seinem Fernglas, das er an einem Riemen um den Hals trug, schaute er durch die Baumlücken ins Tal. Nirgendwo eine Menschenseele.
Von überschwänglicher Freude ergriffen, setzte Michael Groth den beschwerlichen Gang fort. Als vor ihm eine kleine Baumgruppe ihre Pforten öffnete, brach das gleißende Licht einer bereits tief stehenden Sonne durch das dichte Blattwerk sattgrüner Laubbäume. Flirrende Leuchtpünktchen tanzten auf dem Boden vor seinen Füßen.
Wieder blieb er stehen.
Diesmal jedoch, um im Schatten der stummen Riesen zu verschnaufen.
Ächzend setzte er sich, wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn und ließ seinen Blick schweifen. Wo er auch hinsah, erhoben sich die Gipfel der nackten Berge, die eine besondere Macht auf ihn ausübten. Obgleich sie schwiegen, nahm ihr Anblick ihn genauso gefangen wie ein knisterndes Feuer oder die tosenden Wellen des Meeres.
Groth rappelte sich auf und schritt mühsam den immer schwierigeren Pfad entlang. Der Hang fiel inzwischen so steil ab, dass er bei jedem seiner Schritte gezwungen war, sich an den Grasbüscheln der gegenüberliegenden Seite festzuhalten, um nicht abzurutschen.
Seine Hände schwitzten. Die Furcht, das Gleichgewicht zu verlieren, griff nach seiner Kehle und drückte sie zu.
Jetzt nur keine Panik aufkommen lassen, Alter!
Trotzdem beschleunigte er unwillkürlich seinen Schritt, stürzte mehr voran, als dass er lief. Obwohl sich der Überreaktion bewusst, kam er nicht gegen die Reflexe seines Körpers an, vor der Gefahr eines drohenden Absturzes davonlaufen zu wollen.
Schon im nächsten Moment stolperte er über einen zugewachsenen Baumstumpf, kam ins Straucheln, rutschte ein Stück den Hang hinunter und überschlug sich. Wie ein Lumpenbündel rollte Michael Groth den Berg hinab und verlor schon bald die Orientierung. Anfangs griffen seine Hände Halt suchend nach allem, was sich ihnen bot: Äste, Zweige, Grasbüschel, Sträucher. Doch das Fernglas um seinen Hals verhielt sich wie ein störrischer, nach allen Seiten austretender Esel. Während er es mit einer Hand vor der Brust im Zaum hielt, beugte er den anderen Arm schützend über Kopf und Gesicht. Umherliegende Äste und Zweige zerkratzten ihm die Unterarme. Beim Versuch, sie zu schützen, riss er sich die rechte Wange auf. Bevor ihn der beißende Schmerz erreichte, schlug er hart mit dem Rücken gegen einen Baum und fiel vornüber auf den Bauch, wo er endlich liegen blieb.
Eine Weile verharrte Groth reglos in dieser Position. Seine Muskeln und Sehnen vibrierten wie eine angeschlagene Stimmgabel. Das Blut rauschte in den Ohren und das Klopfen seines Herzens dröhnte im Inneren seines Kopfes.
Ach du heilige Scheiße.
Mit dem Gesicht nach unten atmete er den moderigen Geruch des Waldbodens und tastete in Gedanken seine Glieder auf mögliche Verletzungen ab. Zwar spürte er im Moment nichts, doch eine diffuse Angst hockte feuchtkalt in seinem Nacken. Verletzt und ohne Mobiltelefon in dieser Wildnis wäre er verloren.
Verloren im Nirgendwo.
Eine Welle der Verzweiflung versetzte seinen Körper in unkontrolliertes Zittern und trieb ihm Tränen in die Augen. Niemand würde ihn hier finden, weil kein Mensch ihn vermisste.
Die Kehrseite eines Lebens als menschenscheuer Eigenbrötler.
Welches du dir selbst ausgesucht hast.
Als Groth die Kontrolle über seinen Körper zurückerlangt hatte, richtete er sich behutsam auf. Erleichtert stellte er fest, dass alle Knochen heil geblieben waren.
Erst jetzt schaute er sich um.
Sein Sturz war von einer verborgenen Niederung Richtung Tal abgefangen worden. Einer Senke, die, weil rundherum von bewaldeten Felsen und hohem Wildwuchs umgeben, von der Höhe des Weges aus nicht zu sehen gewesen war. Durch die üppigen Blätterkronen der Bäume flimmerten die Sonnenstrahlen und tauchten die Umgebung in ein diffuses Licht.
Groth fühlte sich in eine längst vergessene Zeit zurückversetzt. Vor seinen staunenden Augen erhoben sich gewaltige Bäume mit knotigen Ästen, die wie arthritische Glieder uralter Menschen aussahen. An den Zweigen der Äste hingen bodenlange hellgrüne Flechten wie Spinnweben herab.
Wahrlich gespenstisch. Aber zugleich faszinierend.
Der Waldboden war von dunkelgrünem Efeu bedeckt, dessen Ranken sich besitzergreifend wie Krallen in die Stämme der Baumriesen schlugen, um sich an ihnen hochzuziehen. Natur pur …
Aber was haben wir denn da?
Interessiert griff er zum Fernglas. Inmitten von Felsen, Bäumen und Büschen duckten sich niedrige, sandfarbene Gebäude, die sternförmig von einem etwas höheren Bauwerk, vermutlich dem Hauptgebäude, abgingen.
Massentierhaltung inmitten der österreichischen Berge?
Der Gedanke schien so absurd, dass er ihn auf der Stelle verwarf. Dennoch schnupperte er in die Luft, nahm aber außer den üblichen Gerüchen des Waldes nichts wahr.
Erst jetzt realisierte er bewusst, seit Übersteigen der Absperrkette auf militärischem Sperrgebiet unterwegs zu sein.
Um sich nochmals zu vergewissern, zog er die Karte aus der Seitentasche seines Rucksackes und breitete sie aus.
Wie erwartet, nichts.
Aber die Schotterstraße, die er sich für seinen Rückweg ausgesucht hatte, wand sich nur wenige hundert Meter an diesem Areal vorbei. Die Wanderung zurück ins Hotel sollte demnach kein Problem darstellen.
Erleichtert über so viel Glück, angesichts der widrigen Umstände, denen er seinen unfreiwilligen Aufenthalt in dieser Senke verdankte, verstaute er die Karte wieder.
Seine Neugier war jedoch stärker als der Wunsch, sich sofort auf den Heimweg zu begeben.
Was hatte es mit diesem Bauwerk auf sich? Warum war es auf keiner Karte verzeichnet? In seiner Verlassenheit wirkte es beinahe schon friedlich. Wenn auch auf eine beklemmende Weise.
Wie ein Friedhof, schoss es Groth durch den Kopf. Ein verlassener, vergessener Friedhof.
Die gepflasterten Wege zwischen den einzelnen Baracken vom Wetter der Jahrzehnte aufgebrochen, das Mauerwerk zerbröselt. Sich selbst überlassene Wildpflanzen und Unkräuter bildeten seltene Biotope. Die Hecke aus Feldahorn, wohl irgendwann einmal angepflanzt, um dem Areal Sichtschutz zu gewähren und es neben dem Stahlzaun einzufrieden, ragte inzwischen als stattliche Baumreihe bis weit in den Himmel.
Dornröschenschlaf im 21. Jahrhundert.
Groth lächelte noch über diesen Gedanken, als ein Rohr auf dem Dach des erstaunlich intakt wirkenden Hauptgebäudes seine Aufmerksamkeit auf sich zog.
Rauch?
Er spürte, wie sein Puls in die Höhe schoss. Sollte diese Anlage doch noch in Betrieb sein? Sein Verstand verbot ihm, sich die Folgen auszumalen. Welcher Teufel hatte ihn geritten, den Warnhinweis Militärisches Sperrgebiet nicht ernst zu nehmen?
Andererseits irritierte ihn der laxe Umgang der Militärbehörde. Eine mühelos zu übersteigende Absperrung stellte nicht wirklich ein Hindernis für einen widerrechtlichen Zutritt dar. Schließlich gab es nicht nur harmlose Wanderer wie ihn.
Außerdem beschäftigte ihn die Frage, warum auf seiner Wanderkarte jeglicher Hinweis darauf fehlte. Weil es nichts zu schützen gab und er sich den Rauch nur eingebildet hatte?
Groth blieb stehen. Er schaute erneut durch sein Fernglas nach der tänzelnden Rauchsäule, diesmal vergebens.
Hatte er den falschen Dunstabzug im Fokus? Atemlos suchte er das Dach nach weiteren Rohren ab.
Nichts.
Sollte ihm seine Wahrnehmung nur einen Streich gespielt haben?
In diesem Moment stürmten zwei menschliche Gestalten zu Fuß aus dem Objekt: eine Frau und ein Mann, denen selbst ein Laie wie Groth ihre soldatische Ausbildung ansah. Die Frau hatte lange blonde Haare und bewegte sich in ihrem dunkelblauen Overall geschmeidig wie eine Katze.
Ihr Begleiter überragte sie um mindestens einen Kopf. Obwohl er anstelle des praktischen Overalls einen dunklen Anzug zu einem weißen Hemd trug, sah man auch ihm deutlich das harte Training eines Kriegers an, eines Kämpfers.
Der Mann lief vorneweg, rannte, als wäre der Teufel hinter ihm her. Ohne sich ein einziges Mal nach der Frau umzusehen, vergrößerte er den Abstand zwischen sich und dem Hauptgebäude Meter um Meter.
Plötzlich strauchelte die Frau, griff Halt suchend mit beiden Händen in den Staub und schaffte es tatsächlich, auf den Beinen zu bleiben. Mit eindeutigen Gesten trieb sie ihren Gefährten zur Eile an, der sich nun doch nach ihr umgedreht hatte.
Sie verschwanden in einem Schuppen, den Groth erst bei genauerem Hinsehen als solchen erkannte. In Tarnnetze gehüllt, fügte er sich fast unsichtbar ins Gelände ein.
Im nächsten Moment heulte in der Entfernung ein Motor auf, ein dunkelgrüner Geländewagen schoss aus dem Schuppen hervor und steuerte einen teilweise zugewachsenen Fahrweg an. Ein Weg, der, wenn Groth sich nicht täuschte, auf seine Schotterstraße führte.
Vielleicht ließen sie ihn mitfahren, wenn er es rechtzeitig zur Straße schaffte? Für heute hatte er genug von der Einsamkeit, vom Wandern.
Er könnte behaupten, sich verlaufen zu haben. Doch um auf sie zu treffen, müsste er einen Zahn zulegen.
Los geht‘s!
Ohne den Geländewagen aus den Augen zu verlieren, bewegte sich Groth immer schneller Richtung Schotterstraße und verfiel sogar in einen lockeren Laufschritt.
Der Wagen war keine hundert Meter weit gekommen, als er plötzlich ins Schlingern geriet und gegen einen Felsen prallte.
Scheiße!
Groth blieb wie angewurzelt stehen, die Hände in den Haaren seines Hinterkopfes vergraben. Doch im Gegensatz zu ihm gönnte sich der Fahrer keine Pause. Beim Versuch, zurückzusetzen, spritzten Split und Steine. Er versuchte es erneut. Der Motor schrie wie in Panik auf, aber der Wagen rührte sich nicht vom Fleck.
Er hing fest.
Während die Maschine weiterlief, schwang die Fahrertür auf und der Mann im Anzug sprang heraus. Er hatte sich bei dem Unfall offensichtlich verletzt. Blut lief ihm von der Stirn auf den weißen Kragen seines Hemdes. Ohne davon Notiz zu nehmen, durchwühlte er die Ladefläche, zog rasch ein paar Bretter hervor und schob sie mit routiniert wirkenden Bewegungen unter die Hinterräder.
Dann sprang er wieder hinter das Lenkrad und setzte erneut zurück. Diesmal hatte er Glück, lenkte ein, wendete und raste davon.
Auch Groth setzte sich wieder in Bewegung, rannte, so schnell ihn seine Beine trugen, bis ihn ein hüfthoher Metallzaun stoppte, den er jedoch mühelos überstieg.
Abermals wunderte er sich über die halbherzige Sicherung des militärischen Areals, verbot sich aber selbst, weiter darüber nachzudenken.
Im Moment zählte nur, so rasch wie möglich den Fahrweg zu erreichen, bevor der Geländewagen die Stelle passierte. Nach dem Unfall schien er umso schneller unterwegs zu sein.
Ein plötzlicher greller Lichtblitz stoppte seinen Bewegungsdrang abrupt. Instinktiv duckte er sich hinter einen Felsbrocken. Gerade noch rechtzeitig, ehe eine Druckwelle über ihn hinwegfegte, die selbst hinter seiner Deckung an ihm zerrte. Lose Steinchen, Gräser und Blätter prasselten auf ihn nieder. Die Erschütterung des Bodens, ein dröhnendes Beben, das sich durch seine Schuhe auf ihn übertrug, rüttelte an ihm. Panisch klammerte er sich an den ebenfalls vibrierenden Felsbrocken. Seine Finger krallten sich wie Klauen in das abweisende Gestein. Fingernägel splitterten.
Das Beben am Boden verklang nach wenigen Sekunden, ferner das Fiepen in seinem Ohr.
Groth wagte sich aus der Deckung … und erstarrte.
Von seiner Position aus bot sich ihm ein Bild von absoluter Zerstörung. Die gesamte Kasernenanlage schien wie ausradiert. Wo wenige Augenblicke zuvor Gebäude standen, gähnte nunmehr nichts als braune Brache. Selbst die gepflasterten Wege suchte sein Blick vergebens.
Irritiert blinzelnd setzte er seinen Weg fort.
Sollte ihm der Sturz doch mehr zugesetzt haben und er war die letzte Stunde bewusstlos gewesen? Der verwunschene Urwald, die Kasernenanlage – alles nur das Ergebnis eines durcheinandergeratenen Gehirns, ein Traum?
Das auf ihn zueilende Motorengeräusch verscheuchte die Selbstzweifel.
Hätte er sich die Anlage inmitten scheinbar unberührter Natur nur eingebildet, gäbe es auch diese Leute nicht, die ganz offensichtlich mit ihrem Geländewagen geflohen waren, um der gewaltigen Explosion zu entkommen.
Aber das Auto existierte.
Unaufhaltsam näherte es sich der Stelle, wo Groth in eben diesem Moment den Fahrweg erreichte. Doch die Freude darüber hielt sich in Grenzen. Seinen Plan von der Mitfahrgelegenheit noch vor wenigen Minuten für eine gute Idee haltend, zögerte er jetzt. Ein komisches Gefühl, eine leise Ahnung, dass hier etwas nicht stimmte, schlich durch seinen Verstand. Eine abstruse Angst vor einer Bedrohung, die sich weder greifen noch erklären ließ.
Je näher das Motorengeräusch kam, desto stärker wurde dieses Gefühl, und mit ihm der Drang, sich zu verbergen. Sein Selbsterhaltungstrieb bestand darauf, sich in akuter Lebensgefahr zu befinden.
Dem Brummen nach zu urteilen, blieb ihm nicht mehr viel Zeit, sich dem Blickfeld der Insassen zu entziehen. Schon sah er das reflektierende Blitzen der Scheinwerfer vor sich.
Sein Puls beschleunigte. Unkoordiniert setzte er seinen rechten Fuß auf die Seite des linken Fußes, strauchelte, stolperte, fing sich aber wieder. In buchstäblich letzter Sekunde sprang er hinter einen zwei Meter hohen Felsbrocken, von denen es hier zum Glück ausreichend gab.
Sein Brustkorb hob und senkte sich, als hätte er einen Hundertmeterlauf absolviert. Sich selbst zur Ruhe mahnend, begann er augenblicklich zu schwitzen.
Auch wenn er nicht wusste, was hier Ungeheuerliches vorging, so fühlte es sich doch ganz und gar unheimlich an. Überdies sagte ihm das Gefühl, dass es seiner Gesundheit wesentlich besser bekäme, wenn niemand wüsste, wo er sich aufhielt, beziehungsweise aufgehalten hatte.
Hochaufgerichtet, mit dem Rücken an den Felsen gepresst, lauschte Michael Groth in Richtung Straße.
Das harte, scharfe und porige Gestein drückte sich in seinen Rücken. Im nächsten Moment erreichte der Wagen die Höhe seines Verstecks. Doch anstatt sich genauso schnell wieder zu entfernen, kam er plötzlich zum Stehen. Der Motor verstummte.
Grundgütiger …!
Eine bleierne Schwere senkte sich auf Groth herab. Ihm war, als greife eine fremde Hand mit kalten Fingern in seinen Nacken. Die Haare sträubten sich und kleinste Härchen auf Armen und Beinen richteten sich drahtig auf.
War er trotz aller Vorsicht entdeckt worden?
In diesem Fall tendierten seine Chancen gegen Null, einigermaßen glimpflich davonzukommen.
Terroristen, die gerade eine militärische Anlage in die Luft gesprengt hatten, würden mit Augenzeugen nicht lange fackeln. Denn dass sie etwas mit der Explosion zu tun hatten, daran gab es für Groth keinen Zweifel.
Eine Wagentür klappte, Steine knirschten.
Er presste die Lippen aufeinander, schloss die Augen und hielt die Luft an. Die Verzweiflung überwältigte ihn. Warum war er heute Morgen nicht einfach im Bett geblieben?
In seiner Kehle hockte ein Schrei, der mit Macht nach draußen zu drängen versuchte. Nur mit Mühe hielt er ihn zurück.
Als er die Augen wieder öffnete, trat die blonde Frau gerade um die Ecke – jedoch ohne in irgendeiner Weise Notiz von ihm zu nehmen.
Hechelnd, die eine Hand am Hals, die andere damit beschäftigt, ihre langen, blonden Haare zu bändigen, beugte sie ihren bebenden Körper vornüber und übergab sich mehrere Male.
Ein Verhalten, das Groth stutzen ließ.
Würde sie ihm wirklich den Rücken zukehren, wenn sie sich seiner Gegenwart bewusst wäre? Selbst er, der über keinerlei Kampferfahrung verfügte, traute sich zu, sie von hinten zu überwältigen.
Nein, diese Frau ahnte nichts von ihm. Der Geländewagen hatte rein zufällig in seiner Nähe gehalten.
Doch diese Erkenntnis, so beruhigend sie war, nutzte ihm herzlich wenig. Sobald sie sich umdrehte, würde sie ihn entdecken.
Und dann?
Seine Augen streiften über den Boden. Überall lagen faustgroße Steine verstreut, nach denen er greifen und mit denen er zuschlagen könnte. Mit Betonung auf könnte, weil seine wasserabweisende Funktionskleidung jede seiner Bewegungen lautstark untermalen und seinen bevorstehenden Angriff verraten würde.
Es sei denn, er schlug beim nächsten Brechreiz zu.
Doch mal angenommen, es gelänge ihm, sie außer Gefecht zu setzen. Was würde er als Nächstes tun? Sein Heil in der Flucht suchen? Wie weit käme er, ehe ihr Begleiter die Situation erfasste und ihn außer Gefecht setzte? Ein durchtrainierter Mann, vermutlich soldatisch ausgebildet und geschätzte dreißig Jahre jünger als er?
Was würde so jemand mit mir anstellen?
Bevor er in die Verlegenheit kam, sich selbst eine Antwort darauf zu geben, richtete sich die Frau auf. Mit gesenktem Kopf griffen ihre Hände nacheinander in sämtliche Taschen des Overalls. Vermutlich auf der Suche nach einem Taschentuch. Als sie keins fand, wischte sie sich burschikos mit dem Ärmel über den Mund. Dann drehte sie sich um.
Himmel …!
Der Blick in ihre Augen wirkte für Groth wie ein Sturz ins kalte Wasser, in dem er sofort zu versinken schien. Tosende Wellen schlugen über seinem Kopf zusammen. Vor Schreck wie gelähmt, sank er tiefer und tiefer, mit offenen Augen dem Tod ins Antlitz sehend.
Plötzlich zuckte er wie elektrisiert zusammen und stieß sich den Hinterkopf am scharfkantigen Felsen. Ein alles durchdringender, stechender Schmerz holte ihn in die Realität zurück.
Die Frau starrte ihn an, wirkte ebenfalls überrascht.
Gleichsam schockiert.
Instinktiv nahm er eine Lauerstellung ein, spreizte die Beine und fuhr leicht in die Hocke. Nicht, um gegen sie zu kämpfen, das brächte er nicht übers Herz, sondern um ihre Angriffe so lange wie möglich abzuwehren.
Mit angewinkelten Armen, die offenen Handflächen ihr zugewandt, starrte er sie an. Doch anstatt sich schreiend auf ihn zu stürzen, lockerte sich ihre Haltung. Und je mehr Zeit verging, desto entspannter wirkte sie.
Er selbst stand eine ganze Weile wie vom Donner gerührt, in den Knien wippend mit zitternden Händen, unfähig, seinen Blick von ihr abzuwenden.
Danke, Schicksal, dass du mir nicht erlaubt hast, ihr den Schädel einzuschlagen. Das hätte er sich in der Tat nie verziehen.
»Diana, wo bleibst du denn?«
Die Stimme ihres Begleiters klang ungeduldig, aber auf seltsame Weise vertraut. Sächsisch vertraut, wenn er sich nicht irrte. »Wir müssen los, der Flieger wartet nicht.«
Der Flieger wohin?
»Ich komme sofort«, rief sie über ihre Schulter, ohne Groth aus den Augen zu lassen.
Ihr Lächeln rührte ihn zu Tränen. Er holte Luft, um etwas zu sagen, verstummte aber, als sie kopfschüttelnd ihren Zeigefinger auf die Lippen legte und in die Richtung verschwand, aus der sie gekommen war.
Weinend schaute er ihr nach.
Der Motor brummte auf. Als der Wagen anfuhr, spritzte der Splitt auf dem Fahrweg wie Wasser. Endlich entfernte sich das Geräusch. Groth hielt die Luft an und schöpfte erst neuen Atem, nachdem sich der Motorenlärm vollständig in der Stille dieser faszinierenden Berglandschaft aufgelöst hatte. Im nächsten Augenblick sackte er erschöpft in sich zusammen.
Diana also.
Beim Blick in die Augen dieser jungen Frau hatte er sich gefühlt, als schaute er in einen Abgrund aus Verlogenheit und Betrug. Und die Vergangenheit, welche er glaubte, längst hinter sich gelassen zu haben, holte ihn mit großen Schritten wieder ein.
Indes wurde er sich der seltsamen Stille bewusst, die ihn umgab. Eine Stille, die weit davon entfernt war, eine Wohltat für sein aufgepeitschtes Gemüt zu sein.
Eine Stille wie der Tod.
Nirgendwo ein Laut. Kein Rascheln im Gestrüpp, kein Ächzen, Quietschen, Knacken und Klopfen in den Bäumen. Selbst die Vögel schwiegen.
Vermutlich das Resultat dieser heftigen Explosion.
Aus der Ferne hatte es gewirkt, als wäre das gesamte Areal dabei zerstört worden.
Und aus der Nähe?
Obwohl in seinem Inneren die Alarmglocken schrillten, überwog der Drang, sich an Ort und Stelle und mit eigenen Augen vom Ausmaß der Zerstörung zu überzeugen.
Wovor sich fürchten? Vor dem Tod? Nicht nach dieser schicksalhaften Begegnung mit Diana.
Hätte ihm das heute Morgen jemand gesagt, er hätte ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Er vermochte es ja selbst kaum glauben. Aber es fühlte sich erhebend an. Nur noch ein paar Antworten und sein Leben hatte sich erfüllt. Dann würde er ohne Bedauern sterben.
Michael Groth lächelte weich.
Das Bewusstsein, innerhalb weniger Augenblicke über sich selbst hinausgewachsen zu sein, brachte eine große Zufriedenheit über ihn. Die inneren Fesseln, die er sich im Laufe der Jahre angelegt hatte, fielen von ihm ab. Er spürte, wie neue Vitalität seinen Körper durchflutete.
Beschwingten Schrittes begab er sich auf den Weg, immer die Schotterstraße entlang, hinunter bis zu dem Platz, an dem sich zuvor der Gebäudekomplex erhoben hatte.
Erhoben haben muss, schoss es ihm durch den Kopf, als er die Stelle erreichte. Sein Lächeln verkrampfte sich. Von der Kasernenanlage war kaum etwas übriggeblieben.
Keine Ziegel, keine Holzbohlen vom Dachstuhl, keine Bretter.
Abgesehen von ein paar Betonresten, aus denen verbogene Fragmente der Stahlarmierung heraus spießten, deutete nichts darauf hin, dass hier vor wenigen Minuten mehrere Bauwerke gestanden hatten. Nichts außer Staub. Massen von Staub, die ihn einhüllten und sich nur zögerlich absetzten. Feinstes Gesteinsmehl, das, sobald es am Boden lag, bei jedem seiner Schritte aufwirbelte und die Hosenbeine puderte.
Groth schnupperte in die Luft.
Weder nahm er den typischen Pulvergeruch wahr, der selbst nach dem Zünden eines kleinen Feuerwerks stundenlang in der Luft hing, noch das Aroma verbrannten Holzes oder den Gestank rauchenden Kunststoffmaterials.
Seine Nase roch überhaupt nichts.
Als hätte es dieses Stichwort gebraucht, fegte plötzlich ein Windhauch über ihn hinweg und trug die Gerüche der umliegenden Berge und Täler zu ihm herüber.
Von allen Seiten strömte der Duft nach Heuwiesen, Laub und Tannennadeln, nach Humuserde und Pilzen in die gefühlte Leere, um sich mit der übrigen Atmosphäre zu einem homogenen Bukett des Waldes zu vermischen.
Seine Nackenhärchen stellten sich auf.
Was hatte das alles zu bedeuten? Allein die Vorstellung, er wäre erst in dieser Minute hier vorbeigekommen, völlig ahnungslos, dass hier noch kurz zuvor eine militärische Anlage aus Stahlbeton gestanden hatte, jagte ihm eine Gänsehaut über den Rücken.
1
– Alexander Buschbeck –
Die Freiheit, selbst zu entscheiden, was ein Mensch mit seinem Leben anfängt, gehört in der Bundesrepublik Deutschland zu den von ihrer demokratischen Verfassung garantierten Grundrechten.
Deshalb liegt es auch im Ermessen jedes Einzelnen, welche Menschen er ins Vertrauen zieht, wenn er zum Beispiel seine Zelte abbricht, um ganz woanders neu anzufangen.
Als mündiger Bürger eines Rechtsstaates darf er blind darauf vertrauen, dass seine Entscheidung akzeptiert und seine Privatsphäre geschützt wird.
Doch dieses Privileg birgt auch ein Risiko.
Dann nämlich, wenn enge Angehörige plötzlich spurlos verschwinden, ohne den Wunsch nach einem Neuanfang verspürt zu haben. Wenn geliebte Menschen wie die Mutter, der Bruder oder das inzwischen erwachsene Kind keine Lebenszeichen mehr von sich geben, obwohl sie zuvor allgegenwärtig gewesen waren.
Solange kein hinreichender Verdacht für ein Verbrechen vorliegt, werden die Behörden angesichts der bestehenden Grundrechte nicht tätig.
Bleiben nur private Nachforschungen, mit denen besorgte Familien und Freunde jedoch mehr oder weniger rasch an ihre Grenzen stoßen. Sei es aus finanziellen Gründen oder weil eine effektive Suche das Wissen und Können erfahrener Ermittler erfordert.
In solchen Fällen wenden sich verzweifelte Menschen gern an Privatermittler wie Alexander Buschbeck.
Mehrere Jahre als Profiler und psychologischer Berater für das Landeskriminalamt Sachsen tätig, war er mit den tiefsten Abgründen der menschlichen Psyche vertraut und in der Lage, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Seine ungewöhnlichen Fähigkeiten brachten ihm im Laufe der Zeit den Ruf eines Hellsehers ein. Ein Ruf, auf den verzweifelte Angehörige all ihre Hoffnungen setzen. Sein Engagement beginnt genau dort, wo konventionelle Polizeiarbeit aufhört oder noch gar nicht begonnen hat.
2
– Friedbert Hartmann, Oberst a.D. –
Friedbert Hartmann, Oberst a.D., schaute gerade auf seine Uhr, als ihn ein Geräusch im Rücken zusammenfahren ließ.
»Entschuldigen Sie, ich wollte nur anfragen, ob das Buffet schon aufgetragen werden kann«, sagte das Hausmädchen mit einem Blick, der um Verzeihung bat.
Der Oberst lächelte nachsichtig und schüttelte dann seinen Kopf. »Ich schlage vor, noch eine Viertelstunde zu warten, Luise«, sagte er. »Es sieht so aus, als würden sich die Herren heute etwas verspäten.«
»In Ordnung«, knickste das Hausmädchen. Die attraktive Dreißigjährige entfernte sich leise.
Wieder schaute er nach der Uhrzeit und spürte ein aufgeregtes Kribbeln in der Magengegend, eine kindliche Vorfreude. Den Zeitverlust aufgrund des höllischen Freitagnachmittag-Verkehrs durch die City mit eingerechnet, sollte es nicht mehr lange dauern, bis sein Besuch endlich eintraf. Teure Freunde, die für Jahrzehnte seine bewegte Vergangenheit mit ihm geteilt hatten. Eine Vergangenheit, die zwischenmenschliche Beziehungen entweder für immer zerstörte oder aber auf ewig zusammenschweißte. Eine Vergangenheit allerdings, die eine Mehrheit seiner ehemaligen Kumpane heute am liebsten verleugnete.
Er nicht. Für ihn war Loyalität gegenüber der Vergangenheit eine Frage der Ehre. Eine Einstellung, die er mit den Männern teilte, die er für dieses Wochenende in seine Villa eingeladen hatte.
Einer von ihnen war Dimitri Wasenko, ein hochaufgeschossener, stämmiger Russe, dem er seine außergewöhnliche Karriere beim Ministerium für Staatssicherheit verdankte. Sie hatten sich in Moskau kennengelernt, wo er an der Hochschule für Flugzeugbau studiert hatte.
Zwischen Dimitri und ihm hatte es sofort eine Verbindung gegeben, die weit über eine normale Freundschaft hinausging. Beide waren leidenschaftliche Verfechter des Marxismus-Leninismus, leidenschaftliche Kommunisten, leidenschaftliche Visionäre.
Dimitri arbeitete schon damals für den russischen Geheimdienst und er erzählte mit so viel Begeisterung von seinem Leben im Dienst für Partei und Vaterland, dass auch Hartmann den Entschluss fasste, seine Kraft, sein Wissen und sein Leben dafür einzusetzen.
Dank seiner freundschaftlichen Beziehung zu Dimitri, der wiederum freundschaftliche Beziehungen zum Chef der Hauptabteilung II des Ministeriums für Staatssicherheit, dem damaligen Inlandsgeheimdienst, pflegte, wurde ihm die Ehre zuteil, das Gesicht des zukünftigen Auslandsgeheimdienstes ab 1958 mitzuprägen.
Diese Chance hatte er genutzt.
Schon wenige Jahre nach seinem Eintritt gehörte er zur Führungsriege über ein weltweites Agentennetz mit mehreren tausend hauptamtlichen Mitarbeitern, noch einmal doppelt so vielen inoffiziellen Mitarbeitern und zweitausend Spionen in der Bundesrepublik Deutschland.
Ein Läuten an der Haustür riss den Oberst aus seinen Gedanken. In freudiger Erwartung verließ er sein Arbeitszimmer und durchquerte den angrenzenden Salon, wo inzwischen das erlesene Buffet auf die Gäste wartete. Als er die imposante Eingangshalle erreichte, öffnete Luise soeben die Tür und ein aufgeregtes Gewirr greiser Stimmen schob sich zusammen mit verwelkter Haut an gebeugten Körpern in das Innere des Hauses.
Hartmann spürte, wie seine Augen feucht wurden. Ein breites Lächeln spannte sein Gesicht.
Da waren sie wieder – die Männer der alten Garde, alles ehemalige Geheimdienstler aus befreundeten Ostblockstaaten und allesamt Patrioten, die in ihrer aktiven Zeit für ihr jeweiliges Land Informationen gesammelt, Anschläge vereitelt und die Herrschaftssysteme gesichert hatten.
»Hallo Jerzy«, begrüßte er einen Mittsiebziger mit abstehenden Ohren und einer langen, spitzen Nase. »Du siehst gut aus. Machst du immer noch Sport?«
Jerzy Polanski gehörte früher zum Służba Bezpieczeństwa, dem polnischen Äquivalent zum Staatsicherheitsdienst in der DDR.
»Man tut, was man kann, alter Junge«, antwortete Polanski, nahm die Hand seines Kameraden in beide Hände und schüttelte sie kräftig.
»Dimitri«, sagte Hartmann beim nächsten Gast nur, breitete wie der andere die Arme aus und küsste ihn, wie auch er geküsst wurde. Obwohl sie sich in den vergangenen Jahren nur selten persönlich getroffen hatten, blieb der ehemalige KGB-Mann nach wie vor sein engster und bester Freund. Zwischen ihnen waren keine Worte nötig, um dieser einst unerschütterlichen Verbundenheit neues Leben einzuhauchen.
Der nächste Gast war ein unscheinbarer kleiner Mann mit dunklen Augen und, trotz seines fortgeschrittenen Alters, immer noch schwarzen Haaren.
»László …« Oberst Hartmann intonierte diesen Namen wie ein Zirkusdirektor seine Hauptattraktion. Die Männer schüttelten sich die Hände.
»Ich habe mich über deine Einladung gefreut«, sagte László Leroy, ehemaliger Ausnahmeagent der Államvédelmi Hatóság, der nach dem Muster des sowjetischen KGB gebildeten politischen Polizei in Ungarn. »Habe schon befürchtet, diesen Tag nicht mehr zu erleben.«
»Warum so pessimistisch, Genosse?«
»Weil es in Zeiten von NSA und Google immer schwerer wird, im Untergrund zu agieren.«
»Google«, wiederholte der Oberst amüsiert und die Männer in der Halle lachten. Das nächste Gesicht blickte ihm voller Erwartung entgegen.
»Ich freue mich, dass du es ebenfalls ermöglichen konntest, Nicolae«, sagte er zum ehemaligen Angehörigen der Securitate, dem früheren rumänischen Geheimdienst. Der schwer an Lungenkrebs erkrankte Nicolae Petrescu hatte sich im Verlauf der letzten Jahre äußerlich am meisten verändert. Seine einst so makellose Haut wirkte gelb und fleckig. Schlaffe Oberlider verdeckten trübe Augen, früher ein Spiegel seines unvergleichbaren Scharfsinns. Der körperliche Verfall war nur allzu offensichtlich und keiner wusste, wie viel Zeit ihm noch blieb.
»So eine Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen«, erwiderte er mit der Stimme eines Starkrauchers und hustete. »Wenn man sein halbes Leben lang den Kopf für andere hingehalten hat und sich das andere halbe Leben dafür rechtfertigen muss, freut man sich, auf Menschen zu treffen, denen es ähnlich ergangen ist. Deine Einladungen sind wie die Treffen anonymer Alkoholiker. Man versteht sich eben.«
Wieder brach allgemeines Gelächter unter seinen Gästen aus und der Oberst lachte mit.
Der letzte, der durch die Tür in die Eingangshalle trat, war Karel Kodelka, ehemaliger Top Agent des Státní bezpečnost, dem unter sowjetischer Beratung aufgebauten tschechischen Geheimdienst. Zu Zeiten des Sozialismus das wichtigste Repressionsorgan des damals herrschenden Regimes mit Aufgaben, die ebenfalls mit denen des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR vergleichbar waren.
Kodelka war ein schweigsamer Mensch mit einem wachen Verstand und liebenswerten Manieren. Seiner ruhigen Art gemäß, nickte er Hartmann nur einen Gruß zu und schüttelte seine Hand in tief verbundener Freundschaft.
Indes das Hausmädchen die Eingangstür wieder zusperrte, führte der Oberst seine Gäste in den vorbereiteten Salon.
Während des Essens beobachtete Oberst Hartmann seine Kameraden und ehemaligen Weggefährten mit einem Gefühl väterlichen Stolzes.
Obgleich der Begriff väterlich nicht passte, weil sie doch alle ein und derselben Generation angehörten. Aber mit diesen fünf Männern hatte er seine Jugend verbracht. Er hatte sie geführt, war mit ihnen aufgestiegen, gefallen und später sprichwörtlich durch die Scheiße gegangen.
Im Vergleich zu ihm waren sie nach dem Ende des Kalten Krieges und der damit verbundenen Öffnung des Eisernen Vorhangs relativ glimpflich davongekommen. Von den Repressalien, die er hatte durchleiden müssen, waren sie größtenteils verschont geblieben.
Denn diese Repressalien waren typisch Deutsch.
Und dunkelbraun.
Der Oberst ließ seinen Blick wie bei der Aufnahme eines Panoramafotos durch den Salon gleiten und schwenkte ihn über die Männer hinweg, die angeregt über die aktuelle Lage in der Welt diskutierten.
»So kann es doch nicht weitergehen«, ertönte die pfeifende Stimme des lungenkranken Rumänen. »Die Gewalttätigkeit unter den Menschen wächst. Immer mehr von ihnen entwickeln sich zu gefährlichen Soziopathen. Wo soll denn das noch hinführen? Unsere Gefängnisse sind doch schon jetzt voll mit denen.«
Der Tscheche winkte resigniert ab. »Nicht nur die Gefängnisse«, sagte er mit dem ihm eigenen trockenen Humor. »In den Chefetagen großer Konzerne sieht es nicht anders aus.«
Hartmann spürte, wie sich seine Lippen grinsend in die Breite zogen. Der war gut. Doch offensichtlich wussten seine Freunde den Witz des Tschechen nicht zu schätzen. Oder sie hatten die Pointe nicht verstanden.
Was Dimitri in diesem Moment zu bestätigen schien. »Weil empathischen Menschen ihre Empathie im Weg steht, um es bis in die Chefetagen zu schaffen«, sagte er voller Ernst.
Hartmann tauschte mit dem Tschechen einen Blick, worauf dieser theatralisch die Augen verdrehte und ein Seufzen andeutete.
Deutsche Sprache, schwere Sprache.
»Und weil Menschlichkeit nicht gefragt ist, wenn Wirtschaftswachstum als einziger Gradmesser für den Erfolg einer Nation steht«, fügte Polanski im selben Eifer hinzu. »Europa wird zwar immer reicher, weil erfolgreicher, aber die Armut nimmt trotzdem zu. Warum?«
»Weil auch die Kinder in diesem Geist erzogen werden«, antwortete der Tscheche und bückte sich nach einem Stück Brot, das ihm während des Essens vom Teller gefallen war. »Wenn du einen Baum nicht rechtzeitig in die gewünschte Form ziehst, kann kein Spalierbaum aus ihm werden. So einfach ist das.«
Dimitri schüttelte energisch seinen Kopf. »Ist es nicht«, widersprach er. »Eltern können sich noch so sehr um die Vermittlung edler Werte bemühen, wenn ihnen nicht gleichzeitig eine passende Antwort auf die Frage einfällt, warum Ausbeuter, Betrüger und Steuerhinterzieher im Wohlstand leben, während sie mehrere Jobs brauchen, um den Kühlschrank zu füllen.«
»Stimmt«, meinte Polanski. »Kinder sind nicht dumm. Wenn sie sehen, dass sich Arbeit kaum noch lohnt und man im Gegenteil ein korruptes Arschloch sein muss, um etwas im Leben zu erreichen …« Anstatt den Satz zu beenden, öffnete er bedauernd seine Hände.
Der Ungar nickte. »Das Problem ist der Niedergang unserer moralischen Werte«, sagte er. »Und die Ursachen dafür sind viel zu komplex, als dass wir alten Säcke noch etwas daran ändern könnten. In diesem Punkt sind die jüngeren Generationen gefragt.«
Ihr redet, als wären wir schon tot, hätte Oberst Hartmann am liebsten entgegnet. Er dachte nicht im Traum daran, die Geschicke dieser Welt aus der Hand zu geben. Schon gar nicht an die junge Generation, die sich seiner Meinung nach zu leicht von windigen Machthabern instrumentalisieren ließ. Ohne komplexe Zusammenhänge in der Gänze zu verstehen, redeten sie heute so und morgen wieder ganz anders. Einfach nur zu sagen: Die Welt ist schlecht, reicht nicht. Um sie zu verändern, braucht es echte Visionäre und Strategen, also Profis wie ihn und seine Weggefährten.
»Aber ganz heraushalten dürfen wir uns trotzdem nicht«, sagte er deshalb. »Immerhin war es die Generation der Alten, die diese Entwicklung erst zugelassen hat.«
Der Ungar lachte künstlich auf. »Wir? In welcher Realität lebst du denn? Wir würden doch gern noch ein paar Entscheidungen mit treffen, wenn man uns nur ließe. Ja, wir waren einmal erfolgreiche Agenten. Und ja, wir haben viel bewegt. Doch anstatt sich hin und wieder unseren Rat einzuholen, ignoriert man uns und unsere Lebensleistung, behandelt uns wie Statisten.«
»Recht hat er«, sagte Polanski. »Wir halten uns nicht freiwillig heraus, wir werden herausgehalten.«
Natürlich hatte er Recht. Aber es musste ja nicht so bleiben. »Und wenn wir das nicht mehr akzeptieren?«, entgegnete Hartmann. »Wenn wir einfach wieder werden, was wir einmal waren? Eine gnadenlose Waffe im Kampf gegen …«
»Waren«, unterbrach ihn der Ungar barsch. »Du sagst es. Wir waren einmal eine gnadenlose Waffe.«
»Und könnten es wieder sein«, hielt der Oberst gleichmütig dagegen. »Um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, brauchen wir keine Legitimation von oben.«
Dimitri richtete sich interessiert auf. »Sondern?«
Der Oberst schmunzelte. »Waffenschieber, Menschenhändler und Drogenbosse zerstören die Welt aus dem Untergrund heraus. Was spricht dagegen, sie gleichwohl aus dem Untergrund zu bekämpfen?«
»Aus dem Untergrund?« Dimitri wirkte skeptisch.
»Aus dem Verborgenen«, präzisierte Hartmann und lächelte aufmunternd. »Wie früher.«
»Früher standen wir unter dem Schutz unserer Heimatländer, die uns im Notfall aus der Patsche halfen«, entgegnete der Russe. »Heute wären wir ganz allein auf uns gestellt. Das funktioniert nicht.«
»Unsinn«, entgegnete der Tscheche Kodelka. »Dubiose Syndikate unterhalten perfekt getarnte weltweite Drogennetze. Und das scheinbar unbehelligt, völlig frei. Nehmen wir zum Beispiel die gefährliche synthetische Droge Crystal Meth. Obwohl strengstens verboten, ist sie bei uns inzwischen an jeder Hausecke zu bekommen.«
»Bei uns auch«, bestätigte Polanski kopfschüttelnd. »Unsere Kinder siechen dahin, dass es ein Jammer ist. Erinnert ihr euch noch an die Hysterie Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre? Als die Seuche Aids ausbrach? Damals entsprach die Diagnose einem Todesurteil und jeder hatte Angst. Und heute?«
Mit aufgerissenen Augen schaute er in die Runde. »Heute konsumieren junge Menschen dieses Teufelszeug im vollen Bewusstsein, irgendwann daran zu krepieren. Sie nehmen ihren frühen Tod einfach so in Kauf, warum? Gehört es nicht eigentlich zur Natur des Menschen, so lange wie möglich am Leben bleiben zu wollen? Der Drogenmissbrauch ist allgegenwärtig. Doch anstatt zu reagieren, ignorieren Politik und Gesellschaft dieses Elend, als wäre es ihnen egal. Dabei müsste selbst den kaltschnäuzigsten Ignoranten klar sein, dass mit unseren Kindern auch die Zukunft stirbt. Also was, so frage ich euch, läuft hier schief?«
»Was hier schiefläuft?« Der Rumäne, der im Verlauf der Diskussion immer weiter in sich zusammengesunken war, richtete sich kerzengerade auf. »Was hier schiefläuft, nennt man Freiheit.«
»Oder das, was angebliche Demokraten dafür halten«, entgegnete Kodelka scharf. »Es ist doch mehr als scheinheilig, einer Handvoll unheilbar kranken Menschen einen Tod auf Verlangen strikt zu verwehren, aber bei einer stetig wachsenden Zahl Drogensüchtiger den Konsum todbringender Substanzen nur halbherzig zu thematisieren.«
Der Rumäne nickte. »Ist ja alles richtig, was du sagst, aber Belehrungen, Vorhaltungen und Zurechtweisungen sind völlig fehl am Platz.«
»So?« Der Tscheche funkelte ihn herausfordernd an. »Und was schlägst du stattdessen vor?«
Der Rumäne nahm eine abwehrende Haltung ein, zog aber gleichzeitig den Hals ein, als würde er sich am liebsten wieder in sich selbst verkriechen.
»Uns endlich die Drahtzieher, Drogenküchen und Dealer vorzunehmen, die diese Selbstzerstörung mit ihrem kriminellen Treiben ermöglichen«, antwortete der Oberst an seiner statt. »Diese Menschen sind nichts Geringeres als Massenmörder, ihr Dealen mit Crystal Meth inzwischen ein Milliardengeschäft.«
»Gerade hier im Osten Europas«, bestätigte der Pole. »Was da an den Grenzen zwischen Polen, Deutschland und Tschechien abgeht …« Er pfiff durch die Zähne. »Der Neffe eines meiner Cousins ist als Beamter an der Grenze auf Streife unterwegs. Er vergleicht den Kampf gegen die Dealer schon gern mal mit einem Kampf gegen ein vielköpfiges Fabelwesen. Schlüge man einen seiner Köpfe ab, sagt er, wüchsen an anderer Stelle zwei nach.«
»Die Realität an unseren Grenzen«, seufzte der Tscheche. »Wird ein Meth-Dealer aus dem Verkehr gezogen, rücken an anderer Stelle zwei nach. Eine Sisyphusaufgabe.«
»Und ein wahrlich nervenaufreibender Kampf dazu«, meinte Polanski.
»Den wir trotzdem führen müssen«, sagte Dimitri.
»Und gewinnen«, fügte der Oberst mit erhobenem Zeigefinger hinzu.
»Aber wie?«, rief der Pole ratlos in die Runde. »Manchmal wünschte ich mir die Magie Merlins, um mit einem Zaubertrank das Problem des illegalen Drogenhandels ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.«
»Genau wie den Islamismus«, röchelte der Rumäne. »Ich brauche die vermummten Gestalten nur im Fernsehen zu sehen und mir läuft ein eiskalter Schauer über den Rücken. Wo kommen diese lichtscheuen Kreaturen auf einmal alle her? Aus welchen Kloaken sind die hervorgekrochen?«
Dimitri schnalzte verächtlich mit der Zunge. »Die haben wir den Amerikanern zu verdanken«, sagte er. »Unter dem Deckmantel, die Schutzpolizei der Welt zu sein, dringen diese Räuber in die Hoheitsgebiete souveräner Staaten ein, schneiden sich dort ein großes Stück vom Reichtum ab und verschwinden wieder. Dieses arrogante, selbstherrliche Gesindel.«
»Genau wie wir Europäer«, fügte Hartmann hinzu. »Allen voran Deutschland und Frankreich. Was mich persönlich dabei am meisten stört, ist unsere lächerliche wie gefährliche Überheblichkeit, anderen Kulturen unsere westliche Lebensart überstülpen zu wollen. Wir akzeptieren die Hutpflicht für Damen am britischen Königshaus, echauffieren uns aber über Kopftücher in Ägypten. Wir haben es Jahrzehnte lang nicht hinbekommen, den Kindern und Kindeskindern von Migranten unsere Werte zu vermitteln, stellen uns aber mit erhobenem Zeigefinger an die Grenzen ihrer Herkunftsländer, um sie zu belehren. Ja, was bilden wir uns eigentlich ein?« In seinem Inneren schäumte es. Bevor er Gefahr lief, sich vollends in Rage zu reden, verstummte er. Wollte er mit seinem Vorhaben erfolgreich sein, musste er die Emotionen den anderen überlassen.
Na los! Kotzt euch schon aus! Ich weiß doch, was seit Jahren in euch vorgeht.
Herausfordernd sah er in die Runde. Die verlebten Gesichter wollten nicht so recht zu ihren munteren Augen passen, ihre müden Körper nicht zum wachen Geist.
»Ganz deiner Meinung«, pflichtete der Ungar ihm bei. »Ich sage nur Evolution.«
Evolution? Der Oberst verstand nicht.
»Evolution …?«, wiederholte Polanski irritiert.
Die aufgesetzten Grimassen der anderen Männer verlangten ebenfalls nach einer Erklärung.
Der Ungar verdrehte die Augen. »Das ist doch ganz einfach«, sagte er. »Du kannst keinem unterentwickelten Wesen deine Hochkultur aufzwingen und dann noch erwarten, dass es sich darüber freut. Mit wie viel Eleganz kommt wohl jemand daher, der gerade erst gelernt hat, aufrecht zu gehen?«
»Rassistisches Arschloch«, feixte Polanski und der Rumäne grinste.
Die Blicke von Dimitri und dem Tschechen flohen indes peinlich berührt zu Boden.
»Das ist gar nicht böse gemeint«, rechtfertigte sich der Ungar.
»Nur rassistisch«, blaffte Dimitri.
»Ich rede von radikalen Muslimen, die ein religiöses Leben wie vor 1450 Jahren anstreben.«
»Und ich von Muslimen, die deren Ansichten nicht teilen.«
»Aber trotzdem in dieser Kultur der Gewalt gefangen sind«, entgegnete der Ungar aufgebracht. »Da fällt mir ein, dass wir nach islamischem Kalender gerade um das Jahr 1450 herum leben. Das war im gregorianischen Kalender finsteres Mittelalter.«
»Ja, was meinst du, warum sie zu Tausenden auf der Flucht sind?«, schrie Dimitri.
»Um der Gewalt in ihrem Land zu entfliehen, nicht ihrer Kultur«, schrie der Ungar zurück. »Und die bringen sie mit. Und stiften in ihrer neuen Heimat Unfrieden damit. Und deshalb wäre es besser, sie würden dortbleiben, wo auch ihre Kultur zu Hause ist.«
»Ist das deine Vorstellung von Humanität?« Das Gesicht des Russen war rot angelaufen.
»Allerdings«, antwortete der Ungar. »Unsere Aufgabe wäre es, ihnen vor Ort zu helfen, sich aus der Tyrannei fanatischer Islamisten zu befreien. Nicht, sie bei uns willkommen zu heißen, um im nächsten Moment von ihnen zu verlangen, ihre Kultur aufzugeben.«
Dimitri wirkte verblüfft, stand auf, klopfte dem Ungarn auf die Schulter und setzte sich wieder. »In diesem Punkt stimme ich voll und ganz mit dir überein. Aber ihnen zu helfen, setzt die Einheit und Einigkeit führender Militärnationen voraus. Und dafür, moi Drug, sehe ich leider schwarz. Außerdem würden bei so einem Krieg tausende Soldaten ihr Leben verlieren.«
»Nicht unbedingt«, warf der Oberst ein. Ihm gefiel, wie sich das Gespräch bis hierher entwickelt hatte.
Dimitri missverstand seine Anspielung und winkte enttäuscht ab.
»Solltest du an den Einsatz autonomer Waffensysteme denken, dann vergiss es! Diese Technik wird frühestens in zwanzig Jahren ausgereift sein.« Er hob den Zeigefinger. »Und ihre eigenen Tücken mit sich bringen.«
»Danke für den Hinweis.« Über den Stand der Entwicklungen von Kampfmaschinen, die ohne jegliches Eingreifen des Menschen komplexe Entscheidungsabläufe auf dem Schlachtfeld übernehmen, eigenständig Ziele aussuchen und zerstören, war der Oberst ebenso im Bilde wie seine Freunde. »Aber daran dachte ich mit Sicherheit nicht.«
»Unsere Hilfe käme nämlich zwanzig Jahre zu spät«, fügte der Russe unnötigerweise hinzu.
Was du nicht sagst. »Ich weiß.« Hielten sie ihn für senil?
»Außerdem ist heute noch gar nicht absehbar, ob diese Killerroboter überhaupt jemals zum Einsatz kommen«, meldete auch der Tscheche seine Bedenken an. »Kommen dürfen«, intonierte er nachdrücklich. »Nein, es muss einen anderen Weg geben.«
Jetzt ist es aber genug!
Hartmann hatte das Gefühl, jeden Moment zu explodieren.»Diesen Weg gibt es auch«, platzte es verärgert aus ihm hervor. »Ganz ohne Soldaten und Kampfmaschinen. Oder was glaubt ihr, warum ihr hier seid?«
Die Männer sahen ihn überrascht an. Ihre aufgerissenen Augen und offenen Münder verlangten nach einer Erklärung, die er ihnen aber nicht geben durfte. Noch nicht.
Wie komme ich aus dieser Nummer wieder heraus?
Acht Augenpaare bohrten sich in das Gesicht des Obersts.
»Was hast du damit gemeint?«, fragte Dimitri mit dem ihm eigenen, liebevoll klingenden Singsang in der Stimme.
»Nichts«, antwortete er und flüchtete sich in ein spöttisches Lächeln. »Das war ein Witz, wenn auch ein blöder«, sagte er und ließ ein schallendes Lachen erklingen.
Doch niemand lachte mit.
Wie hungrige Haie gaben sie den Brocken nicht mehr her, den er ihnen so unüberlegt zugeworfen hatte. Verlangten stattdessen mehr Informationen, die sie jedoch nicht bekommen würden. Nicht vor dem Eintreffen seines Sohnes Henry.
Am besten, du hältst den Mund, hatte Henry am Telefon zu ihm gesagt. Mit deinem Halbwissen gefährdest du womöglich die ganze Operation.
Und nun?
»Wer von euch hat Lust auf einen zwanzig Jahre alten Malt?«
Das Ablenkungsmanöver missglückte.
»Was soll das heißen, ganz ohne Soldaten und Kampfmaschinen?«, fragte der Ungar. Die steile Falte zwischen seinen Augenbrauen grub sich so tief ins Fleisch, dass sein Schädel wie gespalten aussah. »Wer oder was soll den Kampf übernehmen?«
Gute Frage, nächste Frage. Warum hatte er nicht einfach seinen Mund gehalten?
»Merlin mit seinem Zaubertrank«, antwortete der Oberst lachend und bot dem Polen die Hand zum Abklatsch.
Polanski ignorierte sie. Dann eben nicht.
Hartmann räusperte sich. »Nun? Wem gelüstet es nach einem Whisky?«
Doch die ehemaligen Geheimdienstmänner ließen sich nicht abschütteln. Sanftmütig und geduldig wie Bluthunde hielten sie an der aufgenommenen Fährte fest.
»Apropos Zaubertrank«, sagte der Rumäne plötzlich. »Gibt es Neuigkeiten von der Front?« Mit seiner für alle Anwesenden unmissverständlichen Betonung des Wortes Front zielte er auf geheime Forschungen ab, die sie seit vielen Jahren finanziell unterstützten. »Hast du uns deshalb in deine schöne Villa eingeladen? Um uns Forschungsergebnisse deines Sohnes zu präsentieren?«
Das hatte er in der Tat. Allerdings nicht zwischen Lachsschnittchen und Kaviareiern.
Während der Oberst überlegte, wie er sich aus dieser Situation herauswinden könnte, geriet sie zusehends außer Kontrolle.
Als würde jemand am Senderknopf eines Radios drehen, wirbelten auf einmal verschiedene Sprachen und Stimmen bunt durcheinander. Die Körper der Alten reckten, duckten und drehten sich. Dünne Arme mit knotigen Händen flogen gestikulierend durch die Luft, Augen strahlten und Münder lachten.
»Eto moi Drug, das ist mein Freund«, rief Dimitri mit einem breiten Lächeln und unaufhörlich hüpfenden Augenbrauen. «Rasskaschitje poschaluista, erzähle bitte …! Dawei …! Spann uns nicht länger auf die Folter!« Die Weichheit seines russischen Akzents und der tiefe klangvolle Bass seiner Stimme ließen die Sätze wie fröhliche Volksweisen klingen. Hartmann mochte diese Herzlichkeit der russischen Seele, die Dimitri jetzt noch dadurch unterstrich, sich vergnügt mit beiden Händen auf die Oberschenkel zu klatschen.
»Nu schto …!«, rief er vergnügt. »Was hat es mit dem Zaubertrank auf sich?«
»Nichts, das war ein Witz«, antwortete er. »Jerzy hat Merlin ins Spiel gebracht, nicht ich.«
Das Gesicht des Russen verdüsterte sich. »Willst du uns für dumm verkaufen?«
»Natürlich nicht.«
»Dann erzähle keine Märchen!«
»Deshalb bin ich jetzt auch still«, sagte Oberst Hartmann, dankbar über die willkommene Steilvorlage. »Für Fragen bezüglich der Forschungen meines Sohnes müsst ihr euch bis zu seiner Ankunft gedulden.«
»Wieso erzählst du uns nichts?«, bohrte der Ungar nach.
»Warum wollt ihr nicht warten? Auf ein paar Stunden hin oder her kommt es doch nicht an.«
»Irrtum«, röchelte der krebskranke Rumäne. »Bei jemandem, der so alt ist wie wir und so krank wie ich, zählt jede Minute.« Der Versuch zu lachen endete in einem Hustenanfall.
»Nicolae hat recht«, sagte Polanski. »Wir sind alle alt, uralt.«
»Und krank«, pflichtete der Rumäne ihm grinsend bei.
Auch der Tscheche schmunzelte. »Sollte einer von uns in den nächsten fünf Minuten abnippeln, was dann?«
Der Oberst gab sich geschlagen. »Schon gut«, sagte er. »Ich glaube, ich greife den Ausführungen meines Sohnes nicht allzu weit vor, wenn ich euch den Film vorspiele, den wir uns eigentlich alle gemeinsam anschauen wollten.«
Dimitri rieb sich die Hände. »Gute Idee.«
»Gibt’s einen Porno?«, raunte Polanski.
Hartmann überging diese Bemerkung, klingelte nach dem Dienstmädchen und ließ sich eine Fernbedienung bringen.
Während er die Vorhänge zuzog und sich vergewisserte, dass auch wirklich alle Fenster und Türen verschlossen waren, kicherten seine greisen Freunde wie kleine Kinder und tauschten Albernheiten aus. Sämtliche Geräusche verebbten in der Dunkelheit. Oberst Hartmann betätigte die Fernbedienung, an der Decke klappte ein riesiger Flat-Screen surrend auf und fuhr nach unten.
Die Augen seiner Kameraden, in denen sich das blaue Licht des Bildschirmes widerspiegelte, funkelten erwartungsvoll.
Na, dann will ich euch mal nicht enttäuschen. Der Oberst drückte auf Play und ließ den Film ohne weitere Vorrede oder Erklärung laufen.
Das Material war überraschend gut geworden. Überwältigende Landschaftsbilder mit Blick auf schneebedeckte Berge, felsige Schluchten und üppig grüne Weiden würden als Imagefilm für eine Urlaubsregion jedem Anspruch genügen. Nur ging es bei diesem Film nicht um die Schönheit der Landschaft, sondern …
In der Ferne tauchte das Ziel auf, ein kleiner Punkt, der zunehmend an Umfang gewann.
»Was ihr hier seht«, erläuterte Hartmann, »ist ein Gebäudekomplex, in dem eine Nachfolgeorganisation des KGB, die übrigens vollkommen unabhängig vom derzeitigen Regime in Russland agiert, die brutalsten Psychopathen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken und den übrigen Ostblockstaaten untergebracht hatte.«
»Hatte …?«
Der Zwischenruf war berechtigt, doch in der Dunkelheit ließ sich die verhaltene Stimme nur schwer einer bestimmten Person zuordnen.
Aber eine Antwort erübrigte sich sowieso.
Spätestens jetzt, da eine gewaltige Explosion den gesamten Komplex in Stücke sprengte.
Kurz darauf riss der Film ab und tiefes Schweigen breitete sich aus.
Oberst Hartmann nutzte den Moment der Stille, um den Bildschirm wieder verschwinden zu lassen und die Vorhänge aufzuziehen.
Als danach noch immer keiner der Männer Anstalten machte, etwas zu sagen, setzte er sich auf einen Stuhl und verschränkte die Arme vor der Brust. »Irgendwelche Fragen?«
Schuhe schabten, Stühle rückten.
»Die Bilder sind erst ein paar Tage alt«, fuhr er erklärend fort. »Sie wurden von einer Drohne aufgezeichnet und in Echtzeit an meinen Computer übermittelt.«
»Dann warst du live dabei, als es passierte?« Der Russe wirkte fassungslos.
»Na ja, so live wie man es vor einem Bildschirm sein kann.«
»Und der Sprengstoff? Nicht nachweisbar?«
»Nein.«
»Auch nicht in den verbliebenen Trümmern?«
Hartmann schüttelte den Kopf. »Es gibt kaum Trümmer, ein paar Reste von den Stahlarmierungen und sonst nur Staub.«
»Jesses …!« Damit schien die Wissbegierde des Polen erst einmal erschöpft zu sein.
Der Oberst wandte sich erwartungsvoll an die anderen, deren Münder jedoch gänzlich stumm blieben, während sich ihre vom Alter gebeugten Körper unter seinem Blick noch weiter zu krümmen schienen.
Hatten sie Angst? Doch wovor sollten sie sich fürchten? Vor dem, was passiert war? Was passieren könnte? Oder vor ihrer eigenen Courage? Aber vielleicht bildete er sich das auch nur ein und ihnen fehlten lediglich die richtigen Worte, um zu beschreiben, was ihnen in diesem Moment durch die Köpfe ging, welche Fragen ihnen auf den Seelen brannten. Denn Fragen hatten sie. Das bewiesen ihre Blicke, die sie einander zuwarfen wie heiße Kartoffeln.
Der Tscheche traute sich als Erster. »Waren da noch Strafgefangene drin?«, fragte er vorsichtig.
»Ja.«
»Und was ist mit ihnen geschehen?«
Der Oberst räusperte sich unwillkürlich. »Verdampft«, antwortete er. »Genau wie die Wachleute.«
»Aber warum die Wachleute?«, fragte der Ungar.
»Weil wir keine Zeugen brauchen. Einleuchtend?« Der Oberst hatte ungewollt seine Stimme erhoben und stand auf. Seine Hände auf die Rückenlehne gestützt, sah er die Männer der Reihe nach an, einen nach dem anderen. Er schaute in entsetzte Augen, die in dunklen Höhlen lagen und die aschfahlen Gesichter wie Totenköpfe aussehen ließen. Wie viel Unerschrockenheit steckte tatsächlich noch in ihnen?
»Wir lassen ein paar unschuldige Wachleute mit über die Klinge springen, um keine Zeugen zu haben?« Der Ungar schüttelte ungläubig seinen Kopf. »Was sagt dieses Verhalten wohl über uns und unsere Ziele aus?«
Oberst Hartmann sah ihn lange an, bevor er antwortete. »Was willst du hören, László? Dass wir nicht besser sind als die Terroristen, die wir bekämpfen? Oder die Amerikaner?«
Der Ungar hob herausfordernd sein Kinn und nickte.
»Und wenn ich dir versichere, dass diese fünf Wachmänner ebenfalls Verbrecher waren? Dass sie ihre Vormachtstellung als Vollzugsbeamte dazu ausgenutzt haben, mit Drogen zu dealen, Häftlinge zu schikanieren und deren Angehörige zu erpressen? Dass sie Ehefrauen, Freundinnen und sogar Töchter von Häftlingen für sich anschaffen ließen, damit dem Ehemann, dem Freund oder Vater nichts passierte?«
Der Ungar atmete einmal tief durch.
Ob vor Erleichterung oder Resignation vermochte Hartmann nicht einzuschätzen.
»Diese Männer waren Abschaum«, fuhr er bitter fort. »Genau wie der Abschaum, den sie bewacht haben. Sie wurden für ihre Verbrechen nur nicht verurteilt und eingesperrt, sondern lediglich zwangsversetzt.«
»Zwangsversetzt in den Tod.«
Der Oberst honorierte diese Bemerkung mit einem gelangweilten Schulterzucken.
Polanski rappelte sich auf. »Verstehe ich das richtig«, begann er und kratzte sich die abstehenden Ohren. »Das viele Geld für diese jahrzehntelangen geheimen Forschungen – steckt dahinter lediglich der Bau einer Bombe, mit der wir unsere Feinde einfach verdampfen lassen?«
»Nein, nein«, winkte der Oberst lachend ab, obwohl ihm eigentlich nicht nach Lachen zumute war. »Die Entwicklung dieser Bombe war nur eine Nebenbaustelle, wenn ich das so sagen darf. Mit ihr räumen wir hinterher nur auf.«
Polanski verengte seine Augen zu Schlitzen. »Wie hinterher?«
3
– Alexander Buschbeck –
Das Detektivbüro lag im Zwielicht. Die Sonne war noch nicht vollständig untergegangen, aber die Schatten der Häuserreihen, die rechts und links die Straße säumten, hatten längst ihre düsteren Tunnel aufgebaut.
Alexander Buschbeck schaute auf die Uhr, höchste Zeit, Licht zu machen.
Während andere Branchen freitags ab Mittag ihre Läden schlossen, weil das Wochengeschäft gelaufen war, ging es bei ihm gegen Abend erst richtig los.
Am letzten Arbeitstag der Woche kamen Klienten, die von Montag bis Donnerstag zu beschäftigt waren, um sich mit einem Privatermittler zu treffen. Außerdem erwartete er Menschen, die diesen Gang aus verschiedensten Gründen immer wieder vor sich hergeschoben hatten. Die einen, weil es ihnen peinlich war, ihren Verdacht gegen Ehepartner, Geschäftspartner oder Freunde vor einem Fremden auszusprechen. Die anderen, weil sie zu den Menschen gehörten, die nur ungern ihre Komfortzone verließen. Für die es deshalb schon Überwindung kostete, einfach nur zum Zahnarzt zu gehen. Oder zum Amt. Die ihre Behördenwege nur deshalb erledigten, weil ihr Leben in gewisser Weise davon abhing.
Doch egal, zu welcher Gruppe seine Klienten gehörten, sie quälten überwältigende Probleme, die sie nicht – oder nicht schon wieder – mit ins Wochenende nehmen wollten.
Buschbeck schaltete das Deckenlicht ein und vergewisserte sich, dass der Lamellenvorhang den Blick durch die Fenster von der Straße her unmöglich machte.
Eine Privatdetektei glich einem Beichtstuhl. Nur mit dem Unterschied, dass sich ein Priester die Sorgen und Ängste seiner Schäfchen lediglich anhörte und die Beichtenden im Gegenzug keine echten Konsequenzen fürchten mussten.
Bete zehn Vaterunser und deine Seele ist wie neu.
Ging dagegen ein Mitwisser, Zeuge oder besorgter Bürger zu einem Privatdetektiv, dann konnte es schon mal kreuzgefährlich für ihn werden. Dann nämlich, wenn durch seine Initiative eine hochrangige Persönlichkeit, wie zum Beispiel ein Banker, Polizeichef, Politiker oder Drogenboss, trotz Schmiergeld Gefahr lief, hinter Gitter zu wandern. Die Verbrecher selbst würden alles daransetzen, diesen Mitwisser, Zeugen oder besorgten Bürger aus dem Weg zu räumen. Doch selbst diejenigen, die sich schmieren ließen, hatten einiges, wenn nicht sogar alles zu verlieren, wenn der Mitwisser, Zeuge oder besorgte Bürger am Leben blieb.
In der Vergangenheit hatte Buschbeck einige dieser Fälle auf dem Tisch gehabt. Und manchmal waren seine Klienten tatsächlich haarscharf am Tod vorbeigeschrammt.
Beichtstühle haben ihre Berechtigung, keine Frage. Aber manchmal brauchen Menschen in Not neben jemandem, der ihnen zuhört, auch jemanden, der ihnen hilft. Es reicht nicht, die Notsituation zu benennen, sie muss untersucht und beendet werden.
Und genau darin sah Buschbeck seine Bestimmung, seinen Job. Wie es Menschen gab, die überdurchschnittlich gut mit Zahlen umgehen konnten, oder über ein außergewöhnliches Talent für Fremdsprachen verfügten, fiel es ihm besonders leicht, sich in die Psyche eines anderen Menschen hineinzudenken. Mit Blick auf eine begangene Tat gelang es ihm, Motive nachzuvollziehen, Widersprüche zu erkennen und den Wahrheitsgehalt einer Einlassung einzuschätzen. Damit klärte er keine Verbrechen auf, das war ihm bewusst, aber er lieferte Anhaltspunkte für die Ermittlungsarbeit der Polizei.
Diese Fähigkeiten, noch vor ein paar Jahren als Fluch empfunden, stellte er seit seinem Ausscheiden aus dem Polizeidienst dem einfachen Bürger zur Verfügung.
Unentgeltlich, weil er aufgrund einer Erbschaft kein zusätzliches Einkommen benötigte. Aus diesem Grund nahm er auch nicht jeden Fall an. Er kümmerte sich weder um Fremdgeher und Erbschleicher, noch ließ er sich von Arbeitgebern dazu einspannen, die Krankmeldung seines Angestellten zu überprüfen.
Stattdessen half er denen, die sich hilflos fühlten, weil sie mit ihren Sorgen, Ängsten, Vermutungen und Verdächtigungen bei Behörden gegen eine Wand aus Ignoranz und Schweigen liefen. Er engagierte sich für Menschen, für die aufgeben keine Option war, weil sie Gewissheit brauchten, um Frieden zu finden.
Buschbeck schreckte auf, als es an der Tür klopfte.
Auf seiner Uhr war es 20 Uhr, woraus er folgerte, nicht nur eingenickt zu sein, sondern volle zwei Stunden geschlafen zu haben.
»Ja, bitte«, rief er und verließ den Platz hinter seinem Schreibtisch, um seinen Gast zu begrüßen.
Die Tür öffnete sich zaghaft und ein Mann mittleren Alters betrat das Büro. Er war kleiner als Buschbeck, schätzungsweise 1,75 m groß. Eine Verletzung auf seiner linken Wange strahlte feuerrot nach allen Seiten des Gesichts aus. Sie war höchstens zwei, drei Tage alt und hatte sich offensichtlich entzündet. Im Großen und Ganzen ein eher unauffälliger Typ, wären da nicht seine unterschiedlich farbigen Augen. Der Blick dieser Augen löste in Buschbeck eine dumpfe Zwiespältigkeit aus, die sich nicht spontan einordnen ließ. Es war, als blicke man gleichzeitig auf zwei Seiten einer einzigen Medaille. Während ihn das linke, graublaue Auge mit abweisender Kälte zu fixieren schien, schaute ihm das rechte, dunkelbraune Auge mit demütiger Wärme entgegen.
Buschbeck sah kurz weg und verscheuchte das Bild von ihm, um es gleich darauf erneut einzufangen. Wie erwartet, gewann er nun den Eindruck einer Fehlstellung der Augen. Schielte der Mann? Eine Empfindung, der er zuvor nur entgangen war, weil er sich sein Gegenüber lang genug angesehen hatte.
Mit Sicherheit war es für seinen Besucher nicht immer leicht, die Reaktionen seiner Mitmenschen auszuhalten. Die einen, die den vermeintlich schielenden Mann wie Luft behandelten, um ihn nicht mit einem zweiten Blick zu kränken. Und die anderen, die ihn fasziniert anstarrten, weil sie einen zweiten Blick gewagt und die Diskrepanz erkannt hatten.
Doch deshalb war er bestimmt nicht hergekommen.
Anhand seiner Körperspannung, dem Schwung seiner Lippen und an der Haltung seiner Hände, konnte Buschbeck deutlich eine innere Zerrissenheit ausmachen, deren Schmerz viel tiefer ging, als von irgendeiner persönlichen Enttäuschung herrührend. An der Oberfläche wirkte er zwar gesetzt und aufgeräumt. In seiner Ausstrahlung fest entschlossen, wenn auch scheu. Aber an der Art, wie er seinen Kopf hielt, leicht schräg wie ein bettelnder Hund, offenbarte sich dem Detektiv seine seelische Erschöpfung. Nach einer nicht enden wollenden Jagd nach Antworten, welcher Art auch immer, verlangte es ihm danach, endlich Frieden zu finden.
Buschbeck schloss auf ein Trauma, das schon einige Jahre zurücklag.