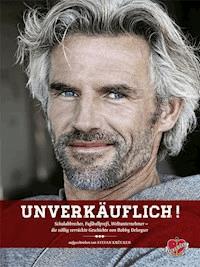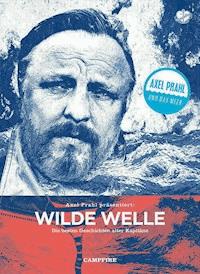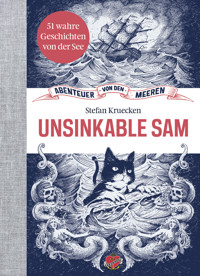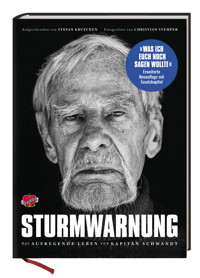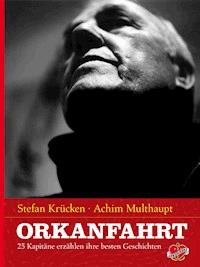
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ankerherz Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wer erzählt die besten Geschichten vom Meer? Kapitäne berichten von wilden Stürmen, von Monsterwellen, von Stunden zwischen Leben und Tod. Von gefährlicher Fracht, geheimnisvollen Aufträgen, von harten Matrosen und leichten Mädchen. Sie erzählen von ihrer Liebe zur See und von einer Romantik, die es vielleicht nie mehr geben wird. Orkanfahrt sammelt 25 Liebeserklärungen an die Seefahrt, an einen Beruf, der wie kein anderer Sehnsüchte, Fernweh, Romantik und die Lust auf Abenteuer weckt. Orkanfahrt ist eine Hommage an alle mutigen Männer auf See. Geschichten aus der Wirklichkeit, spannend aufgeschrieben von Reporter Stefan Krücken, erstklassig fotografiert von Achim Multhaupt, liebevoll illustriert von Jerzovskaja. Denn nichts ist so fesselnd wie das echte Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ORKANFAHRT
25 Kapitäne erzählen ihre besten Geschichten
Tag für Tag weht an uns vorbei, bringt das Boot in den Wind.
Und ein Kuss und ein Tag im Mai, sei nicht traurig, mein Kind.
So viele Jahre und so viele Sterne ist es wohl her,
seit wir draußen sind auf dem Meer.
Übers Meer · Rio Reiser
Prolog
Aus der Mannschaftsmesse
In einer Interviewpause, als er mit Kaffee aus der Küche zurückkam, erzählte einer der Kapitäne folgende Episode: Damals in der Karibik, wenn es ihm zu viel wurde, oder wenn er merkte, dass es seiner Mannschaft zu viel wurde, schaltete er das Funkgerät aus. Suchte eine Insel mit schönen Stränden und ließ den Anker werfen. Zum Sonnenbaden und Bier trinken, für zwei Tage, manchmal für mehr.
Erst dann fuhr sein Schiff weiter, und wenn sich jemand von der Reederei erkundigte, was denn bitte los war, antwortete er: schwere See, Probleme im Hafen.Und keine weiteren Fragen, er habe schließlich zu arbeiten.
»Früher war man als Kapitän noch der wahre Chef an Bord«, erzählte er, und es klang wehmütig, »aber heute?«
Um früher soll es gehen, um die Zeit, als noch keine Satelliten und keine Computer die Reisen der Seeleute überwachten. Als es keine Fahrpläne gab, keine minutengenauen Liegezeiten, keine Joysticks auf der Brücke. Als Schiffe noch nicht wie ferngesteuerte Busse mit einer Dauergeschwindigkeit von 25 Knoten über die Ozeane rauschten.
Wir wollen der alten Seefahrt ein Denkmal setzen. Deutsche Kapitäne erzählen, wie sie als Schiffsjungen vor Kap Hoorn in der Takelage froren, wie sie aus Liebe desertierten oder, wenn es nicht anders ging, tausende Tonnen Getreide in einen argentinischen Fluss kippten. Von Stürmen berichten sie, von Monsterwellen, von Stunden zwischen Leben und Tod. Von gefährlicher Fracht, geheimnisvollen Aufträgen, von Piraten und Schlägereien im Hafen. Von Kerlen wie »Indianer-Fietje« oder »Jimmy Low«, von schweren Fehlern und leichten Mädchen. Sie erzählen von ihrer Liebe zur See und von einer Romantik, die es vielleicht nie mehr geben wird.
Wer alte Kapitäne um ihre beste Geschichte bittet, der muss wissen, worauf er sich einlässt. Man hat mit Männern zu tun, die jahrelang nur die eigene Autorität kannten, oft wortkarge Seeleute, die ein wenig misstrauisch sind und sich selbst nicht so wichtig nehmen. Weshalb es meist ein wenig dauerte, bis sie erzählten. »Wieso wollen Sie das denn so genau wissen?«, diese Frage hörten wir Reporter immer wieder, »ist doch gar nicht so spannend!«
Die Idee zum Projekt kam uns in der Haifischbar, einer Kneipe am Hamburger Hafen, im Herbst 2004. Wer erzählt eigentlich die besten Geschichten? Als wir die Antwort fanden, begann die Suche. Gleich der erste Kapitän, der Hamburger Emil Feith, empfing uns mit rauer Herzlichkeit. Um seine Orkanfahrt präzise zu rekonstruieren, hatte er eigens seinen alten Reeder angerufen, eine Kopie des Logbuchs und den damaligen Wetterbericht besorgt. Bei Kaffee und Gebäck blätterten wir in seinem Fotoalbum, und er berichtete an mehreren Winternachmittagen, wie er trotz des Ausfalls der Ruderanlage mitten im perfekten Sturm auf dem Nordatlantik überlebte.
Für die Porträts reisten wir von Ostfriesland bis Fischland und von Flensburg bis in die Lüneburger Heide. Fast alle Kapitäne leben heute noch in der Nähe des Meeres. Es ist die Liebe ihres Lebens, die sie nie losgelassen hat. Jede Geschichte ist aus ihrer Sicht erzählt; der Kapitän bekam das fertige Manuskript zur Autorisierung vorgelegt. Jedes Wort soll authentisch sein, jedes Wort dem Kapitän gehören.
Unser Dank gilt allen Kapitänen, für ihre Zeit und Gastfreundschaft. Unser Dank gilt außerdem Nikolaus Gelpke, Chefredakteur der Zeitschrift mare, der die Kapitänsgeschichten als Kolumne druckte. Und wir freuen uns über die Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), deren Vormänner zu den Helden dieses Buchs gehören.
Und nun: Anker auf!
Stefan KrückenLüneburg, im September 2007
41° 08’ N ++ 57° 49’ W ++ im Auge von Hurrikan „Grace“ ++ Nordatlantik ++ „MS Svea Pacific“ ++ 30. Oktober 1991
Orkanfahrt
Die »Svea Pacific« gerät in den Hurrikan »Grace«. Mitten im Auge des schlimmsten Sturms seit Beginn der Wetteraufzeichnungen fällt die Ruderanlage des Frachters aus. 20 Meter hohe Wellen rollen auf das Schiff zu.Kapitän Emil Feith berichtet über die längsten Minuten seines Lebens.
Wer so lange zur See gefahren ist wie ich, erkennt einen Sturm an seinem Klang. Bis 9 Beaufort ist es ein Brüllen, ab 11 Beaufort ein Stöhnen. Je stärker ein Sturm, desto tiefer seine Stimme, das ist die Regel. Was ich jetzt auf der Brücke der Svea Pacific höre, macht mir Sorgen. Von draußen dringt ein schwingender Ton herein, ein dumpfes Brummen, wie von einer gewaltigen Orgel.
Der Nordatlantik ist so aufgepeitscht, dass man vor der Scheibe nur noch eine graue Wand sieht. Gewaltige Brecher krachen aufs Deck, das Schiff erzittert unter jedem Schlag, arbeitet schwer in seinen Verbänden. Der Stahl schreit regelrecht, wie ich es noch nie in meinem Leben gehört habe.
Manche Wellen sind 20 Meter hoch, sie heben und senken die Svea Pacific, einen Massengutfrachter von 2509 Bruttoregistertonnen, 88 Meter lang, 15,5 Meter breit, wie ein Spielzeug. »Herr Kapitän, gehen Sie bitte schnell in den Salon«, ruft der Erste Offizier, der gerade auf die Brücke kommt. Ich übertrage ihm das Kommando und nehme die Treppe. Der Salon liegt ein Deck tiefer, darin ein Konferenztisch, Metallstühle, die in den Boden geschraubt sind, ein Fernseher, die Wände sind mit braunem Resopal getäfelt.
Vor den Fenstern hat sich die Mannschaft versammelt und starrt hinaus, obwohl es nichts zu sehen gibt. 13 Mann, alle stammen von den Philippinen. Sie tragen Rettungswesten. Ihre Gesichter sind bleich vor Angst, einige wirken abwesend, wie betäubt. Der Zweite Offizier, er heißt Garcia, zeigt keine Reaktion, als ich ihm meine rechte Hand auf die Schulter lege. Sie fürchten um ihr Leben, und damit liegen sie nicht einmal falsch. Ich bin auch nicht sicher, ob wir die nächsten Stunden überleben werden.
Da fällt mir eine Kassette ein, die mir meine Frau Siggi mitgegeben hat: Country-Musik, die höre ich so gerne, Johnny Cash. Ich drehe die Musik so laut auf, wie es nur geht. Johnny Cash singt:
How high’s the water, mama? / Two feet high and risin’ / How high’s the water, papa? / Two feet high and risin’
Ich pfeife dazu die Melodie, als liefen wir an einem Sommertag durch ruhige See und nicht mitten durch die Vereinigung eines furchtbaren Tiefdruckgebiets mit dem Hurrikan Grace – eine Konstellation, die manche Meteorologen später »Monsterorkan« oder »Jahrhundertsturm« nennen werden. Sogar Hollywood hat einen Film darüber gedreht, Der Sturm mit George Clooney in der Hauptrolle; sehr realistisch übrigens, ich habe mir das auf Video angesehen.
»Ach was Männer, stellt euch nicht so an«, brumme ich und versuche, so gleichgültig wie möglich zu klingen, »ihr müsst erst mal im Winter durch die Biskaya fahren, da habt ihr jeden Tag so ein Wetter!«
In dem Moment kommt der Erste Ingenieur Thode herein – ohne Rettungsweste, wie ich erleichtert feststelle – und nickt mir zu. Er fragt auf Deutsch: »Käpten, mal ehrlich, meinen Sie, dass wir es schaffen?« Chief Thode ist groß und stämmig gebaut, mit einem dichten Vollbart im Gesicht, er sieht aus wie der kleine Bruder eines Grizzlybären. Er fragt und grinst dabei, als habe er gerade einen schmutzigen Witz erzählt, denn die Mannschaft darf bloß nichts mitbekommen. Eine Panik ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können.
Ich lächle zurück: »Chief, sieht nicht gut aus.«
Thode dankt, dann sagt er auf Englisch zur Crew: »Der Kapitän hat Recht, in der Biskaya ist es noch schlimmer.« Dann grinsen wir beide um die Wette. In Hollywood hätte das Clooney auch nicht besser hingekriegt.
Als Kapitän muss man manchmal Schauspieler sein, das gehört zum Beruf. Meine wahren Gefühle darf ich nicht zeigen: Ungewissheit, Zweifel, davon soll keiner etwas merken. Um es ganz klar zu sagen: Ich glaube von Minute zu Minute weniger daran, dass wir diesen Sturm überstehen.
Seit dem 19. Oktober 1991 sind wir nun auf See, ausgelaufen von Houston in Texas, mit 3393 Tonnen Baustahl an Bord. T-Träger für Liverpool, ein Hochhaus soll damit gebaut werden. Bis hinauf zur Lukenabdeckung sind die Laderäume gestaut, zum Glück. Denn egal, wie stark sich das Schiff auf die Seite legt, die Ladung kann nicht kippen, nicht »übergehen«, wie man in der Seefahrersprache sagt.
Nach einer Woche erreicht uns die Nachricht, dass sich der Hurrikan Grace hinter uns mit hoher Geschwindigkeit nähert. Mit voller Kraft laufen wir vor ihm her, verfolgt von seinen Wellen, als unser Funker am Morgen des 27. Oktobers noch ein gewaltiges Sturmtief meldet. Es vergrößert sich nahe Neufundland und bewegt sich mit 33 Knoten nach Südwesten. Den Berechnungen nach würde es zwar unseren Kurs kreuzen, aber ein ganzes Stück vor uns durchziehen.
28. Oktober, 6 Uhr. Alles anders, als Wetterbericht und Berechnungen versprochen hatten. Das Sturmtief nähert sich viel langsamer, mit einer Geschwindigkeit von nur noch fünf Knoten in der Stunde. Eine erschreckende Nachricht: Wir laufen also mitten hinein in den gewaltigen Sturm.
Mein ganzes Leben fahre ich zur See, seit 1952, da war ich 16. Als Kapitän habe ich Schiffe jeder Größe befehligt. Vor Monrovia wurde mein Frachter einmal von Piraten überfallen, in Madagaskar gerieten wir mitten in eine Revolution; im Hafen von Lagos habe ich mehrere Leichen vorbeitreiben sehen. Einmal hat mich ein Taifun erwischt, Kurs Honolulu, und zwar so heftig, dass sich die chinesische Mannschaft vor Panik in ihren Kabinen einschloss. 24 Stunden bevor die Taifun-Warnung der Wetterberatung eintraf, hatte ich aus einem komischen Gefühl heraus den Kurs um 180 Grad geändert. In der modernen Seefahrt werden die Schiffe – ähnlich wie Flugzeuge in der Luftüberwachung – von Seewetterämtern über die Meere gelotst, die Reedereien geben dafür viel Geld aus. In unserem Fall aber kam die Warnung viel zu spät, und ohne den radikalen Kurswechsel wären wir verloren gewesen.
Mich kann so schnell nichts beunruhigen, aber als ich den Wetterbericht studiere, zieht es mir den Magen zusammen.
28. Oktober, 14 Uhr. Der Sturm schickt seine ersten Boten, die Dünung nimmt stetig zu. Unser Schiff beginnt stark zu rollen, 20 Grad nach Backbord, 20 Grad nach Steuerbord. Die Svea Pacific ist ein solides Schiff, das alles laden kann: Erz, Stahl, Container. Aber sie ist Baujahr 1980, was für einen Bulkcarrier, der stark beansprucht wird, ziemlich alt ist. Obendrein ist sie reif für die Werft; die Luken sind nicht mehr ganz dicht.
Ich gebe Anweisungen, das Schiff für den Sturm klarzumachen. Alle Bullaugen werden geschlossen, was noch an Deck, in der Küche oder der Messe herumliegt, wird verstaut. Der Maschinenraum wird abgeschlossen; ab sofort darf ihn nur noch der Chief betreten. Man nennt das »wachfreien Betrieb«, die Maschine wird dann von der Brücke aus gefahren. Am Abend brist der Wind aus südwestlicher Richtung auf, Windstärke acht, zunehmend. Die Wellen sind bereits an die acht Meter hoch. Ich lasse die Deckbeleuchtung einschalten und die ganze Nacht brennen, um im Schadensfall sofort reagieren zu können.
29. Oktober, 12 Uhr. Schwerer Sturm, mindestens 11 Beaufort. Das Barometer fällt weiter, unter 1000 Millibar, was bedeutet, dass der Orkan an Stärke weiter zunehmen wird. Schwere Brecher schlagen von steuerbord über das Deck und die Luken, ich muss den bisherigen Kurs aufgeben und beidrehen. Wir laufen jetzt frontal gegen die Wellen, mit einer Geschwindigkeit, die so weit reduziert ist, dass die Svea Pacific gerade noch steuerfähig bleibt: Man legt sich mit dem Bug in den Wind und bietet möglichst wenig Angriffsfläche, wie ein Pfeil. Den Sturm »abreiten« nennt man das.
Am Nachmittag messen wir Orkanstärke 12, nun ist es, als fahre man durch einen Suppenkessel. Die Wellen kommen in merkwürdig kurzen Abständen; je kürzer die Periode ist, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie brechen. Sie prügeln auf uns ein wie Fäuste aus Wasser. Der Ozean spielt mit uns, wirft uns hin und her, so geht das in den Abend und weiter, die ganze Nacht.
Jeder, der nicht auf der Brücke seinen Dienst verrichtet, hält sich in diesen Stunden irgendwo fest; man versucht, sich gegenseitig Mut zu machen. Es ist auch ein Nervenspiel. Normale Mahlzeiten werden nicht mehr eingenommen, der Smutje öffnet ein paar Konservendosen, Fisch, Ananas, Corned Beef, solche Sachen. Als Kapitän ist man sowieso die ganze Zeit auf der Brücke. Ich trinke Kaffee, kannenweise Kaffee, und knabbere einen Schokoladenriegel nach dem anderen, das gibt Energie und beruhigt die Nerven.
30. Oktober, gegen 11 Uhr, Position 41˚ Nord und 57˚ West: Das Barometer ist auf 985 Millibar gefallen, seit Stunden Windstärke 12, weiter zunehmend. Ich frage mich, wie lange die Svea Pacific das noch aushält, denn durch die Stahlladung ist das Schiff »steif«, was bedeutet, dass sich die Stahlhülle nicht verformen kann. Eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis Risse entstehen. Ich denke gerade wieder darüber nach, da bemerke ich, dass wir deutlich Schlagseite nach backbord haben.
Ein Riss?
Oder ein Leck?
In jedem Fall ein Albtraum, und der Erste Offizier Monongson und Bootsmann Quiros machen sich bereit, an Deck zu prüfen, wie viel Wasser sich schon im Inneren der Svea Pacific gesammelt hat. Monongson ist mein Stellvertreter, Quiros das ranghöchste Mitglied der Mannschaft, deshalb fällt die Wahl auf die beiden.
Sie seilen sich für ihre Expedition nach draußen an. Für die Peilung müssen sie einen Stab, der mit Kreide überzogen ist, durch Rohre in die Ballasttanks zwischen Bordwand und Laderäumen hinablassen. Die Tanks sind dafür konzipiert, dass man sie je nach Ladung fluten kann, um das Gewicht auszugleichen; die Svea Pacific verfügt also über zwei Hüllen.
Das Schiff rollt so stark, dass es beinahe unmöglich ist, Halt zu finden; eine Welle kann die Männer jeden Moment erfassen, sie an der Reling erschlagen oder gegen einen Aufbau schmettern. Die Sicht: gleich Null. Wind und Gischt nehmen einem den Atem. Jemanden bei diesem Wetter an Deck zu wissen, ist so ziemlich das Schlimmste, was es für einen Kapitän gibt.
Wir sehen sie nur schemenhaft. Minuten vergehen. Dann geben sie ein Zeichen, man zieht sie an der Sicherheitsleine ins Schiffsinnere zurück. Mit fürchterlichen Neuigkeiten: Wir haben tatsächlich ein Leck, backbord an der Bordwand, vermutlich unterhalb der Wasserlinie. Mehr als 900 Tonnen Wasser, das errechne ich rasch anhand einer Tabelle, sind bereits in die Ballasttanks eingedrungen.
Ich rufe Chief Thode im Maschinenraum und lasse die zwei Pumpen in den Tanks anwerfen. Wir warten. Minuten später ist klar, dass es die Pumpen schaffen, den Pegel zumindest konstant zu halten. Sonst wären wir bereits gesunken.
30. Oktober, 14 Uhr. Der Sturm flaut ganz plötzlich ab. Von einer Minute auf die andere ist es beinahe windstill, eine unheimliche Atmosphäre. Die Wellen türmen sich noch immer hoch wie Häuser, aber sie sind nur leicht gekräuselt. Tausende Seevögel schwimmen auf dem Wasser, Gänse, Möwen, ihre Schreie sind auf der Brücke zu hören, der Himmel schimmert grau und dunstig; diffuses Licht, als befänden wir uns unter einer Kuppel aus Milchglas.
Wir sind im Auge des Orkans.
Eine erneute Peilung ergibt, dass die Laderäume noch immer fast trocken sind, eine gute Nachricht. Nach meiner Berechnung können wir noch maximal 150 Tonnen Wasser aufnehmen, dann sind wir zu schwer.
Etwa eine Stunde fahren wir mit voller Maschinenkraft weiter, dann ist der Sturm wieder da, beinahe mit einem Schlag, als habe man ein gewaltiges Gebläse auf volle Kraft gestellt. Wir sind zurück im Inferno, der Wind brüllt aus nordöstlicher bis südsüdwestlicher Richtung, die Wellen türmen sich mehr als 20 Meter hoch. Hoffentlich halten die Pumpen durch.
Mühsam muss ich immer wieder beidrehen lassen, wenn die Svea Pacific von den Wellen abgedrängt wird. Der Rudergänger klammert sich ans Steuer, das an das eines Flugzeugs erinnert; für alle an Bord ist es anstrengend, sich die ganze Zeit irgendwo festzuhalten, um nicht quer durch den Raum geschleudert zu werden.
15.45Uhr. Wir empfangen ein S.O.S. Ein Frachter in Seenot, ein 9000-Tonnen-Schiff, mehr als doppelt so groß wie die Svea Pacific. Eine Welle hat die Brücke eingeschlagen. Nach dem Seerecht ist jedes Schiff dazu verpflichtet, sofort zu reagieren. Es sei denn, man ist gerade mit dem eigenen Überleben beschäftigt. Niemand antwortet auf das Mayday, und auch wir können nicht helfen.
30. Oktober, 16.03 Uhr, ich erinnere mich genau an die Uhrzeit. Chief Thode erscheint auf der Brücke, sein Gesicht ist fahl, glänzt vor Schweiß. Er flüstert:»Kapitän, die Rudermaschine verliert Öl. Viel Öl. Wir müssen stoppen.«
»Stoppen? Dann saufen wir ab!«, rufe ich.
»Die Maschine läuft schon heiß. Ich muss auf die Reservemaschine umschalten.«
»Wie lange dauert das?«
»Etwa zehn Minuten.«
Zehn Minuten sollen wir also manövrierunfähig sein, hilflos im schlimmsten Sturm seit Beginn der Wetteraufzeichnung, mitten auf dem Nordatlantik. Wenn die Svea Pacific quer zur See treibt, sind wir der vollen Kraft der brechenden Wellen ausgesetzt. Selbst Supertanker geraten in einer solchen Situation in ernste Schwierigkeiten. Ein Teil des Decks oder die Luken werden aufgeschlagen, das Schiff läuft in kürzester Zeit voll.
Aber welche Wahl haben wir noch?
»Okay Chief, versuchen Sie es.«
Er nickt und eilt zum Maschinenraum. Was nun folgt, sind die längsten Minuten meines Lebens. Angst? Empfinde ich nicht, ganz ehrlich nicht. Ich will jetzt nicht angeberisch klingen, aber Angst hatte ich noch nie in meinem Leben. Das muss ein Genfehler sein. Ich saß zum Beispiel mal in einer Boeing 747 auf dem Weg von Addis Abeba nach Rom, als das Flugzeug stark an Höhe verlor, als stürze es ab. Panik brach aus, nur der Erste Offizier der damaligen Reise, der neben mir saß, blieb auch ganz ruhig. Wir haben uns angesehen und schnell eine Flasche Chivas Regal geöffnet, aus dem Duty Free. Während alle um uns herum weinten und schrien, leerten wir die Flasche mit großen Schlucken.
Die Minuten vergehen so langsam, als sei die Zeit verklebt. Ich denke an nichts, mein Hirn ist wie abgeschaltet, ich starre nur hinaus und beobachte, was der Sturm mit uns treibt. Ganz langsam schiebt sich die Svea Pacific quer zur See. Ich überlege kurz, meine Frau Siggi ein letztes Mal über das Satellitentelefon anzurufen, aber ich lasse es sein. Sofern ich überhaupt eine Verbindung bekomme, wird sie mein Anruf nur beunruhigen, ach was, er wird sie verrückt machen vor Angst. Ich melde mich von unterwegs sowieso nur ganz selten, immer dann, wenn wir einen Hafen angelaufen haben. Zuletzt habe ich sie aus Texas angerufen.
Ich schreibe lieber lange Briefe, aber wo genau ich bin, soll sie nicht wissen. Ich will nicht, dass sie sich unnötig Sorgen macht.
Immer weiter dreht das Schiff zur See. Ein gewaltiger Wasserberg kracht aufs Deck, das Schiff erzittert. Kein Schaden. Aber wie lange geht das noch gut?
Da erscheint Chief Thode wieder auf der Brücke, er ist außer Atem, aber er strahlt, er schreit vor Glück:
»Kapitän, Rudermaschine läuft!«
»Okay«, erwidere ich, »da haben wir ja Glück.«
Wir sind gerettet, fürs Erste. Aber mehr Gefühl erlaube ich mir nicht, man muss ja sein Gesicht wahren. Das ist eben meine Art, ich tanze nicht herum vor Freude, egal, wie froh ich bin.
Es dauert einige Minuten, bis der Bug der Svea Pacific wieder genau in die See zeigt, und nun wagen der Chief und ich etwas, das uns sonst niemals einfallen würde: Wir genehmigen uns einen großen Schluck Scotch, Johnny Walker, Black Label. Nie wieder hat mir ein Drink so gut geschmeckt wie in diesem Augenblick.
Nach einigen Stunden ebbt der Sturm auf Stärke 8 ab, was noch immer kein Vergnügen ist, aber nach dem, was wir hinter uns haben, erscheint es fast harmlos. Meine Sorgen gelten den Pumpen, die den Wassereinbruch in den Ballasttanks konstant halten müssen, doch sie laufen weiterhin tadellos.
8. November, kurz nach 23 Uhr. Wir erreichen in stürmischer See die Schleuse von Birkenhead bei Liverpool. Kurz vor Mitternacht machen wir am Victoriadock fest. Ich gehe über die Gangway und untersuche die Svea Pacific mit dem Handscheinwerfer. Der Orkan hat die Farbe vom Schiff geschlagen, an vielen Stellen sieht man den nackten Stahl. Wir müssen selbst im Hafen die Pumpen weiterlaufen lassen, so groß ist der Riss unterhalb der Wasserlinie.
Was alles geschehen ist, kann ich erst viel später verarbeiten. Mich erwartet der übliche Stress, der jedem Kapitän bevorsteht, wenn sein Schiff in einen Hafen einläuft. Erst kommt die Immigration, dann der Zoll, dann die Hafenbehörde, dann das Gesundheitsamt. Zusätzlich erhalten wir Besuch von der Versicherung, weil die Ladung Seewasser abbekommen hat. Sie ist nur noch als Schrott von Wert: Die T-Träger dürfen nun nicht mehr im Bau eingesetzt werden, weil das Salzwasser sie rosten lässt. Das wird später noch Ärger geben, ganz klar. Aber in diesem Moment ist es mir ganz egal.
Wir haben überlebt.
Kapitän Emil Feith, Jahrgang 1936, kam in Tallinn zur Welt. Die Flucht in den Westen endete im bayrischen Weilheim. Mit 16 Jahren stieg der Vollwaise in einen Zug nach Hamburg und heuerte als Schiffsjunge an. Seine erste Reise führte ihn 1952 an Bord des Küstenmotorschiffs Rügen nach Finnland. Feith durchlief die klassische Karriere vom Moses zum Kapitän. 1973 übernahm er sein erstes Schiff. Es folgten Stückgutfrachter und Containerschiffe jeder Größe. Feith lebt in Hamburg.
59° 24’ S ++ 66° 17’ W ++ im Orkan vor Kap Hoorn ++ Viermastbark „Priwall“ ++ im Juli 1939
Kap Zorn
Seit Wochen schon tobt der Sturm. Die Kälte lässt Finger aufplatzen. Durch die Schlafkammern schwappt eisiges Wasser, und an Deck sind Leichennetze gespannt.
Hans Peter Jürgens erfährt auf der letzten Frachtreise der Viermastbark »Priwall«, warum Gott Kap Hoorn im Zorn erschuf.
Auf meiner ersten Reise erfuhr ich, dass einem auf See manchmal keine Zeit für Albträume bleibt. Dass es eine Form der Erschöpfung gibt, in der das Unterbewusstsein das Kommando übernimmt. Wenn die Fingerbeugen vor Kälte und Anstrengung aufplatzen und einem das nasse Ölzeug den Nacken und die Handgelenke aufscheuert. Es ist nun 67 Jahre her, aber ich erinnere mich an diese Erfahrungen, als sei alles gestern passiert.
Mein Vater, selbst Kapitän, hatte mich als Schiffsjungen auf der Priwall untergebracht, einer Viermastbark von 98,5 Metern Länge und 14,4 Metern Breite. Am 16.Mai