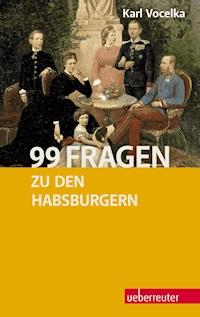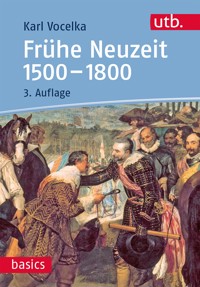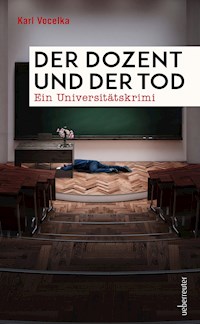9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
on den Anfängen der Christianisierung auf dem Gebiet des heutigen Österreichs bis zu aktuellen Entwicklungen der Gegenwart informiert dieses Buch über die Geschichte einer der ältesten und bedeutendsten Kulturnation Mitteleuropas. Aufstieg, Glanz und Untergang des Habsburgerreichs werden ebenso anschaulich und kritisch beschrieben wie die die Rolle Österreichs während des Nationalsozialismus und die Geschichte des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das Gebiet der heutigen Republik Österreich bildete bis 1806 einen Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches. Ist die Geschichte Österreichs daher eine der Landesgeschichten der seit dem späten Mittelalter immer klarer erkennbaren Territorien des Reiches? Drei wesentliche Faktoren unterscheiden die Entwicklung Österreichs von der anderer Länder des Reiches. Zum Ersten war dieses Gebiet die "Hausmacht" der habsburgischen Dynastie, die von 1438 bis 1806 mit einer kurzen Ausnahme den Herrscher des Heiligen Römischen Reiches stellte. Zweitens kam es schon vor der habsburgischen Herrschaft durch die spezifische Randlage und die besondere Rechtsstellung der Mark Österreich zu einem Phänomen, das man als "Hinauswachsen aus dem Reich" bezeichnet, und drittens bildete dieses Österreich nach 1918 einen eigenen Staat, der zwar um seine Identität rang, aber realpolitisch ein souveräner Staat war. Wie sich die Geschichte Österreichs von den Anfängen bis zum Beitritt zur EU gestaltete, wo seine Grenzen im Laufe von mehr als eintausend Jahren verliefen, welche Bedeutung die Religion für das Land hatte, welche kulturelle Blüte es hervorbrachte, aber auch wie es zum Niedergang der politischen Kultur in der Zeit des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus beitrug, schildert Karl Vocelka in eindrucksvoller Klarheit und Anschaulichkeit in diesem kleinen Band.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Karl Vocelka
ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTE
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Karte: Die Habsburgermonarchie im späten 19. Jahrhundert
Karte: Die Republik Österreich
Gibt es eine österreichische Geschichte?
Österreich vor der ersten Erwähnung des Namens «Ostarrichi» (996)
Christianisierung und bayerische Besiedlung
Mittelalterliche Landesbildung
Die Babenberger und die Landwerdung Österreichs
Die nichtbabenbergischen Länder
Die Herrschaftsübernahme durch die Habsburger
Territoriale Veränderungen im späten Mittelalter
Der Beginn der Neuzeit und die Festigung der habsburgischen Macht
«Aufstieg zur Großmacht»
Die Bildung der Donaumonarchie
Widerstand und Konflikt in der Frühen Neuzeit
Soziale Strukturen und soziale Aufstände
Konfessionalisierung
Gegner im Westen und Osten – Die Osmanen und Frankreich
Konsolidierung und Triumph
Der «absolutistische Staat»
Höfische Gesellschaft und Sozialdisziplinierung
Höfische und kirchliche Kultur des Barock
Barocke Frömmigkeit
Der Weg in die Moderne
Das «Jahrhundert der Aufklärung»
Reformen, Reformen, Reformen
Industrialisierung
Die Entstehung des Bürgertums
Kräfte der Beharrung
Kampf gegen das revolutionäre und napoleonische Frankreich
Bürgertum zwischen Biedermeier und liberalem Verfassungsstaat
Konservative Kräfte – Bürokratie, Armee, Kirche
Kulturelle Blüte – das Fin de Siècle
Die Kräfte des Zerfalls
1848 – Revolution in der Habsburgermonarchie
Die «soziale Frage»
Der Kampf um eine Verfassung der Monarchie
Die Bildung der Massenparteien
Das Nationalitätenproblem
Il mondo casca – Erster Weltkrieg und Ende der Monarchie
Politische Konflikte und Visionen der Ersten Republik
Eine schwere Geburt
Kampf der ideologischen Gegner
Das Rote Wien
Der Weg in den Austrofaschismus
Die Deutschnationalen, der Aufstieg der
NSDAP
und der Anschluss
Österreich als Teil des nationalsozialistischen Deutschland
Opfer und/oder Täter?
Die Shoa und ihre Folgen für Österreich
Widerstand
Die Zweite Republik
Wiedererstehen 1945 und Wiederaufbau
Der Staatsvertrag 1955
Die politischen Verhältnisse der Zweiten Republik
Die Ära Kreisky und ihr Erbe
Veränderung des politischen Klimas 1986
Zusammenbruch des «Ostblocks» 1989 – Beitritt zur EU 1995
Neue Herausforderungen und Perspektiven
Literaturverzeichnis
Spezifische Lexika und Atlanten
Überblickswerke
Geschichte der Bundesländer
Habsburger
Register
Zum Buch
Vita
Impressum
Karte: Die Habsburgermonarchie im späten 19. Jahrhundert
Karte: Die Republik Österreich
Gibt es eine österreichische Geschichte?
Natürlich ist die Frage rhetorisch, sonst hätte man dieses Buch nicht schreiben dürfen. Aber sie hat auch eine gewisse Berechtigung, weil man für verschiedene Epochen Schwierigkeiten hat zu definieren, was denn «Österreich» bedeutet. Am einfachsten scheint das für die Geschichte von 1918 bis zur Gegenwart – sieht man von der schrecklichen Epoche Österreichs in der Historie während des «Dritten Reiches» (1938–1945) ab. Doch das Gebiet der heutigen Republik wurde und wird von vielen HistorikerInnen zurückgespiegelt in die Vergangenheit, und damit wird «österreichische Geschichte» vor 1918 als die Geschichte dieses Territoriums beschrieben. Die unhistorische Perspektive, die dahintersteckt, ist leicht zu erkennen. Selbst wenn man diese Grundannahme akzeptierte, käme man im Detail in Schwierigkeiten. Wie verhält es sich etwa mit Südtirol/Alto Adige, das historisch natürlich ein Teil Tirols ist, oder – um eine andere Perspektive zu zeigen – was ist mit dem Burgenland, das historisch zu Ungarn gehörte?
Die Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich im Jahre 1918 hatte ja ein doppeltes Programm: Einerseits sollte dieser Staat alle in der Monarchie lebenden Deutschen vereinen – was durch die Ansprüche der Nachbarstaaten und Siegermächte nicht möglich war –, und andererseits sollte 1918 kein selbständiger Staat gegründet werden, weil sich die Republik Deutsch-Österreich als Teil der Deutschen Republik verstand. Dieser nationale Zusammenschluss nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker wurde von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges verboten. So ist der Staat von 1918 eine mehr oder weniger zufällige Konstruktion, die erst spät von der Mehrzahl seiner Bewohner akzeptiert wurde, keineswegs aber ein historisch gewachsenes Ganzes.
Noch schwieriger ist die Frage, was denn «Österreich» bedeutet, zu beantworten, wenn man in die Zeit der Habsburgermonarchie zurückblickt. Sicherlich gab es einen Teil der Monarchie, die Erbländer, der im Volksmund als «Österreich» bezeichnet wurde, aber dieser bestand wieder aus historischen Individualitäten, die oft erst sehr spät zu diesem habsburgischen Staat gefunden hatten. Ein gutes Beispiel ist etwa Salzburg, das bis 1803 ein selbständiger geistlicher Staat unter der Herrschaft des Erzbischofs war und dann nach einigem Hin und Her schließlich erst 1815 im Wiener Kongress endgültig an die Habsburgermonarchie fiel. Während Steiermark und große Teile Oberösterreichs (nicht das Innviertel) schon in der babenbergischen Zeit mit dem niederösterreichischen Kernland «Österreich/Ostarrichi» vereint wurden, hatten die anderen heutigen Bundesländer wie Kärnten, Tirol und Vorarlberg im Mittelalter eine eigenständige Entwicklung und kamen erst im 14. Jahrhundert (in Vorarlberg dauerte der Prozess der Landeswerdung sogar bis ins 19. Jahrhundert) zum habsburgischen Besitz. In diesen Ländern gab und gibt es ein ausgeprägtes Landesbewusstsein, das sich auf die historische Einheit des Landes, nicht auf «Österreich» bezieht.
Wenn man der Frage nachgeht, was denn das Spezifische an der österreichischen Geschichte sei, so wird man über weite Strecken feststellen, dass sich die Grundzüge der Geschichte Österreichs nicht so wesentlich von denen anderer Länder unterscheiden, wie das die ältere Geschichtsschreibung herausarbeitete. Nur ein Beispiel für viele: Beim wichtigsten Privileg für die Babenberger in Österreich, dem Privilegium minus von 1156, stellte die ältere österreichische Forschung immer seine Einmaligkeit in den Mittelpunkt. Gibt man diese Nabelschau auf, so kommt man zu dem Schluss, dass auch andere Länder des Reiches in etwa dieser Zeit durchaus ähnliche Privilegien und Vorrechte (wie das weibliche Erbrecht oder die alleinige Gerichtsbarkeit des Landesherrn etc.) erhalten haben.
Das Jahr 996 wird immer wieder «Geburtstag» oder etwas zutreffender «Namenstag» Österreichs genannt und wurde im Laufe der Geschichte Anlass für identitätsstiftende Feiern und Ausstellungen. Was damals eigentlich passierte, war, dass ein kleiner Teil des Donautales, der noch nicht einmal Wien umfasste, in einer Urkunde «Ostarrichi» genannt wurde. Damit war etwas entstanden, das erst nachträglich Sinn bekam, denn bis weit hinein in das späte Mittelalter war nicht ausgemacht, dass gerade von diesem Gebiet, dem Kernstück der babenbergischen Mark, die sich später auf ganz Niederösterreich ausdehnte, der staatenbildende Impuls ausgehen würde.
Doch ist die Geschichte dieser einzelnen Teile Österreichs nicht von der Gesamtheit zu lösen, wie auch die Geschichte der (vorwiegend deutschsprachigen) Erblande nicht von der Geschichte der Gesamtmonarchie zu lösen ist. Nur eine – an den Rändern möglicherweise unscharfe – Zoomaufnahme der Situation entspricht der historischen Realität. So wird in diesem Büchlein zwar die Geschichte des Gebietes, das den heutigen Staat der Republik Österreich bildet, im Vordergrund stehen, aber der Kontext der Gesamtmonarchie soll soweit als möglich im Auge behalten werden. Für eine ausführlichere Geschichte Österreichs wäre in diesem Zusammenhang eine Reihe von Fragen – das Verhältnis zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation sowie zur Habsburgermonarchie, aber auch Fragen der nationalen Identität («deutsch» oder «österreichisch») – zu stellen, die vor allem im 19. und 20. Jahrhundert an Brisanz gewonnen haben und bis in die Gegenwart hineinwirken.
Österreich vor der ersten Erwähnung des Namens «Ostarrichi» (996)
Das Gebiet des heutigen Österreich hatte Anteil an den verschiedenen Phasen der urgeschichtlichen Kulturen Europas; die Kelten bildeten schließlich in diesem Raum ein Reich, das später von den Römern übernommen wurde. Mit dem Ende des Weströmischen Reiches beginnt eine unruhige Zeit für das Land, die aber auch Grundlagen für dessen weitere Geschicke schuf.
Christianisierung und bayerische Besiedlung
Als die Hunnen um 375 in Europa einfielen, gerieten die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Bewegung, die Völkerwanderungszeit begann. Für das Gebiet Österreichs war die Folge davon der Abzug der Romanen, der zugleich das Ende der römischen Herrschaft besiegelte.
395 zogen die Goten durch das Land, die Hunnen besetzten wenig später Pannonien, und um 500 folgten die Langobarden, deren Gräberfelder in Niederösterreich Belege für die kurzfristige Anwesenheit dieses Stammes liefern. Alle diese Völker hinterließen keine bleibenden Spuren in Ortsnamen oder innerhalb der Bevölkerung; erst mit dem 6. Jahrhundert begann eine neue Besiedelung, die langfristig prägend wirken sollte.
Politisch tragend war jene Bevölkerungsgruppe, deren Spuren nur archäologisch belegt sind, die Awaren. Sie kamen aus den Steppen Asiens und wurden erstmals 558 am Hofe Justinians fassbar; sie beherrschten in der Folge Pannonien, und in ihrem Gefolge kamen Slawen in das Gebiet des heutigen Österreich, deren Siedelgebiet durch Ortsnamen heute noch gut zu erschließen ist. Im Osten Österreichs (um 700 hatte sich eine Siedlungsgrenze vom Pustertal über die Hohen Tauern, das Ennstal, Salzkammergut, die Traun und das Mühlviertel gebildet) lebten slawische Siedler, im Norden die Mährer und im Süden die Slowenen. Etwa zur gleichen Zeit kamen vom Westen her die Bayern ins Land, deren Ethnognese (Stammesbildung) ein ungelöstes Forschungsproblem darstellt. Viele Namen in Österreich, die auf -ing und -heim enden, geben Zeugnis von dieser ältesten Schicht der Besiedelung. Tendenziell wurden die Slawen im Laufe der Zeit immer weiter von den Bayern zurückgedrängt, ein Prozess, der sich bis ins 20. Jahrhundert hinein vollzogen hat.
Die bayerische (und in Vorarlberg alemannische) Besiedlung ging Hand in Hand mit der Christianisierung des Alpen- und Donauraumes. Ob das spätantike Christentum weiterlebte, ist in der Forschung umstritten; die ersten Anstrengungen zur Bekehrung in Österreich gingen von den Merowingern und den bayerischen Herzögen aus dem Geschlecht der Agilolfinger aus. Irische Missionare waren die Ersten, die ins Land kamen, Columban (um 600) im Raume Bregenz, später sein Schüler Gallus, aber auch Eustasius, der die Bayernmission betrieb. Um 690 gründete Rupert die Erzabtei St. Peter in Salzburg, einer Stadt, die seit dem 8. Jahrhundert das Zentrum der Missionierung im Ostalpenraum werden sollte; unter dem in Salzburg wirkenden Iren Virgil begann die Bekehrung der Karantanen in den Ostalpen. Eine ähnlich wichtige Rolle spielte die Diözese Passau, deren Missionsgebiet den Donauraum bis weit hinein nach Ungarn umfasste. Auch die bayerischen Herzöge waren an der Missionierung beteiligt, Odilo gründete das Kloster Mondsee (748), und sein Sohn Tassilo III. stiftete ebenfalls einige Missionsklöster (Innichen/San Candido 769, Kremsmünster 777 und Mattsee 784), die der Bekehrung der Slawen dienten und Zentren der Kultur der Zeit waren.
798 wurde Salzburg Erzbistum mit den Suffraganen Regensburg, Passau, Freising und Säben/Sabiona; man schuf damit langfristig eine kirchliche Organisation, die bis zum Ende der Frühen Neuzeit überlebte. Die von Salzburg im Hochmittelalter gegründeten Eigenbistümer Gurk, Seckau und Lavant waren der Kern der späteren Landesbistümer in der Steiermark und in Kärnten. Passau, das bis 1785 Nieder- und Oberösterreich zu seinem Diözesangebiet zählte und bis weit nach Ungarn hinein missionierte, konnte trotz der Versuche Bischof Pilgrims (in den «Lorcher Fälschungen» berief er sich auf eine ältere Bischofstradition als Salzburg) mit der Stellung Salzburgs nicht konkurrieren.
Mittelalterliche Landesbildung
Nach der Entmachtung des letzten bayerischen Stammesfürsten Tassilo III. 788 und den erfolgreichen Awarenkriegen Karls des Großen wurde das Gebiet des heutigen Österreich Teil des karolingischen Markensystems. Ende des 9. Jahrhunderts geriet diese politische Ordnung durch den Einfall der Magyaren, die sich in der ungarischen Tiefebene niederließen, aber Raubzüge quer durch Europa unternahmen, erneut in die Krise. 907 kam es bereits zu einer Schlacht mit ihnen bei Pressburg/Bratislava, in der Markgraf Luitpold (vielleicht ein Ahne der Babenberger) getötet wurde. Erst der Sieg gegen die Ungarn auf dem Lechfeld 955 eröffnete die Möglichkeit einer Neuordnung des Donauraumes.
Die Babenberger und die Landwerdung Österreichs
976 verkleinerte Kaiser Otto II. das bis dahin mächtige Herzogtum Bayern und trennte Kärnten als eigenes Herzogtum ab. Im selben Jahr wird auch der «marchio Luitpoldus» (Leopold I.) erwähnt, der die Dynastie der Babenberger, die bis 1246 in Niederösterreich (später auch in Oberösterreich und Steiermark) regieren sollte, begründete. Über die Herkunft der Familie weiß man nichts Konkretes; trotz der Quellenarmut der Zeit waren aber durch die besitzgeschichtlich-genealogische Methode viele Erkenntnisse über diese Zeit der Babenberger zu erlangen.
Leopold I. beherrschte mit der Mark Österreich zunächst nur einen kleinen Teil des Donautales mit dem Mittelpunkt Melk, das eine zentrale Rolle spielte. Seine Stellung als Markgraf war stark, weil sie militärische und zivile Befugnisse vereinigte. Allerdings gab es auch ausgedehnte Besitzungen anderer Familien – die fast alle Mitte des 11. Jahrhunderts ausstarben – in dem sich rasch vergrößernden Gebiet, und auch die Vogteigewalt über die Klöster lag nicht ausschließlich bei den Babenbergern. Im Laufe der Zeit konnten die Babenberger jedoch immer stärker Fuß fassen und ihre Macht schrittweise ausbauen.
Am 1. November 996 wurde eine Urkunde für das Kloster Freising über die Schenkung des Gutes Neuhofen an der Ybbs ausgestellt, in der zum ersten Mal der Name des Landes vorkam, der bis heute erhalten blieb. Es hieß in dieser Urkunde: Das Gut sei «in regione vulgari vocabulo Ostarrîchi in marcha et comitatu Heinrici comitis filii Luitpaldi marchionis» (in jenem Gebiet, das in der Volkssprache Österreich heißt und in der Mark des Grafen Heinrich, des Sohnes Markgraf Leopolds, liegt). Etwa um die gleiche Zeit taucht in Urkunden auch der Name «Austria» für dieses Land auf. Aus diesen beiden Bezeichnungen leiten sich mit wenigen Ausnahmen die Namen für Österreich in den Sprachen der Welt ab. Der ebenfalls in den Quellen vorkommende Begriff marcha orientalis wurde im 19. und 20. Jahrhundert als «Ostmark» übersetzt und spielte in der Zeit des «Dritten Reiches» als Bezeichnung für dieses Land eine Rolle.
Eine wesentliche Veränderung, die auch ein Ende der Expansion nach Osten für die Mark Österreich bedeutete, war die Christianisierung Ungarns, das mit Stephan dem Heiligen einen christlichen König erhielt. Die Babenberger konzentrierten sich in der Folge stärker auf den inneren Landesausbau. Vor allem ein Siedlungsausbau durch Neurodungen im 11. und 12. Jahrhundert ist an den Ortsnamen (z.B. auf -gschwend, -reith, -brand und -schlag) deutlich ablesbar. Auch viele Klöster, vor allem der Benediktiner, aber auch der Augustiner-Chorherren, Zisterzienser und Prämonstratenser, wurden in dieser Zeit auf dem Gebiet des heutigen Staates gegründet (Ossiach, Lambach, St. Florian, Admont, Göttweig, Melk, St. Paul im Lavanttal, St. Lambrecht, Herzogenburg, Seitenstetten, Rein, Heiligenkreuz, Klosterneuburg, Zwettl, Altenburg, Wilhering, Geras, Vorau, Lilienfeld, Schlägl). Die Grundlage für die Bezeichnung Österreichs als «Klösterreich» wurde zweifellos in dieser Zeit gelegt.
Der bedeutendste Babenberger war sicherlich Leopold III. (1095–1136), der sich im Investiturstreit eindeutig der kaiserlichen Seite zuwandte, nachdem sich sein Vorgänger schwankend verhalten hatte. Er stellte sich im Familienkonflikt zwischen Kaiser Heinrich IV. und dessen Sohn Heinrich V. – im Widerspruch mit seiner Lehenspflicht – auf die Seite des Sohnes und heiratete auch die Schwester des Königs, Agnes, die Witwe Friedrichs von Staufen. So stand er mit einem Schlag mit den wichtigsten Familien des Reiches, den Saliern und den Staufern, in verwandtschaftlicher Beziehung. 1125 nach den Tod Heinrichs V. war er einer der Kandidaten für den Thron des Reiches, lehnte aber ab. Seine Förderung der Kirche brachte ihm später den Beinamen «der Fromme» ein; im 15. Jahrhundert wurde er heiliggesprochen, 1663 machte ihn der habsburgische Kaiser Leopold I. zum Landespatron für ganz Österreich.