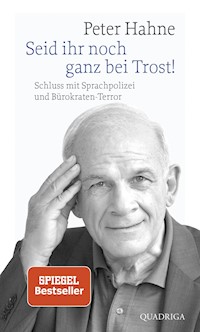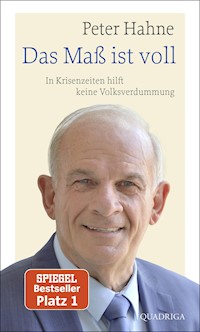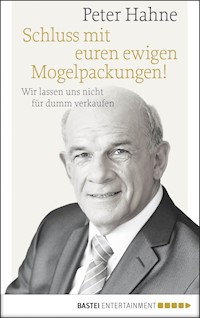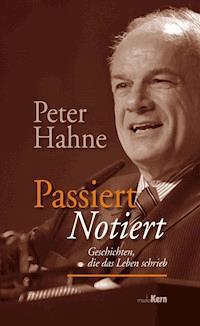
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mediaKern
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ganz Persönliches von TV-Moderator Peter Hahne. Ein spannender Blick hinter die Kulissen. Dreimal an der Todesgrenze. Begegnungen mit Präsidenten, Päpsten, Politikern. Von der "68er"-Zeit geprägt, von schlichtem Kinderglauben getragen. Klare Kante gegen politische und kirchliche Opportunisten und Wendehälse. An Peter Hahne scheiden sich die Geister. "Klartext statt Kuscheljournalismus" (Tagesspiegel Berlin). Wie tickt der Mann, warum denkt, redet und handelt er so und nicht anders? Bewegende Begegnungen mit Kohl, Strauß und den Vogel-Brüdern, mit Horst Lichter, Joachim Fuchsberger, Billy Graham und einem Killer, der Pastor wird. Kleine Wunder auf dem Weg zur Hüft-OP, große Enttäuschung über die Lage der Nation. Kritiker, die sich die Zähne an ihm ausbeißen. Eine Abrechnung ohne Nachtreten. Seite für Seite Erhellendes und Enthüllendes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Hahne
Passiert – notiert
Geschichten, die das Leben schrieb
Weitere Bestseller von Peter Hahne auf www.media-kern.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
eISBN 978-3-8429-1010-2
1. Auflage 2018Bestell-Nr. 5.121.010© 2018 mediaKern GmbH, 46485 WeselUmschlagbild: © Thomas KretschelUmschlaggestaltung, Layout, Satz: Ch. KarádiLektorat: Dr. Ulrich ParlowGesamtherstellung: Drukarnia Dimograf, Bielsko-Biała, PolenPrinted in the EU 2018
www.media-kern.de
Inhalt
Können Sie mir sagen, wo ich hinwill?
Vom Bülowbogen nach Sommerfeld
Fromme Brötchen und ein Hotel der Spitzenklasse
Abzocker-Ärzte und die Lügenpresse
Genscher-Frühstück, Newton-Gesetz und die Engel des Herrn
Strauß, Kohl, Brandt und das aktuelle Mittelmaß
Ein Promi-Wirt und der vergessene Ludwig Erhard
Die Straßen von San Francisco und das Maschinengewehr Gottes
Udo Lindenberg, Joachim Fuchsberger und die Sache mit Jesus
Von schwach möblierten Oberstübchen und der Liebe zum Zuschauer
Der schwarze Hahne und die Goldene Henne
Wie man die Welt madig und Gott mickrig macht
Horst Lichter und ein Killer, der Pastor wird
Zurück zu den Wurzeln
Alles hat seine Zeit
Wenn Kritiker sich die Zähne ausbeißen
Rote Schafe im schwarzen Rock
Wahre Genossen sind nicht rot
Auf Luthers Kanzel und den Spuren von Karl Marx
Arbeit fürs Leben und der Axel Springer des Pietismus
Von offenen Türen und schäbigen Machenschaften
Können Sie mir sagen, wo ich hinwill?
Es war auf einem der letzten Airberlin-Flüge von Nürnberg nach Berlin. Ich saß zusammen mit Frank-Jürgen Weise, damaliger Chef der Bundesagentur für Arbeit, und Dorothee Bär, heutige Staatsministerin für Digitalisierung. Wir sind uns gut bekannt, gerade auch aus der christlichen Szene. Ich erzählte, dass ich gerade von einem Vortrag beim Frühstückstreffen für Frauen kam. Darauf debattierten die beiden, wann und wo sie mich zum ersten Mal gehört hatten. Und vor allem: über was ich da gesprochen hatte.
Nein, an das Thema konnten sich beide nicht mehr erinnern, allerdings wusste Frank Weise noch haargenau, dass ich eine Beispielgeschichte zum Einstieg hatte, die er bis heute nicht vergessen hat: der Absturz eines Fassadenkletterers in Los Angeles. Genauso erging es Dorothee Bär. »Das war die Geschichte von einem Olympia-Langläufer, der bei Ankunft im Stadion die falsche Richtung genommen hatte, worauf hunderttausend Menschen schrien: ›Return, return! Kehr um, kehr um!‹« Für beide waren diese Einstiegsgeschichten und ihre Bedeutung unvergessen.
Beweis, dass der große Goethe recht hat: Die Leute wollen Geschichten hören, Storys. Und sinngemäß fügte er hinzu: Übertreiben macht anschaulich. Ein Erlebnis packend schildern, alle Register ziehen und gar schauspielerisches Talent entfalten, das ist tausendmal eindrücklicher als eine abgelesene akademische Litanei, bei der man das Gefühl haben muss, dass der Redner gleich selber dabei einschläft. Bei manchen kann man beim Reden die Zähne plombieren und beim Gehen die Schuhe besohlen. Ich denke an die Geschichte aus Texas, wo ein Redner sein Publikum derart langweilt, dass einer aufsteht und mit gezogener Pistole langsam Richtung Pult schreitet, so in lässiger Cowboy-Manier. Der Redner gerät erst ins Schwitzen und dann in Panik und geht schließlich in Deckung. Darauf der Mann mit dem Schießeisen: »Keine Angst, von Ihnen will ich nichts. Ich suche nur gerade den, der Sie eingeladen hat.«
Wenige Politiker können mitreißend reden und bei den Pastoren sind es auch nicht gerade viele. Meister dieses Fachs waren Pfarrer wie Klaus Vollmer, Heinrich Kemner oder Wilhelm Busch. Letzterer musste allerdings aufpassen, dass seine Geschichten nicht an jedem Ort anders waren. Darauf angesprochen, meinte sein langjähriger Fahrer – und ich werde das nie vergessen, weil wir so gelacht haben: »Busch hat darunter gelitten, dass sich seine Geschichten unter dem Erzählen verwandelten.« Dieser Erklärung kann man gar nicht böse sein.
Arno Pagel war auch solch ein begnadeter Erzähler oder die Missionare Johnny Thiessen und Fritz Pawelzik, die ich als Jugendlicher mit Begeisterung gehört habe. Da saßen die Leute mit aufgerissenem Mund und waren bereit, dann auch die »Anwendung« der spannenden Erzählungen aufmerksam zu verfolgen. Das ist meine Erfahrung aus vier Jahrzehnten Vortragstätigkeit bei Banken und Wirtschaftsverbänden, bei christlichen Jugendtagen oder missionarischen Abenden: Bester Türöffner ist eine Geschichte, und sei es mein Dauerbrenner Karl Valentin. Der bekannte Komiker ging einst durch die Münchner Innenstadt und fragte die Passanten: »Können Sie mir sagen, wo ich hinwill?« Und schon bin ich beim Thema: Ohne Ziel finde ich keinen Weg. Das Geheimnis des Erfolges ist ein zielorientiertes Leben …
»Alles wirkliche Leben ist Begegnung«, so der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber. »Alles ist letztlich Biografie«, das der Standpunkt meines alten Lehrers, des Neutestamentlers Otto Michel in Tübingen. Theorie langweilt und ist noch nicht einmal etwas fürs Katheder, aber erst recht nichts für die Kanzel. Das Überzeugendste ist immer das praktische Leben. Insofern ist die uralte Bibel kommunikationstechnisch topaktuell: Unser Leben ist wie ein aufgeschlagenes Buch.
Ohne Chronologie habe ich auf den folgenden Seiten Episoden meines Lebens zusammengestellt. Das, was mir gerade einfiel, worauf andere mich ansprachen oder was Menschen in Vorträgen schon geholfen hat. Jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, damit mal anzufangen. Sandra Maischbergers letzte Frage in ihrer letzten Sendung des Jahres 2017 lautete: »Dass ich mit dem 65. Geburtstag aufhöre …« Und ich antwortete: »… ist die weiseste Entscheidung, die ich treffen konnte. Jetzt bleibt endlich Zeit, die Lebenserfahrungen ohne Termindruck weiterzugeben, die anderen vielleicht helfen können.«
Hier ein erster Band mit Geschichten, die das Leben schrieb. Alles aus der Erinnerung, Tagebuch führe ich nicht. Aber so langsam ist man in dem Alter, dass Jüngere fragen: »Erzähl doch mal …« Das Vortragsthema »Passiert – notiert« hatte ich das erste Mal auf der Osterkonferenz 2018 in Gunzenhausen gewählt, insgesamt waren rund 4000 meist junge Leute auf die Hensoltshöhe gekommen. Das Interesse und das Echo waren riesengroß, ich war selber ganz verwundert. Das praktische Leben ist eben interessanter als die Konstruktion eines Hollywoodkrimis. »Tatort Leben« – das ist auch das Geheimnis der Bibel, in der das Alte Testament mit seinen Geschichten spannender ist als der neueste Harry Potter!
Von Persönlichkeiten und Begegnungen, die einen selbst geprägt haben, können vielleicht auch andere profitieren. Jede Erzählung eigener Erlebnisse ist ein Stück Selbstdarstellung. Aber es gibt bekanntlich Schlimmeres. Wer nichts erlebt, hat auch nichts zu sagen.
Vom Bülowbogen nach Sommerfeld
Auf dem Weg vom Hauptstadtstudio nach Hause fuhren wir gerade am U-Bahnhof Gleisdreieck vorbei, als der Taxifahrer meinte: »Na, Sie haben’s aber an der Hüfte …« Da brauchte er nicht viel Fantasie, so hatte ich mich in seinen Wagen gequält. Seit Monaten kämpfte ich gegen heftigen Schmerz besonders auf der linken Seite. Beim Aussteigen zu Hause half er mir und riet: »Lassen Sie’s operieren, ich habe es gerade auf beiden Seiten hinter mir und bin jetzt ohne Beschwerden.« Dann gab er mir den entscheidenden Tipp: die Sommerfeld-Klinik in Brandenburg. »Das brauche ich mir noch nicht mal aufzuschreiben«, entgegnete ich. Wir waren ja gerade dort vorbeigekommen: am Drehort der legendären Arztserie »Praxis Bülowbogen«, in der der große Schauspieler Klaus Schwarzkopf den Penner »Gleisdreieck« spielte, benannt nach dem U-Bahnhof.
Eine klassische Berliner Arztpraxis der 1970er-Jahre in einer normalen Altbauwohnung mit quietschendem Parkett und Stuck an der Decke und einem Wartezimmer voller skurriler Berliner Originale. Das war noch Fernsehen! Anita Kupsch spielte die immerwährende Sprechstundenhilfe, wie man sich das beim »Landarzt« so vorstellt. Auch sie machte übrigens wie ich Urlaub auf der Bettmeralp im Wallis. Günter Pfitzmann spielte den Arzt Dr. Peter Brockmann, der dann von Rainer Hunold alias Dr. Peter Sommerfeld abgelöst wurde. Der dritte Peter konnte sich das also über diese Eselsbrücke leicht merken: »Ich schaue gleich mal im Internet nach.«
Sommerfeld – nur 30 Minuten von Wilmersdorf entfernt an der Autobahn nach Hamburg, von der Abfahrt tief in den Wald hinein: die ehemalige Berliner Lungenheilstätte. Das ganze Ensemble, original Kaiser Wilhelm, denkmalgeschützt und tipptopp modernisiert. Ich googelte die Bewertungen: alles bestens. Na gut, ich frage mal meine Professoren-Freunde von der Charité um Rat, es eilt ja nicht … Nächster Montag: Der »Focus« listete die 100 besten Ärzte und Kliniken für Hüft- und Kniegelenke auf, Sommerfeld unter den Top Ten. Zufall?
Ich sollte mit meiner Hüft-Geschichte noch öfter erleben, dass Zufall wirklich nichts anderes ist als ein Pseudonym Gottes. Ich machte Nägel mit Köpfen und schrieb den Klinikchef Professor Andreas Halder an. Prompte Antwort am Telefon in militärischer Kürze und mit Berliner Schnauze: »Na, dann kommse mal.«
Als Erstes war Röntgen dran, ich hatte mich ja noch nie untersuchen lassen. Die freundliche Schwester sagte nach dem »Fotografieren«: »Ach, ich bewundere Sie so, Herr Hahne.« Ich strahlte sie an und dachte, sie meinte das Fernsehen. Doch sie stellte nur lapidar fest: »Sie müssen die letzten fünf Jahre doch unheimliche Schmerzen gehabt haben.« Stimmt!
Dann der Professor – eingerahmt von zwei Assistenten, die mich schon ganz mitleidig anschauten, als bangten sie um mein Leben, die bedauernswerten Bilder vor sich auf ihren Laptops. Ohne irgendwelchen Small Talk schaute er mich an, dann wieder die Bilder und stellte folgende eindrucksvolle Diagnose: »Alles Schrott! Alles im Eimer! Da müssen wir ran!« Dabei hatte ich noch seine Worte im Ohr: »Eine Operation ist immer das Allerletzte, was infrage kommt«, obwohl er damit ja sein Geld verdient. Dieses Allerletzte war nun eingetreten und wir vereinbarten den ersten OP-Termin für den historischen 17. Juni, unvergessen. Dann hatte ich meine Pensionierung hinter mir und Zeit genug. Nur der Südtirol-Urlaub, ohnehin für den Wanderer eine Qual, musste weichen.
Wie ein Lauffeuer verbreitete es sich unter Kollegen, in den Gemeinden und bei Vorträgen: »Hahne kriegt neue Hüftgelenke.« Es war ja auch kaum zu übersehen, wie nötig das war – obwohl ja bekanntlich nichts alternativlos ist. Das sehen nur Illusionspolitiker in ihrer abgesicherten Parallelgesellschaft anders. Merkels Satz »Wir schaffen das« kommentierte ich am selben Abend: »Das habe ich das letzte Mal von Kaiser Wilhelm gehört.« Wir, das ist das dumme Volk, das das zu schaffen hat, basta!
Ich muss es schließlich wissen, ich bin in Minden-Ravensberg aufgewachsen, sozusagen unter dem monumentalen Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica, wo mit dem Weserdurchbruch die Norddeutsche Tiefebene beginnt. »Wo die Weser einen großen Bogen macht, wo der Kaiser Wilhelm hält die treue Wacht … Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus.« In meiner Heimatstadt Minden ist zudem Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der Große Kurfürst und preußische Herzog, mit einem Denkmal verewigt und der meinte: »Die Mindener sind meine treuesten Untertanen!« Von Alternativlosigkeit hätte der nie gesprochen, weil es ein Zeichen von Schwäche, kombiniert mit Selbstherrlichkeit, ist.
Und weil im Leben normal denkender Leute nichts alternativlos ist, hatten dann auch viele OP-Kritiker ihre »Alternative für Hahne« bereit, die Briefe und Mails könnten dieses Buch mühelos füllen. Den originellsten Gegenvorschlag hatte Professor Johannes Zeichen, Chef der Unfallchirurgie des zweitgrößten Universitätskrankenhauses von NRW, des Klinikums Minden.
Ich hatte dort den Jubiläums-Festvortrag zugesagt und er versprach mir schriftlich: »Nach Ihrem Vortrag rollen wir Sie sofort aus dem Audimax des Campus-Gebäudes in den Operationssaal und unser Team zeigt, was es kann.« Bei dem Gedanken, dass im Merkblatt der Sommerfeld-Klinik sinngemäß stand, man solle seine Patientenverfügung und den Organspendeausweis mitbringen und am besten auch noch sein Testament machen, eine echte Alternative …
Aber Spaß beiseite: Wie beim Thema Impfen gibt es regelrechte Glaubenskriege pro und kontra Operation. Auch ernst zu nehmende Fachleute unter den Christen rieten mir ab, schlugen therapeutische Übungen und homöopathische Mittel vor. Anders gestrickte Zuschauer zum Beispiel vom geschätzten MDR-Talk »Riverboat« waren da schon bei esoterischen Spökenkiekereien und dem Kaffeesatzlesen des Klabautermanns: Wenn schon eine Operation, dann aber in einer bestimmten Mondphase und keinesfalls in einem OP-Saal, der auf einer Wasserader liegt. Und es sei auch überlebenswichtig, ob das Team nun in Blau oder in Grün gewandet sei …
Als ich in den OP geschoben wurde, war mir vor der »Einschläferung« nur eines wichtig: dem Team zu sagen, »dass jetzt Hunderte in Deutschland für uns beten, damit Sie Ihre Begabung richtig zur Entfaltung bringen können«. Gott hat den Ärzten Gaben gegeben genauso wie Handwerkern, Hausfrauen, Lehrerinnen oder Moderatoren. Die gilt es abzurufen im Sinne Martin Luthers: »Heute habe ich viel zu tun, ich muss also viel beten.«
Im Internetauftritt der Sommerfeld-Klinik war mir schon das Seelsorge-Angebot aufgefallen. Bei der Aufnahme wurde ich extra noch mal darauf hingewiesen. Und an den Schwarzen Brettern steht in jeder Station: »Wir laden ein zu christlichen (!) Andachten und Gottesdiensten. Sie werden gerne dorthin gefahren.«
Und so klein ist die Welt: Der neue Leiter der christlich geführten Altmühlseeklinik Hensoltshöhe und Nachfolger meines Freundes Dr. Hans-Ulrich Linke, der Orthopäde Dr. Friedbert Herm, hat vorher in großem Segen und allgemeiner Anerkennung als Chef der Sommerfelder Reha-Klinik gewirkt. Auf allen Zimmern Bibeln!
Und das i-Tüpfelchen: Als ich mit dessen Nachfolger Dr. Volker Liefring nach der zweiten OP das Aufnahmegespräch hatte, endete das überraschend in einer Gebetsgemeinschaft. Auch er ein überzeugter Christ, bewährt und bewahrt schon in DDR-Zeiten. Für ihn war ich Patient und Bruder. Gott hat seine Leute überall.
Professor Thomas Dörner von der Charité, Blutgerinnungsexperte, freute sich an meiner Euphorie nach der ersten OP, riet mir dann aber vor der zweiten, was ich von einem relativ jungen Mediziner nie erwartet hätte: »Gehen Sie demütig in die nächste Runde.« Also nicht das hochmütige »Wir schaffen das, es hat doch bestens geklappt«, sondern ganz neu abhängig zu sein von der Qualifikation der Ärzte und der Güte Gottes. Demut! So auch mein Freund, Professor Wolfram Wermke, der wiederum Sommerfelder Ärzte ausgebildet hat. Die Welt ist klein!
Ja, übermütig sollte man nicht werden, auch wenn beide Operationen ohne Komplikationen verlaufen sind. Katrin Falkowski, zuständig für die OP-Pläne im Patientenmanagement, hat sich rührend um mich gekümmert. Zwei Sätze hat sie mir mitgegeben: »Seien Sie zunächst vorsichtig. Eine falsche Bewegung, und alles war umsonst.« Und dann, worüber ich auf den ersten Blick geschmunzelt habe: »Sie müssen erst mal eins werden mit Ihren neuen Hüftgelenken.« Aber mit dem zweiten sieht man ja bekanntlich besser! Es stimmt: Nach drei, vier Wochen habe ich überhaupt nicht mehr an die Riesenapparate gedacht, die mir da eingebaut wurden. Sie gehören jetzt dazu. Nur in der Sicherheitskontrolle des Flughafens werde ich daran erinnert. Ein Piepton als Signal, das Danken nicht zu vergessen. Vor allem auch für eine Reha der Extraklasse mit einem hoch motivierten, meist einheimischen Team vom Kantinenpersonal bis zur Therapieleiterin, übrigens auch einer »Schwester im Herrn«. Zufall?
Fromme Brötchen und ein Hotel der Spitzenklasse
Vor Sommerfeld stand erst noch Amrum auf dem Terminplan. Medizinisch wertvoll, so mein Professor! Exakte Maßarbeit Gottes, schon vor zwölf Monaten gebucht: Nach der abendlichen Landung von Sylt in Berlin konnte ich mich gleich am nächsten Morgen ins Auto Richtung Brandenburg setzen. Zunächst also zwei Wochen Auftanken, Durchpusten, Muskeln beim Radfahren gegen den Wind aufbauen. In dem Hotel mit dem legendärsten Namen auf der Insel genieße ich seit Jahren das, was ich scherzhaft »betreutes Wohnen« nenne. Klein und fein, ruhig und doch im Zentrum, familiär und doch auf Distanz. Wenn ich seit 15 Jahren jeden November für einen Monat in die USA fliege, habe ich oft das gleiche Team an Bord. Die lachen schon immer, weil ich das Wort »betreutes Fliegen« erfunden habe, wenn einem dort über den Wolken das Bettchen gemacht und jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird.
Oft werde ich auf dem Flug nach Sylt gefragt, was denn dort mein schönstes Ziel sei. »Bloß schnell weg«, ist meine stete Antwort. Per Taxi nach Hörnum und rauf auf den Adler-Express, der mich in ein Idyll bringt, das es so nur noch mal in den Bergen gibt: auf meiner geliebten Bettmeralp. Natur pur mit einem Publikum, das von Schickimicki so weit entfernt ist wie der Mond von der Erde. Klar, manche Einheimischen sind gewöhnungsbedürftig und man muss mit ihnen erst warm werden, den sprichwörtlichen Sack Salz gemeinsam gegessen haben. So herrschte mich die Zeitungsfrau an, sie sei doch keine Altpapier-Sammelstelle, als ich – immerhin Stammkunde von sechs Zeitungen täglich! – höflich fragte, ob ich die gelesene Zeitung, die ich unter dem Arm hatte, mangels Papierkorb auf den Stapel ihrer alten legen könnte. Im Übrigen hätten wir ja freie Marktwirtschaft, doppelte sie nach … Friesisch herb wie das legendäre Bier.
Bestens erholt und frohen Mutes schloss ich meine Wohnung ab, die Zeitungen für die nächsten sechs Wochen abbestellt. Ich wollte gleich in Sommerfeld zur Reha bleiben. Erst mal hatte ich Hunger, der Kühlschrank war ja »dank« Amrum leer. An der Abfahrt ein Autohof mit Burger, das musste nicht sein. Als Nächstes in Kremmen Döner und Kebab, auch nicht mein Ding. Doch kurz vor der Klinik in Schwante entdeckte ich ein gepflegtes rotes Backstein-Ensemble und stutzte bei dem Namen: »Bäckerei Plentz«.
Plentz? War das nicht jener Meisterbetrieb, der auf dem Kongress Christlicher Führungskräfte von über 4000 Teilnehmern ausgezeichnet worden war und den Bundespräsident Steinmeier erst unlängst besucht hatte, weil kaum ein Bäcker in Deutschland prozentual so viele Lehrlinge ausbildet? Fromme Leute, die auch beim Wettbewerb »Deutschlands bester Bäcker« im ZDF dabei waren. Und die es dort ganz nach oben brachten und fröhlich vor laufenden Kameras bei bester Einschaltquote bekannten: »Wir können unser Handwerk, aber wir beten auch, dass Jesus Christus seinen Segen dazugibt!« Ihr Motto: Backen und Beten.
Sollte das also jener Plentz sein, ich fasse es nicht. Anhalten, aussteigen – besser: rausquälen – und rein ins Café. Und dann stand er strahlend vor mir: Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz. Spätes Frühstück in seinem Kaffeegarten, Austausch über Gott und die Welt, als würden wir uns schon ewig kennen. »Aber Sie sind unserem gemeinsamen Freund Helmut Matthies von IDEA so ähnlich« – womit er nicht unrecht hat bei dem, was wir schon alles miteinander erlebt haben.