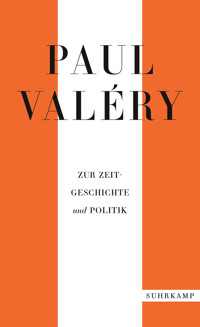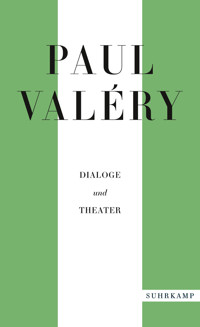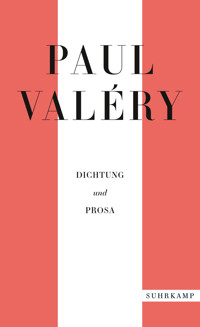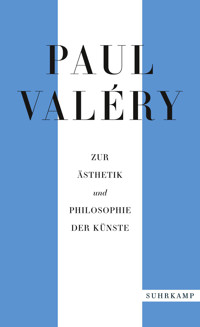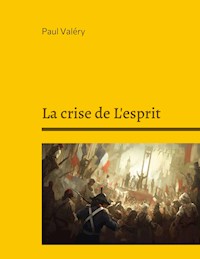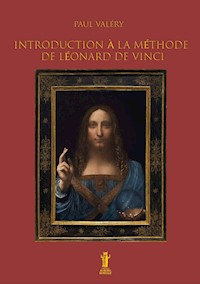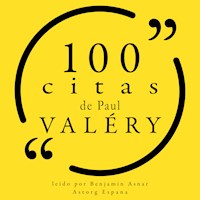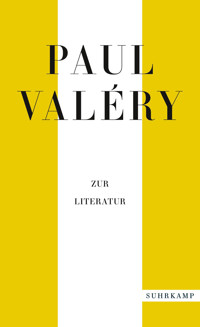
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Band 3 der Gesamtausgabe versammelt Valérys Schriften zur Literatur, entstanden zwischen 1920 und 1945. Seine Überlegungen reichen von den Balladen François Villons aus dem 15. Jahrhundert, über die Lyrik von Stéphane Mallarmé, bis hin zu Marcel Prousts im 20. Jahrhundert veröffentlichten Romanzyklus Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Die chronologisch angeordneten Schriften, Reden und Vorworte bilden ein ausgewähltes Panorama französischer Geistesgeschichte – das ergänzt wird durch Bemerkungen zu Johann Wolfgang von Goethe sowie Auszüge aus einem Briefwechsel mit Rainer Maria Rilke.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 787
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
PAUL VALÉRY WERKE
Frankfurter Ausgabe in 7 Bänden
Herausgegeben von Jürgen Schmidt-Radefeldt
Suhrkamp
Band 3 Zur Literatur
Herausgegeben von Jürgen Schmidt-Radefeldt
Die Originalausgabe erschien 1957 unter dem Titel Œuvres I sowie 1960 unter dem Titel Œuvres II bei Éditions Gallimard, Paris.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5216.
© 1989, Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin
© Éditions Gallimard, 1957
© J. B. Janin, Editeur et Les Editions de la Table Ronde 1948
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Brian Barth
eISBN 978-3-518-77145-7
www.suhrkamp.de
INHALT
Villon und Verlaine
Pontus de Tyard
›Geistliche Gesänge‹
Zu ›Adonis‹ von La Fontaine
Grabrede auf eine Fabel
Über Bossuet
Phädra als Frau
Vorwort zu Montesquieus ›Perserbriefen‹
Voltaire
Rede zu Ehren Goethes
Wie ich Goethe sehe
Man sagt Goethe, so wie man Orpheus sagt
Stendhal
Victor Hugo, ein Dichter der Form
Andenken an Nerval
Die Situation Baudelaires
Die Versuchung des (heiligen) Flaubert
Erinnerung an Mallarmé
Über den ›Würfelwurf‹ von Mallarmé
Letzter Besuch bei Mallarmé
Brief über Mallarmé
Ich sagte manchmal zu Stéphane Mallarmé
Stéphane Mallarmé
Eine Art Vorwort
Existenz des Symbolismus
Mallarmé
Verlaine im Vorübergehen
Rede zum Dank an die Académie française
Erinnerung an J.-K. Huysmans
Durtal
Rede auf Émile Verhaeren
Rede auf Henri Bremond
Marcel Proust zu Ehren
Literarische Erinnerungen
Erinnerung an Rilke
An Rainer Maria Rilke
Orient und Okzident
Vorwort zu den ›Legenden aus Guatemala‹ von Asturias
Vorwort zu Gedichten von Gabriela Mistral
Der Liebhaber Zürichs
ANHANG
Editorische Nachbemerkung
Verzeichnis der Abkürzungen
Anmerkungen
Nachweise zu den einzelnen Texten
Namen- und Werkregister
ZUR LITERATUR
VILLON UND VERLAINE
Nichts ist leichter, und nichts schien unlängst selbstverständlicher, als François Villon mit Paul Verlaine in einem Atemzug zu nennen. Der Nachweis, daß diese beiden literarischen Gestalten sich ähnlich sind, ist für den Liebhaber historischer – will sagen: eingebildeter – Symmetrien nur ein Kinderspiel. Beide sind wunderbare Poeten, beide waren Bösewichte, in ihrer beider Werk paart sich der Ausdruck tiefster Frömmigkeit mit Worten und Bildern größter Zügellosigkeit, und beide wechseln die Tonart außerordentlich leicht; beide beherrschen mit wahrer Meisterschaft ihre Kunst und ebenso die Sprache ihrer Zeit, wobei sich zeigt, daß sie außer ihrer Bildung einen unmittelbaren Sinn für den Umgangston besitzen, ja für die Stimme des Volkes, das sie umgibt und das nach seinem Geschmack Worte und Formen umbildet, kombiniert und prägt. Latein beherrschen beide nicht schlecht, den Argot vorzüglich, sie besuchen je nach Stimmung Kirchen oder Kneipen, und beide sehen sich, aus keineswegs denselben Gründen, gezwungen, bittere Tage in strenger Klausur zu fristen, wo sie weniger als Sünder denn als Dichter in sich gehen und der Läuterungsprozeß die poetische Essenz von Reue, Ängsten und Gewissensqual ergibt. Beide fallen, bereuen, fallen erneut und sind, wenn sie sich wieder erhoben haben, große Dichter. Der Vergleich drängt sich auf und läßt sich gut an.1
Doch was sich so bequem und scheinbar so glatt vergleichen und zur Deckung bringen läßt, ließe sich mit ebenso geringer Mühe wieder trennen und voneinander unterscheiden. Man darf das nicht so ernst nehmen. Villon und Verlaine entsprechen einander zweifellos aufs gefälligste in einem Phantasiegebäude der französischen Literatur, in dem man unsere großen Männer, sorgfältig ausgewählt und paarweise gruppiert, zur Abwechslung symmetrisch anordnen würde, mal aus Gründen des angeblichen Kontrastes: Corneille und Racine, Bossuet und Fénelon, Hugo und Lamartine; mal aus Gründen der Ähnlichkeit, wie zum Beispiel die Genannten. Das gefällt dem Auge, bis die Überlegung einsetzt und uns zeigt, wie wenig Konsistenz und Konsequenz eine derart schöne Ordnung hat. Ich mache diese Bemerkung übrigens nur, um Sie vor der Versuchung und Gefahr zu warnen, ein Verfahren der – sagen wir: dekorativen – Rhetorik mit einer wirklich kritischen Methode zu verwechseln, die zu positiven Resultaten führen kann.
Ich füge hinzu, daß das System Villon–Verlaine, diese offenkundige und verführerische Entsprechung zweier Ausnahmeexistenzen, über die ich zu Ihnen sprechen soll, zwar vertretbar ist und an einigen biographischen Details Halt und Stütze findet, jedoch ins Wanken gerät und auseinanderfällt, wenn man die Werke vergleichen will, wie man die Schöpfer verglichen hat. Ich werde Ihnen das sogleich zeigen.
Kurz, der Gedanke, sie miteinander zu verbinden, hat sich an den partiellen Ähnlichkeiten ihrer Lebensläufe entzündet und bestimmt mich, hier zu tun, was ich im allgemeinen kritisiere. Ich bin der Meinung – es ist dies eines meiner Paradoxe–, daß die Kenntnis von Autoren-Biographien unnütz, wenn nicht sogar verderblich ist für den richtigen Umgang mit den Werken, der sei’s in dem Genuß besteht, den sie uns verschaffen, sei’s in den künstlerischen Lehren, die sie uns erteilen. Was scheren mich die Frauen um Racine? Mir ist nur Phädra wichtig. Was kümmert mich der Rohstoff, der sich so gut wie überall findet? Die Begabung ist es, die Kraft der Verwandlung, die mich berührt und um die ich ihn beneide. Alle Leidenschaft der Welt und alle noch so rührenden Begebenheiten eines Menschenlebens bleiben außerstande, auch nur einen schönen Vers hervorzubringen. Was einem Autor Wert und Dauer gibt, ist auch im günstigsten Fall nicht das, worin er Mensch ist, sondern das, worin er etwas mehr als Mensch ist. Und wenn ich sage, daß biographische Neugier schädlich sein kann, so darum, weil sie nur zu oft als Anlaß, Mittel, Vorwand dient, dem genauen sachgerechten Studium einer Dichtung auszuweichen. Man glaubt, seine Schuldigkeit getan zu haben, und hat sich in Wahrheit von der Dichtung nur entfernt, die Berührung mit ihr vermieden, mit Forschungen über Ahnen, Freunde, Lebensnöte und berufliche Tätigkeiten des Autors sich und den anderen nur etwas vorgemacht, die Hauptsache verfehlt und sich an Nebensächlichkeiten festgebissen. Wir wissen nichts über Homer. Der ozeanischen Schönheit der Odyssee fehlt darum nichts ... Was wissen wir von den Dichtern der Bibel, was vom Autor des Ekklesiastikus, dem des Hohelieds? Der Schönheit dieser ehrwürdigen Texte geht darum nichts ab. Und was wissen wir von Shakespeare? Nicht einmal, ob er den Hamlet geschrieben hat.
Doch in unserem Fall ist das biographische Problem nicht zu umgehen. Es drängt sich auf, und ich muß hier tun, was ich soeben verurteilt habe.
Der Fall Verlaine-Villon ist von besonderer Art. Er ist ungewöhnlich und der Beachtung wert. Ihrer beider Werk bezieht sich zu einem nicht geringen Teil auf ihren Lebenslauf und ist zweifellos in mehr als einer Hinsicht autobiographisch. Beide machen uns Geständnisse mit genauen Einzelheiten. Doch wir sind ungewiß, ob sie uns stets die Wahrheit sagen. Und selbst wenn sie die Wahrheit sagen, sagen sie doch nicht die ganze Wahrheit, und keinesfalls nichts als die Wahrheit. Ein Künstler wählt, selbst wenn er bekennt, und vielleicht vornehmlich dann, wenn er bekennt. Er bauscht auf, er verharmlost hier und da ...
Ich sagte, dieser Fall sei ungewöhnlich. Natürlich sprechen die meisten Dichter ausgiebig über sich. Ja, die Lyriker unter ihnen sprechen von nichts anderem. Denn über wen und wovon sollten sie auch sprechen? Lyrik ist die Stimme eines Ichs, auf den reinsten, wenn nicht höchsten Ton gestimmt. Doch diese Dichter sprechen über sich, wie es Komponisten tun, das heißt, sie schmelzen die Empfindungen aller wirklichen Begebenheiten ihres Lebens zu einer innerlichen Substanz universaler Erfahrungen um. Wer sie verstehen will, braucht nichts, als am Licht des Tages sich gefreut zu haben, glücklich, und vor allem unglücklich gewesen zu sein, etwas ersehnt, etwas besessen, verloren und beklagt zu haben – es genügen diese wenigen, sehr einfachen Empfindungen des Menschenlebens, die allen gemeinsam sind und deren jeder eine Saite auf dem Instrument Apolls entspricht ...
Das genügt zumeist, für Villon genügt es nicht. Man weiß das seit geraumer Zeit, schon seit mehr als vier Jahrhunderten, denn bereits Clément Marot sprach aus, daß wir, um einen nicht unbedeutenden Teil dieses Werkes zu verstehen, »hätten müssen zu Lebzeiten Villons in Paris gewesen sein und die Plätze, Dinge, Menschen kennenlernen, von denen er uns sagt: je mehr die Erinnerung an sie dahingeht, desto weniger wird man den Kunstfleiß des genannten Dichtwerks gewahren. Weshalb der, welcher ein Werk von langer Dauer schaffen will, sein Sujet nicht aus solcher niedrigen und besonderen Materie nehmen soll.«2
Es ist also unerläßlich, nach dem Leben und den Abenteuern François Villons zu forschen, sie nach seinen Angaben zu rekonstruieren, oder die Anspielungen zu entschlüsseln, die uns in seinem Werk auf Schritt und Tritt begegnen. Er nennt uns die Namen der Menschen, die seine holprige Lebensbahn im Guten oder Bösen kreuzten, dankt den einen, spottet oder flucht den andern; er nennt die Schenken, in denen er verkehrte, und malt mit knappen, immer wunderbar treffenden Worten die Örtlichkeiten und Besonderheiten von Paris. All das ist in seine Dichtung hineinverwoben, von ihr untrennbar, und macht sie oft fast unverständlich für den, der sich nicht in das Paris der Zeit versetzt, in seine malerischen und finsteren Winkel. Mir scheint, einige Kapitel aus Notre-Dame de Paris wären keine schlechte Einführung in die Lektüre Villons. Hugo hat, glaube ich, auf seine kraftvolle und im Phantastischen präzise Art das Paris des ausgehenden 15. Jahrhunderts gut gesehen – oder gut erfunden. Doch verweise ich Sie vor allem auf das bewundernswerte Buch von Pierre Champion, in dem Sie alles, was man über Villon und das Paris von damals weiß, finden werden.3
Was die Lektüre Villons schwierig macht, ist nicht nur die zeitliche Distanz und das Verschwinden mancher Dinge, sondern auch die besondere Eigenart des Autors. Dieser geistvolle Pariser Literat ist ein gefährliches Subjekt; mitnichten ein Scholar oder ein Bürger, der Verse und ein paar Bübereien ausheckt, der darauf seine Risiken begrenzt und sich mit den begrenzten Erfahrungen bescheidet, über die ein Mensch seiner Zeit und seines Standes verfügt. Dieser Magister Villon ist ein Sonderfall – denn es ist die Ausnahme, daß in unserer Zunft (mag ihr Denken noch so abenteuerlich sein) ein Dichter sich als eine Art Bandit betätigt, als ausgepichter Übeltäter, der Herumtreiberei anrüchigster Art stark verdächtig, als Mitglied wilder Bruderschaften, von geraubter Beute lebend, stets auf der Hut und auf der Lauer, ein Geldschrankknacker, der gelegentlich einen Menschen umbringt, den der Strick am Halse juckt – und der dabei großartige Verse schreibt. Die Folge ist, daß dieser steckbrieflich gesuchte Dichter, dieser Galgenvogel (dessen Ende wir noch immer nicht kennen und besser vielleicht nie kennenlernen sollten) in seine Verse manche Redensart und eine Fülle von Vokabeln aufnimmt, die der kurzlebigen, geheimen Gaunersprache angehören. Bisweilen schreibt er in ihr ganze Gedichte, die uns nahezu verschlossen sind. Das Volk, das diese Sprache spricht, zieht die Nacht dem Tage vor, auch in seiner Sprache, die es nach seiner Façon zwielichtig4 bildet, aus der gewöhnlichen Sprache nämlich, deren Syntax es bewahrt, und einem mysteriösen Vokabular, das man nur an Eingeweihte weiterreicht und das sich rasch erneuert. Dies häßlich klingende, oft abstoßende Idiom ist oft schrecklich ausdrucksvoll. Selbst wenn uns sein Sinn verborgen bleibt, erraten wir unter der brutalen oder karikierenden Wortfratze manch bewundernswerten Fund, manches nur durch die Wortgestalt nachdrücklich suggerierte Bild.
Wir haben hier einen Urtyp dichterischer Schöpfung vor uns, denn die erste und erstaunlichste der dichterischen Schöpfungen ist die Sprache selbst. Obgleich nur aufgepfropft auf die Sprache der besseren Stände, ist der Argot, Jargon oder Jobelin doch ein Gebilde eigener Art, in den Spelunken, Zuchthäusern und dunkelsten Winkeln von Paris unablässig komplettiert und umgeformt von einer Welt, die mit der Welt in Feindschaft lebt, einer furchtbaren und furchtsamen, gewalttätigen und erbärmlichen Welt, unentwegt befaßt mit dem Aushecken von Schandtaten, Orgien und Racheplänen, zugleich unablässig heimgesucht von den oft greifbar nahen Schreckensbildern der unvermeidbaren (damals oft entsetzlich grausamen) Folterungen und Leibesstrafen, und so von Schuld und Sühne ruhelos umhergetrieben wie ein wildes Tier im Käfig.
Dem Lebensweg François Villons, wie dem Werk, fehlt es nicht an Dunkelheit in des Wortes mehrfacher Bedeutung. Undurchsichtig ist das eine und das andere, und sogar er selbst.
Was wir von ihm wissen, klärt uns über sein wahres Wesen nur sehr unvollkommen auf, denn wir entnehmen alles, oder fast alles, seinen Versen und einigen Gerichtsurkunden – zwei Quellen, die in den Fakten weitgehend übereinstimmen und die miteinander kombiniert uns das Bild eines rachsüchtigen, zu allem fähigen Menschen übelster Sorte vermitteln, der dann uns plötzlich überrascht durch einen frommen oder zarten Ton, wie in dem berühmten, bewundernswerten Gebet, das er seine Mutter sprechen läßt, diese arme Frau, die um das Jahr 1435 eines Tages dies dem Bösen, dem Ruhm, den Ketten und der Dichtung bestimmte Kind, den François de Montcorbier, in die Hände des Guillaume Villon legte, des Kaplans der Kapelle Saint Jean in der Kirche Saint-Benoît-le-Bétourné.
Sie erinnern sich an die Ballade, eine der Kostbarkeiten französischer Dichtung:
Femme je suis povrette et ancïenne,
Qui riens ne sçay; oneques lettre ne lus.
Au moustier voy dont suis paroissienne
Paradis paint, ou sont harpes et lus,
(Ich bin nur eine arme alte Frau,
Die gar nichts weiß, kein Buch in Händen hielt
Und las. In meines Sprengels Münster schau
Voll Harfen, Lauten, ich des Himmels Bild ...)5
Obgleich einzelne Worte ihre Gestalt ein wenig verändert haben, ist diese Sprache noch die unsere; und dabei wurden diese Verse vor fast fünfhundert Jahren geschrieben; noch heute sind sie imstande, uns zu entzücken und zu ergreifen. Zu Bewunderung nötigt uns auch die Kunst, die dieses Meisterwerk vollendeter Form hervorgebracht hat, diesen zugleich klaren und musikalisch vollkommenen Strophenbau, in dem eine ungemein abwechslungsreiche Syntax und eine lebendige Fülle aufeinanderfolgender Figuren sich völlig ungezwungen ihrem Gehäuse aus 10 Versen zu 10 Silben mit vier Reimen einpaßt. Ich bewundere die Dauerhaftigkeit dieser unter Ludwig XL. geschaffenen Form. Ich sehe in ihr ein lebendiges Zeugnis der über Jahrhunderte reichenden Kontinuität unserer Literatur und unseres wesentlichen Sprachbestandes. In Europa können wohl nur Frankreich und England sich einer derartigen Kontinuität rühmen. Vom 15. Jahrhundert an haben diese beiden Nationen ununterbrochen Werke und Schriftsteller ersten Ranges in jeder Generation hervorgebracht.
Kurz, aufgeknüpft oder nicht, Villon lebt: er ist ebenso lebendig wie die Autoren, die für uns sichtbar sind; er lebt, weil seine Dichtung zu uns spricht, weil sie auf uns wirkt – und überdies jeden Vergleich aushält mit dem, was vier Jahrhunderte großer Dichter, die nach ihm kamen, an Machtvollem und Vollkommenem hervorgebracht haben. Was den unschätzbaren Wert der Form beweist.
Doch genug vom Nachruhm des Werks und zurück zum Lebensweg des Menschen. Ich sagte, daß unser Wissen über ihn nur fragmentarisch ist. Große Partien liegen, wie bei einem Rembrandt, in tiefem Schatten, aus dem das eine oder andere in ungewöhnliche Helligkeit emportaucht und einige Details mit erschreckender Schärfe sichtbar werden. Diese Details entnehmen wir, wie Sie sehen werden, den Akten einiger Strafverfahren, und die Kenntnis dieser Akten, die alles enthalten, was wir an sicheren Informationen über Villon besitzen, verdanken wir der großartigen Arbeit von drei oder vier Männern, Gelehrten ersten Ranges. Es ist hier der Augenblick, eines Longnon, Marcel Schwob und Pierre Champion ehrend zu gedenken. Bevor ihre Arbeiten erschienen waren, hatten wir von Villon nur ein äußerst vages Wissen. Sie haben nacheinander die großen Archive durchforscht und in den Aktenbündeln und Papieren der Pariser Justizbehörden die entscheidenden Dokumente gefunden.6
Auguste Longnon habe ich nicht gekannt, Marcel Schwob jedoch sehr gut, und ich erinnere mich nicht ohne innere Bewegung an unsere langen Gespräche in der Dämmerung, in denen dieser eigentümlich scharfsinnige und leidenschaftlich bohrende Geist mich in seine Forschungen und Vermutungen einweihte und von seinen Funden sprach, die ihm gelungen waren auf der Spur der Wahrheit, die er suchte: der Wahrheit über den Fall Villon. Ausgerüstet mit der induktiven Phantasie eines Edgar Poe und dem minutiösen Scharfsinn eines in Textanalysen bestens bewanderten Philologen, besaß er zugleich eine eigenartige Leidenschaft für Ausnahmeexistenzen, für Menschen, die sich mit gewohntem Maß nicht messen lassen, eine Leidenschaft, die ihn so manches Buch entdecken und so manchen literarischen Wert setzen ließ.
Dem Vorbild Longnons folgend – und im Grunde so verfahrend, wie in der Praxis auch die Polizei – gebrauchte er, um Villon dingfest zu machen, die Methode des Netzfangs. Er warf das Netz über die mutmaßlichen Kumpane des Delinquenten und hoffte, ihn dadurch zu fangen, daß er die ganze Bande aushob: das heißt, identifizierte. Mit Staunen hörte ich von ihm, mit welcher Sorgfalt damals Straftaten verfolgt wurden. Eines Tages berichtete er mir von den finsteren Abenteuern einer Schar von Bösewichtern, zu deren Bande auch Villon gehörte. Schwob entdeckte sie in Dijon, wo sie schon allerhand auf dem Kerbholz hatten. In dem Augenblick, da man beinahe ihrer habhaft wird, flüchten sie und zerstreuen sich. Aber der Staatsanwalt von Dijon bleibt ihnen auf der Spur. Er schickt einem seiner Amtskollegen einen Rapport, der uns mit wünschenswerter Genauigkeit über das Schicksal der flüchtigen Verbrecher unterrichtet. Drei verschwinden, beladen mit der ganzen Beute, in irgendeinem Wald. Dort lassen zwei von ihnen, die sich zusammengetan haben, den Dritten über die Klinge springen, teilen unter sich, was ihm zugefallen war, und gehen auseinander. Der eine läßt sich in, ich glaube, Orléans aufknüpfen, der andere wird in Montargis wegen Falschmünzerei in siedendes Öl gesteckt. Man sieht, daß die Justiz von damals, ohne Telegramme, Telefone, Photos, Fingerabdrücke und Anthropometrie, ihrer Aufgabe ganz gut gewachsen war!
Villon steht unter dem schweren Verdacht, dieser Bande der sogenannten »Muschelbrüder« – »Compagnons de la Coquille« oder »Coquillards« – angehört zu haben. Sein heilloses und produktives Leben war jedenfalls recht kurz, und es steht sehr zu vermuten, daß er keine vierzig Jahre alt geworden ist. Ich werde über dieses Leben kurz berichten, oder vielmehr das zusammenfassen, was wir durch die Forscher wissen, die ich nannte, und die man lesen muß, um sowohl die Gedichte dieses großen Lyrikers besser zu verstehen, als auch um die vollbrachte Leistung exakter historischer Rekonstruktion zu würdigen und dabei zu begreifen, daß es ein Genie des Forschens gibt wie ein Genie des Findens, und ein Genie des Lesens wie ein Genie des Schreibens.
Villon, der sich erst François de Montcorbier nannte, wurde 1431 in Paris geboren. Seine Mutter, zu arm, um ihn aufziehen zu können, übergab ihn einem gelehrten Priester, Guillaume de Villon, der zum Kapitel von Saint-Benoît-le-Betourné gehörte und auch da wohnte. Dort wuchs François Villon heran, dort erhielt er seine ersten Schulkenntnisse. Sein Adoptivvater ist ihm anscheinend stets mit Güte, ja mit Zärtlichkeit begegnet. Mit achtzehn Jahren ist der junge Mann Baccalaureus, mit einundzwanzig, im Sommer 1452, erwirbt er den Grad eines Lizentiaten. Welche Kenntnisse besaß er? Sicher die, die man erwerben konnte, wenn man mehr oder weniger fleißig die Vorlesungen der Artistenfakultät besuchte: Grammatik (lateinische), formale Logik und Rhetorik (nach Aristoteles, so wie man seine Werke damals kannte und verstand), später folgten etwas Metaphysik und ein Abriß der Ethik, der Physik und der Naturkunde jener Zeit.
Kaum hat er Brief und Titel – diese doppelsinnige »Lizenz« –, beginnt Villon ein immer zügelloseres und bald auch gefährlicheres Leben zu führen. Das Kleriker-Milieu war sehr gemischt. Der geistliche Stand war von denen sehr begehrt, die damit rechnen mußten, eines Tages vor Gericht zu stehen. Geistlicher sein hieß, daß man nur von einem geistlichen Gericht verurteilt werden durfte und so dem weltlichen entging, das ungleich härter strafte. So mancher Geistliche führte einen zweifelhaften Lebenswandel. So manche betrübliche Gestalt mischte sich unter die Kleriker, gab vor, es zu sein; und in den Gefängnissen erteilte man bisweilen seltsame Lateinlektionen, die einem Festgenommenen die Möglichkeit verschaffen sollten, sich als Kleriker auszugeben und damit das Gericht zu wechseln.
In dieser zusammengewürfelten Gesellschaft machte Villon Bekanntschaften der übelsten Sorte. Den Damen fehlte es auch hier gewiß an Reizen nicht. Sie spielten, wie sich von selbst versteht, in den Gedanken und den abenteuerlichen Taten unseres Dichters eine große Rolle. Doch keine hätte sich träumen lassen, daß dieser Junge ihr ein wenig Unsterblichkeit verschaffen würde. Weder Blanche, die Schusterin, noch die dicke Margot, weder die schöne Helmmachersfrau noch Jehanneton, die Haubennäherin, oder Katherine, die Beutelmacherin.
Beachten Sie all diese Zunftnamen ... Es hat den Anschein, als hätte jede Zunft ihre Frauen der Göttin opfern müssen und als habe das mittelalterliche Handwerk unfehlbar zu ehelichen Zerwürfnissen geführt.
Dann kommt der Augenblick, da Ausschweifung und Unzucht in Gewalttätigkeit ausarten. Am 5. Juni des Jahres 1455 tötet Villon. Der Vorfall ist uns recht genau bekannt, denn er ist festgehalten in einem Begnadigungsschreiben Karls VII. für einen »Magister François des Loges, alias de Villon, ungefähr sechsundzwanzig Jahre alt, der am Fronleichnamstag auf einem Stein unter dem Zifferblatt der Uhr von Saint-Benoît-le-Bien-Tourné gesessen, in der großen Rue Saint-Jacques unserer Stadt Paris, und war mit ihm einer namens Gilles, ein Priester, und eine namens Ysabeau, und geschah dies ungefähr um neun Uhr abends«. Es kommt dann ein gewisser Philippe Sermoise oder Chermoye hinzu, ebenfalls ein Geistlicher, und ein Magister Jehan le Mardi. Wie aus dem Bericht hervorgeht, der Villons Angaben folgt, ohne sie anzuzweifeln, sucht dieser Priester Sermoise Händel mit Villon, der ihn zunächst beschwichtigen will und aufsteht, um ihm Platz zu machen ... Doch zieht Sermoise unter seiner Soutane ein Kurzschwert hervor und schlägt Villon ins Gesicht, »sodaß viel Blut hervorfloß; Villon, der wegen der Abendkühle einen Mantel trug, worunter ihm ein kurzes Schwert am Gürtel hing«, zieht ebenfalls und trifft Sermoise in der Leiste, »vermeinend, er habe ihm kein Leid getan«. (Diese Entschuldigung klingt sehr verdächtig.) D a Sermoise, wie es scheint, noch nicht genug hat und ihm weiter zusetzt, nimmt Villon einen Stein und schlägt ihm diesen mitten ins Gesicht. Alle Zeugen haben sich davongemacht.
Villon läuft zu einem Bader und läßt sich dort verbinden. Der Bader, der den Behörden Meldung machen muß, fragt seinen Patienten nach dem Namen. Villon gibt einen falschen Namen an: Michel Mouton. Sermoise wird erst in ein Kloster transportiert, dann ins Hôtel-Dieu, und stirbt dort am Tag darauf, »weil er sich nicht brav hat arzneien lassen«. Der Mörder hält es für geraten, sich aus dem Staub zu machen.
Einige Monate später wird ihm das Begnadigungsschreiben übermittelt, aus dem ich einiges zitiert habe. Es fällt auf, daß dieser ausdrückliche Gunsterweis sich lediglich auf Aussagen und Argumente François Villons beruft. Eine Untersuchung unterbleibt. Die Entschuldigung der Notwehr wird widerspruchslos hingenommen. Der Beteuerung des Angeklagten, daß seit dem bedauernswerten Zwischenfall seine Lebensführung untadelig gewesen sei, wird aufs Wort geglaubt. Dabei kann man nicht umhin, den Bericht für wenig glaubwürdig zu halten; daß der Angriff des Sermoise unerklärt bleibt, daß Villon dem Bader Fouquet einen falschen Namen angibt, daß er flieht und die Zeugen von der Bildfläche verschwinden – all das sind recht beunruhigende Einzelheiten dieses Falles. Manch anderer wurde auf Grund dürftigerer Indizien an den Galgen befördert. Aber seien wir nicht unnachsichtiger als der König, der, »Gnade vor Recht ergehen lassend«, Tat und Ausgang vergibt und vergißt – »womit wir«, sagt der Text, »unserm Staatsanwalt ewiges Schweigen auferlegen«. Dieses Schweigen sollte bald gebrochen werden.
Über das zweite uns bekannte Verbrechen Villons gibt es keinen Zweifel, und alle einschlägigen Begriffe, die das Strafgesetzbuch definiert, sind hier versammelt. Nichts fehlt: Es war ein Einbruch, des Nachts, an bewohntem Ort, mit Einstieg, Einbruch, Gebrauch von Nachschlüsseln und jeder Art von Einbruchswerkzeug. Villon, der die Gelegenheit ausgekundschaftet hatte, bringt so mit Hilfe von professionellen Einbrechern und anderen Komplizen fünfhundert Goldtaler an sich, die dem Collège de Navarre gehörten. Die Truhe, in der sie aufbewahrt waren, stand in der Sakristei der Kapelle des Collège. Der Diebstahl wurde erst zwei Monate später entdeckt. Die Einzelheiten der von königlichen Kommissaren durchgeführten Untersuchung sind hochinteressant. Ich gebe nur eine Probe.
Die Kommissare beriefen als Experten neun Schlosser, die mit einem besonderen Schwur vereidigt wurden und deren Namen und Adressen uns in den Akten des Verfahrens überliefert sind. Sie rekonstruierten sehr genau, wie die Diebe vorgegangen waren. Doch die hatten schon das Weite gesucht. Zu ihrem Pech kommt man ihnen durch die Geschwätzigkeit eines unvorsichtigen Komplizen auf die Spur, den ein Pfarrer in einer Schenke von dem Vorfall im Collège de Navarre hat reden hören. Dieser Priester, für den Gottesdienst wohl weniger berufen als für den Spitzeldienst der Polizei, löst eine erstaunlich straff geführte Untersuchung aus, und die führt geradewegs zu François Villon. Eilends macht Villon sich auf in die Provinz.
Welche Schicksale ihm dann beschieden waren, weiß der Himmel! ... Wir finden ihn bald im Gefängnis, bald in Verbindung mit dem Dichter-Fürsten Charles d’Orléans, und zweifellos wird er hier und da an den Unternehmungen der Coquillards teilgenommen haben. Jedenfalls bekam er offenbar das äußerst harte bischöfliche Zuchthaus von Meungsur-Loire zu schmecken, vielleicht wegen eines Kelchdiebstahls aus einer Sakristei. Der Bischof von Orléans, Thibaud d’Auxigny, behandelte ihn mit einer Strenge, die Villon in grausamer Erinnerung blieb; er verhängte die Wasserfolter über ihn, dann warf er ihn in Ketten in ein unterirdisches Verlies. Von Ludwig XI. amnestiert, kehrt er nach Paris zurück, doch leider! ohne sich zu bessern. Hier findet er alte Bekannte wieder, gewinnt neue, nicht von der besten Sorte, und gerät durch ihren Umgang in die schlimmste Bedrängnis seines Lebens. Nach einer Rauferei, bei der ein bischöflicher Notar verletzt wird, verurteilt das Châtelet Villon zu Strang und Galgen. Als die Justizbehörden der Berufung stattgeben, die er gegen das Urteil eingelegt hat, und die Strafe, vor der er immer bangte, die ihm so schlimme Träume eingab und die er so ungeschminkt beschrieben hat, umwandelten in eine zehnjährige Verbannung aus Paris, offenbart die Freude, die er zeigt, daß er Tage voller Angst durchlebt hat zwischen Folterungen und dem Gedanken an das grauenhafte Bild des Galgens, an dem sein Leib baumelt. Als er erfährt, daß er mit heiler Haut davonkommt, läßt die Erleichterung ihn gleich zwei Gedichte schreiben. Im einen wendet er sich an den Gefängniswärter und beglückwünscht sich, Berufung eingelegt zu haben, das andere richtet er an den Hof, als Dank. Alle seine Sinne, Glieder, Organe ruft er auf,
Foye, pommon et rate, qui respire;
(Milz, Leber, Lunge, meines Atems Schwaden, )
den Hof zu preisen!
Er verläßt also Paris, froh, so billig davongekommen zu sein.
Dann ... Doch dann wissen wir nichts mehr.
Wann und wie fand Villon sein Ende?
Dictes moy ou, n’en quel pays?
(O sagt mir, wo, in welchem Land)
Darüber wissen wir absolut nichts.7
In gänzlicher Finsternis verliert sich dies an Schatten reiche Leben. Doch seit dem Beginn des sechzehnten Jahrhunderts wird das Werk dieses Delinquenten gedruckt; der Vagabund, der Dieb, der zum Tod Verurteilte erhält unter den französischen Dichtern einen Rang, den ihm niemand mehr streitig machen sollte. Die Dichtung, die auf ihn folgt, greift auf die Antike zurück, bedient sich eines edlen, gebieterisch erlesenen Stils. Die Salons sagen ihr mehr zu als Straßenecken und Spelunken. Und doch wird Villon stets gelesen, sogar von Boileau. Sein Ruhm ist heute größer denn je; und daß seine Verworfenheit, durch authentische Urkunden erhärtet und erwiesen, klarer zu Tage tritt als einst, steigert das Interesse an seinem Werk, wie man zugeben muß, mehr als angemessen. Durchmustert man die Buch- und Bühnenproduktion aller Epochen, so zeigt sich, daß Verbrechen große Anziehungskraft besitzen und Lasterhaftigkeit auch die nicht unbeeindruckt läßt, die den Pfad der Tugend nicht verlassen, oder doch nur selten. Im Fall Villon ist es ein Schuldiger, der zu uns spricht, und er spricht als großer Dichter. Damit stellt sich ein Problem, das ich als ein psychologisches bezeichnen würde, wenn ich nur sicher wüßte, was dieses Wort bedeutet.
Wie können in demselben Kopf Gedanken an Verbrechen, ihre Planung, der unbeirrte Entschluß, sie zu begehen, mit der Sensibilität zusammenwohnen, von der einige Gedichte zeugen und die von jeder Kunst untrennbar ist; wie sind sie vereinbar mit der Reflektiertheit, die in dem berühmten Debat du cueur et du corps8 sich nicht nur zeigt, sondern sich auch einen so genauen Ausdruck schafft? Woher hat dieser Bandit, der vor dem Galgen zittert, den Mut, so wunderbare Verse den elenden Vogelscheuchen in den Mund zu legen, die der Wind am Ende ihres Stricks wiegt und langsam zerfallen läßt? Das Entsetzen hindert ihn nicht, seine Reime zu suchen; seine Vision wird dichterisch verwertet: sie ist zu etwas nütze, das durchaus verschieden ist von dem, was die Justiz sich erhofft, wenn sie sich und ihre Strenge mit dem, was sie das abschreckende Beispiel der Strafe nennt, rechtfertigt. Doch mögen sie die einen hängen, die anderen vierteilen oder in siedendes Öl werfen, sie hindern nicht, daß ein Mann, der kein geringer Verbrecher, aber als Dichter größer ist denn als Verbrecher, seine Laster, Frevel, Ängste, Reuegefühle und Gewissensqualen sammelt und aus diesem erbärmlichen und abscheulichen Gemisch die Kunstwerke gewinnt, die wir vor uns haben.
Der Beruf des Dichters – wenn das ein Beruf ist – läßt sich zweifellos mit einer geregelten gesellschaftlichen Existenz vereinbaren. Die meisten, glauben Sie mir, die allermeisten, waren oder sind die ehrbarsten Menschen der Welt, und bisweilen die geehrtesten. Und doch ...
Eine Überlegung, die ein wenig beim Dichter verweilt und den ihm in der Welt zustehenden Platz zu finden sich bemüht, gerät dieser undefinierbaren Spezies wegen bald in Verlegenheit. Stellen Sie sich eine wohlgeordnete Gesellschaft vor – das heißt eine Gesellschaft, die jedem Mitglied den genauen Gegenwert dessen gibt, was es für sie leistet. Eine so vollkommene Gerechtigkeit schließt jeden aus, dessen Leistung nicht berechenbar ist. Die Leistung des Dichters oder Künstlers ist es nicht. Sein Wert ist für die einen gleich Null, für die anderen unschätzbar. Eine Aufrechnung ist unmöglich. Das soziale System, in dem solche Existenzen leben, muß also unvollkommen genug sein, um die Hervorbringung des Schönsten zu ermöglichen, dessen Menschen fähig sind und durch das sie, umgekehrt, erst wahrhaft Menschen werden. Eine solche Gesellschaft läßt Ungenauigkeiten des Leistungsaustauschs zu, windige Gelegenheitseinkünfte und Almosen, kurz, all das, womit ein Verlaine sein Dasein fristen konnte, ohne, wie unser Villon, von einer Diebesgenossenschaft Dividenden zu beziehen, nachdem die nötigen Summen des Nachts mit Hilfe von Leitern und Stemmeisen aus den Truhen reicher Sakristeien geholt worden sind.
Ich erspare mir Ausführungen über das Leben Verlaines: es ist uns noch zu nahe, und ich möchte nicht die Akte noch einmal aufschlagen, die aus der Gerichtskanzlei von Mons in die königliche Bibliothek nach Brüssel gewandert ist, um dort (nicht ohne Störungen) zu ruhen, so wie die Akte Villons die Schränke des Pariser Gerichtshofs mit denen des Nationalarchivs vertauschen mußte. Villon ist uns genügend fern: über ihn können wir sprechen wie über eine legendäre Gestalt. Doch Verlaine! ... Wie oft habe ich ihn an meinem Haus vorübergehen sehen, lachend, fluchend und wild den Boden schlagend mit einem Knotenstock, der weniger nach dem Stock eines Kranken aussah als nach dem eines angriffslustigen Vagabunden. Wie hätte man vermuten können, daß dieser in seinem Auftreten und seinem Reden oft brutal anmutende, dreckige, Mitleid und Unbehagen zugleich einflößende Landstreicher der Autor zartester poetischer Musik, der unerhörtesten und ergreifendsten Wortmelodien war, die es in unserer Sprache je gegeben hat? Die Summe aller nur denkbaren Laster hatte diese machtvoll-milde Gabe der Eingebung unversehrt gelassen, ja vielleicht befruchtet oder zur Entfaltung gebracht, diese Sanftheit, Inbrunst, zarte Innigkeit, die niemand so wie er ausdrücken konnte, denn keiner war wie er vertraut mit den subtilsten Künsten virtuoser Dichter, keiner hat wie er vermocht, die Techniken einer meisterhaft beherrschten Kunst so zu verschleiern oder einzuschmelzen in Gedichten, die ganz mühelos geschrieben scheinen und deren Ton naiv, fast kindlich ist. Denken Sie an:
Calmes dans le demi-jour
Que les branches hautes font ...
[Ruhig im Zwielicht,
Das die hohen Zweige werfen ...]
Seine Verse lassen uns bisweilen an die rhythmisch gemurmelten Gebete in der Katechismus-Stunde denken; bisweilen sind sie von einer erstaunlichen Ungezwungenheit und in saloppem Umgangston geschrieben. Gelegentlich experimentierte er mit Metren, wie in dem merkwürdigen Crimen Amoris, einem Gedicht in Elfsilblern. Übrigens hat er sich so gut wie aller Metren bedient: vom Fünfsilbler angefangen bis hin zum Vers mit dreizehn Silben. Er machte auch von ungewöhnlichen oder seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr üblichen Kombinationen Gebrauch und schrieb Gedichte mit nur männlichen oder nur weiblichen Reimen.
Doch will man ihn unter allen Umständen mit Villon vergleichen, nicht als Menschen, der mit den Gesetzen in Konflikt geraten ist und ein Strafregister aufzuweisen hat, sondern als Dichter, so entdeckt man überrascht – oder vielmehr, so entdecke ich, denn das ist mein persönlicher Eindruck –, daß Villon (vom Vokabular abgesehen) im einen oder anderen ein modernerer Dichter ist als Verlaine. Er ist präziser, und er ist farbiger. Seine Sprache ist erheblich fester. Die Sätze, aus denen der Debat du cueur et du corps gefügt ist, haben die Klarheit und Strenge Corneilles. Und Villon hat eine Fülle unvergeßlicher Verse geprägt, deren jeder ein Fund ist von der Art, wie sie den Klassikern gelangen ... Vor allem jedoch gebührt Villon der Ruhm, ein wahrhaft großes Werk geschaffen zu haben, das berühmte Testament, diese einzigartige, vollkommene Schöpfung, ein Jüngstes Gericht, das einer über die Menschen und Dinge hält, der mit dreißig Jahren schon allzuviel gesehen, schon allzulang gelebt hat. Diese Folge von Gedichten in der Art eines testamentarischen Vermächtnisses hat etwas von einem Totentanz und der Comédie humaine; Bischöfe, Fürsten, Henker, Schurken, Huren, Saufkumpane: jedem wird sein Erbteil zugesprochen. Alle, die ihm Gutes taten, und alle, deren Härte er zu spüren hatte, sie alle sind vertreten, mit einer einzigen Formel, einem einzigen und stets endgültigen Vers verewigt. Und in dieser eigenwilligen Komposition stehen zwischen genauen Porträts, in welche Namen, Spitznamen, selbst Adressen aufgenommen sind, als gleichsam allgemeinere Figuren, die schönsten Balladen, die je geschrieben wurden. Sie unterbrechen die saloppe Sprache des Monologs. Das Geständnis wird Gesang und entfaltet Schwingen. Die bei Villon so häufige Anrede wird zu einem Element des Lyrischen, und die so oft auftretende Frageform:
Mais ou sont les neiges d’antan?
(Wo schmolz der Schnee des Winters hin?)
Le lesserez la, le povre Villon?
(Laßt Ihr den armen Villon hier allein?)
Dictes moy ou, n’en quel pays ...?
(Sagt mir, wo, in welchem Land ...?)
Qu’est devenu ce front poly,
Cheveulx blons, ces sourcils voultiz ...?
(Was ward aus meiner glatten Stirn,
Dem blonden Haar, den runden Brauen ...?)9
gibt seinen Versen durch die Wiederholung, mehr noch durch die Intonation, einen kraftvoll-pathetischen Zug. Er ist der einzige französische Dichter, der es verstanden hat, dem Refrain nachdrückliche und sich steigernde Wirkungen abzugewinnen.
Wenn ich nun von Verlaine (auf eigene Gefahr) behaupte, daß sein Werk sich weniger literarisch gibt als das Villons, so meine ich nicht, er sei naiver. Naiv ist weder der eine noch der andere, ebensowenig wie La Fontaine. Dichter sind nur dann naiv, wenn sie keine sind. Ich meine, daß diese Dichtung, die nur Verlaine zu schreiben vermochte, die von La bonne chanson, Sagesse und die der späteren Sammlungen, auf den ersten Blick nicht ebensoviel voraufgegangene Tradition voraussetzt wie die Villons, was übrigens ein Schein ist, der trügt; es läßt sich dieser Eindruck durch die Feststellung erklären, daß der eine am Beginn einer neuen Epoche unserer Dichtung steht und zugleich am Ende der Poetik des Mittelalters, einer Poetik der Allegorien und Moralitäten, der Romane und frommen Legenden. Villon kündigt gewissermaßen die schon sehr nahe Epoche an, da die künstlerische Produktion sich im vollen Bewußtsein ihrer selbst und um ihrer selbst willen entfaltet. Die Renaissance ist die Geburt der Kunst für die Kunst. Verlaine sieht sich in der genau umgekehrten Situation. Er hat das alles hinter sich, wendet dem den Rükken, flieht den Parnasse; er ist, oder er glaubt sich, am Ende eines ästhetischen Paganismus. Er reagiert gegen Hugo, gegen Leconte de Lisle, gegen Banville; er versteht sich gut mit Mallarmé, doch Mallarmé und er sind zwei Extreme, die sich einander nur genähert haben, weil sie mehr oder minder dieselben Anhänger hatten und mehr oder minder dieselben Gegner.
Diese Frontstellung nun zwingt Verlaine, sich eine Form zu schaffen, die derjenigen genau entgegengesetzt ist, deren Perfektion ihm unerträglich wurde ... Bisweilen möchte man glauben, daß er in den Silben und Reimen nur umhertappt und den musikalischsten Ausdruck sucht, den der Augenblick eingibt. Doch er weiß genau, was er tut, ja er erhebt es zum Programm: er verordnet eine ars poetica der »Musik vor allen Dingen«, und das erklärt, warum er Freiheit will ... Das Programmatische daran ist symptomatisch.
Dieser Naive ist ein »Primitiver« mit System, ein »Primitiver«, wie es ihn nie gegeben hat: ein im Grunde virtuoser und sehr bewußter Künstler. Keine wirklich naive Kunst gleicht der Verlaines. Vielleicht hat man ihn angemessener eingestuft, als man ihn um das Jahr 1885 einen ›dekadenten Dichter‹ nannte. Keine Kunst ist subtiler als die, welche unter dem Zwang entsteht, eine vergangene fliehen zu müssen, statt Vorläuferin einer kommenden zu sein.
Verlaine wie Villon zwingen uns schließlich zu der Einsicht, daß ein ausschweifendes Leben, der Kampf mit einem harten und wechselvollen Schicksal, eine ungesicherte Existenz, Aufenthalte in Gefängnissen und Hospitälern, Trunksucht, Umgang mit dem Abschaum der Gesellschaft, ja selbst Verbrechen durchaus nicht unvereinbar sind mit den erlesensten Zartheiten dichterischer Schöpfung. Wollte ich über diesen Punkt ein wenig philosophieren, so wäre hier die Bemerkung am Platz, daß der Dichter kein besonders soziables Wesen ist. Insofern er Dichter ist, fügt er sich in keine zweckgerichtete Organisation. Der Respekt vor den bürgerlichen Gesetzen endet an der Schwelle der Spelunke, in der er seine Verse formt. Die Größten, Shakespeare wie Hugo, haben mit Vorliebe Menschen außerhalb aller sozialen Ordnung erdacht und zu Leben erweckt, Rebellen gegen jede Autorität, ehebrecherisch Liebende, die sie gleichwohl zu ihren Helden machten und zu Gestalten, denen unsere Sympathie gehört. Sollen sie die Tugend preisen, fühlen sie sich weniger in ihrem Element: Mit der Tugend macht man, leider, keine gute Figur. Die Verachtung für den Bürger, die von den Romantikern eingeführt wurde und nicht ohne politische Folgen blieb, ist im Grunde nichts anderes als Verachtung für ein geregeltes Dasein.
Das ist der Grund, warum der Dichter ein schlechtes Gewissen hat. Irgendwo jedoch nistet immer der moralische Instinkt. Selbst bei den übelsten Schurken, den schlimmsten Verbrecherbanden tauchen zuletzt Regeln auf, wird ein Gesetz des Dschungels verkündet. Im Gesetzbuch, dem der Dichter zu gehorchen hat, steht nur ein einziger Paragraph, der mein letztes Wort sein soll:
Dichterische Todesstrafe verdient, sagt das Gesetz, wer kein Talent hat ... ja wer nicht etwas mehr hat als Talent.
PONTUS DE TYARD
Pontus de Tyard gehört keineswegs zu den ganz großen Gestalten der Literatur. Man verbindet seinen Namen vor allem mit der Plejade, und so hat er sich von dieser Sternen-Konstellation etwas Licht geborgt, mit Hilfe dessen er sich bis zu uns heute hat bewegen können.
Falls nun aber die Aufmerksamkeit der Wissenschaft sich diesem Gefährten von Ronsard und du Bellay zuwendet, so erkennt sie auch in Tyard fast alle jene noblen Eigenschaften, die die großen Geister seiner Epoche aufwiesen. Man weiß doch, daß ihnen keinerlei Begabung fehlte und ihre Seelen von vielen Begierden entflammt waren.
Von Leonardo da Vinci bis Francis Bacon erweist sich ein Jahrhundert besonders reich an universalen Geistern. In jenen legendären Zeitläuften gewinnen die Neugier der sinnlichen Wahrnehmung, die Lust an der Erkenntnis und die Leidenschaft des Erschaffens eine geradezu beispiellose Kraft. Die Künste, Wissenschaften, das Hebräische, Griechische, die Mathematik, die spekulative oder angewandte Politik, der Krieg, die Theologie ... nichts, was diesen vielgestaltigen, nach Wissen und Können dürstenden Monstern, die alles Vergangene verschlingen und eine völlig neue Zukunft gebären, nicht erstrebenswert, genüßlich und leicht erschiene.
Unser Pontus gehört nun wohl zu dieser Art, wenngleich von etwas kleinerer Größe. Dieser Dichter war Astronom; dieser Astronom Bischof; und dieser Bischof zugleich Bevollmächtigter des Königs und seines wissenschaftlichen Federkriegs. Leier, Mitra und Astrolabium könnten auf sein Grab gesetzt werden. Der vierte Winkel des Steins jedoch wäre durch ein anderes Emblem zu schmücken, das offensichtlich Tyard ebenso rechtmäßig zugesprochen werden muß wie den anderen: eine jener göttlichen und dickbauchigen Flaschen, die er gut und gern zur Hand nahm, vorausgesetzt, es war Burgunderwein, was nun einmal der Wein seiner Heimat und seines Geschmacks war.
Hinsichtlich der Liebe hat Tyard wie jedermann nicht versäumt, dieser unausweichlichen Lehrmeisterin den entsprechenden Tribut zu entrichten. Eine gewisse Pasithée hat ihn stark beschäftigt. Aber die Liebe beschenkte ihn als Gegengabe mit einer beträchtlichen Zahl von zauberhaften Versen; sie flüsterte ihm dieses Livre des erreurs amoureuses ins Ohr, in dem man Dankgebete wie das folgende findet:
Ô calme nuit qui doucement composes
En ma faveur l’ombre mieux animée
Qu’onque Morphée en sa salle enfumée
Peignit du rien de ses métamorphoses ...
[O stille Nacht, die du sanft zusammenstellst
Mir zur Gunst diesen beseelteren Schatten,
Den vordem Morpheus in rauchgeschwärztem Saal
Mit dem Nichts seiner Metamorphosen bemalte ...]
Ich darf natürlich, indem ich von Pontus de Tyard spreche, nicht vergessen, daß eine bestimmte Tradition ihm zuerkennt, der erste Verfasser von Sonetten in französischer Sprache gewesen zu sein. Über dieses Verdienst unseres Bischofs besteht allerdings Zweifel, doch schon allein dieser Zweifel ist an sich rühmlich, denn das Sonett ist eine wahrlich glückhaft erfundene Form, deren Kürze und Strenge weder Michelangelo noch Shakespeare gefürchtet haben und die jeden Dichter geradezu zur Perfektion verdammt – so daß der bloße Verdacht, diese Form bei den Franzosen eingeführt zu haben, schon über die Maßen ehrenvoll ist.
Tyard hatte eine gewisse Schwäche für die Inversion, die er etwas übertreibt und zu oft verwendet; sie stellt nun aber für die Dichtung eine nützliche und bedeutsame Freiheit dar, indem sie gesucht ehrwürdig den natürlichen Ablauf und die Einförmigkeit des sprachlichen Ausdrucks erschwert.
Indem er für sein Verschwinden die Gelegenheit einer totalen Sonnenfinsternis nutzte, starb Tyard 1605, im Alter – ohne davon erschöpft zu sein – von vierundachtzig Umdrehungen jenes Gestirns; er hatte loyal gedient, ohne sie allzu durcheinanderzubringen: Apoll, Venus, Urania, Heinrich III., Bacchus und der Kirche.
›GEISTLICHE GESÄNGE‹
Den Liebhabern der Schönheit unserer Sprache schlage ich vor, als einen der vollkommensten Dichter Frankreichs den bisher nahezu unbekannten Karmeliter R. P. Cyprien de la Nativité de la Vierge anzusehen.
Ich habe seine Entdeckung vor gut dreißig Jahren gemacht: gewiß eine kleine Entdeckung, insofern aber mancher großen ähnlich, als sie, wie man sagt, das Ergebnis eines Zufalls war. Ein ziemlich dickes Buch war mir in die Hände geraten, das nicht zu der Art von Büchern gehörte, die ich für gewöhnlich lese oder in denen ich etwas nachschlage. Es war ein alter Quartband mit einem sehr verblichenen roten Schnitt, gebunden in schon grau gewordenem Pergament, eines jener schweren Bücher, von denen man allzu leicht annimmt, sie enthielten nur die Leere toter Sätze, eines jener Bücher, die Mitleid erregen in den Bibliotheken, deren Wände sie mit ihren dem Leben zugekehrten Rücken bilden. Hin und wieder kommt es jedoch vor, daß ich in frommer Absicht eines dieser literarischen Gräber öffne. Denn in Wahrheit zieht sich einem das Herz des Geistes bei dem Gedanken zusammen, daß nie jemand mehr in diesen Tausenden von Bänden lesen wird, die sorgfältig aufbewahrt werden für die Würmer und die Flammen.
Doch kaum hatte ich den Titel dieses Bandes erfaßt, packte er mein Interesse. Er verkündete: Les œuvres spirituelles du b. père lean de la Croix, premier carme déchaussé de la Réforme de N.D. du Mont Carmel, et coadjuteur de la Saincte Mère Térèse de Iésus, etc., etc. Le tout traduit en français par le R. P. Cyprien de la Nativité de la Vierge, carme déchaussé, 1641.1
Ich bin kein großer Leser mystischer Werke. Ich glaube, man muß sich selbst auf dem Wege befinden, den sie weisen und dessen Marksteine sie bilden, und muß sogar ziemlich weit auf ihm vorangekommen sein, um in seiner ganzen Bedeutung einen Text aufzunehmen, dessen Natur es nicht zuläßt, ihn »kursorisch« zu lesen, und der nur Nutzen bringen kann, wenn man ihn tief und gleichsam uneingeschränkt durchdringt. Er verlangt eine vitale Anteilnahme, die etwas ganz anderes ist als ein einfaches Verstehen. Das Verstehen ist dabei gewiß nötig, aber es reicht keineswegs aus.
Deshalb hätte ich das alte Buch nur aufgeschlagen und rasch wieder geschlossen, wenn der illustre Name des Verfassers mich nicht dazu verführt hätte zu verweilen. Ich erlebte freudige Überraschungen.
Das Lieblingsthema des heiligen Johannes vom Kreuz ist ein Zustand, den er die »Dunkle Nacht« nennt.1 Der Glaube verlangt oder schafft sich diese Nacht, die die Abwesenheit jedes natürlichen Lichtes und die Herrschaft jener Finsternis sein soll, die ausschließlich rein übernatürliche Erleuchtungen vertreiben können. Vor allem kommt es ihm also darauf an, die kostbare Dunkelheit zu bewahren, sie vor jeder bildlichen oder intellektuellen Helligkeit zu schützen. Die Seele muß sich von all dem entfernen, was ihr nach ihrer natürlichen Beschaffenheit zukommt, das heißt vom Wahrnehmbaren und Vernünftigen. Nur unter dieser Bedingung kann sie zur höchsten Kontemplation geführt werden. In der Dunklen Nacht bleiben und sie in sich erhalten muß also darin bestehen, nichts dem gewöhnlichen Erkennen zu überlassen – denn alles, was der Verstand begreifen, was die Einbildungskraft schmieden, der Wille gutheißen kann, all das ist sehr verschieden von Gott und ihm unangemessen.
Es folgt eine außerordentlich subtile Analyse, die ich zu meinem Erstaunen vollkommen klar fand oder zu verstehen glaubte. Sie legt die Schwierigkeiten dar und beschreibt sie, wie auch die Möglichkeiten des Irrtums, die Verwirrungen, die Gefahren, die »natürlichen oder eingebildeten Befürchtungen«, die die finstere Reinheit dieser Phase stören oder die Vollkommenheit dieser mystischen Leere vermindern können, in der nichts auftreten oder sich ausbreiten darf, was aus der sinnlichen Welt stammt oder aus den geistigen Fähigkeiten, die sich mit ihr befassen.
Schließlich werden die Zeichen beschrieben, die erkennen lassen, daß man, ohne Selbsttäuschung und Unsicherheit, vom Zustand der Meditation, den es zu verlassen gilt und der vom Licht minderen Ranges erfüllt ist, in den Zustand der Kontemplation übergeht.
Es steht mir nicht zu, über diese so hohen Themen zu befinden. Es handelt sich hier um eine Lehre, die grundverschieden von jeder »Philosophie« ist, da sie ihre Wahrheit durch eine Erfahrung erweisen muß, und zwar eine solche, die allen durch das Wort zu erfassenden und vergleichbaren Erfahrungen so fern wie nur möglich ist; während eine Philosophie nur das Ziel haben kann, diese Erfahrungen der Intelligenz durch ein System darzustellen, das so umfassend und klar wie möglich ist und sich darauf beschränkt, sich zwischen der Sprache, der Welt und dem reflektierenden Denken zu bewegen und deren Beziehungen in ihrer Gesamtheit gemäß einer Person, dem Philosophen, zu organisieren.
Obwohl ich ein höchst unvollkommener Leser dieser dem Erhabenen zuzurechnenden Seiten war, geriet ich in Entzükken beim Lesen der Bemerkungen über die inneren Worte und über das Gedächtnis, die ich in den Traités de la montée au Mont Carmel und in La nuit obscure de l'âme fand. Hier gibt es Stellen, die von einem Bewußtsein seiner selbst zeugen und von einer Fähigkeit, die sinnlich nicht wahrnehmbaren Dinge zu beschreiben, wie man sie in der Literatur, selbst in der ganz speziell der »Psychologie« gewidmeten, selten findet. Allerdings ist, wie ich schon sagte, meine Kenntnis mystischer Werke und der Mystik selbst außerordentlich begrenzt; ich kann diese Analyse des heiligen Johannes vom Kreuz nicht mit anderen ähnlicher Art vergleichen, und es ist möglich, daß ich mich täusche.
Ich komme nun zu dem, was mir als so bemerkenswert an diesen Abhandlungen erschien: es sind beides Kommentare zu Gedichten. Diese Gedichte sind drei GEISTLICHE GESÄNGE: der eine besingt das glückverheißende Abenteuer der Seele, »entblößt und sich läuternd durch die Dunkle Nacht des Glaubens zur Vereinigung mit ihrem Vielgeliebten zu gehen; der andere handelt von der Seele und ihrem Bräutigam Jesus Christus, und der dritte schließlich feiert die Seele in inniger Vereinigung mit Gott«. Das ergibt im Ganzen zweihundertvierundsechzig Verse, wenn ich richtig gezählt habe, und diese Verse von sieben oder zehn Silben sind in Strophen von je fünf Versen aufgeteilt. Der Kommentar dazu ist dagegen höchst ausführlich, und diese Auslegungen und Erklärungen füllen den dicken Band, von dem ich gesprochen habe. Die poetische Aussage dient hier also als zu interpretierender Text, als Programm, das entwickelt werden soll, und auch als symbolische und musikalische Illustration der Darstellung mystischer Theologie, die ich vorhin erwähnt habe. Die heilige Melodie wird von einem gelehrten Kontrapunkt begleitet, der rings um den Gesang ein ganzes System innerer Disziplin schafft.
Diese Vorlage, die für mich etwas ganz Neues war, hat mich nachdenklich gemacht. Ich fragte mich, welche Wirkungen in der weltlichen Dichtung ein solches bemerkenswertes Vorgehen haben würde, bei dem zum Gedicht eine vom Autor selbst gelieferte Auslegung tritt, wofür vorauszusetzen wäre, daß der Dichter etwas über sein Werk zu sagen hat, was allerdings in den meisten Fällen zu seinen Ungunsten gedeutet würde. Es hätte indessen manche Vorteile, und vielleicht solche, die bisher unmögliche oder sehr kühne Entwicklungen der literarischen Kunst zeitigen könnten. Die Substanz oder das poetisch Wirksame mancher Stoffe oder mancher Weisen des Empfindens oder Begreifens offenbaren sich ungenügend vorbereiteten oder unterrichteten Personen nicht unmittelbar, und die meisten, selbst die belesenen, wollen nicht wahrhaben, daß ein dichterisches Werk nicht voll erfaßt werden kann ohne wirkliche geistige Arbeit oder gründliche Kenntnisse. Sowohl der Dichter, der diese Voraussetzungen für erfüllt hält, wie auch der Dichter, der versucht, das für das Verständnis Geforderte in sein Werk mit aufzunehmen, läuft Gefahr, verurteilt zu werden: der eine wegen Dunkelheit, der andere wegen Lehrhaftigkeit.
Plato mischt gewiß eine sehr delikate Poesie in seine sokratischen Beweisführungen, doch schreibt er nicht in Versen und bedient sich zudem der geschmeidigsten aller Ausdrucksformen, des Dialogs. Der Vers erträgt schlecht, was sich auf die Benennung einer Sache beschränkt und nicht versucht, das aufzurufen, was ihr in unserer Empfindung Wert gibt. Ein Objekt ist nur ein Objekt, und sein Name ist nur ein Wort inmitten anderer Wörter. Sobald es aber fähig ist, eine Erinnerung oder ein Vorgefühl in uns zu wecken, ist da schon eine Resonanz, die die Seele in das Universum des Poetischen führt, wie ein reiner Ton inmitten der Geräusche sie ein ganzes musikalisches Universum ahnen läßt. Deshalb hat jener Mann, der behauptete, daß »sein Vers, ob gut oder schlecht, immer etwas sage«, nur eine Dummheit gesagt, verschlimmert noch durch das abscheuliche »gut oder schlecht«. Wenn man daran denkt, daß dieser Satz mehr als ein Jahrhundert lang der französischen Jugend eingeimpft worden ist, in jener Zeit, da man von den Zauberkräften der Sprache absolut nichts mehr wissen wollte, da die Versdiktion nicht mehr beherrscht oder abgelehnt oder mit Deklamation verwechselt wurde, wundert man sich nicht mehr, daß die authentische Versdichtung sich im Verlauf dieser dem Sinnlosen sich widmenden Epoche nur durch aufeinanderfolgende Rebellionen hat bekunden können, die sich nicht nur gegen diejenigen wandten, die den Publikumsgeschmack bestimmten, sondern gegen die Mehrheit dieses Publikums selbst, das um so empfindlicher für die wahre Schönheit der Dichtung geworden war, je mehr es in den Sprach- und Literaturwissenschaften unterrichtet wurde, die man hochtrabend und töricht als »Humaniora« qualifizierte.
Nichts verbietet uns also zu denken, daß die vom heiligen Johannes vom Kreuz gewählte Weise, das, was man die Obertöne seines mystischen Denkens nennen könnte, darzulegen, während dieses Denken selbst sich in unmittelbarer Nachbarschaft unverhüllt ausdrückt, jedem abstrakten oder in die Tiefe gehenden Gedanken dienlich gemacht werden könnte, allen denen jedenfalls, die uns erregen können. Es gibt solche Gedanken, und es gibt eine Sensibilität für intellektuelle Dinge: der abstrakte Gedanke hat durchaus seine Poesie. Man kann sich sogar fragen, ob das spekulative Denken überhaupt jemals ganz auf lyrische Elemente verzichten kann, die ihm das an Charme und Energie verleihen, was er braucht, um den Geist dazu zu verlocken, sich mit ihm einzulassen.
Der Kommentar zu den GEISTLICHEN GESÄNGEN war notwendig, denn diese Strophen sind bei der ersten Lektüre zwar durch sich selbst völlig klar, aber sie enthüllen nicht unmittelbar ihre zweite, mystische Bedeutung. Dem äußeren Anschein nach sind diese Gedichte ein sehr zärtlicher Gesang, der uns zunächst vermuten läßt, es handele sich um eine ganz normale Liebe und um irgendein süßes bukolisches Abenteuer, das der Dichter wie in verstohlenen und manchmal mysteriösen Ausdrücken leicht skizziert. Doch darf man sich von dieser ersten Klarheit nicht irreführen lassen; man muß, mit Hilfe der Erläuterungen, wieder zum Text zurückkehren und erkennen, daß seinem Zauber die Tiefe einer übernatürlichen Leidenschaft zugrunde liegt und ein Mysterium, das unendlich viel kostbarer ist als jedes Liebesgeheimnis, das im menschlichen Herzen lebt.
Das Vorbild ist gewiß das Hohelied Salomos, das ebenso wie die Gesänge des heiligen Johannes vom Kreuz nicht auf eine Erklärung verzichten kann. Kann ich es wagen, hier zu gestehen, daß all die Schönheiten dieses prunkvollen Gedichtes eine Übersättigung durch Metaphern in mir bewirken, und daß all der Schmuck, mit dem es beladen ist, letztlich meine okzidentale Seele und meinen zur Abstraktion neigenden Geist verstimmen? Demgegenüber ziehe ich die reine Sprache des Werkes vor, von dem ich hier spreche.
Lassen wir meinen Geschmack beiseite, er ist ganz unwichtig. Ich halte lediglich fest, daß das Salomo zugeschriebene Hohelied eine Gattung allegorischer Dichtung geschaffen hat, die dem Ausdruck der mystischen Liebe besonders angemessen ist und zu den anderen vom Alten Testament geschaffenen oder verbreiteten literarischen Gattungen gehört. Die Psalmen zum Beispiel haben etwas vom Hymnus wie von der Elegie, eine Kombination, die eine bemerkenswerte Verbindung der lyrisch ausgedrückten kollektiven Empfindungen mit denen schafft, die sich aus dem Intimsten der Person und ihres Glaubens ergeben. Hier nun kann ich Pater Cyprien von der Geburt der Jungfrau Maria einführen, den bewunderungswürdigen Übersetzer des heiligen Johannes vom Kreuz, über den ich zunächst ein paar Worte habe sagen müssen. Ich hätte vermutlich in dem alten Band, in dem ich blätterte, niemals viel weiter gelesen, wenn mein Blick nicht zufällig auf die Verse gefallen wäre, die einem spanischen Text gegenüberstanden. Ich sah, ich las, und murmelte zugleich:
À l’ombre d’une obscure Nuit
D’angoisseux amour embrasée,
Ô l’heureux sort qui me conduit
Je sortis sans être avisée,
Le calme tenant à propos
Ma maison en un doux repos ...
[Im Schatten einer dunklen Nacht
Von angstvoller Liebe entflammt,
O glücklich Los, das mich lenkte,
Ging ich unbemerkt hinaus,
Die Stille hielt zur rechten Zeit
Mein Haus in sanfter Ruh ...]
Oh, das singt ja von ganz allein! ... sagte ich mir.
Es gibt keine andere Gewißheit für Poesie. Es muß geschehen und es genügt, um zu wissen, daß wir zweifellos Poesie vor uns haben (oder zumindest, daß wir uns in gefährlicher Nähe von Poesie fühlen), daß die einfache Zusammenfügung von Wörtern, die wir soeben lesen wollten wie man spricht, unsere Stimme, selbst die innere, zwingt, sich von dem Ton und der Gangart der gewöhnlichen Rede zu lösen, und sie in einen ganz anderen Modus wie in eine ganz andere Bewegung übersetzt. Dieser innere Zwang zur Bewegtheit und zum Rhythmisieren verwandelt zutiefst alle Werte des Textes, der ihn uns auferlegt. Dieser Text gehört schlagartig nicht mehr zu denen, die uns dargeboten werden, um uns etwas zu lehren und um zu verlöschen, sobald die Sache verstanden ist, sondern er wirkt auf uns ein, um uns ein anderes Leben leben zu lassen, gemäß diesem zweiten Leben zu atmen, und setzt einen Zustand oder eine Welt voraus, in der die darin sich befindenden Objekte und Lebewesen oder vielmehr deren Bilder andere Freiheiten haben und in anderen Verbindungen zueinander stehen als in der Welt unserer täglichen Erfahrung. Die Namen dieser Bilder spielen von nun an eine Rolle in deren Schicksal: die Gedanken folgen oft der Bestimmung, die ihnen der Klang oder die Silben dieser Namen zuweist; sie werden reicher durch die Ähnlichkeiten und Gegensätze, die von ihnen erweckt werden; all das erzeugt schließlich die Vorstellung von einer verwunschenen, wie durch einen Zauber den Launen, den Verführungskünsten, den Mächten der Sprache unterworfenen Natur.
Als ich diese Verse gelesen und wiedergelesen hatte, bekam ich Lust, das Spanische zu betrachten, das ich ein wenig verstehe, wenn es besonders leicht ist. Die reizvolle Strophe, die ich zitierte, ist die Übertragung der folgenden:
En una noche oscura
Con ansias en amores inflamadas,
O dichosa ventura!
Salí sin ser notada
Estanda mia casa sosegada
Getreuer kann man einen Text nicht wiedergeben. Der Übersetzer-Pater hat gewiß den Typus der Strophe modifiziert. Er hat unseren Achtsilber verwendet, statt den Variationen des vorgegebenen Metrums zu folgen. Er hat begriffen, daß die Prosodie der Sprache folgen muß, und er hat nicht versucht, so wie andere es getan haben (insbesondere im 16. und im 19. Jahrhundert), dem Französischen das aufzuzwingen, was das Französische nicht von sich aus dem französischen Ohr aufzwingt oder darbietet. Das heißt wirklich übersetzen: es besteht darin, die Wirkung einer bestimmten Ursache so genau wie möglich neu hervorzubringen – hier einen Text in spanischer Sprache neu hervorzubringen mit Hilfe einer anderen Ursache –, einen Text schaffen in französischer Sprache.2
Indem er dies tat, hat Pater Cyprien, wenn auch in äußerst zurückhaltender (bisher kaum wahrnehmbarer) Weise unsere Dichtung um eine kleine Zahl von Versen bereichert, doch von untrüglicher und reinster Qualität.
Die Fortsetzung erfüllte meine höchsten Erwartungen. Ich las mit Entzücken:
À l’obscur, mais hors de danger,
Par une échelle fort secrette
Couverte d’un voile estranger
Je me dérobay en cachette,
(Heureux sort, quand tout à propos
Ma maison estoit en repos).
En secret sous le manteau noir
De la Nuict sans estre apperceuë
Ou que je peusse apercevoir
Aucun des objects de la veuë ...
[Im Dunkel, doch ohne Gefahr,
Über eine geheime Leiter
Verhüllt von einem fremden Schleier
Entfloh ich ganz heimlich
(Glücklicher Umstand, daß zur rechten Zeit
Mein Haus in voller Ruhe lag).
Verborgen unter dem schwarzen Mantel
Der Nacht, ohne gesehen zu werden
Oder ohne daß ich hätte sehen können
Irgendeinen wahrnehmbaren Gegenstand ...]
Das hier war ohnegleichen, war aus sehr wenig Material gemacht und entzückte mich in meinem tiefsten Wesen, ohne daß ich zu erkennen vermochte, woraus dieser Charme sich zusammensetzte, in dem größte Schlichtheit und erlesenste »Vornehmheit« sich in bewunderungswürdiger Ausgewogenheit vereinigten.
Ich dachte: Wie kommt es, daß dieser Mönch eine solche Leichtigkeit des Strichs, der Gliederung der Form erworben und sofort den Faden der Melodie seiner Worte erfaßt hat? Es gibt nichts Sichereres, Freieres, Natürlicheres und also Kunstvolleres in der französischen Poesie. Gibt es selbst bei La Fontaine oder bei Verlaine einen klarer dahinfließenden – dabei aber keineswegs kraftlosen – Gesang, der beglückender aus dem Schweigen hervortritt?
Dans mon sein parsemé de fleurs
Qu’entier soigneuse je lui garde,
Il dort ...
[In meinem mit Blumen übersäten Schoß,
Den sorgfältig ganz ich ihm bewahre,
Schläft er ...]
Oder auch:
Morte bise, arrête ton cours:
Lève-toi, ô Sud qui resveilles
Par tes souffles les saincts amours ...
[Toter Nordwind, halt ein deinen Lauf:
Erheb dich, o Südwind, der du durch deinen Atem
Erweckst die Kräfte der heiligen Liebe ...]
Oder auch dieser Landschaftshintergrund, den zarte Klänge malen:
Allons ...
Au mont d’où l’eau plus pure sourd,
Au bois plus épais et plus sourd ...
[Auf geht es ...
Zum Berg, wo das reinste Wasser quillt,
Zum Wald, wo er am dichtesten und stummsten ist ...]
Ich habe die Untugend, daß ich in der Dichtung nur das liebe (oder überhaupt nur ertrage), worin ich Vollkommenheit spüre. Wie so viele andere Fehler verschlimmert sich auch dieser mit dem Alter. Wenn ich in einem Werk etwas finde, das ich mit geringer Mühe ändern zu können glaube, ist das der Feind meiner Freude, das heißt der Feind des Werkes. Es mag darin noch so viele Einzelheiten geben, die mich entzükken oder überraschen: wenn das Übrige nicht fest mit ihnen verbunden ist und mir die Freiheit läßt, es zu beseitigen, bin ich verärgert, und um so mehr verärgert, je kostbarer diese verstreuten Funde waren. Es irritiert mich, daß Schönheit dem Zufall zuzuschreiben ist und ich das Gegenteil eines Werkes vor mir habe.
Selbst gehäufte starke Effekte, immer wieder unerwartete und wunderbar aus entlegenster Ferne herbeigebrachte Bilder und Epitheta, die in uns, noch bevor wir in das Werk selbst eingedrungen sind, für den Verfasser und sein Können Bewunderung wecken, verschleiern das Ganze der Dichtung, und das Talent des Vaters ist verhängnisvoll für das Kind. Allzu viele verschiedenartige Stilmittel, Überladung des Textes mit ausgefallenem Wissensstoff, zu häufige und zu systematische Abschweifungen und Überraschungen lassen uns im Dichter einen Mann sehen, der, von seinen Vorzügen berauscht, diese mit allen Mitteln zur Entfaltung bringt, nicht gemäß dem Charakter und der Ordnung eines einzigen Planes, sondern im freien Raum der natürlichen unerschöpflichen Inkohärenz des Geistes. Dieses beunruhigende Bild tritt als Gegenvorstellung dem Eindruck gegenüber, den eine mit sich selbst im Einklang stehende Komposition erwecken würde, die von unbeschreiblichem Zauber und gleichsam ohne Autor