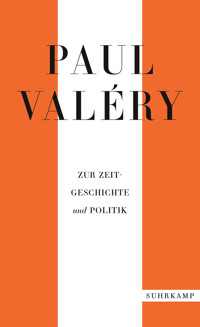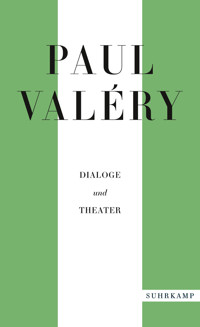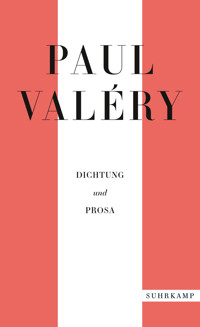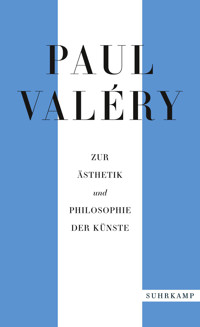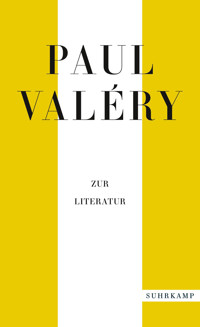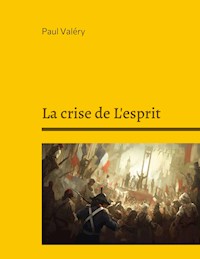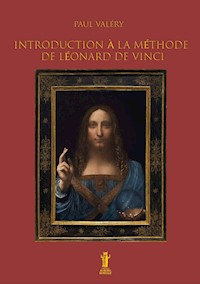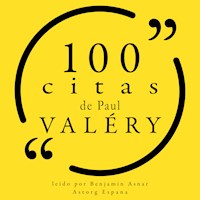16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Band 4 der Gesamtausgabe umfasst Essays, Reden, Vorworte und Briefe zu Wissenschaft und Philosophie. Die Textsammlung dokumentiert Valérys Auseinandersetzung mit Philosophen und Theoretikern wie Descartes und Pascal, deren Vorstellungen zu den Bausteinen seines eigenen Denkens gehörten; darüber hinaus legen die Schriften Valérys philosophische Ansätze dar. Wie schon in den Prosawerken kennzeichnet diese Beobachtungen der Versuch, den Vorgang des Sinneseindrucks zu rekonstruieren sowie Verständnis- und Schaffensprozesse rationaler Überprüfung zu unterziehen. Sie lassen eine Verflechtung einzelner (natur-)wissenschaftlicher Disziplinen mit der Welt der Literatur und mit Fragen der Ästhetik erkennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
PAUL VALÉRY WERKE
Frankfurter Ausgabe in 7 Bänden
Herausgegeben von Jürgen Schmidt-Radefeldt
Suhrkamp
Band 4 Zur Philosophie und Wissenschaft
Herausgegeben von Jürgen Schmidt-Radefeldt
Die Originalausgabe erschien 1957 unter dem Titel Œuvres I sowie 1960 unter dem Titel Œuvres II bei Éditions Gallimard, Paris.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5217.
© 1989, Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin
© Éditions Gallimard, 1957
© J. B. Janin, Editeur et Les Editions de la Table Ronde 1948
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Brian Barth
eISBN 978-3-518-77146-4
www.suhrkamp.de
INHALT
Fragment eines Descartes
Descartes
Eine Ansicht von Descartes
Zweite Ansicht von Descartes
Die Rückkehr aus Holland
Variation übereinen Gedanken Pascals
Marginalien zu ›Variation über einen Gedanken Pascals‹
Zu ›Heureka‹
Swedenborg
Vier Briefe über Nietzsche
Rede auf Bergson
Der Mensch und die Muschel
Rede an die Chirurgen
Einfache Überlegungen zum Körper
Studien und Fragmente über den Traum
Bericht über die Tugend-Preise
Die ›Furcht vor den Toten‹
Kleiner Brief über die Mythen
Wissenschaftler und Wissenschaft
Bilder von Jean Perrin
Persönliche Ansichten über die Wissenschaft
Gesichtspunkte
ANHANG
Editorische Nachbemerkung
Verzeichnis der Abkürzungen
Anmerkungen
Nachweise zu den einzelnen Texten
Namen-und Werkregister
ZUR PHILOSOPHIE UND WISSENSCHAFT
FRAGMENT EINES DESCARTES
Noch vor fünfzehn Jahren fand man in einer Straße ganz nahe des Place Royale1 eine Gendarmeriekaserne, wo die Reservisten ihre Militärpapiere ergänzen und abstempeln ließen.
Wer eintrat, sah sich in einem vornehmen und vertrauten Hofe um. Die gesuchten Büros lagen zur Linken unter einigen Korbbogenarkaden, den einzigen Überresten eines ziemlich alten Klosters. Diese zerfallene Erhabenheit paßte sich dem gemächlichen, halb amtlichen, halb intimen Leben an, das sich seit dem Ersten Kaiserreich hier allmählich eingenistet hatte. Es gab einen geistesabwesenden Wachposten, an den Säulen hängende Käfige mit Kanarienvögeln, Käppis, Blumentöpfe an den Fenstern, da und dort trockneten lange weiße Hosen an einer Schnur. Im Jahresdurchschnitt gingen um die hunderttausend Reservisten über diesen Hof. Ich weiß nicht, ob auch nur einer von ihnen geahnt hat, daß man ihn zu einer Pilgerfahrt veranlaßt hatte. Selbst die Befehlsgewalt, die ihn herbeorderte, so hochgestellt sie auch sein mochte, kannte das eigentliche Ziel nicht. Sie glaubte die Matrikel nur um ihrer selbst willen zu führen; ohne es zu wissen, zwang sie uns dazu, eines der ehrwürdigsten Denkmäler der Geschichte des Denkens zu besuchen.
Diese Kaserne ersetzte das Kloster, und die Gendarmen nahmen die Stelle der Minimen ein. Dort lebte und starb Pater Mersenne2, ein sehr nützlicher und recht namhafter Mann in der geistigen Gesellschaft zu Beginn des 17. Jahrhunderts; ein umgänglicher Ordensmann, voller Neugier, der einem von dem unsrigen recht verschiedenen intellektuellen Europa Probleme und manchmal auch Rätsel aufgab; in der Wissenschaft wirkte er als Katalysator und als Verbindungsglied zwischen den Gelehrten von unterschiedlicher Religion; er war ein Jugendfreund von Descartes gewesen und blieb ein beharrlicher und ein außergewöhnlicher Freund; er verbreitete seine Lehren, und unter jenen zweitrangigen Menschen, deren Rolle bei der Entwicklung großer Menschen und bei der Auslösung großer Dinge vielleicht unabdingbar ist, einer der liebenswürdigsten. Es wäre eine ziemlich neuartige und meines Erachtens auch recht fruchtbare Untersuchung, wenn man die Geschichte dieser Hilfskräfte, dieser inoffiziellen Vertrauensleute, Helfer oder Mittler systematisch erforschen würde, die sowohl in der Umgebung von Genies als auch unter den geringfügigen lebenden Ursachen großer Ereignisse immer anzutreffen sind.
Als Descartes nach Paris kam, pflegte man ihn vormittags bei den Minimen an der Place Royale bei dem äußerst geistreichen Pater zu besuchen. Am 11. Juli 1644 empfing er dort Monsieur Mélian. Von La Haye kommend, steigt er im Juni 1647 beim Abbé Picot in der Rue Goeffroy-Lasnier ab und verfaßt dort die Vorrede zu den Principes. Er begibt sich in die Bretagne, wohin ein Geschäft ihn gerufen hatte, kehrt über das Poitou und die Touraine zurück und findet bei seiner Rückkehr in Paris Anfang September die gute Nachricht vor, daß ihm der König auf Empfehlung des Kardinal-Ministers eine Rente von 3000 Livres bewilligt hat. Nachrichten dieser Art waren selten geworden.3
Zu dieser Zeit »verspürte der junge Pascal, der sich in Paris aufhielt, den Wunsch, ihn zu sehen, und er hatte die Genugtuung, sich bei den Minimen mit ihm zu unterhalten, nachdem man ihm den Hinweis gegeben hatte, er könne ihn dort treffen. Monsieur Descartes fand ein Vergnügen daran, ihn über die Experimente mit dem leeren Raum4 sprechen zu hören, die er in Rouen durchgeführt hatte und über die er gerade einen Bericht drucken ließ, von dem er ihm einige Zeit später, nach seiner Rückkehr, ein Exemplar nach Holland sandte. Monsieur Descartes war über die Unterredung mit Monsieur Pascal begeistert.«
Mit dem Ruhm des letzteren verbindet mich zu viel, als daß ich hier die Fortsetzung wiedergeben möchte.
Als ich eines Tages dort vorbeiging, sah ich voller Verdruß anstelle der alten Heimat der Minimen ein kubisches Bauwerk aus einem allzu neuen und reinen Kreidestein, gekrönt mit gesprenkelten Sandsteinkugeln. Die Gendarmen hat man in diesen Block zurückverlegt. Mir gefielen sie besser in dem alten Kloster, denn die Gendarmerie ist ja eine Art von militärischem Orden, auch wenn er sich der Heirat seiner Mitglieder keineswegs zu widersetzen scheint.
Es gibt in Europa nur wenige Nationen, bei denen ein durch eine so großartige Aura geweihtes Haus, das in seinen Mauern ein solches Gespräch vernehmen durfte, so unauffällig verschwinden könnte wie bei uns. Es gab an dem Minimenkloster nicht einmal eine Tafel, die diese Mauern über das, was sie gesehen hatten, zum Sprechen brachte. Was ich hier berichte, und was ich bei Baillet5 gefunden habe, scheint niemand gewußt zu haben, denn keine Menschenseele hat sich beklagt oder der Demolierung dieses Gemäuers widersetzt. Das Ganze verschwand in der Staubwolke von Abbruchfirmen.
Descartes hat hier kein Glück. Kein einziges Standbild dieses bewundernswerten Mannes in Paris – allerdings bin ich einverstanden, wenn dieser Zustand sich nicht ändert. Man hat lediglich eine Straße nach ihm benannt, eine ziemlich üble, auch wenn sie durch die Berühmtheiten der Ecole polytechnique belebt wurde und ein wenig im Banne Verlaines steht, der dort gestorben ist. Schließlich haben wir sogar seine Gebeine in Saint-Germain-des-Prés verstreut, und mir ist nicht bekannt, daß man sie für die Krypta des Panthéons zusammensucht.6
Aber als kluger Mann, der er war, und als unvergleichlicher Künstler im Umgang mit den härtesten Werkstoffen hat er sich eigenhändig ein Grabmal geschaffen; eines jener Grabmäler, die nachahmenswert sind. Er hat das Standbild seines Geistes errichtet, so klar und dem Blick so wirklichkeitsgetreu, daß man schwören könnte, es sei lebensecht und spreche zu uns in Person; daß uns keine dreihundert Jahre von ihm trennen, sondern ein direkter Umgang mit ihm möglich sei, allerdings nicht mit dem Abstand zwischen Geist und Geist, es sei denn mit dem Abstand des Geistes zu sich selbst. Sein Denkmal ist jener Discours, der wie alles, was genau geschrieben ist, so gut wie unzerstörbar ist. Eine selbstbewußte und geläufige Sprache, der es weder an Stolz noch an Bescheidenheit fehlt, macht uns die allen denkenden Menschen gemeinsamen Willenskräfte und Einstellungen so faßbar und beachtenswert, daß das Ergebnis weniger ein Meisterwerk der Ähnlichkeit oder der Wahrscheinlichkeit ist als vielmehr eine wirkliche Gegenwärtigkeit, die sich sogar aus der unsrigen speist.
Keine Schwierigkeiten, keine Bilder, keine scholastischen Erscheinungen, nichts gibt es in diesem Text, was nicht dem einfachsten und menschlichsten inneren Ton entspräche, kaum weniger präzise als die Natur selbst. Der Autor, den man zu hören glaubt, scheint sich darauf beschränkt zu haben, die unmittelbare Stimme, die er sich von seinen Erinnerungen und Hoffnungen erhalten hatte, zu reinigen, getreu nachzuzeichnen und manchmal sehr deutlich zu artikulieren. Er übernahm die Stimme, die uns zuallererst in unseren eigenen Gedanken unterweist und die sich schweigend von unserer gelenkten Erwartung entfernt.
Eine innere Rede, ohne Effekte und strategische Überlegungen, kann, auch wenn sie noch so eng zu uns gehört, die uns selbst am nächsten liegende und die gewisseste Eigentümlichkeit ist, nicht anders als universal sein.
Es war die Absicht Descartes’, uns ihn selbst vernehmen zu lassen, das heißt den für ihn notwendigen Monolog in uns wachzurufen und uns sein eigenes Gelübde ablegen zu lassen. Es ging darum, daß wir in uns finden sollen, was er in sich fand.
Eben dies ist die ursprüngliche Absicht. Jeder Gründer im Reich des Geistes muß sich darum kümmern, unwiderstehlich zu werden. Die einen hüllen uns mit ihrem Zauber ein; die anderen verkleinern uns durch ihre Strenge: Descartes teilt uns sein Leben mit, damit die Abfolge seiner Sinneseindrücke und Handlungen uns auf dem gleichen natürlichen Weg der Ereignisse und Träumereien in seine Gedanken einführe, den er selbst seit seiner Jugend eingeschlagen hatte und der vielen anderen Wegen gleicht, auch wenn er uns zu ganz anderen Gesichtspunkten führt.
Indem er uns vermittels seiner Anfänge zu seinesgleichen macht und unser Interesse an seiner Laufbahn weckt, verführt er uns mühelos zur Rebellion seiner Jünglingszeit, weil er uns von unserer eigenen erzählt, von unseren Widerständen und hochmütigen Urteilen. Nach Beendigung seiner Schulausbildung, die er geringschätzt und für beinahe überflüssig hält (in der Tat ist die Schulbildung praktisch überflüssig für einen, der sich dessen, was er nicht selbst erfunden hat, nicht zu bedienen weiß), fährt er kreuz und quer durch Europa, reinigt seinen Geist auf Reisen und in den Abläufen eines Krieges zur damaligen Zeit, in die er sich je nach Laune einzumischen scheint. Er hütet sich geflissentlich vor Büchern, die den Armeen nur lästig sind. Er übt sich in der Mathematik; in einer Kunst, die zu ihrer Ausübung bloß eine Schreibfeder erfordert, die sich überall entfalten kann, zu jeder Zeit und so lange, wie unser Kopf dafür die Ausdauer aufbringt.
Welch ein Luxus an Freiheit, welch eine elegante und sinnliche Art des Selbstseins, wenn der Mensch sich so in den Dingen aufgehen lassen kann, ohne aufzuhören, sich in seinen Ideen zu behaupten! ...
Das Zufällige, das Oberflächliche, mit seinen lebhaften Veränderungen, erregen und erhellen das Tiefste und das Beständigste bei einer Person, die wahrhaft für die höchsten geistigen Bestimmungen geschaffen ist. In der Unabhängigkeit der Seele genießt man die Lust an der Existenz, um in dieser klar zu sehen. Dem organisierten Bewußtsein kommt alles zustatten. Alles entrückt es, alles führt es auf sich selbst zurück; es versagt sich nichts. Je mehr es an Beziehungen in sich aufnimmt oder erleidet, desto stärker verbindet es sich mit sich selbst, und desto stärker löst und entbindet es sich. Ein völlig gebundener Geist wäre im Grenzfall ein unendlich freier Geist, da Freiheit letztlich nichts anderes als die Nutzung des Möglichen und das Wesentliche des Geistes der Wunsch ist, mit seinem Ganzen zur Übereinstimmung zu gelangen.
Descartes schließt sich mit dem Ganzen seiner Aufmerksamkeit ein; er nützt das Mögliche in sich selbst so weitgehend, daß er mitten im Bericht über sein Leben an seiner Existenz zu zweifeln beginnt! ... Derselbe Mensch, der die Welt durcheilte und sich als militärischer Laie am Krieg beteiligte, kehrt mit einem Mal in den Rahmen seiner Gegenwart und seines Körpers zurück und relativiert das gesamte System seiner Bezugspunkte und unserer normalen Gewißheiten; er macht sich zu einem anderen, wie der Schlafende, dessen abrupte, dem Traum entstammende Bewegung den Traum verändert und transzendiert und ihn erst in einen als solchen qualifizierten Traum verwandelt. Er stellt das Sein dem Menschen gegenüber.
Das Sein im Menschen zu empfinden, beides so deutlich voneinander zu trennen, durch eine Art von außergewöhnlichem Verfahren eine höherstufige Gewißheit zu finden – das sind aber die ersten Anzeichen einer Philosophie ...
Vielleicht sollte ich mit diesem Wort innehalten, genau an dem Punkt, bevor ich nicht mehr weiß, wovon ich spreche. Noch ist es Zeit, mich von jenen Schwierigkeiten fernzuhalten, die nicht zu den von mir selbst ausgesuchten gehören und deren am meisten gefürchteten die für mich unsichtbaren sind. Ich fühle mich in der Philosophie nicht wohl.7 Es gilt als selbstverständlich, daß man sie nicht umgehen könne und daß man nicht einmal den Mund aufmachen könne, ohne ihr Tribut zu zollen. Wie sollte man sich denn vor ihr hüten können, wenn sie selbst uns nicht mit Sicherheit sagen kann, was sie ist? Die oft geäußerte Behauptung, jeder philosophiere, ohne es zu wissen, ist eigentlich fast sinnlos, da nicht einmal derjenige, der sich bewußt mit der Philosophie befaßt, genau erklären kann, was er da macht.
Ich dagegen halte mich in der Philosophie auf wie ein Barbar in einem Athen, wo er zwar weiß, daß er von kostbaren Gegenständen umgeben ist und daß alles, was er sicht, beachtenswert ist; wo er aber unruhig wird, Langeweile verspürt, Unbehagen und eine mit abergläubischer Furcht vermischte, unbestimmte Ehrfurcht; gepackt von einer groben Lust, alles zu zerschlagen oder an diese vielen wunderbaren Geheimnisse, für die er in seinem Inneren kein Beispiel findet, Feuer zu legen. Wie soll man es ertragen, daß es deren so viele gibt, berühmte sogar, die einem nie in den Sinn gekommen wären? Ich vergleiche mich auch mit jenen Unglücklichen, die gesunde Ohren haben und alle Töne wahrnehmen können, denen sich aber alle Zusammenhänge und Mischungen der Töne, ihre Figuren, Schöpfungen, zarten Verknüpfungen und ihre Unendlichkeit, kurz, ihre Musik, entziehen. Die Musik der Philosophen ist für mich beinahe unhörbar.
Wenn ich es also trotzdem wage, über Descartes zu sprechen, dann zweifellos deshalb, weil ich ihn von jenen abgrenze ...
DESCARTES
Herr Präsident,
Herr Minister,
meine Damen und Herren –
die Académie française durfte es nicht versäumen, der Einladung Folge zu leisten, die das Organisationskomitee des IX. Internationalen Philosophiekongresses freundlicherweise an sie gerichtet hat, und meine erste Aufgabe ist es, mich beim Komitee in ihrem Namen zu bedanken. Die Akademie war es sich schuldig, hier in dem Augenblick anwesend zu sein, da es anläßlich des dreihundertsten Jahrestags der Veröffentlichung des Discours de la méthode1 Descartes zu feiern gilt.
Der große Einfluß, den Descartes auf unsere Geisteswissenschaften ausgeübt zu haben scheint; das Ereignis, zum ersten Mal ein philosophisches Werk in französischer Sprache hervorgebracht zu haben, dessen Urheber er ist; der weltweite Ruhm, den seine Werke unserer Nation eingebracht haben: das sind drei Anlässe, die die Akademie unmittelbar angehen und die für sie drei ebenso gewichtige wie kostbare Gründe sind, ihre Ehrung all den anderen hinzuzufügen, die das Andenken an diesen großen Mann heute auf sich vereinigt.
Was nun die Ehre betrifft, die mir die Akademie durch den Auftrag erweist, sie Ihnen gegenüber zu vertreten, so brauche ich Ihnen nicht zu sagen, daß ich sie allein der erzwungenen Abwesenheit des berühmtesten Philosophen unserer Zeit zu verdanken habe. Der Gesundheitszustand unseres Kollegen Henri Bergson läßt es nicht zu, daß er hier den Platz einnimmt, auf dem ihn jedermann zu sehen hoffte; ihn, der mit der ihm eigentümlichen bezaubernden Autorität, der natürlichen Tiefe und Schönheit des Ausdrucks zu Ihnen über Descartes gesprochen hätte.2 Doch in Gedanken ist er bei uns, und Sie werden sogleich den Brief hören können, den er freundlicherweise an uns gerichtet hat:
»Sehr geehrte ausländische Teilnehmer,
das Organisationskomitee hat in seiner Bescheidenheit mir den Auftrag erteilt, Sie willkommen zu heißen und Ihnen seine Anerkennung dafür auszusprechen, daß Sie zum Glanz und zur Bedeutung dieses Kongresses beitragen.
Daß man dem Kongreß die Überschrift »Descartes« gegeben hat, verleiht ihm eine ganz besondere Bedeutung. Sie wissen ja, bis zu welchem Punkt die klarsten und feinfühligsten Charaktere des französischen Geistes im Denken dieses bedeutenden Mannes geprägt wurden. Deshalb nimmt das festliche Gedenken seines Ruhms für uns die feierliche Bedeutung eines nationalen Aktes an, den die Anwesenheit des Staatsoberhaupts gleichsam bestimmt und auch unterstreicht.
Verehrte Anwesende, wir danken Ihnen, daß Sie sich unserer Ehrung anschließen und Descartes den Besuch erwidern, den er mehr als nur einer Nation gemacht hat. Es gab keinen besseren Europäer als unseren intellektuellen Helden, der so mühelos kam und ging. Er dachte dort, wo er bequem denken konnte: überall meditiert, erfindet, rechnet er ein wenig; in einem gut geheizten Zimmer in Deutschland, auf den Kais in Amsterdam, sogar im fernen Schweden, wo der Tod den Reisenden ereilt, dessen Geistesfreiheit das höchst kostbare Gut war, dem er durch diese ungehinderte Beweglichkeit unablässig nachstrebte.
Ich wünsche Ihnen, daß Sie sich in Frankreich von der Sympathie umgeben fühlen, die wir allen Denkenden gern erweisen, und daß Sie bei Ihrem philosophischen Aufenthalt ebenso begünstigt sein mögen, wie es Descartes an den verschiedenen Orten war, an die seine Laune ihn geführt hatte.«
Ich muß mich nun ein wenig über den Gegenstand auslassen, der uns zusammengeführt hat, und über Descartes und die Philosophie sprechen, so gut ich kann. Unermeßliche Themen sind zu streifen. Die Philosophen, aus Notwendigkeit unerbittlich, haben mich zu diesem Versuch zweifellos so aufgefordert, wie man ein Experiment am lebendigen Körper durchführt; vielleicht haben sie aber auch beschlossen, auf dem Altar der Vernunft ein unschuldiges und zur Sühne bereites Opfer darzubringen.
Sofort freilich, nachdem ich mich durch sie gebunden und verpflichtet fühlte und mir die ganze Schwierigkeit und auch die Gefahren einer Aufgabe vorstellte, zu der mich nichts bestimmte, betrachtete ich im Geiste das unüberwindbare Hindernis einer unerhörten Menge von Schriften. Was gibt es denn zu sagen, was nicht mit Sicherheit in ihnen schon zu finden ist? Ja, welchen Irrtum sollte man denn noch erfinden, der noch ein ganz frischer wäre, und welchen Interpretationsfehler, für den es noch kein Beispiel gäbe?
Descartes ... Zwar wird sein Denken seit dreihundert Jahren von so vielen erstrangigen Menschen nachvollzogen, von so vielen fleißigen Exegeten zerlegt und kommentiert, von so vielen Lehrern für so viele Schüler zusammengefaßt – wo aber bleibt Descartes? Ich wage gar nicht Ihnen zu sagen, daß es eine Unzahl von möglichen Descartes gibt; Sie wissen ja besser als ich, daß man mehr als nur einen zählt, alle gut belegt, mit dem Text in der Hand, und alle merkwürdig verschieden voneinander. Die Vielfalt der plausiblen Descartes ist eine Tatsache. Ob es sich nun um den Discours de la méthode handelt oder um die daran anschließenden metaphysischen Entwicklungen: die Verschiedenheit der Urteile und die Abweichung der Meinungen sind da und sie verblüffen. Und dabei gilt Descartes definitionsgemäß als ein klarer Autor.
Wie zu erwarten, sind die empfindlichsten und in gewisser Weise die innersten Stellen seiner Philosophie die umstrittensten und am unterschiedlichsten ausgelegten.
So entdecken zum Beispiel die einen bei Descartes bloß einen Behelfsgott, der ihm als Garant für seine spekulative Gewißheit und als erster Beweger dient. Pascal gab mit der übergroßen Klarsicht der schrankenlosen Antipathie dieser Meinung unverblümt Ausdruck.
Andere wiederum, die sich anders auskennen, legen uns einen aufrichtig, seinem Wesen nach religiösen Descartes nahe. Sie wollen uns sogar in den Fundamenten des Discours, unter dem Gebäude der rationalen Erkenntnis, die Ausgrabung einer Krypta zeigen, in der ein Schimmer aufleuchtet, der keinem natürlichen Licht entstammt.
Ob Mensch oder Text, welchen größeren Ruhm gibt es als den, Widersprüche auszulösen? Der endgültige Tod ist durch allgemeine Übereinstimmung gekennzeichnet. Die Anzahl der verschiedenen und unvereinbaren Gesichter, die man jemandem mit Grund zuschreiben kann, weist dagegen auf die Reichhaltigkeit seiner Komposition hin. Wie viele Napoleons wurden nicht produziert! Ich selbst bin nicht der Auffassung, daß man eine Existenz wirklich abgrenzen, in ihren Gedanken und Handlungen einschließen und auf das reduzieren kann, als was sie erscheint, und sie gewissermaßen in ihren Werken umzingeln. Wir sind viel mehr (und manchmal auch viel weniger) als das, was wir gemacht haben. Wir wissen selbst sehr wohl, daß unsere Identität und unsere Einzigkeit uns gleichsam äußerlich und beinahe fremd sind, daß sie viel eher in dem liegen, was wir indirekt erfahren, als in dem, was wir durch unser unmittelbares Bewußtsein erfahren. Einem Menschen, der sich noch nie vorher im Spiegel gesehen hat, würde beim ersten Anblick nichts deutlich machen, daß dieses unbekannte Gesicht, das er erblickt, auf die geheimnisvollste Weise der Welt mit dem zusammenhängt, was er auf seiner Seite empfindet und zu sich sagt.
Jeder von uns kann sich also seinen eigenen Descartes zurechtlegen, da ja gerade diejenigen, die sich mit ihm aus nächster Nähe befassen, sich um so weiter voneinander zu entfernen scheinen, je aufmerksamer sie ihren Gegenstand betrachten. Weil mir diese Feststellung sehr wichtig erscheint, wiederhole ich nochmals, daß diese Uneinigkeit sich im Hinblick auf den innersten Punkt von Descartes’ Denken am deutlichsten abzeichnet.
Ich gestehe Ihnen, meine Herren, daß mir diese Unterteilung zwischen Kennern und Autoritäten in Sachen Descartes gelegen kommt. Wenn sie sich untereinander nicht einig sind, atmet der Laie sogleich auf und fühlt sich eher befähigt, selbst hinzuhören und seinen eigenen Neigungen zu folgen.
Ich selbst habe in diesen Fragen nur eine recht freie Neugier, die sich mehr auf den Geist selbst als auf die Dinge richtet, die in diesem Geist sich darstellen, auswirken und determinieren. Meine natürlichste Aufmerksamkeit entzündet sich am vergeblichen Wunsch, die Arbeit des Denkens selbst wahrnehmen zu können. Für das Thema, das Problem und die Reichweite dieses Denkens interessiere ich mich nur widerwillig. Wer sich als Amateur für das eigentliche Leben des Geistes interessiert, den fesseln die Substitutionen und Transmutationen, die sich meiner Vorstellung nach darin abspielen; die Wechselfälle der Luzidität und des Willens, die Interventionen und Interferenzen, die sich darin vollziehen. Diese eigentümliche Sorge, beobachten zu wollen, was beobachtet, und vorzustellen, was vorstellt, ist nicht frei von einer gewissen Naivität: sie erinnert an die alten Holzschnitte, die man in der Dioptrique von Descartes findet und auf denen das Phänomen des Gesichtssinns mit einem Männchen erklärt wird, das, hinter einem riesigen Auge postiert, mit der Betrachtung des Bildes beschäftigt ist, das sich auf der Netzhaut abzeichnet.3
Dennoch ist die Versuchung unwiderstehlich und sie impliziert keine Philosophie, keine Voreingenommenheit und keine endgültige Schlußfolgerung, denn der Geist hat durch sich gar kein Mittel zur Verfügung, mit seiner wesentlichen Aktivität zu Ende zu kommen, und es gibt keinen Gedanken, der für ihn ein letzter Gedanke wäre. Die Mechanik lehrt uns, daß es unmöglich ist, einem festen Körper eine solche Form zu geben, daß dieser Körper dann, wenn er auf eine horizontale Ebene gestellt wird, nie seine Gleichgewichtsposition finden wird. Der Geist aber hat das Problem gelöst, wovon er uns in den Stunden der Unruhe und in den schlaflosen Nächten sehr mühselige, ermüdende Beweise geliefert hat. Der Liebhaber des Geistes macht dennoch nichts anderes, als diese Kombinationen und Fluktuationen des Verstandes zu genießen, an dem er so manche Wunder bestaunt: er sieht in ihm zum Beispiel, wie die wesenhafte Unordnung eine zeitweilige Ordnung erzeugt; wie im Ausgang von einer beliebigen Disposition eine Notwendigkeit entsteht oder sich aufbaut; wie ein Zwischenfall ein Gesetz hervorbringt; wie das Nebensächliche die Hauptsache zum Verschwinden bringt. Er sieht darin auch, wie der persönliche Hochmut imaginäre Hindernisse aufstellt, an denen er die in ihm enthaltenen inneren Kräfte der Aufmerksamkeit und der Analyse verausgaben und messen kann.
Schließlich gelangt er zur Behauptung, es gebe auf der ganzen Welt keinen poetischen Stoff, der reichhaltiger wäre als dieser; daß das Leben des Verstandes ein unvergleichliches lyrisches Universum darstellt, ein umfassendes Drama, in dem weder Abenteuer noch Leidenschaft fehlt und auch nicht der Schmerz (der in einer ganz besonderen Konzentration darin enthalten ist), und auch nicht das Komische oder überhaupt etwas Menschliches. Er beteuert, daß es einen ungeheuren Bereich der intellektuellen Sensibilität gibt, unterhalb der Erscheinungen, denen manchmal die gewöhnlichen Reize so sehr fehlen, daß die meisten sich davon abwenden, als handelte es sich um Reservate der Langeweile und um die Aussicht auf mühselige Anstrengungen. Diese Welt des Denkens, in der man das Denken des Denkens undeutlich gewahrt und die sich vom Kernmysterium des Bewußtseins bis hin zum leuchtenden Gebiet erstreckt, wo sich der Wahn der Klarheit entzündet, ist ebenso vielfältig, ebenso bewegend und durch ihre Theatercoups und die Eingriffe des Zufalls ebenso überraschend, von sich aus ebenso bewundernswert wie die Welt des Gefühlslebens, die allein von den Trieben beherrscht wird. Was kann es denn spezifischer Menschliches und stärker dem menschlichsten Menschen Vorbehaltenes geben als die Anstrengung des Verstandes, die von jeder Praxis losgelöst ist, und was wäre reiner und kühner als seine Entfaltung auf diesen abstrakten Wegen, die manchmal so seltsam in die Tiefen unserer Möglichkeiten abweichen?
Vielleicht wäre es nicht unnütz, diese vornehmen Exerzitien des Geistes zu feiern, in einer Zeit, da weder die Vergeblichkeit noch die Unruhe fehlen, weder die Oberflächlichkeit noch die Zusammenhangslosigkeit, getragen und stets genährt durch die mächtigen Kräfte, die Ihnen bekannt sind.
Meines Wissens hat sich die Literatur bisher jedoch wenig um diesen unermeßlichen Schatz von Gegenständen und Situationen gekümmert. Die Gründe für diese Vernachlässigung sind offenkundig. Dennoch muß ich einen davon, den Sic sehr gut kennen, hervorheben. Es ist die extreme Schwierigkeit, die uns die Sprache bietet, wenn wir sie zwingen wollen, die Phänomene des Geistes zu beschreiben. Was soll man mit Ausdrücken anfangen, die man nicht präzisieren kann, ohne sie neu zu erschaffen? Gedanke, sogar Geist, Vernunft, Verstand, Verstehen, Intuition oder Inspiration?4. . . Jede dieser Benennungen ist abwechselnd Mittel und Zweck, Problem und Lösungsfaktor, Zustand und Idee; und jede von ihnen ist, bei uns allen, je nach der Funktion, die ihr die Umstände zuordnen, zureichend oder unzureichend. Sie wissen, daß der Philosoph dann zum Dichter wird, oft sogar zu einem großen: er leiht sich von uns die Metapher, und mit großartigen Bildern, um die wir ihn nur beneiden können, versammelt er die ganze Natur zum Ausdruck seines tiefen Gedankens.
Der Dichter ist bei seinen Versuchen der reziproken Operation nicht so erfolgreich. Von Zeit zu Zeit allerdings kommt es vor, daß ich mir nach dem Modell der Comédie humaine, wenn nicht gar nach der Divina Commedia ausdenke, was ein großer Schriftsteller im Bereich des rein intellektuellen Lebens erreichen könnte, das diesen Werken ähnlich wäre. Der Drang zu verstehen und der Drang zu schaffen, der Drang, von anderen Erreichtes zu übertreffen und es den Berühmtesten gleichzutun; im Gegensatz dazu die Verleugnung, die man bei einigen findet, und der Verzicht auf den Ruhm. Und dann nicht zuletzt auch die einzelnen Augenblicke der mentalen Handlung: das Warten auf das Geschenk einer Form oder einer Idee; das einfache Wort, welches das Unmögliche in etwas Fertiges verwandelt; die Begierden und die Opfer, die Siege und die Katastrophen; schließlich die Überraschungen, die Unendlichkeit der Geduld und die Morgenröte einer »Wahrheit«; und so außerordentliche Momente wie zum Beispiel das abrupte Entstehen einer Art Einsamkeit, die sich mit einem Schlag sogar inmitten der Menge deutlich macht und über einen Menschen fällt wie ein Schleier, unter dem sich das Geheimnis einer unmittelbaren Einsicht vollziehen wird ... Was weiß ich? Alles dies legt uns sehr wohl eine Poesie mit unerschöpflichen Möglichkeiten nahe. In ihren vornehmsten Formen und den seltensten Erzeugungen scheint mir die schöpferische Sensibilität ebenso zu einer bestimmten Kunst fähig zu sein wie das ganze Pathos und die Dramatik des gewöhnlich gelebten Lebens.
Ihnen, meine Herren Philosophen, kann ich indessen nicht verheimlichen (den Philosophen könnte man ohnehin kaum etwas verheimlichen), daß diese Art, den Geist zu betrachten, in ganz natürlicher Weise dazu führt, die Philosophie selbst als eine Anwendung des Denkens auf das Denken anzusehen; und dieser Blick, der sich für die inneren Handlungen interessiert, sicht sich am Schauspiel der Verwandlungen dieses Denkens satt und hält die Schlußfolgerungen gern für einfache Vorkommnisse, für kurze Pausen oder Fermaten. Genau so muß sich aber dem Auge des Dichters das System der zwar deutlich abgegrenzten, aber mit allen notwendigen Illusionen versehenen geistigen Welt darstellen; es fehlen darin weder die Wortwolken, die aufzulösen sind, noch die Unendlichkeiten und Perspektiven, die ein Raum uns ausmalt, der möglicherweise ein gekrümmter Raun5 ist.
Der große Vorteil dieser Position liegt darin, daß sie bei der Behandlung der reinen intellektuellen Angelegenheiten die größte Allgemeinheit einführt; achten Sie besonders darauf, von welchem Interesse sie für die Philosophie sein kann, die sie zunächst etwas leichtfertiger zu behandeln scheint, als es notwendig ist.
Denken Sie doch einmal an das Schicksal all der Lehrmeinungen, die uns als widerlegt erscheinen, an das Schicksal der Hypothesen und Thesen, die durch den Erkenntnisfortschritt, den Zuwachs an Genauigkeit oder durch die zur Gewohnheit gewordene Präzision und die Entdeckung ganz neuer Tatsachen überflüssig gemacht wurden. Denken Sie an die vielen berühmten Schriften, in denen Fragen gestellt werden, die man nicht mehr stellen kann, oder die Fragen beantworten, die man nicht mehr hören kann. Muß man sie zu jener Art von Tod verurteilen, den eine Erwähnung im Geschichtsbuch und eine Eintragung ins Unterrichtsprogramm feststellen?
Mit Mumien diskutiert man nicht mehr. Ihre fremdgewordenen Namen lassen allenfalls in der Erinnerung der Schüler einige schlimme Augenblicke aufkommen. Damit sie wieder etwas zurückgewinnen, wenn auch nicht ihre gesamte Energie, sondern nur etwas von der Kraft, die sie entstehen ließ, genügt es indes, an den lebendigen Akt ihrer Schöpfer und an die Form dieses Aktes zu denken, an ihre einstige Lebensnotwendigkeit. Dann entdeckt man, daß die Widerlegung, die offenkundigen Fehler, der Verzicht auf Kommentare oder deren Überfluß, auch wenn sie die Philosophie erschöpfen, zerstören, aufreiben und unbrauchbar oder sogar für die nachfolgende Epoche unverständlich machen können, ihr dennoch die strukturelle Bedeutung und die Festigkeit als Kunstwerk belassen müssen.
Ich werde mir vielleicht in Kürze erlauben, Ihnen zu sagen, weshalb es mir notwendig erscheint, daß diese Überlegung einem philosophischen Auditorium vorgetragen – oder vielmehr vorgemurmelt – wird. Die Philosophie scheint mir – ich bitte Sie, meinen Vorschlag meiner Unwissenheit zuzuschreiben – ebenso wie alle anderen menschlichen Dinge dieser Zeit in einem kritischen Zustand ihrer Entwicklung angelangt zu sein, und zwar aufgrund desselben Effekts der außerordentlichen Fortschritte in den Naturwissenschaften.
Glauben Sie nicht, meine Herren, daß ich mich im Augenblick von Descartes weit entfernt habe. Ich spreche nämlich unablässig von ihm. Was diesen Zustand der menschlichen Angelegenheiten betrifft, so ist er einer seiner ersten und tatkräftigsten Urheber. In der riesigen KOMÖDIE DES GEISTES, für die ich mir einen Balzac, wenn nicht gar einen Dante wünschte, nähme Descartes einen Platz in der vordersten Reihe ein. Allerdings vollendet der Tod in einem Werk dieser Art das Abenteuer der Figuren keineswegs. Ihr Leben ist manchmal nichts anderes als ein Prolog zu ihrer unbegrenzten Laufbahn: es gleicht der Exposition der Tragödie ihres Denkens. Descartes ist einer von denen, deren postumes Schicksal ein höchst bewegtes ist. Er, dieser große Mensch der Neuzeit, hat kein Grabmal. Seine Gebeine liegen irgendwo: man weiß über sie nichts Sicheres. Sein mutmaßlicher Schädel befindet sich im Pariser Museum für Naturgeschichte, wo man ihn mir sogar überreichen und für einige Augenblicke in die Hand geben wollte.6 Er hat kein Standbild in Paris, sowenig wie Racine: ich beklage mich darüber nicht; allerdings weiß ich nicht, wie die Bildhauer dies ertragen können.
Was sein Werk betrifft, so ist dessen Abenteuer ein ganz anderes.
Bekanntlich hat der rein mathematische Teil dieses Werks nicht nur aus sich selbst heraus überlebt: er war so lebensvoll, so zukunftsträchtig, in einer so glanzvollen Weise unabdingbar – daß er weniger eine Erfindung als eine Entdeckung zu sein scheint und man kaum begreifen kann, weshalb die Wissenschaft oder vielmehr weshalb der menschliche Geist nicht schon lange vor Descartes ein Werkzeug zu schaffen vermochte, dessen Bedeutung fast mit der von so kostbaren Institutionen wie der der Zahl oder der Sprache gleichzusetzen ist. Offenbar mußte aber die Algebra erst so weit entwikkelt sein, daß man sich ein System der reziproken Entsprechung zwischen Zahl und Größe ausdenken konnte. Es gibt nichts, das interessanter wäre als Descartes’ Überlegungen zu diesem Thema und die Art, wie er die Psychologie seiner Hervorbringung darstellt, die er mit der einer von ihm selbst durchgeführten Beobachtung über die Grenzen unserer Aufmerksamkeit verknüpft. Fundamental bei Descartes ist außerdem die Absicht, die jeweils erforderliche Mühe zu mindern und den Zwang, für jedes Einzelproblem eine besondere Lösung zu finden, durch eine einheitliche Behandlungsweise (manchmal auch durch eine Art von Automatismus) zu ersetzen: sie ist das Wesen der Methode. Durch seine Geometrie erreicht sie den glücklichsten Erfolg, den ein Mensch jemals erreichte, dessen Genius sich daran wandte, das Bedürfnis nach dem Genius zu reduzieren und eine erstaunliche Denkökonomie zu verwirklichen. Eine Methode zu suchen heißt ein System ausdrückbarer Operationen zu suchen, das die Arbeit des Geistes besser als der Geist selbst leistet, und eben dies kommt dem nahe, was man durch Mechanismen erreichen könnte. Alle die erstaunlichen Maschinen, die es gestatten, mit großer Geschwindigkeit zu rechnen und zu integrieren, leiten sich direkt von der Cartesischen Erfindung und Absicht her. Descartes war äußerst verblüfft darüber, »daß ein Kind z.B., das Arithmetik gelernt und eine Addition nach den gelernten Regeln angestellt hat, sicher sein kann, über die betrachtete Summe alles herausgefunden zu haben, was vom Menschengeist überhaupt gefunden werden kann«7; und als er gezeigt hatte, daß man durch Anwendung der algebraischen Regeln auf die Projektionen eines Raumpunktes durch richtig durchgeführtes Aufschreiben alles herausfand, was man über die Figuren und ihre Eigenschaften wissen wollte, und darüber hinaus noch eine ganze Menge von Analogien und Relationen, die keine Intuition hätte herausfinden können, da bereicherte er jenes glückliche Kind, das zum jungen Mann geworden war, auf einen Schlag mit Kenntnissen, von denen selbst die größten Geometer früherer Zeiten nicht einmal etwas hätten ahnen können.
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß eine Anwandlung von recht bitterer Eifersucht angesichts dieser Art Schöpfung der Totalität des geometrisch Möglichen die Seele Pascals gequält hat. Die ganze tiefgründige Kunst, die er in sich spürte, um die besonderen Probleme der Geometrie zu lösen, war dadurch hinsichtlich der Resultate verkleinert worden.
Descartes selbst konnte sich die Weiterentwicklungen, die sein unerschöpflicher Kunstgriff erfahren sollte, nicht vorstellen. Auf diesen berühmten Achsen gibt es eine nicht abzählbare Menge von Entdeckungen, eine transfinite Menge von Ideen, die sich der eigenartigen Kraft des geometrischen Geistes darbot, der sich durch die immer ausgesuchtere Analyse seiner selbst endlos anreichert; der in der scheinbaren Evidenz seiner ersten Axiome, in der Struktur seiner einfachsten Operationen verborgene Schätze entdeckt und hinabsteigt bis zum Mechanismus jener »Gruppen«, die das einfachste und abstrakteste Element unserer Raumanschauung bilden.
Doch sollte keines der Wunder, die seinem Genius entsprangen, den Hochmut unseres Descartes’ in Erstaunen versetzen. Ich wäre nicht allzu überrascht, wenn er auch dann, als man ihm, nachdem er die Geometrie aufgegeben hatte, in der Mechanik und Physik seine Fehler vorzuwerfen begann, in der Sicherheit seines anspruchsvollen Denkens eine Antwort à la Corneille gefunden hätte.
»Natürlich mußte sich einer irren«, würde er uns sagen, »allerdings so, wie nur ich mich irren konnte. Keiner vor mir hatte an ein rein mathematisch darstellbares Universum gedacht, an ein Weltsystem, das ein Zahlensystem ist. Ich wollte nichts Dunkles darin haben, keine verborgenen Kräfte. Keine Wirkung in die Ferne; ich weiß nicht, was das ist. Es scheint aber, daß im letzten Stadium eurer Wissenschaften eine aufs höchste verfeinerte Geometrie, die Urenkelin meiner eigenen, euch endlich von der Anziehungskraft befreien wird. Das ist im Geist meines Werkes angelegt. Man hat sich über meine Wirbel und meine subtile Materie lustig gemacht, als ob man nicht anderthalb Jahrhunderte nach meinem Tod die Magnete und die Bewegung des Lichtes immer noch mit der Aktivität eines Mediums erklären würde, das mit kleinen rotierenden Kreiseln ausgestattet ist.«
Ich bitte um Entschuldigung dafür, daß ich den großen Schatten so freimütig sprechen lasse. Vielleicht würde er auf die berühmte Angelegenheit mit der Bewegungsgröße zurückkommen. Vielleicht zieht er es vor, darüber zu schweigen und uns die Mühe zu überlassen, eine Verteidigung dafür zu finden. Ist nicht gerade dies die Aufgabe einer pietätvollen Nachwelt?
Descartes kommt die ganz besondere Ehre zu, der erste Konstrukteur eines völlig metrischen Universums gewesen zu sein, und zwar vermittels Begriffen – oder sagen wir, vermittels Vorstellungsbildern –, die es ermöglichten, dieses Universum als einen riesigen Mechanismus zu behandeln. Pascal freilich schätzte diesen Plan nicht; sein eher logischer als intuitiver Geist lehnte ihn ebenso ab wie seine Empfindung. Er wettete schließlich, daß der Entwurf scheitern müsse; und es ist richtig, daß den Wirbeln und allem übrigen kein großes Schicksal widerfuhr. Im Gegensatz dazu ist aber der Gedanke einer Universalphysik unablässig gewachsen. Auch wenn der Welt von Descartes keine Dauer beschieden war – wie viele andere haben sich ihr hinzugesellt! Das Universum der Fernkräfte, der verschiedenen Arten des Äthers, das Universum von Fresnel, von Maxwell und von Lord Kelvin; das rein energetische Universum von vor fünfzig Jahren folgten aufeinander. Jedes dieser zerbrochenen Gefäße, die die Welt nicht zu fassen vermochten, hat indessen einige schöne Scherben zurückgelassen. Nicht nur bis hin zu dem berühmten Faulpelz Maupertuis, der durch eine von Voltaire nicht vorausgesehene glückliche Wendung für seine kleinste Kraftmenge eine gewisse Verwendung fand. Ich brauche nicht zu sagen, daß er über die neuartige Bedeutung, die man ihr nun gibt, nicht verblüfft wäre.8
Hier nun aber, was ich auf eigene Gefahr hin zugunsten unseres Descartes’ noch sagen möchte. Als Physiker des Universums, das er einer mathematischen Darstellung unterordnen will, ist er also gezwungen, ihm Bedingungen aufzuerlegen, die sich in Gleichungen ausdrücken lassen. Die mathematische Formel für sich allein zwingt ihn also dazu, irgendeine Größe zu finden, die auch während der Transformationen der Phänomene unverändert bleibt. Er glaubt sic im Produkt aus Masse und Geschwindigkeit erfaßt zu haben. Leibniz deckt den Fehler auf. Aber in die Wissenschaft hatte eine Idee von größter Bedeutung Eingang gefunden, die Idee der Erhaltung; eine Idee, die nun die verworrene Vorstellung der Ursache ersetzte, eine einfache Vorstellung, die recht klar erscheinen mochte. Diese Idee ist sicherlich schon in die reine Geometrie eingeflossen, wo man, um diese auf eine sichere Grundlage zu stellen, wohl annehmen muß, daß feste Körper sich bei ihren Ortsveränderungen selbst nicht verändern. Das wechselhafte Schicksal dieser Idee der Konstanz ist bekannt: man kann behaupten, daß seit Descartes nichts anderes getan wurde, als das Unveränderliche zu verändern: von der Erhaltung der Bewegungsgröße zur Erhaltung der lebendigen Kraft, dann zur Erhaltung der Masse und schließlich zur Erhaltung der Energie; man wird zugeben müssen, daß die Transformationen der Erhaltung ziemlich rasch aufeinander folgten. Nun hat aber seit etwa einem Jahrhundert die berühmte Entdeckung Carnots9 die Naturwissenschaft dazu gezwungen, die verhängnisvolle Bezeichnung Ungleichheit einzuführen –die eine Zeitlang die Welt zu einer unausweichlichen Ruine zu verdammen schien –, neben der Bezeichnung Gleichheit, die der rein mathematische Geist von Descartes schon erahnt hatte, ohne sie exakt bestimmen zu können. Ich weiß nicht recht, was heute Gegenstand der Erhaltung ist ... Ich glaube, man kann dieser Verteidigung von Descartes meine vielleicht etwas naive Bemerkung hinzufügen, daß er, um seine Erhaltungsformel aufschreiben zu können, die Konstituenten der Bewegung in der Form eines Produkts verbunden hatte; nun sollte aber die von ihm schlecht ausgefüllte Form die – irgendwie natürliche – Form aller Ausdrücke der Energie sein.
Was die Physiologie betrifft, meine Herren, der gegen sein Lebensende offensichtlich die intensivste Forschungsarbeit galt, so zeugt sie vom selben Willen zur Konstruktion, der sein gesamtes Werk beherrscht. Heutzutage ist es leicht, diesen Maschinismus, diese grobschlächtige und arglos ausgetüftelte Simplifizierung zu verspotten. Was konnte denn der Mensch damals versuchen? Für uns ist es unglaublich, für den menschlichen Geist fast schon eine Schande und dem beobachtenden Verstand des Menschen gegenüber beinahe ein Einwand, daß der für uns so offensichtliche und, wie es scheint, so leicht zu entdeckende Sachverhalt des Blutkreislaufs erst zur Zeit von Descartes erwiesen wurde. Natürlich mußte Descartes sich über dieses mechanische Phänomen wundern und darin ein kraftvolles Argument für seine Idee des Automaten finden. Selbst wenn wir inzwischen sehr viel mehr darüber wissen, so hat uns gerade dieser Wissenszuwachs bisher von einer befriedigenden Darstellung der Lebensphänomene ferngehalten. Wie alles übrige gerät auch die Biologie von einer Überraschung in die andere, da sie, wie alles übrige, von einem neuen Forschungswerkzeug zum anderen übergeht. Es kommt uns so vor, als ob wir nicht einmal den Gedanken fassen könnten, auch nur einen Augenblick lang auf diesem abschüssigen Hang der Entdeckungen anzuhalten, um uns an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Stunde eine wohlbegründete Vorstellung über das Lebewesen zu bilden. Niemand kann heute vor diesem Vorhaben innchalten und sich an die Arbeit machen. Zur Zeit von Descartes war dieses Vorhaben keineswegs absurd. Als Widersacher standen einem nur metaphysische Gründe entgegen, das heißt solche, mit denen man tabula rasa machen konnte; wir dagegen haben die Menge und die Unbekanntheit der experimentellen Möglichkeiten gegen uns. Deshalb müssen wir auch Probleme lösen, deren Ausgangsbedingungen und Formulierungen in jedem Augenblick auf unvorhersehbare Weise wechseln. Nehmen wir einmal an, der Plan sei gefaßt, sich über das Funktionieren des Lebendigen Rechenschaft zu geben, und nehmen wir ferner an, daß wir ebensowenig wie Descartes verborgene Kräfte und Entitäten annehmen (von denen man in der Medizin einen so ausgedehnten Gebrauch machte), dann sehen wir sofort, daß es für ihn wohl unumgänglich war, der damaligen Mechanik die gesamte Ausrüstung an Pumpen und Bälgen zu entleihen, um die Vorstellung von einem Organismus zu bilden, der zu den wichtigsten oder offenkundigsten Lebensfunktionen fähig war.
Steckt nun darin nicht eine Überlegung, die man auf unsere gesamte Ansicht von Descartes ausdehnen müßte: eine Verteidigung seines Ruhms und eine Methode, uns ein würdiges Bild von ihm zu machen? Wir müssen dahin gelangen, uns die Ansprüche und die Mittel seines Denkens in einer Weise und Folgerichtigkeit so vorzustellen, daß schließlich das Nachdenken über Descartes unweigerlich zu einem Nachdenken über uns selbst wird. Das wäre die größte Huldigung.
Ich frage mich also, was mich an ihm am meisten beeindruckt, denn eben dies kann und muß noch lebendig sein. Was mich in seinem Werk auf mich selbst und auf meine eigenen Probleme zurückwirft – das verbindet mein eigenes Leben mit diesem Werk. Ich räume ein, daß es nicht seine Metaphysik ist, die ich auf diese Weise wiederbeleben kann, und auch nicht seine Methode, zumindest so, wie er sie im Discours formulierte.
Was mich an ihm bezaubert und ihn mir lebendig macht, ist sein Selbstbewußtsein, das Bewußtsein seines ganzen Seins, das sich in seiner Aufmerksamkeit konzentriert; das eindringliche Bewußtsein von den Vorgängen in seinem Denken; ein so willentliches und präzises Bewußtsein, daß er aus seinem ich ein Werkzeug macht, dessen Unfehlbarkeit allein vom Grad des Bewußtseins abhängt, den es davon hat.
Man sieht sogleich, daß diese Absicht, die ich Ihnen ungeschützt darbiete, zu recht eigentümlichen Urteilen und einer Wertzuordnung von Descartes’ Arbeiten führt, die keineswegs üblich ist.
Tatsächlich würde ich bei ihm unterscheiden zwischen den Problemen, die in ihm selbst entstanden sind und deren Stachel und persönliche Notwendigkeit er an sich selbst spürte, und den Problemen, die er nicht selbst erfunden hatte und die gewissermaßen künstliche Bedürfnisse seines Geistes waren. Während er vielleicht dem Einfluß seiner Erziehung und seiner Umwelt nachgab, seiner Sorge, als ein Philosoph zu gelten, der so vielseitig und vollkommen ist, wie es sich eben gehört, und der es sich schuldig ist, auf alles zu antworten, hat sein Wille sich meines Erachtens darauf gerichtet, jenen zweitrangigen Herausforderungen Genüge zu tun, die seiner wahren Natur ziemlich äußerlich oder fremd zu sein scheinen.
Achten Sie nur einmal darauf, wie er bei jeder Frage triumphiert, auf die er mit dem Akt seines ich antworten kann. Sein ich ist Geometer. Ohne auf diesem Gedanken zu bestehen, würde ich, wenn auch mit Vorbehalten, behaupten, daß der Leitgedanke seiner Geometrie für seine gesamte Persönlichkeit kennzeichnend ist. Man könnte sagen, daß er dieses so stark empfundene ich in jeder Disziplin zum Ausgangspunkt für die Achsen seines Denkens genommen hat.
Wie man sieht, schätze ich den beträchtlichen Teil seines Werkes, der all jenen Gegenständen gewidmet ist, von deren Existenz oder Bedeutung er durch andere erfahren hat, gering ein.
Allerdings bin ich sicher, meine Herren, daß ich mich irre. Dafür spricht alles, und für mein eigenes Empfinden habe ich nichts als die Unmöglichkeit, in der ich mich befinde, ihm nicht zu folgen.
Ich kann nicht umhin, dem, was mir die Figur unseres Helden auferlegt, nur zuzustimmen. Wie ich mir vorstelle, fühlt er sich auf einigen Gebieten unbehaglich. Er stellt darüber langwierige Überlegungen an, kommt auf seine Schritte zurück, entledigt sich der Einwände, so gut er kann. Nach meinem Eindruck sieht er sich in solchen Fällen von seinem Gelübde abgerückt, als untreu sich selbst gegenüber, und er hält sich für verpflichtet, wider den Kern seines Geistes zu denken.
Was also lese ich im Discours de la méthode?
Es sind nicht die Grundsätze selbst, die uns lange aufhalten können. Was im Ausgang von der reizvollen Erzählung seines Lebens und der anfänglichen Umstände seines Forschens meinen Blick auf sich zieht, ist seine eigene Präsenz in diesem Vorspiel zu einer Philosophie. Wenn man so will, ist es der Gebrauch des ich, des Je und des Moi, in einem solchen Werk, und der Tonfall der menschlichen Stimme; vielleicht steht genau dies der scholastischen Architektur am deutlichsten entgegen. Wenn dieses Je und Moi uns in Denkweisen einer umfassenden Allgemeinheit einführen soll, dann liegt gerade darin mein Descartes.
Indem ich ein Wort von Stendhal übernehme, der es in unsere Sprache eingeführt hat, und für meine Zwecke in eine etwas andere Richtung lenke, behaupte ich, daß die eigentliche Methode von Descartes Egotismus10 heißen müßte; Entwicklung des Bewußtseins für die Ziele der Erkenntnis.
Damit entdecke ich ohne Schwierigkeit, daß das Wesentliche des Discours nichts anderes ist als die Schilderung der Bedingungen und Folgen eines Ereignisses, einer Art von Staatsstreich, der dieses ich von allen Schwierigkeiten und von allen parasitären Zwängen oder Vorstellungen befreit, die es belasten, ohne daß es sie angestrebt oder in sich selbst vorgefunden hätte. Der Zweifel an seiner eigenen Existenz erscheint ihm recht lächerlich. Dieser Zweifel ist ja ein damals zur Mode gewordener Seelenzustand. Man trug so etwas zwischen Hamlet und Montaigne. Sobald der Geist ihn aber klar aussprechen will, entdeckt er ohne jede Anstrengung, daß das Wörtchen sein keinerlei besonderen Vorzug besitzt; daß seine Funktion allein die des Verbindens ist und daß die Aussage »Ich bin nicht« dasselbe ist wie die Aussage »Ich bin«. Niemand sagt »Ich bin«, es sei denn in einer ganz bestimmten Einstellung, die sehr unbeständig und im allgemeinen erlernt ist, und selbst dann sagt man es nur mit einer ganzen Menge unausgesprochener Nebenbedeutungen: manchmal ist dazu auch ein langer Kommentar notwendig.
Es wäre Descartes, der an seinem Wert nicht zweifelte, nicht in den Sinn gekommen, an seiner Existenz zu zweifeln. Der Wert seines eigenen ich war ihm gründlich bekannt, und wenn er sagt, »Ich denke«, gibt er damit zu verstehen, daß es Descartes ist, der denkt, und nicht irgendwer.
Im Cogito steckt kein Syllogismus, ja nicht einmal eine wörtliche Bedeutung. Es steckt darin vielmehr ein Kraftstoß, eine Reflexhandlung des Verstandes, ein Lebendiger und Denkender, der ausruft: Mir reicht’s! Euer Zweifel hat in mir keine Wurzel. Ich werde mir einen anderen Zweifel bilden, der nicht unnütz sein wird, und ich werde ihn methodischen Zweifel nennen. Ihr werdet darunter leiden, daß ich ihn zunächst einmal auf euere Sätze anwende. Eure Probleme führen mich auf nichts; daß ich der einen Philosophie zufolge existiere, und einer anderen zufolge nicht existiere, ändert gar nichts, weder an den Dingen noch an mir, an meinen Vermögen und an meinen Leidenschaften ...
Das ist freilich noch nicht alles, was man in der Phantasie aus diesem berühmten Cogito folgern könnte, und es wäre bewundernswert, wenn Descartes in einem Traum darauf gestoßen wäre. Schließlich ist auch das nicht unwahrscheinlich! ...
Mir drängt sich ein Eindruck auf, der zum Gesagten paßt. Stendhal, auf den ich noch zurückkomme, erzählt uns an einer Stelle, ich weiß nicht mehr wo, daß Napoleon in kritisehen Augenblicken seiner Existenz sich sagte – oder gesagt haben soll –: »Alors comme alors!« Er gab sich damit selbst einen Ansporn.11
Das Cogito hat auf mich die Wirkung, als ob Descartes seine egoistischen Vermögen zum Appell aufrufen würde. Er wiederholt es und kommt an mehreren Stellen seines Werkes darauf zurück, als Thema seines ich, als Weckruf an den Stolz und den Mut des Geistes. Darin liegt – im magischen Wortsinn – der Zauber dieser Formulierung, die so häufig kommentiert wurde, wo es meines Erachtens doch ausreichen würde, sie einfach zu empfinden. Beim Klang dieser Worte lösen die Entitäten sich auf; der Wille zur Macht überfällt den Mann, richtet den Helden wieder auf, erinnert ihn an seine ganz persönliche Sendung, an sein eigenes Schicksal sowie an seine Verschiedenheit, an seine individuelle Ungerechtigkeit – denn schließlich ist es ja möglich, daß das zur Größe bestimmte Wesen sich taub, blind und empfindungslos gegenüber all dem machen muß, was seinen Impuls, sein Geschick, seine Wachstumsbahn, sein Licht, seine Linie im Universum durchkreuzen würde, selbst wenn es Wahrheiten oder Realitäten wären.
Und wenn das Ichgefühl schließlich dieses Bewußtsein und diese zentrale Herrschaft über unsere Kräfte übernimmt, wenn es mit Absicht zum Bezugssystem der Welt und zum Ausgangspunkt schöpferischer Reformen wird, die es der Zusammenhangslosigkeit, der Mannigfaltigkeit, der Komplexität der Welt ebenso entgegenstellt wie der Unzulänglichkeit der herkömmlichen Erklärungen, dann fühlt es sich selbst von einer unausdrückbaren Empfindung gespeist, vor der die Mittel der Sprache versagen, die Ähnlichkeiten nicht mehr gelten, der Erkenntniswille, der sich darauf richtet, darin aufgesogen wird und nicht mehr zu seinem Ursprung zurückkehrt, weil es kein Objekt mehr gibt, das ihn widerspiegelt. Es ist kein Denken mehr ...
Alles in allem, meine Herren, konnte der eigentliche Wunsch von Descartes nur der sein, auf den höchsten Punkt zu bringen, was er in sich selbst als das Stärkste und Verallgemeinerungsfähigste vorfand. Allen Dingen gegenüber will er seinen Vorrat an Begierde und intellektueller Kraft ausnutzen, und er kann nichts anderes wollen. Darin liegt das Prinzip, das stärker bleibt als die Texte selbst. Es ist der strategische Punkt, der Schlüssel der cartesianischen Position.
Dieser große Kapitän des Geistes findet auf seinem Weg zwei Arten von Hindernissen. Zum einen die natürlichen Probleme, die sich für jeden Menschen stellen, der auf diese Welt kommt: die Phänomene, das physische Universum, die Lebewesen. Daneben gibt es aber auch andere Probleme, die in bizarrer und gleichsam willkürlicher Weise mit den ersten verwickelt sind: Probleme, die er sich nicht selbst vorgestellt hatte und die ihm vom Schulunterricht, den Büchern, den herkömmlichen Überlieferungen her zufallen. Schließlich gibt es auch noch die Konventionen, die Hindernisse, wenn nicht gar die Gefahren praktischer und gesellschaftlicher Art.
Gegenüber allen diesen Problemen und Hindernissen nun das ich, und zur Unterstützung dieses ich bestimmte Fähigkeiten. Eine davon hat sich bewährt: man kann sich auf sie verlassen, auf ihre Verfahrensweisen, die unfehlbar sind, wenn man sie zu handhaben weiß; auf den von ihr ausgeübten unabweislichen Zwang, alles klarzustellen und zurückzuweisen, was sich nicht in distinkte Operationen auflösen läßt: die Mathematik.
Nun kann das Handeln beginnen. Ihm geht ein selbständiger Diskurs voraus und kündet es an. Und der Kampf zeichnet sich ab.
Worum geht es? Und was ist das Ziel?
Es geht darum, nachzuweisen oder zu beweisen, was ein ich vermag. Was wird dieses ich von Descartes machen?
Da es seine Grenzen nicht kennt, wird es alles machen oder alles neu machen wollen. Doch zunächst einmal reinen Tisch. Alles, was nicht von diesem ich kommt oder nicht aus ihm gekommen wäre, all das ist nichts als Gerede, Worte. Alles, was nur in Worten endet, die wiederum nur auf Meinungen, Zweifel, Kontroversen oder auf simple Wahrscheinlichkeiten hinauslaufen, hält vor diesem ich nicht stand und besitzt keine ihm vergleichbare Kraft. Und bald wird dieses ich ganz allein seinen Gott finden, wenn es nötig ist; es wird ihn sich geben, und es wird ein Gott sein, der ebenso klar und ebenso bewiesen ist, wie es ein Gott sein muß, um der Gott Descartes’ sein zu können. Ein »notwendiger und hinreichender« Gott; ein Gott, der Descartes ebenso zufriedenstellt wie der Gott, der Bourdaloue12 zufriedenstellte: »Ich weiß nicht, ob Du mit mir zufrieden bist«, sagte dieser berühmte Gläubige, »aber was mich betrifft, so muß ich, mein Gott, zu Deinem Ruhm bekennen, daß ich mit Dir zufrieden bin, und zwar restlos. Denn zu sagen, ich sei mit Dir zufrieden, heißt zu sagen, daß Du mein Gott bist, da es nur einen einzigen Gott geben kann, der mich zufriedenstellen kann.«
Andererseits entwickelt er bei den von mir als natürlich bezeichneten Problemen in dem Kampf um seine Klarheit jenes gesteigerte Bewußtsein, das er seine Methode nennt und das auf wunderbare Weise ein grenzenloses geometrisches Imperium erobert hat.
Er möchte es auf die verschiedenartigsten Phänomene ausdehnen; er wird die gesamte Natur durcharbeiten, wobei er, um sie als rational zu erweisen, eine erstaunliche Fruchtbarkeit der Einbildungskraft entfaltet. Sie gehört einem ich an, dessen Denken es nicht der Veränderung der Phänomene, der Verschiedenheit der Mittel und der Formen des Lebens unterordnen will ...
Welch ein Mensch! Vielleicht wäre es doch besser gewesen, die schwierige Aufgabe, ihn zu feiern, nicht einem Dichter zu überlassen? ...
Da es nun aber einmal so ist, werde ich diese erfinderische Analyse noch bis zu dem Punkt fortführen, wo ich mich frage, was ein Descartes wäre, der in unserer Zeit geboren würde. Nur als Spiel.
Welchen Tisch würde er heute vorfinden, um tabula rasa zu machen? Und wie würde er mit einer Naturwissenschaft zurechtkommen, deren umfassende Aneignung unmöglich geworden ist und die nunmehr so eng von einem unermeßlichen und ständig anwachsenden Material abhängig ist; eine Wissenschaft, die sich in jedem Augenblick in einem labilen Gleichgewicht mit ihren eigenen Mitteln befindet.
Darauf gibt es keine Antwort. Mir scheinen diese Fragen jedoch einen Wert zu haben.
Das Individuum wird zu einem Problem unserer Zeit; die Hierarchie der Geister wird zu einer Schwierigkeit unserer Zeit, in der es eine Art Halbgötterdämmerung gibt, das heißt jener in der Zeit und auf der Erde verstreuten Menschen, denen wir das Wesentliche dessen verdanken, was wir Kultur, Erkenntnis und Zivilisation nennen.
Deshalb habe ich das Gewicht auf die starke und kühne Persönlichkeit des großen Descartes gelegt, dessen Philosophie für uns vielleicht weniger wertvoll ist als die uns vorgestellte Idee eines großartigen und denkwürdigen ich.
EINE ANSICHT VON DESCARTES
René Descartes wurde am letzten Märztag des Jahres 1596 in La Haye in der Touraine geboren. Sein Elternhaus gehörte dem ältesten Adel an. Man hatte sich dort dem Waffendienst verschrieben, bis zu seinem Vater, Joachim Descartes, der das Amt eines Ratsherren am Gerichtshof der Bretagne übernahm. Seine Mutter starb wenige Tage nach der Geburt; vermutlich erlag sie einem Tuberkuloscleiden. Von ihr erbte er »einen trockenen Husten und eine blasse Hautfarbe, die er bis zum Alter von über zwanzig behielt«. Die Ärzte fällten das Urteil, daß er jung sterben werde.*
Wegen seiner Anfälligkeit blieb er lange Zeit zu Hause, in der Obhut der Frauen. Der Vater wachte jedoch auch über die Entwicklung seines Geistes und bemerkte sehr früh, wohin dieser sich entwickeln könnte. Er nannte das Kind, das ihn unablässig ausfragte, seinen Philosophen. Als dieser Philosoph zehn Jahre alt war, gab ihn der vortreffliche und hellsichtige Joachim Descartes, der ihm die bestmögliche Ausbildung verschaffen wollte, in das Collège von La Fleche, das eben erst von Henri IV. gegründet und den Jesuiten übergeben worden war, denen der König die Aufgabe anvertraute, die adlige Jugend Frankreichs heranzubilden. Während seiner gesamten Ausbildungszeit in den klassisch-philologischen Fächern war Descartes ein Musterschüler. Als er aber von diesen zum Studium der Logik, Physik und Metaphysik wechselte, war er über die Ungewißheit und Dunkelheit der Doktrinen nicht weniger schockiert als über die erstaunliche Vielfalt der Meinungen: er stellte fest, daß es nichts noch so Seltsames und Unglaubwürdiges gab, das nicht von irgendeinem Philosophen gelehrt wurde. Dieser intellektuelle Schock ist eines der wichtigsten Ereignisse in seinem geistigen Leben. Er erlebt es im Alter von sechzehn Jahren, einem kritischen Alter, in dem sich sehr oft das Schicksal der Freiheit und des Charakters des Denkens entscheidet. Man kann seine gesamte Laufbahn als Entfaltung dieser Selbsterfassung betrachten, die sich unter der Einwirkung eines zweiten inneren Erlebnisses sieben Jahre später – von dem ich in Kürze sprechen werde – in eine kraftvolle schöpferische Reaktion verwandeln sollte.
Zur gleichen Zeit, als er sich der Philosophie gegenüber in die Defensive begab, widmete er sich mit größtem Eifer und größtem Vergnügen dem Studium der Mathematik: er wunderte sich jedoch darüber, daß sie zwar solide und beständig war, daß man aber nichts Bedeutenderes auf ihr aufgebaut hatte als ihre Anwendung auf verschiedene Techniken, die von ihr Gebrauch machten. So bietet ihm das Gefüge des fertig vorgefundenen Wissens, das ihm von den Lehrern vermittelt wird, den Gegensatz zwischen der Bedeutung, die allgemein einer Philosophie zugeschrieben wird, deren Autorität weder die Schwäche der Prämissen noch die Verwegenheit der Deduktionen kompensiert, und einer auf unmittelbarer Einsicht und strenger Folgerichtigkeit beruhenden Wissenschaft, die indes in Anwendungsbereiche abgeschoben wird, wie sie die Anforderungen der Praxis ihr verschaffen.
Descartes selbst zieht nun im Hinblick auf eine allgemeine Einschätzung der intellektuellen Werte, die seine Zeit zu bieten hat, die Bilanz der Bedürfnisse, der Wünsche und eigenen Ressourcen seines Geistes. Er muß folgenden Schluß ziehen: »Man hat mich von Kindheit an glauben lassen, daß ich in meinen Studien alles Wissenswerte finden würde und daß dieses Wissen klar und gewiß sein würde. Ich habe mich mit Eifer daran gesetzt. Ich war Schüler der besten Lehrer Europas, im berühmtesten Collège. Ich habe alles gelernt, was dort unterrichtet wurde, außerdem habe ich alle wissenschaftlichen Bücher gelesen, die ich bekommen konnte. Ich habe schließlich abgeschlossen, um nicht minderwertiger zu sein als einer meiner Mitschüler. Aber abgesehen von der Mathematik stelle ich fest, daß alles übrige bloß Unterhaltung ist oder absolut nichts.«
Was tun? Er verläßt das Collège und seine literarisch-philologischen Bücher, in denen er nur Geschwätz und Enttäuschung fand, ohne Bedauern. Er widmet sich der Reitkunst, vor allem aber der Fechtkunst, für die er sich so ernsthaft interessiert, daß er darüber sogar eine kleine Abhandlung schreibt. Sein Vater, der ihn zur militärischen Laufbahn bestimmt, zunächst aber Wert darauf legt, daß er die »große Welt« kennenlernt, schickt ihn nach Paris. Er kommt dort als Sohn aus gutem Hause mit eigenem Kammerdiener und Bediensteten an, besucht weniger die vornehme Welt als die des Vergnügens und gewinnt oder verliert einige Monate mit diversem Zeitvertreib, Ausflügen und vor allem beim Spiel.
Die Allerweltsvergnügen verloren für ihn jedoch bald ihren Anreiz. Er setzt sich so gut er kann von seinen Gefährten des leichtfertigen Lebens ab, um sich neue Freunde und einen ganz anderen Zeitvertreib zu verschaffen. Vor allem verbündet er sich mit Monsieur Mydorge, der damals als der erste Mathematiker Frankreichs galt und bei dem er jenes »gewisse Etwas fand, das ihm höchst zustatten kam, sei es wegen des Humors, sei es wegen der Geistesart«; er nahm wieder Kontakt auf mit einem Mann, den er sehr jung im College kennengelernt hatte und der in seinem Leben einen der wichtigsten Plätze einnehmen sollte: Marin Mersenne. Nach dem Weggang von La Flèche war Mersenne in den Orden der Minimen eingetreten. Er war für Descartes der beständigste und der nützlichste Freund, beinahe der offizielle Repräsentant seines Denkens, und er nahm bei ihm die unendlich wertvolle Rolle des Vertrauten, des Verteidigers, des Informanten und des Briefpartners ein. In der Umgebung großer Menschen trifft man häufig auf diese Art Persönlichkeit. Pater Mersenne muß jedoch fraglos in die erste Reihe solcher Gefolgsleute des Genies eingeordnet werden.
Descartes ist einundzwanzig. Für ihn ist die Zeit gekommen, die militärische Laufbahn einzuschlagen. Er hat zunächst die Absicht, sich den königlichen Truppen anzu