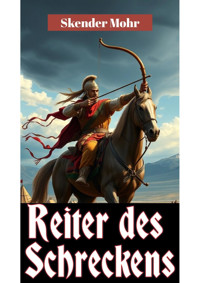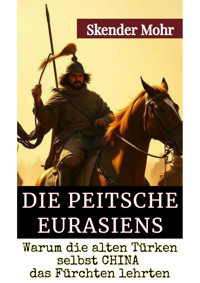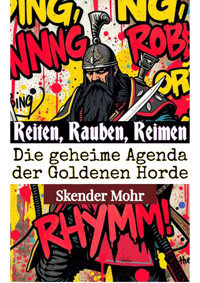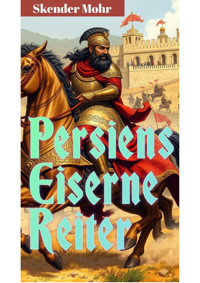
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Sassanidischen Kriegsführung mit "Persiens Eiserne Reiter: Die Militärmacht des Sassanidenreiches"! Dieses packende E-Book enthüllt die Geheimnisse einer der mächtigsten Militärmächte der Spätantike und zeigt überraschende Parallelen zur heutigen geopolitischen Lage. Entdecken Sie die Ursprünge einer der einflussreichsten Militärmächte der Geschichte, deren Erbe bis in unsere Zeit nachwirkt. Von den gepanzerten Kataphrakten bis zu den ausgeklügelten Belagerungstaktiken - erleben Sie die Entwicklung der persischen Armee und ihre epischen Schlachten gegen Rom. Das Buch beleuchtet detailliert: - Die Struktur und Organisation der sassanidischen Armee - Das beeindruckende Waffenarsenal und die fortschrittliche Ausrüstung - Innovative Taktiken und Strategien, die das Schlachtfeld revolutionierten - Die faszinierende Geschichte der römisch-persischen Kriege Erfahren Sie, wie das Sassanidenreich als Bindeglied zwischen Ost und West fungierte und einen nachhaltigen Einfluss auf die spätantike Welt ausübte. Die Autoren ziehen geschickt Parallelen zur heutigen Zeit, in der der Nahe Osten erneut im Zentrum geopolitischer Spannungen steht. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Intrigen, epischer Schlachten und bahnbrechender militärischer Innovationen. Entdecken Sie, wie die Militärmacht der Sassaniden nicht nur das Römische Reich, sondern auch die Entwicklung des europäischen Rittertums und des byzantinischen Militärsystems beeinflusste. Dieses E-Book ist ein Muss für: - Militärhistoriker und Strategieexperten - Enthusiasten der antiken Kriegskunst - Studierende der Geschichte und Politikwissenschaften - Alle, die die Wurzeln aktueller geopolitischer Konflikte verstehen wollen Mit detaillierten Karten, Illustrationen und einer umfassenden Analyse bietet "Persiens Eiserne Reiter" einen unvergleichlichen Einblick in eine der faszinierendsten Epochen der Militärgeschichte. Die Autoren zeigen auf, wie die Lehren aus den Sassanidisch-römischen Konflikten auch heute noch relevant sind für das Verständnis moderner militärischer und politischer Strategien. Erleben Sie, wie die Vergangenheit die Gegenwart erhellt und gewinnen Sie neue Perspektiven auf aktuelle globale Herausforderungen. "Persiens Eiserne Reiter" ist nicht nur ein Geschichtsbuch, sondern eine Reise durch die Zeit, die Ihnen die Augen öffnen wird für die zeitlosen Prinzipien von Macht, Strategie und Konflikt. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Sicht auf die antike und moderne Welt zu revolutionieren. Laden Sie jetzt "Persiens Eiserne Reiter: Die Militärmacht des Sassanidenreiches" herunter und entdecken Sie die faszinierende Welt der Sassanidischen Kriegskunst!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Persiens Eiserne Reiter: Die Militärmacht des Sassanidenreiches.
Eine umfassende Analyse der Kriegskunst, Taktik und Konflikte im spätantiken Iran
Autor: Skender Mohr
2025
Inhaltsverzeichnis
EINFÜHRUNG
TEIL 1. PERSISCHE KRIEGSFÜHRUNG IN DER SASSANIDENZEIT
Kapitel 1. ZUSAMMENSETZUNG UND ORGANISATION DER SASSANIDISCHEN ARMEE
#1. Struktur der persischen Armee
#2. Organisation der sassanidischen Armee
Kapitel 2.WAFFEN UND RÜSTUNG DER SASSANIDISCHEN ARMEE
#1. Waffen
#2. Panzerrüstung
Kapitel 3.TAKTIK DER PERSISCHEN ARMEE
#1. Taktik der Feldschlacht
#2. Taktik der Belagerungskriegsführung
Kapitel 4.PERSISCHE MILITÄRSTRATEGIE
TEIL 2. GESCHICHTE DER MILITÄRISCHEN UND DIPLOMATISCHEN KONFRONTATION ZWISCHEN DEM OSTRÖMISCHEN REICH UND DEM SASSANIDISCHEN IRAN
Kapitel 5.DAS SASSANIDISCHE IRAN UND DAS RÖMISCHE REICH IN DER MITTE DES DRITTEN BIS ZUM ENDE DES VIERTEN JAHRHUNDERTS
#1. Der Beginn der Konfrontation: Von der iranischen Dominanz zur römischen Hegemonie (235-298)
#2. Wechsel des Anführers (298-387)
Kapitel 6.DAS SASSANIDENREICH UND DAS OSTRÖMISCHE REICH IM SPÄTEN IV. BIS ZUM SPÄTEN VI. JAHRHUNDERT
#1. Verbündete Feinde (387-540)
#2. Khosrow der Große: der Angriff auf die Lunte (540-579)
Kapitel 7.DER SASSANIDISCHE IRAN UND DAS BYZANTINISCHE REICH VOM SPÄTEN VI. BIS ERSTEN DRITTEL DES VII. JAHRHUNDERTS
#1. Instabiles Gleichgewicht (579-591)
#2. "Nach Ionien und Karien" und zurück (591-628)
SCHLUSSBETRACHTUNG
ANHÄNGE
#1. Römische und byzantinische Kaiser (Ende des II. - erste Hälfte des VII. Jh.)
Römische Kaiser (spätes II. bis spätes IV. Jahrhundert)
Kaiser des Oströmischen (Byzantinischen) Reiches (Ende IV. - Mitte VII. Jahrhundert)
#2. Antike Längen-, Masse- und Geldeinheiten, die im Text erwähnt werden
EINFÜHRUNG
Ich widme dieses Buch meinem Sohn Tim
Der sassanidische Iran war eine der führenden Mächte Eurasiens in einer kritischen Periode der Weltgeschichte - der Epoche des Übergangs von der Antike zum Mittelalter. Die historische Rolle des sassanidischen Staates bestand nicht nur (und langfristig nicht so sehr) in seinem Kampf um die militärische und politische Vorherrschaft im Nahen Osten und Westasien, sondern auch in dem Einfluss, den die persische Macht auf ihre Nachbarn, einschließlich der spätantiken Welt, ausübte. Das Sassanidenreich wurde zu einer Art Bindeglied, durch das der Westen und der Osten in ausnahmslos allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens miteinander interagierten. Darüber hinaus war das Persien der Sassanidenzeit, bildlich gesprochen, ein Prisma, durch das die spätantike Welt die gesamte östliche Zivilisation wahrnahm. Es ist kein Zufall, dass der letzte große römische Historiker Ammianus Marcellinus (4. Jh. n. Chr.) das gesamte Gebiet östlich des Euphrat als "Persien" bezeichnete - so fest war in den Köpfen der Römer der letzten Jahrhunderte des Römischen Reiches die gesamte östliche Welt mit dem sassanidischen Iran verbunden.
Einer der wichtigsten Kanäle für den Einfluss Persiens auf die spätantike Welt war der militärische Bereich. Unter dem Einfluss des sassanidischen Militärs kam es zu gravierenden strukturellen Veränderungen im römisch-byzantinischen Heer, die auch in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens tiefgreifende Veränderungen mit sich brachten. Es handelt sich vor allem um das Auftreten von schwer bewaffneten Reiterkommandos im Spätreich, die zur wirksamen Bekämpfung persischer Invasionen in den östlichen Provinzen geschaffen wurden und nach persischem Vorbild organisiert und bewaffnet waren. Diese äußerlich rein militärische Anleihe führte zu bedeutenden systemischen Veränderungen in den sozialen, wirtschaftlichen und anderen Strukturen des späten Roms und Byzanz: Es entstand eine besondere militärische Klasse, deren Vertreter in den Reihen der schweren Kavallerie dienten. Im westlichen Teil der römischen Welt wurde diese soziale Schicht zum Vorbild für die Herausbildung des Rittertums, das den Kern des gesamten Feudalsystems der westeuropäischen mittelalterlichen Gesellschaft bildete. Ähnliche Prozesse fanden in Byzanz statt, wo sie unter Kaiser Heraklius (610-641) in der Entstehung der Femeorganisation gipfelten. Von diesem Zeitpunkt an erhielt jeder byzantinische Krieger eine eigene Landzuteilung, war von Steuern und staatlichen Abgaben befreit und zahlte für seine eigene Rüstung (die Feme-Reform des Heraklius war übrigens eindeutig von ähnlichen Maßnahmen inspiriert, die ein Jahrhundert zuvor vom sassanidischen Schahanshah Khosrow Anushirvan (531-579) ergriffen worden waren). Natürlich waren die Besitztümer der Reiter die größten, und sie wurden in den folgenden Jahrhunderten zu einem der wichtigsten Elemente des byzantinischen Feudalbesitzes.
Natürlich nahm der sassanidische Iran selbst viele Anleihen bei Rom, auch im militärischen Bereich (man denke nur an den aktiven Einsatz von Belagerungsgerät durch die Perser, der für die iranischen Armeen der vorangegangenen Periode nicht so typisch war), aber der östliche "Wind des Wandels" war in seinen Folgen eindeutig stärker.
Im ersten Teil dieses Werkes werden verschiedene Aspekte (Heereszusammensetzung und -organisation, Bewaffnung und Ausrüstung, Taktik und Kampfstrategie) der iranischen Militärangelegenheiten der Sassanidischen Ära (erste Hälfte des 3. bis Mitte des 5. Jahrhunderts) untersucht, die sich vor allem auf dem westlichen Schauplatz der militärischen Operationen manifestierten, wo es einen fast ununterbrochenen Kampf zwischen dem römischen (später byzantinischen) Reich und der Sassanidischen Macht um die Hegemonie in der vorderasiatischen Region gab, dessen wichtigste Ereignisse im zweiten Teil des Buches erörtert werden. Die Themen im Zusammenhang mit den persischen Militäroperationen in Zentralasien wurden nicht speziell behandelt, da dies eine weitgehend andere Quellenbasis, andere Ansätze für die Analyse bestimmter Aspekte der Entwicklung des persischen Militärwesens und ganz allgemein die Untersuchung des sehr spezifischen historischen Hintergrunds voraussetzt, vor dem sich die Besonderheiten der Sassanidischen Militärkunst an den östlichen und nordöstlichen Grenzen Persiens manifestierten. Um jedoch ein vollständigeres Bild zu erhalten, wird in diesem Buch in vielen Fällen auch das Material der "Ostfront" unter Einbeziehung der einschlägigen Quellen behandelt.
* * *
TEIL 1. PERSISCHE KRIEGSFÜHRUNG IN DER SASSANIDENZEIT
Die Armee und die militärischen Angelegenheiten im Sassanidischen Iran lassen sich wie folgt charakterisieren:
- Die Zusammensetzung und Organisation des persischen Heeres;
- das Waffenarsenal und die Ausrüstung der persischen Armee;
- Die Taktik der persischen Armee auf dem Schlachtfeld;
- Persische Militärstrategie.
Die Zusammensetzung und Bewaffnung der persischen Streitkräfte wurde nicht zufällig an die erste Stelle gesetzt. Diese beiden Komponenten der persischen Streitkräfte bestimmten weitgehend ihre Kampfeigenschaften und dementsprechend die Ziele und Aufgaben, denen sie sich gegenübersahen, sowie die Mittel und Wege zu deren Lösung, d.h. die eigentliche Taktik und Strategie der persischen Armee.
Kapitel 1. ZUSAMMENSETZUNG UND ORGANISATION DER SASSANIDISCHEN ARMEE
#1. Struktur der persischen Armee
Im Gegensatz zum römischen Heer ist das sassanidische Heer in Bezug auf seine Struktur, Organisation und sein Verwaltungssystem weit weniger gründlich und umfassend erforscht worden. Der Hauptgrund für diesen Zustand ist das Fehlen von ausreichend umfangreichem und detailliertem Quellenmaterial, das für die Erforschung der Geschichte des Militärwesens im Sassanidischen Iran so wichtige Fragen beleuchten könnte. In diesem Zusammenhang ist es nicht möglich, die Organisationsstruktur des Sassanidischen Heeres ausführlich und detailliert zu beschreiben, seine Zusammensetzung klar zu definieren und viele andere Fragen zu beantworten. Dennoch lässt sich auf der Grundlage der relativ wenigen und fragmentarischen Quellen, die den Forschern zur Verfügung stehen, ein allgemeines Bild dieser Aspekte der Entwicklung des Militärwesens im Sassanidischen Iran bis zu einem gewissen Grad rekonstruieren.
Die Struktur der persischen Armee sollte anhand von zwei Hauptkriterien betrachtet werden: 1) die Zweige der Armee; 2) die ethnische Zugehörigkeit des Personals. Darüber hinaus geben die Quellen, wie im Folgenden gezeigt wird, Aufschluss über die soziale Zusammensetzung des sassanidischen Heeres und deren Einfluss auf die Aufgabenverteilung zwischen den einzelnen Teilen des sassanidischen Heeres und seiner Struktur insgesamt.
A. Die wichtigsten Zweige der Streitkräfte
Der wichtigste Zweig der persischen Armee, das Rückgrat ihrer Armee, war die Kavallerie. In den Quellen erscheint die Kavallerie sehr oft als die wichtigste Komponente der persischen Streitkräfte, ohne die die Armee nahezu wirkungslos ist (Herodian. VI. 5. 3; SHA. XVIII. 55. 2-5; Proc. Bell. Pers. i. 13. 25-28; 15. 9-16; 17. 1; 18. 45; Theophyl. II. 1. 6; III. 14. 2; Theophan. A. M. 6078).
Die persische Kavallerie war nicht homogen. Der leistungsfähigste Teil war die schwere Kavallerie, in den Quellen Kataphrakten (lateinisch catafracti, griechisch κατάφρακτοι) genannt. Die Kataphrakten waren die Hauptschlagkraft der persischen Kavallerie und der Armee im Allgemeinen, und als solche werden sie in den Quellentexten stets hervorgehoben (Amm. Marc. XVIII. 8. 7; XIX. 7. 4; XX. 7. 2; XXIV. 6. 8; XXV. 1. 12; 3. 4; XXIX. 1. 1; Eunap. Fr. 27. 8; Heliod. IX. 14. 3; 16. 3; 17. 2; 18. 2; 20. 1; Liban. Or. XVIII. 265). Die häufigste Erwähnung der persischen Kataphrakten stammt von Ammianus Marcellinus, einem Augenzeugen und Teilnehmer an den römisch-persischen Kriegen in der Mitte des 4. Jahrhunderts, einem Berufskrieger; seine Meinung zu militärischen Fragen kann als sachkundig angesehen werden; dies zeigt deutlich die Bedeutung der Rolle, die die persische schwere Kavallerie auf den Schlachtfeldern spielte. Manchmal verwendet Ammianus Ausdrücke wie "eisenbeschlagene Kavallerie" (ferreus equitatus) (Amm. Marc. XIX. 1. 2), "glänzende [gepanzerte] Kavallerieeinheiten" (corusci globi turmarum) (Amm. Marc. XIX. 2. 2), um die Kataphrakten zu beschreiben.
Zur gleichen Zeit werden in der Biographie des Kaisers Alexander Severus, deren Autorschaft Elius Lampridius zugeschrieben wird (SHA. XVIII. 55. 2), die schwer bewaffneten persischen Reiter als clibanarii bezeichnet. Hier heißt es, dass die Römer, angeführt von Severus, zehntausend persische Heere von cataphractarii besiegten, "die sie [Perser - S. M.] clibanarii nennen" (catafractarios quos illi (d. h. Persae. - S. M.) clibanarios vocant). Lampridius' Erwähnung der Perser-clibanarii löste unter den Spezialisten der Militärgeschichte eine Diskussion aus, die bis heute andauert und deren Kern darin besteht, die Tatsache zu rechtfertigen oder zu widerlegen, dass die Perser einen solchen Typus von Kavallerie wie die clibanarii hatten. Die Argumente beider Seiten in diesem Streit sowie der Inhalt und die Beziehung der Begriffe "Kataphrakt", "Kataphraktarius" und "Klibanarius" werden in einer Reihe von Werken von V. P. Nikonorov (der übrigens der Meinung ist, dass die Perser keine Klibanarii hatten) ausführlich genug behandelt, so dass wir den an Details interessierten Leser auf die Werke dieses Autors verweisen. Generell ist anzumerken, dass wir als Spezialist auf dem Gebiet des Militärs und direkter Teilnehmer an den römisch-persischen Kriegen der Terminologie des Ammianus Marcellinus den Vorzug geben sollten, der bekanntlich die persische berittene Kavallerie nicht ein einziges Mal als klibanarii bezeichnet, sondern für sie die Bezeichnung "Kataphrakten" verwendet. Die erwähnte Passage aus den "Schreibern der Geschichte des Augustus" ist eine zu wackelige Grundlage, um eine Theorie über das Vorhandensein der persischen klibanarii aufzustellen, denn dieses Monument der spätrömischen Literatur zeichnet sich durch extreme Unzuverlässigkeit, Kompilierungscharakter und eine Fülle von verzerrten oder schlichtweg fiktiven Details aus. Der Hinweis des Aelius Lampridius, dass die Römer von den Persern erbeutete Waffen und Ausrüstungsgegenstände schwer bewaffneter Reiter zur Ausrüstung ihrer eigenen Kavallerieeinheiten verwendeten ("mit ihren Waffen bewaffneten wir unsere eigenen" (SHA. XVIII. 55. 5)), kann jedoch als Spiegelbild einer realen Praxis angesehen werden. Höchstwahrscheinlich war dies einer der Wege, um römische Einheiten schwerer Kavallerie für den Kampf gegen die persischen Kataphrakten zu schaffen.
Aus den Worten von Ammianus Marcellinus können wir schließen, dass die schwere Sassanidische Kavallerie aus Vertretern des persischen Adels bestand. Der Historiker berichtet, dass in der Kavallerie "all ihr Adel und ihre Edelleute dienen" (desudat nobilitas omnis et splendor) (Amm. Marc. XXIII. 6. 83). Obwohl Ammianus nicht angibt, von welcher Kavallerie - leicht oder schwer - er spricht, ist es kaum möglich anzunehmen, dass der persische Adel in der leichten Kavallerie diente. Außerdem war die persische Armee bis zur Militärreform von Khosrow I. (531-579) (und auch danach) größtenteils irregulär und hatte eigentlich den Charakter einer Miliz1. Daraus wird ersichtlich, dass nur adlige und wohlhabende Perser Krieger sein konnten, die über Kriegspferde, deren Kosten und Unterhalt sehr hoch waren, sowie über alle notwendigen Ausrüstungsgegenstände eines schwer bewaffneten Reiter-Katafakten verfügten.
Neben den Kataphrakten verfügte das persische Heer auch über leichte Kavallerieeinheiten, die im Verhältnis zu den Kataphrakten eine sekundäre, unterstützende Rolle spielten (Amm. Marc. XXIII. 3. 4; XXIV. 3. 1; 4. 7; 7. 7). Gleichzeitig waren die leichten Reiter ein integraler Bestandteil der persischen Kavallerie und des gesamten Heeres, denn die militärischen Erfolge der Sassaniden (wie schon in der früheren Arschakidenzeit) waren gerade auf das klare Zusammenspiel der verschiedenen Heeresteile auf dem Schlachtfeld zurückzuführen, allen voran der leichten und schweren Kavallerie.
Das zahlenmäßige Verhältnis von Kataphrakten und leicht bewaffneten Reitern in der persischen Armee lässt sich nicht genau bestimmen. Aus einigen indirekten und fragmentarischen Daten können wir jedoch schließen, dass die Zahl der gepanzerten Reiter in der persischen Kavallerie um ein Vielfaches geringer war als die Zahl der leicht bewaffneten berittenen Krieger. Aus Quellen ist bekannt, dass bei den Parthern je nach Lage auf einen schweren Reiter 10 bis 125 leichte kamen, und da die Militärkunst der Perser der Sassanidischen Epoche in vielerlei Hinsicht dem Militärwesen Parthiens ähnlich war und weitgehend dessen Traditionen fortsetzte, wurde das angegebene Verhältnis von leicht- und schwerbewaffneten Reitern in der parthischen Armee aller Wahrscheinlichkeit nach von der persischen Armee übernommen.
Es gab eine klare Aufgabenteilung zwischen leichter und schwerer persischer Kavallerie. Die Aufgabe der Kataphrakten bestand darin, der gegnerischen Schlachtordnung einen kräftigen, alles vernichtenden Schlag zu versetzen, um den Feind in die Flucht zu schlagen oder seine Formation aufzulösen. Die mobilere und wendigere leichte Kavallerie wiederum musste das Vorrücken und die Umgruppierung der gegnerischen Truppen erschweren. Dies wurde durch massiven Beschuss der feindlichen Reihen mit Bögen aus großer Entfernung erreicht, gefolgt von einem schnellen Rückzug und einem Überraschungsangriff an anderer Stelle (Amm. Marc. XXV. 1. 18).
Auch die persische Infanterie war in ihrer Zusammensetzung heterogen und wurde je nach Bewaffnung und Funktion in verschiedene Kategorien eingeteilt.
Erstens muss man die Bogenschützen von der allgemeinen Masse der Fußtruppen unterscheiden. Ammianus Marcellinus spricht am häufigsten von den persischen Bogenschützen - Fußsoldaten (Amm. Marc. XIX. 5. 1, 5; 6. 9; XX. 6. 6; 7. 6; 11. 9, 12-13; XXIV. 2. 8, 15; 3. 14; 4. 16; XXV. 1. 13, 17-18; 3. 11; XXIX. 1. 1), wobei er gleichzeitig feststellte, dass sich die Perser fast von Kindheit an in der Kunst des Bogenschießens auszeichneten (cuius artis fiducia ab incunabulis ipsis gens praevaluit maxima) (Amm. Marc. XXV. 1. 13; vgl. Strab. XV. 3. 18). Die Bedeutung der Fußschützen war enorm, vor allem bei Operationen zur Einnahme oder Verteidigung von Festungen, wenn dichtes und unaufhörliches feindliches Feuer die Erfolgsaussichten der Perser deutlich erhöhte.
Neben den Bogenschützen verfügte die persische Infanterie auch über Schleuderer (Amm. Marc. XIX. 5. 1; XX. 11.9; XXIV. 2. 15) und Pikeniere (Amm. Marc. XXV. 1. 13). Außerdem ist anzumerken, dass die Perser über schildtragende Krieger verfügten, die in dicht geschlossenen Reihen in die Schlacht zogen und dabei längliche, konvexe Schilde von großer Größe vor sich hielten (Amm. Marc. XXIV. 6. 8; Proc. Bell Pers. I. 14. 25-26). Nach der Beschreibung des Ammianus Marcellinus zu urteilen, standen die Schildträger in der zweiten Schlachtreihe der Perser und schützten die Soldaten hinter ihnen vor feindlichen Pfeilen und anderen Wurfgeschossen.
Neben den bekannten Varianten der persischen Infanterie sind zwei weitere Kategorien von Einheiten der Sassanidischen Fußarmee zu erwähnen, nämlich Soldaten, die Belagerungsgeschütze und andere militärische Maschinen warteten (Amm. Marc. XX. 6. 3; Proc. Bell Pers. II. 17. 12, 30; Bell Goth. IV. 14; Agath. III. 25), und von Ingenieurseinheiten, deren Soldaten mit der Errichtung von Erdwällen und -hügeln, Belagerungstürmen, dem Ausheben von Gräben und Kanälen, dem Anlegen von Übergängen, der Zerstörung von feindlichen Festungsmauern usw. beschäftigt waren. (Amm. Marc. XIX. 6. 6; Proc. Bell Pers. i. 14. 25-26; II. 21. 21-22; Agath. III. 25).
Zusätzlich zu den Infanteristen, die (in verschiedenen Funktionen) direkt an den Kampfhandlungen teilnahmen, umfasste das persische Heer eine große Anzahl von Fußsoldaten, die die Funktionen von Trägern, Wagen, Dienern usw. (oder, um es in modernen Begriffen auszudrücken, nicht-uniformierte Einheiten) ausübten (Amm. Marc. XXIII. 6. 83; Proc. Bell. Pers. I. 14. 25; Agath. III. 23). (oder, um es mit modernen Worten zu sagen, nicht-militärische Einheiten) (Amm. Marc. XXIII. 6. 83; Proc. Bell. Pers. I. 14. 25; Agath. III. 23). Darüber hinaus wurden sogar Frauen und Kinder rekrutiert, um Hilfsfunktionen im persischen Fußvolk zu erfüllen (insbesondere für den Transport von Ladungen, Munition usw.) (Herodian. VI. 5. 3; Liban. Or. LIX. 100; Theophan. A. M. 6118).
Im Allgemeinen ist der Status der Infanterie in der persischen Armee als sehr niedrig einzustufen. So schreibt Ammianus Marcellinus:
Die Infanteristen, die wie Myrmillons bewaffnet sind, dienen als Träger. Die ganze Masse folgt der Kavallerie, als ob sie zu ewiger Sklaverei verurteilt wäre, ohne jemals mit Lohn oder irgendwelchen Zuwendungen belohnt zu werden (Amm. Marc. XXIII. 6. 83).
Ammianus betont, dass es die Infanterie war, die schwere und ungelernte Arbeiten für die Perser verrichtete (z. B. das Errichten von Erdwällen (Amm. Marc. XIX. 6. 6)). Diese Angaben stimmen weitgehend mit den Daten anderer Autoren überein, deren Werke ebenfalls Beschreibungen des persischen Heeres enthalten. Nach Lactantius z. B. zogen die Perser "nach ihrer Gewohnheit mit all ihrem Hab und Gut in einer ungeordneten Menge mit Wagen voller erbeuteter Waren in den Krieg" (Lact. Mort Pers. VIII. 5). Procopius von Caesarea liefert ähnliche Informationen:
Ihr ganzes Fußvolk ist nichts anderes als eine Schar unglücklicher Bauern, die mit dem Heer nur mitziehen, um Mauern aufzugraben, den Gefallenen die Rüstungen abzunehmen und den Soldaten bei anderen Gelegenheiten zu dienen. Sie haben also keine Waffen, mit denen sie dem Feind Schaden zufügen könnten; und ihre riesigen Schilde setzen sie nur ein, um sich gegen die Pfeile und Speere des Feindes zu verteidigen (Proc. Bell. Pers. I. 14. 25-26).
Eine ebenso wenig schmeichelhafte Darstellung der persischen Infanterie (als "Bauern" (oder "muzhitsa") "Pöbel") findet sich im Werk von Menander Protector (Men. Fr. 20. 3).
In einer Reihe von Momenten konnte die Infanterie jedoch eine entscheidende Rolle spielen. Zunächst einmal handelt es sich, wie bereits teilweise erwähnt, um militärische Aktivitäten belagerungsdefensiver Art, zumal die wichtigsten Schlachten in der Regel unter den Mauern von Festungen und nicht im Feld stattfanden. Darüber hinaus waren persische Infanteristen auch in Feldschlachten durchaus in der Lage, erfolgreich gegen römische Truppen zu operieren, was sich besonders deutlich in der Schlacht von Chlomaron (585) zeigte, als aus lokalen Bauern rekrutierte Infanterie (sogar ohne Kavallerieunterstützung!) die Nachhut des sich zurückziehenden Heeres des Philippicus vollständig vernichtete (Theophyl. II. 9. 16).
Die letzte Art von Truppen, deren Vorhandensein die Perser in den Quellen häufig erwähnen, waren Einheiten von Kriegselefanten. Die Tiere wurden von Kriegern beherrscht, die auf ihnen saßen und ein Messer mit langem Griff in der Hand hielten, das notwendig war, um das Tier zu neutralisieren, das durch die im Kampf erlittenen Wunden wütend war (Amm. Marc. XIX. 2. 3; XXV, 1. 15). Wenn es unmöglich war, mit einem wütenden Tier fertig zu werden, durchtrennte der Mann, der es beherrschte, die Wirbelsäule des Elefanten an der Stelle, wo sie mit dem Schädel verbunden war, mit einem kräftigen Schlag (Amm. Marc. XXV. 1. 15). Felsreliefs in Taki Bustan zeigen, dass sich auf jedem Tier zwei Männer befinden, und das, obwohl hier nur eine Jagdszene dargestellt ist. Während des Kampfes auf dem Elefanten sollten mindestens zwei Krieger anwesend sein, die das Tier kontrollieren und den Feind mit Pfeilen oder anderen Wurfwaffen treffen. Nach Agathius von Myrinae und Theophylact von Simokatta gab es mehrere Krieger auf Elefanten (Agath. III. 27; Theophyl. V. 10. 6).
Die Bemerkung von Ammianus Marcellinus, dass in der Armee von Shapur II. (insbesondere 359 bei Amida) Elefanten von Segestanern (Amm. Marc. XIX. 2. 3) eingesetzt wurden, d. h. von Eingeborenen aus dem östlichen Teil des Iran, der in der Nähe von Indien liegt und seit langem die Staaten des Nahen Ostens mit Kampfelefanten versorgt hatte, verdient besondere Aufmerksamkeit. Es genügt, an den vielleicht berühmtesten Fall in dieser Hinsicht zu erinnern, als Seleukos Nikator 500 Elefanten von Chandragupta Maurya erhielt (Strab. XV. 2. 9). Es ist offensichtlich, dass auch im Sassanidischen Iran Kriegselefanten aus Indien kamen, und daher ist es kein Zufall, dass es Krieger aus Segestan waren, die sie einsetzten. Die Tatsache, dass die Perser Elefanten aus Indien erhielten, wird auch in Ammianus' zeitgenössischer "Vollständigen Beschreibung des Universums und der Völker" (ETM. 18) erwähnt.
Elefanten konnten in der persischen Schlachtordnung verschiedene Positionen einnehmen. So gibt Ammianus bei der Beschreibung der Schlacht von Ktesiphon (363) an, dass die Perser Kriegselefanten hinter der Hauptmasse der Soldaten in der letzten Reihe hatten (Amm. Marc. XXIV. 6. 8). Zur gleichen Zeit schreibt Agathius, dass in der Schlacht von Phasis (555) die persischen Elefanten vor ihren Truppen, vor den Verteidigungsanlagen, standen (Agath. III. 26). Ein ähnliches Bild beschreibt Theophylakt: Er stellt fest, dass in der entscheidenden Schlacht zwischen dem byzantinisch-persischen Heer und dem Heer von Bahram Chubin (591) Elefanten vor der Kavallerie, d.h. vor der ersten Kampflinie, als eine Art "vorgeschobene Bastionen" aufgestellt waren (Theophyl. V. 10. 6).
Neben den Feldschlachten wurden Elefanten von den Persern auch bei Belagerungsaktionen eingesetzt. Neben den Feldschlachten wurden Elefanten von den Persern auch bei Belagerungsaktionen eingesetzt:
Als Khosrow und das persische Heer die Mauern von Edessa stürmten, wurde ein Elefant, auf dem eine große Truppe der kriegerischsten Perser saß und der eine Art Kriegsmaschine - "Hagelzerstörer" - darstellte, auf die Mauer geführt. Es schien wahrscheinlich, dass die Perser bald die Stadt einnehmen würden, wenn sie mit ihrer Hilfe diejenigen überwältigen würden, die sich vom Turm aus verteidigten, und sie mit häufigen Schlägen auf den Kopf trafen. Doch die Römer entgingen dieser Gefahr, indem sie ein Schwein am Turm aufhängten. Am Bein aufgehängt, fing das Ferkel natürlich an, wütend zu quieken: der Elefant, darüber erzürnt, hörte auf zu gehorchen und zog sich bald zurück (Proc. Bell. Goth. IV. 14)2.
Eine weitere originelle Art und Weise, wie die Perser Kriegselefanten einsetzten, diesmal in Wasserschlachten, wird von Agathias von Myrinae beschrieben:
Als er die Mitte des Flusses zwischen der Insel und der Stadt erreicht hatte, sperrte er [der persische Heerführer - V. D] den gesamten Flusslauf mit miteinander verbundenen Baumstämmen und Booten und stellte von hinten Gruppen von Elefanten auf, wo man passieren konnte (Agath. III. 20).
Elefanten, trotz der umfangreichen, ja jahrhundertealten Erfahrung im Kampf gegen sie, die die römische Armee seit den Pyrrhuskriegen im 3, Jh. v. Chr.gesammelt hatte, einen überwältigenden Eindruck auf die Römer.3 Ammianus Marcellinus, der viele Jahre im Militärdienst verbrachte und selbst Jahrzehnte nach den Ereignissen, die er erlebte, direkt mit persischen Kriegselefanten in Berührung kam, kann nicht ruhig über die Elefanten im Heer Shapurs II. schreiben: "Ihr furchtbares Aussehen und ihr schrecklicher Rüssel erregten ein kaum zu überwindendes Grauen" (Amm. Marc. XXV. 1. 1. 14); "die runzligen Ungeheuer boten ... einen schrecklichen Anblick, der unbeschreibliche Furcht einflößte" (Amm. Marc. XIX. 2. 3); ihr "Gebrüll und ihre schreckliche Erscheinung ... sind das Schrecklichste, was sich der Mensch vorstellen kann" (Amm. Marc. XIX. 7. 7); "die Elefanten, die sich wie Berge bewegten ... drohten, diejenigen zu vernichten, die sich ihnen näherten, und flößten Angst ein" (Amm. Marc. XXIV. 6. 8).
Für die Perser selbst stellten die Elefanten jedoch eine potenzielle Gefahr dar. Ein bemerkenswerter Fall in dieser Hinsicht wird von Agathias beschrieben:
Die vor den Befestigungen platzierten Elefanten, die die Römer angriffen, verwirrten sofort selbst deren geschlossene Formation, wenn sie ihnen irgendwo gegenüberstanden. Außerdem fügten die auf ihnen sitzenden Bogenschützen den angreifenden Römern großen Schaden zu und schossen auf sie, ohne sie zu verfehlen ... Zu dieser Zeit stieß einer von Martins Knappen namens Ognaris ... mit großer Wucht einen Speer in die Augenbraue des wildesten der ihn angreifenden Elefanten, und die Spitze des Speers drang so tief ein, dass das Ende herunterhing. Der Elefant, der unter der Wunde litt und zudem durch den Pfeil, der in der Nähe seines Auges baumelte, erschrocken war, wich sofort zurück und begann, in verschiedene Richtungen zu flüchten. Dann ließ er seinen Rüssel wie eine Peitsche baumeln, schlug viele Perser und warf sie in die Höhe, dann streckte er ihn in die Länge und stieß einen furchtbaren und starken Schrei aus. Er warf die Soldaten, die auf ihm saßen, mit einem kräftigen Stoß zu Boden und tötete sie, indem er sie mit seinen Füßen zertrat; schließlich brachte er das ganze persische Heer in Unordnung, und die Pferde, denen er sich näherte, wurden in Raserei versetzt... Alles war erfüllt von Geschrei und Verwirrung (Agath. III. 26-27).
So lassen sich in der persischen Armee drei Haupttypen von Truppen unterscheiden: Kavallerie, Infanterie und Einheiten von Kriegselefanten. Die ersten beiden waren, wie oben gezeigt wurde, nicht homogen und können in eine Reihe anderer Kategorien unterteilt werden, die sich in ihren Aufgaben und Funktionen voneinander unterscheiden.
B. Ethnische Zusammensetzung
Das zweite Kriterium für die Analyse der Struktur der persischen Armee ist ihre ethnische Zusammensetzung. In dieser Hinsicht war das sassanidische Heer sehr heterogen. Dieses Merkmal ist für iranische Armeen seit der Achämenidenzeit (6.-4. Jahrhundert v. Chr.) und vielleicht sogar noch früher charakteristisch. In diesem Zusammenhang sei an die farbenfrohe und detaillierte Beschreibung des Heeres von Xerxes durch Herodot (Herod VII. 61-99) erinnert, in der der Historiker die Völker aufzählt, deren militärische Kontingente am persischen Feldzug gegen Griechenland teilnahmen. Die Heterogenität war charakteristisch für die Streitkräfte aller Mächte, die auf dem Gebiet des Iran existierten - das Reich Alexanders des Großen, das Seleukidenreich und der Partherstaat. Der sassanidische Iran wurde so zum Fortsetzer der antiken militärgeschichtlichen Tradition.
Der Hauptgrund für die Multinationalität der iranischen Armee der Sassanidischen Ära, wie auch der vorangegangenen, ist offensichtlich und liegt in der Multiethnizität des Sassanidischen Staates selbst, der sich von Westasien bis Indien erstreckte. Die auf dem Gebiet des Sassanidischen Irans lebenden Völker waren per definitionem gezwungen, eine "Blutsteuer" zu entrichten, indem sie ihre Vertreter unter die Fahnen der Schahanshahs schickten.
Darüber hinaus nahmen eine Reihe von Volksgruppen, die keine Untertanen der Sassanidischen Herrscher waren, dennoch gemeinsam mit den Persern an militärischen Operationen gegen Rom (und später Byzanz) teil. Dies geschah hauptsächlich durch den Mechanismus des Bündnisses, bei dem ein Bündnisvertrag zwischen dem Schahanshah und einer Nation geschlossen wurde, die an den Grenzen Persiens lebte oder in sein Gebiet eindrang, und bei dem die Nachbarn oder jüngsten Feinde des Irans ihm mit ihren Truppen beistanden. Leider kennen wir, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Einzelheiten und konkreten Bedingungen solcher Verträge nicht, aber die Fakten ihres Abschlusses werden in den Quellen wiederholt erwähnt.
Ein weiterer Grund für Ausländer, in der persischen Armee zu dienen, waren die traditionell freundschaftlichen, verbündeten Beziehungen, die sich zwischen den Sassaniden und bestimmten ethnischen Gruppen oder Staaten entwickelten, die offenbar nicht durch besondere Verträge oder Vereinbarungen formalisiert wurden. Das anschaulichste Beispiel hierfür ist der arabische Staat der Lachmiden, der nahe der westlichen Grenze des Sassanidischen Iran lag und ein ständiger Verbündeter und strategischer Partner der Sassaniden in den Kriegen im Westen war.
Schließlich trugen die Römer selbst durch ihre nicht immer wohlüberlegte Politik in einigen Fällen dazu bei, dass die sassanidische Armee mit Truppen ehemaliger römischer Verbündeter aufgefüllt wurde. Dies war zum Beispiel während des Persienfeldzuges von Kaiser Julian (363) der Fall, als die Araber des Fürstentums der Ghassaniden (die mit den Lachmiden in Fehde lagen und in der Regel auf der Seite des Reiches kämpften), nachdem sie von Julian nicht die ihnen zustehenden Geldsummen und Geschenke erhalten hatten, auf die Seite der Perser übertraten (Amm. Marc. XXV. 6. 10), oder im VI. Jahrhundert, als die transkaukasischen Verbündeten von Byzanz - Armenier und Lasen - aufgrund von Missbräuchen der byzantinischen Verwaltung auf die Seite der Perser übergingen (Proc. Bell. Pers. II. 3. 1-7; 15.9-11).
Die Multinationalität als eines der charakteristischen Merkmale der Sassanidischen Armee war also durch verschiedene Faktoren bedingt und ergab sich sowohl aus den objektiven Bedingungen der Existenz des Sassanidischen Staates selbst als auch aus den spezifischen Situationen, in denen er sich in dieser oder jener Periode seiner Geschichte befand.
* * *
Den wichtigsten Platz in der Sassanidischen Armee nahmen die Araber ein, oder, in der Terminologie der antiken Historiker, die Sarazenen. Im Gegensatz zu vielen anderen Völkern nahmen sie während des gesamten Bestehens der Sassanidischen Macht an den römisch-persischen Kriegen teil, vom Zeitpunkt ihres Auftretens in der Mitte des dritten Jahrhunderts bis zu ihrem Untergang in der Mitte des siebten Jahrhunderts. Wie bereits erwähnt, war der wichtigste Verbündete der Perser der Staat der Lachmiden im nordöstlichen Teil der arabischen Halbinsel, südwestlich des Unterlaufs des Euphrat. Allem Anschein nach waren die in den nördlichen Regionen Arabiens (einschließlich des Gebiets des Lachmidenstaates) lebenden Araber sozio-politisch weiter entwickelt als die Mehrheit ihrer Stammesangehörigen in den südlicheren Regionen, in denen der Staat erst später, im VI. und VII. Ihre politischen Institutionen entstanden bereits im 3. Jahrhundert, was vor allem auf die Nähe zu ihren hoch entwickelten Nachbarn zurückzuführen ist: die Zivilisationen Westasiens und Irans einerseits und das Römische Reich andererseits.
Ab dem 4. Jahrhundert nahmen die Araber systematisch an den römisch-persischen Kriegen teil. In der Konfrontation zwischen den beiden Großmächten um die Vorherrschaft in Westasien spalteten sich die arabischen Stämme in zwei gegnerische Lager: den Ghassanidenstaat (an der Grenze der römischen Besitzungen im östlichen Mittelmeer, in der Region Syrien) und den Lachmidenstaat. Aufgrund geopolitischer Faktoren waren die Ghassaniden dazu verdammt, Rom zu unterstützen, ebenso wie die Lakhmiden dazu verdammt waren, den Iran zu unterstützen. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Sarazenen in einer Reihe von Fällen von ihrer "allgemeinen" außenpolitischen Linie abwichen, was ihnen den Ruf unzuverlässiger und sogar gefährlicher Verbündeter einbrachte, die, wie Ammianus Marcellinus schreibt, für die Römer besser gewesen wären, "weder Freunde noch Feinde zu haben" (Amm. Marc. XIV. 4. 1). Theophylact Simocatta beschreibt die Sarazenen auf dieselbe Weise:
Denn die Sarazenen sind ein höchst untreuer Stamm, bereit, dem einen oder dem anderen zu dienen, ungehobelt im Geist und in Bezug auf Ehrlichkeit und Klugheit völlig unzuverlässig (Theophyl. IV. 17. 7).
Die Funktionen der Sarazenen im persischen Heer wurden durch ihre Kampfeigenschaften bestimmt. Da sie die Perser mit leichter Kavallerie versorgten, bestand ihre Rolle in den Kämpfen in schnellen und plötzlichen Angriffen auf die Römer, gefolgt von einem ebenso schnellen Rückzug auf ihre ursprünglichen Positionen. Ammianus Marcellinus gibt ein Beispiel für eine solche Taktik der arabischen Kavallerie:
Als wir weiter vorrückten, stürmten die Sarazenen, die zuvor von unserer Infanterie zurückgeschlagen worden waren und sich bald mit der Hauptstreitmacht der Perser vereinigten, in Windeseile auf unseren Transport zu, kehrten aber, als sie den Kaiser sahen, zu ihren Reserven zurück (Amm. Marc. XXV. 1. 3).
Darüber hinaus überfielen sarazenische Armeen die Besitztümer des Reiches, verwüsteten Grenzgebiete, erbeuteten Beute, töteten und nahmen die lokale Bevölkerung gefangen und versetzten die Römer in große Angst. Nach demselben Ammianus verwüsteten die Sarazenen "bei ihren Raubzügen hier und dort in einem Augenblick alles, was sie antrafen, wie gefräßige Drachen, die, wenn sie Beute von oben sehen, sie in einem schnellen Raubzug ergreifen und, wenn sie sie nicht erbeuten können, davonfliegen" (Amm. Marc. XIV. 4. 1).
Der berühmteste und begabteste Anführer der mit den Persern verbündeten Sarazenen war ein Vertreter der Lachmiden-Dynastie, al-Mundir ibn al-Nu'man, der am aktivsten an den Kriegen von Khosrow Anushirvan gegen das Byzantinische Reich teilnahm. Die militärischen Aktivitäten von al-Mundir werden von Procopius von Caesarea sehr detailliert beschrieben:
Alamundar [al-Mundir. - S. M.] war ein äußerst kluger und in militärischen Angelegenheiten äußerst erfahrener Mann, der den Persern sehr zugetan und außerordentlich energisch war. Fünfzig Jahre lang erschöpfte er die Kräfte der Römer. Von den Grenzen Ägyptens bis nach Mesopotamien verwüstete er alle Gebiete, raubte und nahm alles reihenweise mit, verbrannte Gebäude, die ihm in die Hände fielen, und versklavte viele Zehntausende von Menschen, von denen die meisten sofort getötet, andere für viel Geld verkauft wurden. Niemand sprach gegen ihn, denn er unternahm nie einen unüberlegten Raubzug und griff immer so unerwartet und zu einem für ihn günstigen Zeitpunkt an, dass er meist mit der ganzen Beute schon weit weg war, wenn die Befehlshaber und Soldaten der Römer erst von den Geschehnissen erfuhren und sich zum Feldzug gegen ihn sammelten. Wenn die Römer ihn zufällig einholten, stürzte sich dieser Barbar auf seine noch nicht zum Kampf vorbereiteten und nicht in Kampfordnung gebauten Verfolger, schlug sie in die Flucht und vernichtete sie ohne große Schwierigkeiten, und nahm einmal alle Soldaten, die ihn verfolgten, zusammen mit ihren Befehlshabern gefangen ... Kurz, dieser Mann war der schrecklichste und ernsteste Feind, den die Römer je hatten. Der Grund dafür war jedoch, dass Alamundar, der einen königlichen Titel trug, allein über alle Sarazenen innerhalb der persischen Grenzen herrschte und mit seinem ganzen Heer Überfälle auf jeden Teil der römischen Macht machen konnte, den er wollte (Proc. Bell Pers. I. 17. 40-43, 45).
Die Perser schätzten die militärische Unterstützung, die sie von den Sarazenen erhielten, sehr. Davon zeugt zum Beispiel die Tatsache, dass al-Mundir einer der wenigen engen militärischen Berater Khosrows war, dessen Empfehlungen und Vorschläge zur Organisation und Durchführung militärischer Operationen gegen Byzanz der Schahanshah aufmerksam anhörte und oft ohne Widerspruch annahm - nur wenigen Anführern nicht-persischer Militärkontingente wurde eine solche Ehre zuteil. Bei der Belagerung feindlicher Städte erhielten zudem die Sarazenen (neben den Persern selbst) die Möglichkeit, sich nach der Einnahme der Festung an der Gefangennahme der Bewohner zu beteiligen, ohne direkt am Angriff teilzunehmen, d.h. ohne sich in Lebensgefahr zu begeben:
An jedes Tor stellte er [Khosrow. - S. M.] einen der Befehlshaber mit einer Abteilung von Truppen, und nachdem er so die ganze Mauer umstellt hatte, begann er, Leitern und Maschinen an sie heranzuführen. Hinter ihm stellte er alle Sarazenen mit einigen Persern auf, nicht damit sie die Stadt angreifen sollten, sondern damit sie, nachdem die Stadt eingenommen war, diejenigen, die aus ihr fliehen wollten, fangen und gefangen nehmen sollten (Proc. Bell. Pers. IL 27. 29-30).
Neben den Sarazenen erwähnen die Quellen eine Reihe anderer Völker, die mit den Persern an den Kriegen gegen das Reich teilnahmen. In den VI-VII Jahrhunderten. eine herausragende Rolle in der sassanidischen Armee spielten Abteilungen Deylemites. Bewohner von Deylem, einer bergigen Region an der südwestlichen Küste des Kaspischen Meeres (Proc. Bell. Goth. IV. 14; Agath. III. 17. 6-9; 28. 6-7; Theophyl.
IV. 3. 1; 4. 17). Ausreichend detaillierte Informationen über die Deylemiten geben Prokopius von Caesarea, der die Deylemiten als Dolomiten bezeichnet, und Agathius, der sie unter dem Namen Dilimniten erwähnt:
Diese Dolomitenbarbaren, die unter den Persern leben, waren nie Untertanen des persischen Königs. In den steilen und unzugänglichen Bergen angesiedelt, sind sie von alters her bis heute unabhängig geblieben und haben sich nur gegen Bezahlung den Persern angeschlossen, wenn diese einen Feldzug gegen ihre Feinde unternommen haben. Sie sind alle Infanteristen, jeder trägt ein Schwert und einen Schild und hat drei Pfeile in der Hand. Sie verstehen es, sehr gut und schnell über Bäche und Berggipfel zu klettern, als ob sie auf einer glatten Ebene liefen (Proc. Bell. Bell. Goth. IV. 14).
Sie [die Deylemiten - S. M.] können zu den kriegerischsten Völkern gezählt werden. Sie sind keine Bogenschützen oder Kämpfer aus der Ferne. Sie tragen Speere und Sarissas, ein Schwert, das an der Schulter hängt, einen kleinen Dolch, der am linken Arm befestigt ist, und sind durch große und kleine Schilde geschützt. Man kann sie weder als leicht bewaffnete Truppen noch als Hopliten oder schwer bewaffnete Truppen bezeichnen. Wenn nötig, schwingen sie ihre Speere aus der Ferne und kämpfen im Nahkampf. Sie sind gut im Zusammenstoß mit der feindlichen Phalanx und können mit starken Angriffen die dichten feindlichen Reihen durchbrechen. Sie sind erfahren darin, die Schlachtordnung neu zu organisieren und sich an alle Eventualitäten anzupassen. Sie erklimmen mühelos hohe Hügel, besetzen die Hochebenen und laufen, wenn nötig, mit größter Schnelligkeit zurück, um sich dann wieder umzudrehen und den Feind heftig zu verfolgen. Geschickt und sehr erfahren in allen Arten der Kriegsführung, treffen sie ihre Feinde mit sehr schweren Schlägen. Seit langem an den Krieg gewöhnt, kämpfen sie seit langem unter dem Banner der Perser, aber nicht unter dem Zwang der Untertanen. Denn sie sind frei, nach ihren eigenen Gesetzen zu leben und sind nicht gewohnt, sich Gewalt und Willkür zu unterwerfen (Agath. III. 17).
Die ungefähre Zahl der Deylemiten im persischen Heer lässt sich aus den Angaben des Agathius ableiten, der angibt, dass die Perser eine dreitausendköpfige Abteilung Deylemiten in ihrem Dienst hatten (Agath. III. 17).
Die Funktionen der Deylemiten im Kampf waren sehr wichtig. Sie füllten eine besondere Lücke, die durch das Fehlen einer eigenen kampffähigen Infanterie der Perser entstanden war, und waren daher in bestimmten Situationen unverzichtbar. Es handelt sich insbesondere um die Erstürmung byzantinischer Festungen, vor allem dort, wo die Festungsmauern auf bergigen Hängen standen (Proc. Bell. Goth. IV. 14), um plötzliche nächtliche Angriffe, bei denen sich die Deylemiten (mangels Pferde) völlig lautlos dem Standort der feindlichen Truppen nähern konnten (Agath. III. 18), Ablenkungsmanöver, deren Vollstrecker die Infanterie sein musste, um der persischen Reiterei Gelegenheit zu geben, sich für einen Angriff neu zu formieren oder sich geordnet zurückzuziehen (Agath. III. 28). Gleichzeitig zeichneten sich die Deylemiten, wie auch die Mehrzahl der ausländischen Söldner, nicht durch Loyalität gegenüber den Sassaniden aus. Theophylakt erwähnt eine Verschwörung gegen Ormizd IV., zu deren Organisatoren ein deylemitischer Führer namens Zoarab gehörte (Theophyl. IV. 3. 1).
Neben den Deylemiten gehörten zum persischen Heer auch Vertreter eines anderen Stammes, der im südlichen Kaspischen Meer lebte - die Kadisinen (Proc. Bell Pers. 1. 14. 38, 39), die in Claudius Ptolemäus' Geographie (Ptol. II. 6) als "Kadusii" erwähnt werden. Wir kennen keine Einzelheiten über die Funktionen der Kadisinen in der Sassanidischen Armee, aber wir können davon ausgehen, dass sie Reiter waren und schwer bewaffnet. Procopius von Caesarea berichtet, dass die Kadisinen in der Schlacht von Dara (530) zusammen mit den Persern die linke Flanke der Römer angriffen und bedrängten, und dass die Perser, die das Heer des Velisarius angriffen, Kataphrakten waren und zusammen mit ihnen die Kadisinen agierten, die an der Speerspitze des Angriffs auf die rechte, d.h. schlagende, Flanke standen. Nach der Beschreibung des Prokopius zu urteilen, verfolgten sie die Byzantiner dicht (und nicht aus der Ferne, wie es der Fall sein sollte, wenn die Kadisinen leichte Kavallerie waren), höchstwahrscheinlich waren sie schwere Kavallerie.
Im IV. Jahrhundert, unter Shapur II., waren im persischen Heer Vertreter einer anderen Ethnie anwesend, deren Geschichte uns nicht sehr gut bekannt ist. Es handelt sich um die Chioniten. Sie werden von Ammianus Marcellinus als einer der engsten Verbündeten der Perser während ihres Feldzuges gegen das Reich im Jahre 359 erwähnt (Amm. Marc. XVIII. 6. 22; XIX. 1. 7-8; 2. 3), mit denen Schapur II. etwas früher, im Jahre 358, nach einem langen Krieg einen Friedensvertrag geschlossen hatte (Amm. Marc. XVII. 5. 1). Das Ergebnis dieses Abkommens war die Teilnahme der Chioniten unter der Führung von König Grumbat an Schapurs Krieg gegen Rom.
Die Chioniten im persischen Heer waren allem Anschein nach Reiter. Die Quellen berichten dies nicht direkt, aber eine solche Schlussfolgerung liegt nahe, da die Chioniten ein Nomadenvolk zentralasiatischen Ursprungs waren und Bildquellen sie (wie auch die verwandten Ephthaliten und Kidariten) ziemlich genau als leicht bewaffnete Reiter charakterisieren. Außerdem mussten sie, bevor sie die Grenzen Persiens erreichten, (objektiv) fast ganz Zentralasien erobern, wo die Basis der Streitkräfte traditionell die Kavallerie war. Darüber hinaus charakterisiert Ammianus Marcellinus den chionitischen Anführer Grumbatus als einen König, "der für viele herausragende Siege berühmt ist" (Amm. Marc. XVIII. 6. 22), darunter offenbar auch über die Perser selbst. Es liegt auf der Hand, dass solche Erfolge im Kampf gegen Gegner, die sich auf Kavallerieaktionen stützen, von einem Fußvolk nicht erreicht werden konnten.
Zur gleichen Zeit, bei der Belagerung von Amida (359), nahmen die Chioniten an der Erstürmung der Festungsanlagen teil (Amm. Marc. XIX. 2. 3), was von ihrer Fähigkeit spricht, sowohl zu Pferd als auch zu Fuß zu kämpfen.
Im vierten Jahrhundert werden auch persische Verbündete wie Albaner (Amm. Marc. XVIII. 6. 22; XIX. 2. 3) und Segestaner (Amm. Marc. XIX. 2. 3) erwähnt. Wie die Chioniten nahmen sie am Feldzug des Shapur im Jahre 359 teil.
Albaner - Einwohner des kaukasischen Albaniens, das auf dem Gebiet des heutigen Aserbaidschan liegt. Ammianus Marcellinus beschreibt eine Szene, in der der König der Albaner (wie auch der König der Chioniten) zu Pferd neben Schapur II. ritt (Amm. Marc. XVIII. 6. 22), was zeigt, wie wichtig dem Shahanschah das Bündnis mit den Albanern war. Dies wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass Albanien an Armenien und Iberien grenzte, was in den römisch-persischen Beziehungen immer ein Stolperstein gewesen war, und daher ein bequemes Sprungbrett für Invasionen in deren Gebiet darstellte.
Ammianus charakterisiert die Segestaner - Bewohner von Segestan (Sakastan), einer Region im östlichen Iran, Nachfahren der Saken, die sich dort im 2. Jahrhundert n. Chr. niederließen - als "die brutalsten aller Krieger", die über Schwadronen von Kriegselefanten verfügten (Amm. Marc. XIX. 2. 3). Der letztgenannte Umstand bestimmte die taktischen Aufgaben der Segestaner in den militärischen Plänen der Perser. Darüber hinaus war Segestan allem Anschein nach irgendwann ein Vermittler bei der Versorgung der Sassaniden mit Kriegselefanten, die aus Indien geliefert wurden.
Die byzantinischen Historiker erwähnen die Hunnen häufig als Verbündete der Perser (Proc. Bell. Pers. I. 3. 4; 8. 13; 15. 1; 21. 13, 27; II. 26. 5; Men. Fr. 23. 1; Theophan. A. M. 6013, 6020). Dieses Ethnonym ist jedoch eine Sammelbezeichnung für verschiedene Ethnien, die am Vormarsch der hunnischen Horden in den Westen Eurasiens teilnahmen und sich an den Grenzen des Sassanidischen Iran wiederfanden. Und die Autoren selbst geben, wenn sie die Hunnen erwähnen, oft an, welches "hunnische" Volk sie in diesem oder jenem Fall meinen. In dieser Reihe sind die Ephthaliten (Proc. Bell. Pers. I. 3. 4; 8. 13; Sebeos. XXVI) zu nennen, die vor allem in den an Persien angrenzenden Gebieten Zentralasiens lebten, und die Sabiren (Proc. Bell. Bell. Pers. I.
15. 1; Agath. III. 17, 18; Men. Fr. 23.1) - Nomaden, die das Gebiet an der Westküste des Kaspischen Meeres nördlich der Kaukasuskette (das Gebiet des heutigen Dagestan, Russische Föderation) bewohnten. Darüber hinaus bezeichnet Prokopius die mit den Persern verbündeten Hunnen als Massagetae (Proc. Bell. Pers. I. 13-15, 28) oder einfach als Hunnen ohne jegliche Spezifizierung (Proc. Bell. Pers. II. 26. 5-8). In den beiden letztgenannten Fällen ist es schwierig, Einzelheiten über die Bewaffnung und Taktik der von Procopius erwähnten Stämme zu ermitteln. Es gibt jedoch ähnliche Angaben über die Ephthaliten und Sabiren. Die Ephthaliten waren, wie oben erwähnt, leicht bewaffnete Reiter-Bogenschützen, was neben der Ikonographie von demselben Prokopius bezeugt wird (Proc. Bell. Pers. I. 1.7. 8). Sabiren (oder Saviren) waren auf dem Schlachtfeld schwer bewaffnete berittene Krieger - so identifiziert sie Agathius, der eine zweitausend Mann starke Abteilung von Sabiren erwähnt, die auf byzantinischer Seite kämpften (Agath. III. 17).
Im 6. Jahrhundert waren die Alanen Verbündete des Iran (Proc. Bell. Goth. IV. 1, 3, 8; Theophyl. III. 9. 7). Die iranischsprachigen Stämme der Alanen bewohnten ein riesiges Gebiet vom südlichen Ural bis zur nördlichen Schwarzmeerküste. Ein Teil von ihnen beteiligte sich im IV. und V. Jahrhundert an der Großen Völkerwanderung und drang zusammen mit den Vandalen und Goten nach Westeuropa ein, wo sie bis nach Spanien vordrangen.
Wie viele andere nördliche Nachbarn von Persien und Byzanz dienten die Alanen je nach den Umständen auf der Seite beider Mächte. Das Hauptmotiv für die außenpolitischen Präferenzen der Alanen war der Geldbetrag, den sie von ihren mächtigen Nachbarn im Gegenzug für militärische Hilfe erhielten. Am aktivsten waren die Alanen in der Mitte des 6. Jahrhunderts in die byzantinisch-persischen Kriege verwickelt. 540 unterstützten einige Alanen offenbar Byzanz und erhielten von diesem (wie die Sabiren) finanzielle Belohnungen (Proc. Bell Pers. IL 29. 29; 30. 28). Später, in den 50er Jahren des 6. Jahrhunderts, werden die Alanen in den Quellen als Verbündete der Perser erwähnt: Prokopius von Caesarea stellt fest, dass "dieser Stamm unabhängig war; zum größten Teil war er mit den Persern verbündet und zog gegen die Römer und andere Feinde der Perser" (Proc. Bell Goth. IV. 1, 3, 8).
Eine der Exkursionen von Ammianus Marcellinus ist der Beschreibung der Lebensweise der Alanen und ihrer Kampfeigenschaften gewidmet: