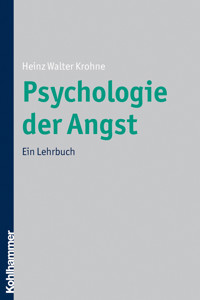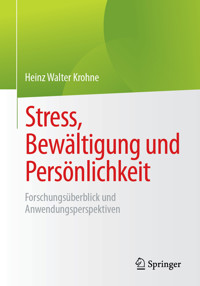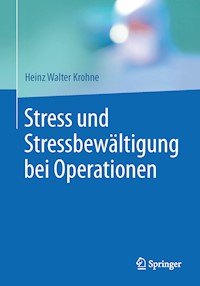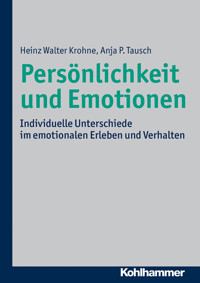
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit Emotionen wissenschaftlich erforscht werden, wird auch über ihre Beziehung zu anderen Merkmalen der Person nachgedacht. In diesem Band werden detailliert biologische und psychologische Ansätze vorgestellt, die individuelle Unterschiede in emotionalen Reaktionen als Persönlichkeitsmerkmale beschreiben, theoretische Konstruktionen, die zur Erklärung von Persönlichkeitsunterschieden im emotionalen Erleben und Verhalten herangezogen werden, sowie Variablen, die die Beziehung zwischen Umweltereignissen und emotionalen Verhaltensweisen (einschließlich emotionsbezogener Merkmale wie etwa Gesundheitsstatus) moderieren. Im abschließenden Kapitel wird eine Integration der verschiedenen Ansätze und der empirischen Befunde unternommen und ein ausführlicher Ausblick auf mögliche Anwendungen der Ergebnisse sowie weiteren Forschungsbedarf gegeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinz Walter KrohneAnja P. Tausch
Persönlichkeit undEmotionen
Individuelle Unterschiede im emotionalenErleben und Verhalten
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2014
Alle Rechte vorbehalten
© 2014 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart
Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher
Gesamtherstellung:
W. Kohlhammer GmbH + Co. KG, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-010408-2
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-024425-2
epub: ISBN 978-3-17-024426-9
mobi: ISBN 978-3-17-024427-6
Inhalt
Vorwort
1 Definition, Geschichte, Problemstellungen
1.1 Definition
1.2 Historischer Hintergrund
1.3 Frühe naturwissenschaftliche Ansätze: Darwin, Freud, James, Cannon
1.4 Problemstellungen und Perspektiven
1.5 Plan des Buches
2 Die Messung emotionsbezogener Merkmale
2.1 Emotionsbezogene Konstrukte und ihre empirische Erfassung
2.2 Physiologische Prozesse als Emotionsindikatoren
2.3 Die Erfassung psychologischer Emotionsmerkmale
3 Biologisch orientierte Emotionskonstrukte
3.1 Individualspezifische Reaktionsmuster
3.2 Zirkadianer Rhythmus
3.3 Hemisphären-Asymmetrie und Affektiver Stil
4 Psychologische Ansätze
4.1 Interozeptionsfähigkeit
4.2 Alexithymie
4.3 Emotionale Intelligenz
4.4 Emotionale Expressivität
5 Emotionsmodelle und Persönlichkeit
5.1 Überblick
5.2 Eysencks Theorie der Erregung und Aktivierung
5.3 Grays Theorie der Verstärkersensitivität
6 Positive Emotionalität
6.1 Definitionen
6.2 Extraversion
6.3 Impulsivität
6.4 Sensation Seeking (Bedürfnis nach Stimulation)
7 Negative Emotionalität: Ängstlichkeit, Depressivität und verwandte Konstrukte
7.1 Einordnung der Konstrukte
7.2 Ängstlichkeit
7.3 Angstbewältigung
7.4 Depressivität und Negative Affektivität
8 Antisoziale Emotionalität
8.1 Definition der Konstrukte
8.2 Psychotizismus
8.3 Ärgerneigung und Feindseligkeit
9 Persönlichkeit als Moderator zwischen Umwelt und emotionalen Reaktionen
9.1 Das Konzept des Moderators
9.2 Kontrollüberzeugung
9.3 Optimismus
9.4 Kontrollbedürfnis und Typ A-Verhaltensmuster
9.5 Stressanfälligkeit versus Stressresistenz
10 Bewertungen, Integration und Perspektiven für Forschung und Anwendung
10.1 Übersicht
10.2 Bewertungen
10.3 Integration
10.4 Perspektiven für Forschung und Anwendung
Literatur
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Seit Emotionen wissenschaftlich erforscht werden, wird auch über ihre Beziehung zur Persönlichkeit nachgedacht. Dieser enge Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Emotionen wird auch darin deutlich, dass Persönlichkeit als ein zeitlich stabiles Muster kognitiver, verhaltensmäßiger und emotionaler Merkmale bestimmt wird.
Zentral für den Begriff der Persönlichkeit ist die Idee, dass sich Menschen vergleichsweise stabil (also nicht nur momentan) in ihrer Tendenz unterscheiden, in spezifischen Situationen bestimmte emotionale Reaktionen (z. B. Angst oder Ärger) zu zeigen. Derartige Unterschiede wurden bereits in der antiken Temperamentlehre relativ präzise beschrieben. In der neueren Persönlichkeitsforschung wurden diese Ansätze zu dimensionalen Modellen individueller Unterschiede ausgebaut. Im Hinblick auf das Thema Persönlichkeit und Emotionen wurde dabei eine Vielzahl derartiger Dimensionen identifiziert und empirisch erforscht. Neben eher engen Dimensionen wie etwa Affektiver Stil konzentrierte sich die Forschung insbesondere auf drei große Bereiche emotionalen Reagierens: individuelle Unterschiede beim Erleben und Ausdruck positiver (Positive Emotionalität), negativer (Negative Emotionalität) sowie antisozial orientierter Emotionen (Antisoziale Emotionalität).
Die Darstellung in diesem Buch folgt dieser Einteilung. Nach einer Einführung, in der Definition, Geschichte und Problemstellung skizziert werden, und einem Kapitel über die Messung emotionsbezogener Konstrukte werden als Erstes die erwähnten engeren Dimensionen individueller Unterschiede im emotionalen Reagieren vorgestellt, wobei zunächst biologisch orientierte und sodann psychologische Ansätze beschrieben werden. Die Darstellung zweier zentraler Theorien (Eysenck, Gray), in denen individuelle Unterschiede im emotionalen Reagieren mit Hilfe spezifischer Persönlich-keitskonstrukte erklärt werden, bereitet die Beschreibung der genannten drei großen Bereiche individueller emotionaler Unterschiede vor. Im Zentrum der Positiven Emotionalität steht das breite Persönlichkeitskonstrukt der Extraversion. Allerdings lässt sich Extraversion nicht auf das Erleben positiver Emotionen reduzieren, da in ihm auch individuelle Unterschiede bei Kognitionen, Bedürfnissen und Verhaltensweisen eine wesentliche Rolle spielen. Kern der Negativen Emotionalität sind die nicht minder breiten Konstrukte der Ängstlichkeit und Depressivität. Auch diese Konstrukte lassen sich nicht auf die Emotionalität reduzieren. Individuelle Unterschiede hängen hier auch ab von Fähigkeiten und Strategien zur Regulation und Bewältigung aversiver Ereignisse und Zustände. Im Zentrum der Antisozialen Emotionalität stehen individuelle Unterschiede, die unter Begriffen wie Aggressivität, Feindseligkeit, Ärgerneigung und Ärgerausdruck erforscht werden.
Danach werden Persönlichkeitsmerkmale betrachtet, die selbst zwar nicht unmittelbar als emotional bezeichnet werden können, aber als Moderatoren zwischen bestimmten Umweltereignissen (z. B. Stressbelastungen) und emotionalen Reaktionen fungieren. Wichtige Merkmale sind hier Kontrollüberzeugung, Optimismus oder Stressresistenz. Im abschließenden Kapitel werden die vorgestellten Ansätze kritisch bewertet und der Versuch einer Integration zentraler Annahmen und empirischer Befunde unternommen. Der Band schließt mit einem Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf sowie mögliche Anwendungen der gesicherten Ergebnisse zum Thema Persönlichkeit und Emotionen.
Die neuere Forschung zu den Ursprüngen emotionaler Dispositionen hat aufgezeigt, dass diese Dispositionen eine starke biologische Basis besitzen. Während einige dieser Differenzen bereits mit der Geburt oder spätestens der frühen Kindheit festgelegt zu sein scheinen, entwickeln sich andere durch Prozesse des Lernens und der Sozialisation, oft allerdings in Interaktion mit angeborenen Dispositionen. Die Erkenntnis, dass emotionale Prozesse eine starke biologische Verankerung aufweisen, hat auch unmittelbare Konsequenzen für deren empirische Erfassung. Deshalb wird eine größere Zahl von Studien vorgestellt, in denen individuelle Unterschiede im emotionalen Reagieren nicht nur über Selbstberichte der Probanden (Fragebogen), sondern auch über psycho- und neurophysiologische Messansätze erfasst werden.
Die Autoren haben vielen für ihren Beitrag zur Fertigstellung dieses Buches zu danken. Boris Egloff, Volker Hodapp, Lothar Laux und Andreas Schwerdtfeger haben zu einzelnen Kapiteln kritische Rückmeldungen und wesentliche Anregungen gegeben. Claudia Müller und Amara Otte haben bei der technischen Bearbeitung des Manuskripts geholfen. Allen, die durch ihre Hilfe dazu beigetragen haben, dass dieser Band erscheinen konnte, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Mainz, im September 2013
Heinz Walter Krohne
Anja P. Tausch
1 Definition, Geschichte, Problemstellungen
1.1 Definition
In den Wissenschaften vom Verhalten haben Emotionen schon immer eine bedeutende Rolle gespielt. Dies gilt insbesondere für die Psychologie, die dem Aspekt des Verhaltens (einschließlich bestimmter biologischer Reaktionen des Organismus) noch den des Erlebens als zentrale Ebene der wissenschaftlichen Analyse an die Seite stellt. Entsprechend war die Frage, was eigentlich unter einer Emotion zu verstehen ist, von Anfang an ein wichtiges Thema der Emotionsforschung (James, 1884).
Gewöhnlich erwartet man, dass am Anfang der Erforschung eines Gegenstands dessen Definition steht. Für den Fall der Emotion begegnen wir hier allerdings einer Reihe von Schwierigkeiten (vgl. Frijda, 1986; Scherer, 1990). Zunächst einmal findet sich für emotionale Phänomene eine Vielzahl von sprachlichen Begriffen, z. B. Emotion, Gefühl, Affekt oder Stimmung, die sich allerdings nicht auf identische Sachverhalte beziehen, sondern in ihrer Bedeutung nur mehr oder weniger stark überlappen. Darüber hinaus besteht keine Übereinstimmung darin, welche Phänomene überhaupt als emotional anzusprechen sind. Während etwa bei Wut, Angst oder Freude Einigkeit herrscht, dass wir es hier mit Emotionen zu tun haben, gehen die Meinungen bei Phänomenen wie Überraschung, Interesse oder Verwirrung auseinander (Lazarus, 1991). Schließlich existieren unter Emotionsforschern sehr unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich Anzahl und Strukturierung von Emotionen. Dementsprechend verwundert es nicht, dass Emotion auf sehr verschiedenartige Weise definiert wird. So haben etwa Kleinginna und Kleinginna (1981) in einer Übersicht mehr als hundert Definitionen dokumentiert.
Die Quellen dieser fehlenden Übereinstimmungen liegen in unterschiedlichen theoretischen Auffassungen und damit Konzeptbildungen über die Natur des zugrunde liegenden Phänomens. Deshalb ist es auch unrealistisch, als Ausgangspunkt der Erforschung eines bestimmten Sachverhalts zunächst dessen (verbindliche und möglichst umfassende) Definition zu erwarten. Eine derartige Definition ist immer an theoretische Annahmen gebunden und kann erst am Ende des Prozesses der Ausarbeitung einer entsprechenden Theorie geliefert werden.
Dennoch muss man die Darstellung zu einem Forschungsgebiet natürlich mit einer Bestimmung des zentralen Gegenstands der Analyse beginnen. In eine derartige »Arbeitsdefinition« müssten folgende Bestimmungsstücke eingehen (vgl. Lazarus, 1991; Scherer, 1990, 2005): (1) Emotionen bezeichnen Veränderungen in bestimmten Systemen des Organismus, die sich relativ schnell vollziehen und von eher kürzerer zeitlicher Erstreckung sind. (2) Diese Veränderungen werden ausgelöst durch die Bewertung eines externen oder internen Vorgangs als sehr bedeutsam für die Ziele und Bedürfnisse des betreffenden Organismus. (3) Bei den Systemen handelt es sich nach Scherer (1990, 2005) um die Informationsverarbeitung, Versorgung, Steuerung, Aktion und Überwachung. Die Veränderungen sollen im Zustand einer ausgelösten Emotion aufeinander bezogen sein, also synchronisiert erfolgen.
Im System der Informationsverarbeitung vollzieht sich die Bewertung interner und externer Ereignisse im Hinblick auf die Frage, ob diese für den Organismus wichtige Veränderungen signalisieren. Das Versorgungssystem dient der Energetisierung und Regulierung der mit einer Emotion verbundenen Handlungen. Die Steuerung leistet die Planung dieser Handlungen. Das Aktionssystem dient dem Ausdruck und der Kommunikation von emotionsbezogenen Reaktionen. Das Überwachungssystem kontrolliert und reflektiert die aktuellen Zustände der anderen Systeme. Subjektiv äußert sich die Aktivität dieses Systems als spezifischer Gefühlszustand. Entsprechend der Bestimmung dieser Subsysteme schlägt Scherer (1990, S. 6) folgende Arbeitsdefinition von Emotion vor:
»Emotionen bestehen aus der Abfolge von aufeinander bezogenen, synchronisierten Veränderungen in den Zuständen aller fünf organismischen Subsysteme. Diese Veränderungen werden ausgelöst durch die Bewertung eines externen oder internen Reizes als bedeutsam für die zentralen Bedürfnisse und Ziele des Organismus.«
Die sich in diesen Systemen vollziehenden Arbeitsprozesse sind an unterschiedliche Komponenten der Emotion gebunden. Damit lassen sich diese Prozesse über verschiedene emotionsrelevante Parameter erfassen. Generell kann man biologische, verhaltensmäßig-expressive und subjektive (bzw. kognitive) Parameter unterscheiden.
Prozesse der Informationsverarbeitung basieren vorwiegend auf der kognitiven Komponente der Emotion und werden deshalb in der Regel über subjektive Parameter (Selbstberichte) operationalisiert. Daneben ist aber auch eine Erfassung über objektive Verfahren möglich, deren Messintention (wie etwa bei vielen Reaktionszeitaufgaben) für den Probanden nicht durchschaubar ist. Gerade für Emotionen mit hoher Bedeutung für das Überleben des Organismus, z. B. Furcht, muss man aber auch mit der Beteiligung automatisierter, also nichtkognitiver, Prozesse rechnen. Derartige Prozesse, deren adaptive Funktion darin besteht, dass sie sehr schnell zu einer Verhaltensauslösung (z. B. Flucht) führen, werden im Wesentlichen durch subkortikale Strukturen, insbesondere die Amygdala, gesteuert (Öhman & Mineka, 2001). Das Versorgungssystem basiert dagegen auf neuroendokrinen Prozessen und einer Aktivierung des autonomen Nervensystems und wird über entsprechende Messmethoden erfasst. Aspekte der Steuerung lassen sich sowohl über subjektive Daten als auch über Verhaltensbeobachtung registrieren. Das Aktionssystem wird in erster Linie über verhaltensmäßig-expressive Daten, insbesondere aus dem Ausdruckverhalten, operationalisiert. Das Überwachungssystem, das sich, wie erwähnt, in bestimmten Gefühlszuständen manifestiert, lässt sich primär über Selbstberichte, daneben aber auch über Fremdbeobachtung, erfassen. (Zu Messmethoden s. Kap. 2 sowie Krohne, 2010; Krohne & Hock, 2007.)
1.2 Historischer Hintergrund
In diesem Buch geht es um ein spezielles Thema der Emotionsforschung, die Beziehung zwischen Persönlichkeit und Emotionen. Wir stellen hier die Frage nach der Existenz überdauernder Persönlichkeitsmerkmale in Bezug auf die Emotionalität des Menschen. Dieser persönlichkeitspsychologische Ansatz befasst sich also mit verschiedenen Aspekten der individuellen Unterschiedlichkeit emotionaler Funktionen und der Bestimmung von Persönlichkeitsdimensionen innerhalb des emotionalen Reagierens und der Regulation von Emotionen.
Dieses Thema hat in der Geschichte der Psychologie eine lange Tradition. Seit Emotionen wissenschaftlich erforscht werden, hat man auch über ihre Beziehung zu anderen Merkmalen des Individuums nachgedacht. Bereits in der Antike spekulierten Hippokrates (ca. 460–370) und nach ihm Galen (ca. 129–200) über den Einfluss chemischer Vorgänge im Körper (die sog. Körpersäfte oder »humores«) auf die Ausprägung der Temperamente sanguinisch, melancholisch, cholerisch und phlegmatisch, die wiederum die persönlichkeitsspezifische Grundlage emotionalen Verhaltens bilden sollten. Diese antike Spekulation beeinflusste ganz wesentlich die Philosophie, Kunst, Literatur und Medizin der frühen Neuzeit. So hat etwa Kant (1798/1964) in seinem Werk »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht« die Vorstellung dieser vier Temperamente wieder aufgenommen und im Hinblick auf ihre Bedeutung als emotionale Grundlage der Persönlichkeit ausführlich beschrieben. Dabei stellte er auch bereits Überlegungen zu den Beziehungen innerhalb dieser vier Temperamente an (Kant, 1798, S. 262).
Auch in der modernen Psychologie hat diese antike Temperamentlehre in ihrer Wiederaufnahme durch Kant Spuren hinterlassen. So unterscheidet Wundt (1903) Menschen hinsichtlich Schnelligkeit und Intensität der Gefühlsentstehung. Die durch Kombination von jeweils zwei Ausprägungen dieser Dimensionen (schnell/langsam bzw. stark/schwach) resultierende Ordnung personspezifischer Emotionalität entspricht dabei im Wesentlichen den vier Temperamenten des Hippokrates. So sollen etwa Choleriker durch eine schnell ausgelöste und starke Gefühlsentstehung gekennzeichnet sein, während Phlegmatiker durch das entgegengesetzte Reaktionsmuster beschrieben werden. In der neueren Persönlichkeitsforschung bezieht Eysenck (1967) seine zentralen Dimensionen Extraversion-Introversion und Emotionale Labilität-Stabilität (Kap. 5) ausdrücklich auf die antike Temperamentlehre in ihrer Reformulierung durch Wundt. Dabei sollen hohe Ausprägungen in Labilität und Extraversion dem cholerischen, in Labilität und Introversion dem melancholischen, in Stabilität und Introversion dem phlegmatischen und in Stabilität und Extraversion dem sanguinischen Temperament entsprechen (vgl. Eysenck & Eysenck, 1985, Figure 8).
1.3 Frühe naturwissenschaftliche Ansätze: Darwin, Freud, James, Cannon
Auch wenn die antike Temperamentlehre und ihre neueren Rekonstruktionen im Lichte der modernen Physiologie, Endokrinologie oder Persönlichkeitspsychologie als zu starke und damit unangemessene Vereinfachungen erscheinen, so ist es doch unbestritten, dass Intensität, Dauer und Qualität ausgelöster Emotionen wesentlich von bestimmten Charakteristika der betreffenden Person abhängen (Frijda, 1986; Watson, 2001). Emotionen sind also nicht nur Funktion der konkreten Situation, sondern werden immer auch durch Merkmale der einzelnen Person determiniert (Arnold, 1960; Lazarus, 1991). Diese Überzeugung findet sich implizit bereits bei Darwin (1872/1965), der den Emotionen eine adaptive Funktion innerhalb der Evolution zuweist. Eine derartige Annahme ist aber letztlich nur sinnvoll, wenn gleichzeitig stabile individuelle Differenzen bei emotionalen Reaktionen betrachtet werden. Was sich im Gefolge der Evolution an Verhaltensmustern herausgebildet hat, darf also nicht nur im Hinblick auf Beziehungen zwischen den Arten, sondern muss auch in Begriffen interindividueller Unterschiede innerhalb einer Art gesehen werden. Derartige Unterschiede sind nämlich das einzige Material, an dem die Selektion systematisch ansetzen kann (vgl. auch Merz, 1984).
Noch deutlicher wird der Bezug zur Persönlichkeit, wenn man die Rolle der Emotionen bei psychopathologischen Erscheinungen analysiert. So ist im Werk Freuds, beginnend mit seinen ersten Arbeiten zur Hysterie und Angstneurose (Freud, 1893/1971b, 1895/1971c), die Beziehung zwischen Persönlichkeit und Emotionen ein zentrales Thema. Für Freud enthalten Emotionen stets Elemente, die über die unmittelbar gegebene Situation hinausreichen (z. B. personspezifische, d. h. dispositionell determinierte Bewertungen) und so gewissermaßen verschiedene Situationen für eine Person verbinden. Die Person trägt diese Elemente in die Situation hinein, so dass die Emotion zwar durch die Situation ausgelöst wird, eine wesentliche Determinante aber im Individuum liegt (vgl. Funder, 2008).
Das Interesse an Persönlichkeitsunterschieden trat zurück mit dem Aufkommen einer primär an physiologischen Prozessen orientierten Emotionsforschung (z. B. Dunlap, 1928). Die Kontroverse um die Theorien von James (1884, 1890) bzw. Lange (1887) und Cannon (1927) ließ wenig Raum für eine differentialpsychologische Betrachtung. Erst die Aufdeckung vergleichsweise stabiler interindividueller Unterschiede im Muster neurophysiologischer Reaktionen durch Wenger (u. a. 1941; vgl. auch Freeman & Pathman, 1942) und deren systematische Erforschung in den Arbeitsgruppen von Lacey (Lacey, 1950; Lacey & Lacey, 1958) und Malmo (Malmo & Shagass, 1949) verstärkten wiederum das Interesse an Persönlichkeitsmerkmalen. Hinzu kam, dass bei der Analyse der Reaktionen auf extreme Stressbelastung, insbesondere im Zusammenhang mit Ereignissen des Zweiten Weltkriegs (vgl. Eysenck, 1944; Grinker & Spiegel, 1945; Janis, 1951), die Bedeutung interindividueller Unterschiede erneut deutlich wurde.
Diese Entwicklung wurde durch das Aufkommen neuerer biopsychologischer Theorien weiter verstärkt. Im Hinblick auf Emotionen wird in derartigen Ansätzen gefragt, welche biologischen Strukturen und Prozesse für die Auslösung aktueller Emotionen wie auch für die Ausprägung vergleichsweise stabiler individueller Unterschiede im emotionalen Erleben und Verhalten verantwortlich sein könnten. Die Theorien ziehen neuroanatomische, neurophysiologische und biochemisch-endokrine Parameter heran, um individuelle Unterschiede bei der Neigung zu bestimmten emotionalen Reaktionen (z. B. Angst) zu erklären. Wichtige Vertreter dieser Richtung sind Eysenck (1967; vgl. auch Eysenck & Eysenck, 1985), Gray (1982; vgl. auch Gray & McNaughton, 2000), Cloninger (1986) sowie Zuckerman (1991). Neuere speziell neurowissenschaftlich fundierte Ansätze wurden u. a. von Davidson (1998a; 2000), LeDoux (1996) und Panksepp (1998) vorgestellt. Übersichten über derartige biopsychologische Ansätze finden sich u. a. in Hennig und Netter (2005a), Stelmack (2004) und Stemmler (2002).
1.4 Problemstellungen und Perspektiven
Wallbott und Scherer (1985) beschreiben vier Problemstellungen, um die die gegenwärtige Emotionsforschung zentriert ist: die Analyse der Rolle antezedenter Situationen bei der Emotionsauslösung, den Nachweis differentieller Emotionsmuster für diskrete Emotionen, die Identifizierung personspezifischer Reaktionsmuster sowie die Frage nach der Kontrolle und Regulation von Emotionen in sozialen Interaktionen. Es ist offensichtlich, dass diese Fragestellungen auch einen Bezug zur Persönlichkeitsforschung haben.
Was die Rolle antezedenter Situationen betrifft, so hängt die Beantwortung der Frage nach der Rolle von Personmerkmalen davon ab, ob Situationen mittels objektiver oder subjektiver Parameter erfasst werden (vgl. Krohne, 1990; Lazarus, 1990, 1991, 2005; Magnusson & Stattin, 1982). Bei Verwendung objektiver Kriterien wird die Situation durch ökologische, räumliche, geographische, architektonische oder organisationsbezogene Strukturen beschrieben, unabhängig davon, wie das betroffene Individuum die jeweiligen Merkmale interpretiert. (Für die objektive Bestimmung von Situationen vgl. u. a. Levi & Andersson, 1975; Levine & Scotch, 1970; McGrath, 1970; Mechanic, 1975.) Subjektive Kriterien beziehen sich auf die »psychologische« Situation, d. h. die Art und Weise, wie eine Person ihre physikalische oder soziale Umwelt wahrnimmt. Wesentliche Dimensionen sind hier etwa die erlebte Kontrollierbarkeit einer Situation (Averill, 1973; Seligman, 1975) sowie die antizipierten Konsequenzen von Ereignissen und eigenen Verhaltensweisen (vgl. u. a. Bandura, 1977; Mischel, 1973). Proponenten dieses auf Lewin (1935) zurückgehenden Ansatzes sind u. a. Bandura (1997), Lazarus (1991; Lazarus & Launier, 1978) und Mischel (1973; Mischel & Shoda, 2008).
Für die subjektive Konzeptualisierung situativer Antezedenzien von Emotionen liegt die Bedeutung von Personmerkmalen auf der Hand. So werden beispielsweise hochängstliche Personen viele Situationen (z. B. Prüfungen) im Hinblick auf Kontrollierbarkeit und Konsequenzen anders interpretieren und damit vermutlich in ihnen auch emotional anders reagieren als niedrigängstliche (Kap. 7 sowie Krohne, 2010). Aber auch bei objektiver Situationsbeschreibung sollte die Einbeziehung von Persönlichkeitsvariablen die Güte der Verhaltensvorhersage erhöhen. Selbst wenn beispielsweise zwei Personen eine Stresssituation im Sinne der genannten Strukturen gleich interpretieren, müssen ihre emotionalen Reaktionen noch nicht identisch sein. Personmerkmale wie Stressresistenz (Hardiness; Kobasa, 1979; Kap. 9) oder die unterschiedliche Verfügbarkeit über Bewältigungsressourcen (z. B. die Fähigkeit, soziale Unterstützung zu erlangen; vgl. z. B. Cohen & Wills, 1985; Sarason & Sarason, 1982) sollten hier einen moderierenden Einfluss haben.
Die zweite von Wallbott und Scherer genannte Problemstellung bezieht sich auf die Kontroverse zwischen Vertretern einer allgemeinen Aktivierungstheorie und Proponenten eines Modells diskreter Emotionen. Für Vertreter der ersten Richtung (u. a. Duffy, 1962) ist unterschiedliches emotionales Erleben im Wesentlichen Ausdruck kognitiver (attributiver) Prozesse auf der Basis erhöhter, jedoch unspezifischer allgemeiner Erregung (Schachter & Singer, 1962; vgl. auch Reisenzein, 1983). Nach dem Modell diskreter Emotionen (Ekman, 1999; Izard, 2007; Plutchik, 1980; Scherer, 2005) soll sich dagegen eine begrenzte Zahl von Emotionen auf verschiedenen Erhebungsebenen (biologischer, verhaltensmäßig-expressiver, subjektiver) unterscheiden lassen. Neuere Forschungen speziell aus dem Bereich der Neuropsychologie konnten eine höchst komplexe Vernetzung der verschiedenen an der emotionalen Aktivierung beteiligten neuroanatomischen Strukturen nachweisen. Die Beschreibung der auf diesen verschiedenen Strukturen basierenden qualitativ unterschiedlichen Reaktionsmuster (vgl. u. a. Stemmler, 2004) lässt damit eine eindimensionale Konzeption von Aktivierung als wenig fundiert erscheinen.
Auch von Seiten der Persönlichkeitsforschung könnte in mehrfacher Hinsicht ein Beitrag zur Klärung dieser Kontroverse geleistet werden. So wäre etwa zu beachten, dass Menschen offenbar in unterschiedlichem Ausmaß dazu in der Lage sind, ihre physiologische Erregung wahrzunehmen und in spezifisches emotionales Erleben (Blascovich, 1990; Katkin, 1985) bzw. Verhalten (Sifneos, 1973) umzusetzen (Interozeptionsfähigkeit,Kap. 4). Darüber hinaus müssten auch die Entwicklungsbedingungen der Emotionalität differentiell erforscht, also die interindividuell variablen Lernbedingungen für emotionales Erleben und Verhalten in Beziehung gesetzt werden zur späteren emotionalen Entfaltung (u. a. Dunn, 2004; Lewis & Saarni, 1985; Saarni & Harris, 1989).
Der dritte Komplex, die personspezifischen Reaktionsmuster, spricht unmittelbar die Persönlichkeitsforschung an. Dabei lassen sich zwei Zugangsweisen unterscheiden. In einem primär deskriptiven Zugang werden interindividuelle Differenzen im emotionalen Reagieren betrachtet und auf transtemporale und transsituative Konsistenz hin überprüft. Bei einer eher explikativen Betrachtung wird demgegenüber nach den persönlichkeitsspezifischen Ursachen vergleichsweise stabiler individueller Differenzen bei einzelnen emotionalen Reaktionen (z. B. Angst) gesucht.
Der vierte Problembereich, die Analyse sozialer Kontrolle und Regulation von Emotionen, kann sowohl stimulus- als auch personbezogen (oder im Hinblick auf die Interaktion zwischen beiden) betrachtet werden. Mit Konzepten wie »feeling rules« (Ekman & Friesen, 1975) oder »display rules« (Hochschild, 1979; Saarni, 1985) wird der interaktive Aspekt betont. Feeling rules beziehen sich dabei auf die vom Individuum erlebte Notwendigkeit, eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen seinem momentanen Gefühlszustand und dem für bestimmte Situationen normativ geforderten Zustand durch bestimmte Techniken der Emotionsregulierung zu verringern. Display rules beschreiben demgegenüber das durch individuelle Überzeugungen gesteuerte Bemühen einer Person, bestimmte Gefühlzustände durch unterschiedliche Techniken (u. a. Abschwächung, Hemmung, Dissimulation oder Verstärkung) darzustellen.
1.5 Plan des Buches
Bei der Analyse der Beziehung zwischen Persönlichkeit und Emotionen lassen sich, wie erwähnt, zwei Zugangsweisen unterscheiden. Arbeiten wie die von Lacey (1950) oder Malmo und Shagass (1949) sind primär um Reaktionsunterschiede zentriert; d. h., individuelle Unterschiede bei emotionsbezogenen Prozessen und Reaktionen (z. B. in der Herzrate) werden als vergleichsweise stabile Persönlichkeitsmerkmale betrachtet (vgl. Fahrenberg, 1986). Derartige Ansätze verzichten also zunächst auf eine persönlichkeitstheoretische Erklärung dieser Differenzen. Dieser Zugang wird deshalb als deskriptiv bezeichnet. In den erwähnten Arbeiten Freuds (aber auch in dem eingangs angesprochenen Modell Eysencks) werden dagegen Persönlichkeitsmerkmale theoretisch bestimmt (z. B. die Persönlichkeitsdisposition Extraversion oder die Tendenz zu bestimmten Angstabwehrmechanismen) und sodann zu Vorhersagen und Erklärungen interindividueller Unterschiede bei emotionalen Reaktionen und damit zusammenhängenden Verhaltensweisen (z. B. Angst und Vermeidung) herangezogen. In diesen Ansätzen geht es also nicht in erster Linie um die Beschreibung emotionsrelevanter Reaktionsunterschiede, sondern um das Aufzeigen von Verursacherunterschieden. Wir nennen diesen Zugang, der häufig auch Interaktionen von Person und Situation einschließt (vgl. Funder, 2008), deshalb explikativ.
Eine in jüngster Zeit verstärkt verfolgte Variante innerhalb des explikativen Zugangs kritisiert insbesondere das einfache Ursache-Wirkungsdenken bei der Analyse der Beziehung zwischen Persönlichkeit und Emotionen. Tatsächlich herrschen hier, wie insbesondere in der Stressforschung deutlich wird, komplexe Interaktionen und Rückmeldungen zwischen Situation, Person und Emotionen (Krohne, 2010; Lazarus & Launier, 1978; Stemmler, 2002). Persönlichkeit könnte hier, wie schon die frühen Forschungen zu individuellen Differenzen bei Reaktionen auf extreme Stressereignisse andeuteten (z. B. Janis, 1951), eine Moderatorfunktion im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen emotionsauslösendem Ereignis und resultierenden Emotionen einnehmen.
Wir beginnen mit verschiedenen Ansätzen zur Messung emotionsbezogener Merkmale (Kap. 2). Sodann werden (biologische und psychologische) Dimensionen vorgestellt, die interindividuelle Reaktionsunterschiede als Persönlichkeitsmerkmal konzipieren, also eher eine deskriptive Orientierung erkennen lassen (Kap. 3 und 4). Die in diesen beiden Kapiteln darzustellenden Konstrukte bilden, über die Einteilung in biologische und psychologische Ansätze hinaus, eine recht heterogene Gruppe. Einige sind hinsichtlich ihres Beitrags zur aufgeklärten Varianz beobachteter Daten sehr eng angelegt (z. B. der Zirkadiane Rhythmus oder die Alexithymie), andere sind empirisch auf eine Vielzahl erlebnis- und verhaltensmäßiger Dimensionen bezogen (z. B. der Affektive Stil). In einigen Konstrukten drücken sich unmittelbar individuelle Differenzen in der Emotionalität aus (etwa, auf biologischer Ebene, in der Hemisphären-Asymmetrie oder, auf psychologischer Ebene, in der Emotionalen Expressivität). Andere sind dagegen nur indirekt auf individuelle Unterschiede in der Emotionalität bezogen, und zwar über Variablen, die das emotionale Erleben beeinflussen, wie z. B. die Wahrnehmung viszeraler Aktivitäten bzw. körperlicher Symptome (Interozeption). Einige Konzepte sind eindeutig deskriptiv (z. B. die Individualspezifischen Reaktionsmuster), während andere (z. B. die Emotionale Intelligenz oder die Emotionale Expressivität) eng auf weitere Persönlichkeitskonstrukte bezogen sind und damit auch eine gewisse erklärende Funktion besitzen.
Danach wechselt die Perspektive zum explikativen Zugang. Es wird aufgezeigt, wie bestimmte theoretische Konstruktionen zur Erklärung interindividueller Differenzen bei emotionalen Reaktionen und damit zusammenhängenden Verhaltensweisen herangezogen werden (Bates, Goodnight & Fite, 2008). Zunächst werden mit den Ansätzen von Eysenck und Gray zwei wesentliche Theorien zu emotionalen Persönlichkeitsmerkmalen beschrieben (Kap. 5). Danach folgen Kapitel zu zentralen emotionsrelevanten Spektren der Persönlichkeit. Diese lassen sich nach der zentrale Valenz (positiv, negativ, antisozial) derjenigen Emotionen klassifizieren, die im Mittelpunkt dieser einzelnen Konstrukte stehen. Dementsprechend werden diese drei Spektren Positive Emotionalität (Kap. 6), Negative Emotionalität (Kap. 7) und Antisoziale Emotionalität (Kap. 8) genannt. Kap. 9 erweitert diesen Ansatz. Persönlichkeitsmerkmale werden nunmehr als Moderatoren der Beziehung zwischen Umweltereignissen und emotionalen Verhaltensweisen betrachtet. Dieser Ansatz geht von der Annahme aus, dass ein bestimmtes Ereignis nicht bei allen, sondern nur bei spezifisch disponierten Personen emotionale Reaktionen hervorruft. Behandelt werden hier u. a. Ansätze wie Kontrollüberzeugung, Optimismus, Kontrollbedürfnis und Typ A-Verhaltensmuster sowie Stressanfälligkeit versus Stressresistenz. Im Gegensatz zu den in den Kap. 6 bis 8 vorgestellten Konstrukten, die explizit auf die Manifestation einer bestimmten Emotion hin konzipiert worden waren (Ängstlichkeit etwa im Hinblick auf die Auslösung aktueller Angst), sind die in Kap. 9 zu behandelnden Merkmale nicht per se über bestimmte Emotionen definiert. Vielmehr kommt es hier nur beim Zusammentreffen bestimmter Situations- und Personenmerkmale zur Auslösung einer spezifischen Emotion. So wird beispielsweise die Konfrontation mit Schwierigkeiten bei der Lösung eines wichtigen Problems nur bei Personen mit einer geringen Ausprägung in Optimismus zu Verzweiflung und Resignation führen.
Im abschließenden Kap. 10 werden die vorgestellten theoretischen Ansätze zunächst kritisch bewertet. Anschließend wird der Versuch einer Integration zentraler Annahmen und empirischer Befunde unternommen. Schließlich wird ein Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf und mögliche Anwendungen der gesicherten Ergebnisse in diesem Gebiet gegeben.
2 Die Messung emotionsbezogener Merkmale
2.1 Emotionsbezogene Konstrukte und ihre empirische Erfassung
Aktuelle emotionale Zustände wie auch emotionsbezogene Persönlichkeitsmerkmale lassen sich auf drei »Ebenen«, der subjektiven (erlebnisdeskriptiven), verhaltensmäßig-expressiven und biologischen (physiologischen), empirisch erfassen (vgl. etwa Krohne, 2010; Krohne & Hock, 2007). Diese Bestimmung mag zunächst unmittelbar einleuchten, ist jedoch tatsächlich mit einer Reihe von Vorbehalten verbunden: (1) Man muss sich darüber im Klaren sein, dass weder der aktuelle emotionale Zustand als solcher noch ein emotionsbezogenes Persönlichkeitsmerkmal unmittelbar beobachtet werden können. (2) Die sog. »Drei-Systeme-Strategie« (Lacey, 1967; Lang, Rice & Sternbach, 1972) der Organisation emotionsbezogener Variablen berücksichtigt nicht, dass zu jeder der drei Ebenen sehr viele und sehr unterschiedlich operierende Systeme beitragen. (3) Diese einzelnen Systeme weisen selbst innerhalb einer Ebene und erst recht zwischen den einzelnen Ebenen meist nur eine geringe Kovariation auf, so dass es unzulässig ist, Emotionalität auf nur einer Ebene und dort nur durch jeweils einen Indikator (etwa den Selbstbericht) beschreiben zu wollen. Auf jeden dieser Vorbehalte soll im Folgenden etwas ausführlicher eingegangen werden.
(1) Emotionsbezogene Zustände und Persönlichkeitsmerkmale können nicht unmittelbar beobachtet werden. Registrieren kann man immer nur bestimmte Phänomene, beispielsweise, dass jemand in einer bestimmten Situation schwitzt, stottert, errötet oder sagt, dass er »aufgeregt« sei. Objektiv feststellen kann man auch, dass eine Person in einem bestimmten Fragebogen einzelne Feststellungen bejaht und andere verneint. Alle diese Phänomene können im Prinzip von jedem Beobachter in gleicher Weise registriert werden. Das heißt nun aber nicht, dass damit auch schon die Bedeutung dieser Phänomene festliegt. Um dem Beobachteten seine theoretische Bedeutung zu verleihen, führt die Psychologie gedankliche Konstruktionen ein, die sog. theoretischen Konstrukte. Wichtige Konstrukte der Psychologie sind Intelligenz, kognitive Stile und eben auch emotionsbezogene Sachverhalte wie Ärger, Trauer oder Angst und die entsprechenden Persönlichkeitsmerkmale Ärgerneigung, Depressivität oder Ängstlichkeit. Konstrukte sind Theorien über einen bestimmten Sachverhalt, z. B. Ängstlichkeit, der in verschiedenen Beobachtungssituationen (also auch in unterschiedlichen Erhebungsverfahren) relevant wird. Aus der Perspektive des Konstrukts fungieren diese Situationen bzw. Verfahren als dessen empirische Indikatoren, d. h., sie operationalisieren bestimmte Konstruktaussagen.
Ein theoretisches Konstrukt ist dabei niemals mit nur einem »Strang« in der Welt beobachtbarer Phänomene verankert (vgl. Krohne, 2010). Das Konstrukt Ängstlichkeit etwa ist also nicht identisch mit Reaktionen in einem bestimmten Angstfragebogen. Vielmehr ist ein Konstrukt auf eine mehr oder weniger große Zahl unterschiedlicher Phänomene bezogen, z. B. Antworten in verschiedenartigen Testverfahren, klinische Diagnosen, von Beobachtern registrierte Verhaltensäußerungen oder Reaktionen in psychophysiologischen Messanordnungen. Die Bedeutung eines theoretischen Begriffs wie Ängstlichkeit ergibt sich dann aus dem Ort, den dieser in einem sich herausbildenden Netzwerk von Beziehungen, dem sog. »nomologischen Netz« (Feigl, 1958), einnimmt. Der Prozess der Entwicklung dieses Netzwerks ist niemals abgeschlossen. Ein Konstrukt bezeichnet nur die augenblicklich bekannte Konstellation in diesem Bereich. Konstrukte sind also durch »Bestimmungslinien« mit der Welt der beobachtbaren Phänomene verbunden. Anhand dieser Linien wird festgelegt, welche Elemente zur Klasse konstruktspezifischer Merkmale gehören.
(2) Die Drei-Systeme-Strategie zur Erfassung emotionsrelevanter Merkmale stellt eine starke Vereinfachung der tatsächlichen Manifestation von Emotionen dar. Der Ansatz berücksichtigt nämlich nicht, dass wir es nicht nur mit drei globalen, sondern mit sehr vielen, z. T. sehr spezifischen Systemen zu tun haben, die zudem, wie im nächsten Punkt angesprochen wird, häufig nur eine geringe Kovariation aufweisen. Besonders auf der Ebene der physiologischen Prozesse sind sehr unterschiedliche Systeme (z. B. kortikale, limbische oder kardiovaskuläre) an der Manifestation von Emotionen beteiligt. Ähnliches gilt für die verhaltensmäßig-expressive Ebene, wobei hier noch hinzukommt, dass die einzelnen Systeme in ihrem Operieren von der betreffenden Person in unterschiedlichem Maße gesteuert werden können. So ist etwa verbales Verhalten besser steuerbar als die Körperhaltung oder das Ausdrucksverhalten.
(3) Innerhalb einer Ebene weisen die Indikatoren von Emotionalität häufig nur geringe Kovariationen auf. Dies gilt insbesondere für die biologischen (physiologischen) und verhaltensmäßig-expressiven Variablen, während die Indikatoren auf subjektiver Ebene, also die Selbstbeurteilungen der Emotionalität, untereinander generell recht ausgeprägte Zusammenhänge zeigen. Allerdings sind die auf der subjektiven Ebene erhobenen Daten mit den Daten aus den beiden anderen Ebenen meist nur sehr schwach korreliert (vgl. Myrtek, 1998). Dieser Sachverhalt zwingt zu einer multimodalen Diagnostik von Emotionen (Fahrenberg & Wilhelm, 2009). Bei den subjektiven Beschreibungen von Emotionen kommen dabei insbesondere Fragebogen und Eigenschaftslisten zum Einsatz. Verhaltensmäßig-expressive Reaktionen manifestieren sich in Mimik, Vokalisation, motorischen Reaktionen, nonverbalen Erregungsanzeichen sowie bestimmten verbalen Indikatoren. Bei der Registrierung physiologischer Prozesse werden zentralnervöse, peripherphysiologische, muskuläre, endokrine sowie immunologische Parameter herangezogen (vgl. Krohne, 2010; Peper & Lüken, 2002).
Die nur geringen Kovariationen zwischen einzelnen Emotionsindikatoren und die sich daraus ableitende Notwendigkeit einer multimodalen Diagnostik verweisen zugleich auf Schwierigkeiten bei der Validierung dieser Indikatoren im Sinne des Multitrait-Multimethod-Ansatzes von Campbell und Fiske (1959; vgl. auch Krohne & Hock, 2007). Dieser Ansatz geht davon aus, dass die Korrelationen zwischen den aus verschiedenen Erhebungsmethoden (Ebenen) stammenden Indikatoren eines bestimmten Konstrukts (etwa der Emotion Angst) deutlich höher ausfallen sollen (konvergente Validität) als die Korrelationen zwischen den Indikatoren verschiedener Konstrukte (etwa der Emotionen Angst und Ärger) aus derselben Ebene (diskriminante Validität). Würde man bei einer derartigen Analyse z. B. Indikatoren für Angst und Ärger heranziehen und deren Korrelationen etwa für die physiologische und die subjektive Ebene vergleichen, so dürften sich Schwierigkeiten bei der Validitätsbestimmung dieser Indikatoren ergeben.
2.2 Physiologische Prozesse als Emotionsindikatoren
Von körperlichen Veränderungen im Zustand erhöhter Emotionalität sind das Zentralnervensystem (ZNS), das autonome (vegetative) Nervensystem(ANS), das muskuläre und endokrine System sowie das Immunsystem betroffen. Aus diesen Systemen lässt sich zur Erfassung unterschiedlicher emotionaler Zustände (z. B. Angst, Ärger, Trauer) eine Vielzahl von Parametern ableiten (vgl. Tab. 2.1), wobei deren Zahl mit zunehmender Erforschung bestimmter Systeme (z. B. des Immunsystems) stetig ansteigt. An dieser Stelle geht es jedoch nicht um eine möglichst umfassende Darstellung der Messung spezifischer emotionaler Zustände mit Hilfe physiologischer Indikatoren, sondern um solche Variablen aus biologischen Prozessen, die relativ stabile interindividuelle Unterschiede im emotionalen Reagieren in bestimmten Situationen reflektieren und deshalb zur Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen herangezogen werden können. Derartige Variablen wurden bislang insbesondere für das zentrale und autonome Nervensystem sowie für das endokrine System betrachtet. Deshalb konzentriert sich die folgende Darstellung auch auf diese Bereiche. (Detaillierte Darstellungen physiologischer Indikatoren emotionaler Zustände finden sich u. a. in Hennig, 1998; Hennig & Netter, 2005a; Larsen et al., 2008; Schandry, 2003; Vossel & Zimmer, 1998. Für eine frühe umfassende Beschreibung vgl. Cannon, 1914.)
Tab. 2.1: Wichtige physiologische Indikatoren emotionaler Zustände
Innerhalb des Zentralnervensystems (ZNS) gilt das limbische System als die zentrale Instanz für die Auslösung emotionaler Prozesse. Dieses System wurde insbesondere von Eysenck (1967) als biologische Basis seiner zentralen Dimension Emotionale Labilität-Stabilität in die Persönlichkeitsforschung eingeführt. Es handelt sich hier um ein komplexes System, das u. a. aus älteren Teilen des Kortex sowie aus den subkortikalen Strukturen Amygdala, Hypothalamus, Hippocampus und Septum besteht.
Die Zusammenfassung dieser unterschiedlichen Strukturen zu einem System wird heute von vielen Neurowissenschaftlern infrage gestellt, da die einzelnen Elemente dieses Systems, obwohl räumlich benachbart und vielfach verschaltet, weder in ihrem Aufbau noch in ihrer Funktion eine besondere Einheitlichkeit aufweisen. Stattdessen werden in der neueren Forschung mehrere Ebenen emotionaler Regulation unterschieden (Peper & Lüken, 2002). Zu diesen Ebenen gehören u. a. Systeme des Hirnstamms, das Zwischenhirn mit Beiträgen aus Thalamus, Hypothalamus, dem basalen Vorderhirn und dem Septum, die Amygdala und der Hippocampus sowie Bereiche des Präfrontalen Kortex (PFK bzw. PFC). Die Systeme auf der Ebene des Hirnstamms sind dabei mit der Auslösung von allgemeiner Erregung und der Kampf- und Fluchtreaktion (»fightflight«; Cannon, 1915) verbunden. Auf der Ebene des Zwischenhirns werden insbesondere die vegetativ-endokrinen Reaktionen sowie die Aufmerksamkeits- und Motivationsprozesse gesteuert. Amygdala und Hippocampus spielen die zentrale Rolle bei der automatisierten (d. h. sehr schnellen) Bewertung von Ereignissen als emotional bedeutsam (insbesondere bedrohlich) sowie bei entsprechenden assoziativen Lernprozessen, während durch die Funktionen des Kortex elaborierte Prozesse wie etwa die Emotionsregulation gesteuert werden.
Für die standardisierte Erfassung von Indikatoren emotionaler Aktiviertheit wurde in der psychophysiologischen Diagnostik eine Vielzahl von Paradigmen entwickelt. Diese entsprechen den etablierten Testverfahren der psychologischen Diagnostik, ohne allerdings deren Grad von Standardisiertheit schon vollständig zu erreichen (vgl. u. a. Fahrenberg & Wilhelm, 2009).
Indikatoren der Aktivität des ZNS werden in der Emotionsforschung durch Aufzeichnung des Elektroenzephalogramms (EEG) sowie durch bildgebende Verfahren gewonnen. Mit Hilfe des EEGs, mit dem wir uns als Erstes befassen wollen, können sowohl die Spontanaktivität des ZNS als auch durch kontrollierte Stimulation evozierte (ereigniskorrelierte) Potentiale registriert werden.
Bei der Spontanaktivität der Zellverbände der Hirnrinde (kortikale Aktivität) treten mehrere gut unterscheidbare Frequenzen auf, die in sog. Frequenzbänder eingeteilt werden. Wichtig für die Feststellung von Erregungszuständen ist die Beachtung zweier Frequenzbereiche, der Alphawellen mit großer Amplitude und einer Frequenz von 8 bis 12 Hz und der Betawellen mit geringerer Amplitude und einer Frequenz von 13 bis 30 Hz. Alphawellen dominieren das EEG im entspannten Wachzustand (bei geschlossenen Augen). Sie verschwinden bei Reizbeachtung oder jeder Form höherer Aktiviertheit und werden dann durch Betawellen ersetzt. Diese Alphablockade kann somit als Hinweis auf einen beginnenden emotionalen Erregungszustand angesehen werden. Zahlenmäßig ausgedrückt wird die Aktivität in diesem Frequenzband durch den Alphaindex, das ist der prozentuale Anteil von Alphawellen an der kortikalen Aktivität in einem bestimmten Zeitraum (etwa einer Minute). Ein niedriger Index ist somit ein Hinweis auf einen Erregungszustand. Weitere Frequenzbänder sind das Deltaband (1–3 Hz), das vorwiegend im Tiefschlaf beobachtet wird, und das Thetaband (4–7 Hz), das bevorzugt im Zustand des Dösens oder der Phase des Einschlafens auftritt.
Neben dieser Spontanaktivität erzeugt das ZNS auch bestimmte typische Potentialverläufe, die durch spezifische innere oder äußere Ereignisse hervorgerufen werden (evozierte bzw. ereigniskorrelierte Potentiale, EKP). Im Roh-EEG sind die EKP zunächst noch nicht zu erkennen, da ihre Fluktuationen deutlich geringer sind als die zufälligen EEG-Fluktuationen. Deshalb bedient man sich einer Mittelungstechnik, bei der die Reaktionen auf eine mehrmalige Darbietung desselben Reizes aufgezeichnet und dabei die zufälligen EEG-Schwankungen (Hintergrundrauschen) ausgemittelt werden. Dadurch treten nur die unmittelbar mit dem Reiz in Verbindung stehenden Spannungsänderungen hervor.
Das EKP besteht aus Einzelsegmenten in Form von Wellenbergen und -tälern (Komponenten), die üblicherweise einen charakteristischen Verlauf mit positiven (P) und negativen (N) Auslenkungen aufweisen. Nach der Polarität dieser Auslenkung (P bzw. N) und der mittleren Latenz (in msec) werden bestimmte charakteristische Komponenten unterschieden (z. B. N100 bzw. N1 für die negative Auslenkung nach durchschnittlich 100 msec; P300 bzw. P3 für die positive Auslenkung nach etwa 300 msec). Wenn die Potentiale von den physikalischen Eigenschaften externer Reize ausgelöst werden, spricht man von exogenen Komponenten. Im Gegensatz dazu meint endogene Komponente, dass die Potentiale stärker durch personinterne Faktoren, etwa Erwartungen oder Bewertungen, ausgelöst werden (Vossel & Zimmer, 1998). Das bedeutet also, dass diese Komponenten in Latenz und Amplitude nicht nur als Funktion der Stimulation variieren, sondern auch abhängen von bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, z. B. Ängstlichkeit, Extraversion oder Augmenting/Reducing (Kap. 6 und 7). So steht etwa eine niedrige Amplitude bei P3 für eine geringe (kortikale) Erregung (Hamm, Schupp & Weike 2003; Hennig & Netter, 2005a).
Zunehmende Bedeutung für die Emotionsforschung hat in den letzten Jahren die Analyse der Verteilung der Aktivitäten in den einzelnen Arealen des ZNS, speziell in den beiden Hirnhälften, erlangt (Kap. 3). Soweit es sich hier um Aktivitäten der Hirnrinde (des Kortex) handelt, lassen sich diese mit Hilfe des EEG registrieren. Eine Analyse der Aktivitäten tieferliegender Regionen des ZNS, etwa der besonders für die Auslösung von Angst und Furcht bedeutsamen Amygdala, ist aber nur mit Hilfe moderner bildgebender Verfahren möglich. Für die Zielsetzungen der Emotionsforschung haben sich dabei die Positronenemissionstomographie (PET) sowie die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) als besonders fruchtbar erwiesen. Diese Verfahren ermöglichen eine vollständig nichtinvasive Erfassung der Aktivitätsmuster im Gehirn mit großer raum-zeitlicher Auflösung. Beide Verfahren beruhen darauf, dass in einer Region mit erhöhter Aktivität der Nervenzellen der Sauerstoff- und Glucosebedarf steigt. Die betreffende Region wird dann als Folge einer Gefäßerweiterung vermehrt mit Blut versorgt. Diese Veränderung der regionalen Hirndurchblutung wird von beiden Verfahren, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise, erfasst. Mit PET und fMRT kann man also nicht nur, wie mit allen anderen bildgebenden Verfahren auch, beispielsweise der in der medizinischen Diagnostik wichtigen Computertomographie (CT), ein Bild von den Strukturen des ZNS gewinnen, sondern auch dessen wechselseitige Funktionszustände analysieren. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Veränderung der Hirndurchblutung nur in einem indirekten Zusammenhang mit der ja eigentlich interessierenden Aktivität an den Synapsen steht (vgl. Peper & Lüken, 2002).
Mit Hilfe dieser Methoden konnte u. a. nachgewiesen werden, dass bei Konfrontation mit aversiven Reizen (z. B. furchterregenden Bildern) bzw. im Zustand der Angst bestimmte Hirnareale besonders stark aktiviert sind. Bei positiven oder neutralen emotionalen Zuständen lässt sich dagegen eine andersartige Aktivitätsverteilung registrieren. Darüber hinaus scheinen auch stabile individuelle Aktivitätsunterschiede, etwa als Funktion der Disposition Ängstlichkeit, bei Konfrontation mit bestimmten Reizen zu bestehen.
Unter dem Begriff autonomes (vegetatives) Nervensystem (ANS) fasst man die sensiblen Neuronen der inneren Organe sowie alle effektorischen Nerven zusammen, die das Herz, die Blutgefäße, die glatte Muskulatur und die Drüsen versorgen. Das ANS wirkt nicht völlig autonom, sondern ist mit dem animalischen (somatischen) Nervensystem auf allen Schaltstufen des ZNS verbunden. So können Reize aus der Umwelt autonome Reaktionen hervorrufen. Umgekehrt können Aktivitäten der inneren Organe auch Einfluss auf die quergestreifte Muskulatur und die höheren Sinnesorgane nehmen.
Am ANS kann man einen zentralen und einen peripheren Anteil unterscheiden. Im Folgenden interessieren nur die Parameter des peripheren ANS. Dieses periphere ANS besteht aus zwei Subsystemen, dem parasympathischen und dem sympathischen Nervensystem. Fast alle Organe werden durch beide Subsysteme innerviert, jedoch fallen diesen dabei unterschiedliche Funktionen zu. Das parasympathische System ist in der Regel dann aktiviert, wenn der Organismus wenig belastet ist und vorherrschend Routinefunktionen (z. B. Verdauung) erfüllt. Die parasympathische Innervation der meisten inneren Organe geschieht durch einen (in der Medulla oblongata entspringenden) Hirnnerv, den Vagus. Das sympathische System ist dagegen meist dann dominant, wenn der Organismus belastet, z. B. bedroht wird. Dieses System hemmt Prozesse, die parasympathisch reguliert werden, um auf diesem Wege Energie für die aktuelle Bewältigung der Belastung bereitzustellen. Umgekehrt kann auch das parasympathische Nervensystem Prozesse hemmen, die sympathisch beeinflusst werden. Dies geschieht, wenn die sympathisch ausgelöste Erregung ein biologisch tragbares Niveau zu überschreiten droht. Parasympathisches und sympathisches Nervensystem sind also, oft in antagonistischer Weise, an einem biologischen Regulationsprozess beteiligt, wobei dem sympathischen System in erster Linie die Funktion der Aktivierung (etwa bei entsprechenden externen Aufgabenstellungen) und dem parasympathischen System im Allgemeinen die Funktion des Schutzes vor totaler Erschöpfung und damit die Bewahrung von Energien für lebensnotwendige Körperfunktionen zufällt.
Es ist nun seit langem bekannt, dass sich alle vom ANS kontrollierten Systeme bzw. Organe im Zustand der emotionalen Erregung im Sinne einer Sympathikusaktivierung verändern. Tab. 2.2 gibt eine Übersicht über die Auswirkungen der sympathischen Aktivierung auf verschiedene Organe. Aus diesen Systemen lässt sich mit vergleichsweise einfachen, den Probanden nur wenig beeinträchtigenden Methoden eine Vielzahl von Variablen zur Bestimmung der psychophysiologischen Aktivierung gewinnen. Als für die Emotionsmessung besonders geeignet haben sich dabei verschiedene kardiovaskuläre Reaktionen wie Herzrate, peripheres Blutvolumen und (systolischer und diastolischer) Blutdruck sowie verschiedene Parameter der elektrodermalen Aktivität wie Hautleitfähigkeitsniveau und Spontanfluktuationen erwiesen.
Tab. 2.2: Auswirkungen der sympathischen Aktivierung auf verschiedene Organe
Reaktion Auswirkung
Für die Emotionsforschung bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung von tonischen und phasischen Veränderungen. Tonische Veränderungen beziehen sich auf längerfristige Prozesse und sind damit geeignet, länger anhaltende (ja sogar vergleichsweise dauerhafte) emotionale Zustände anzuzeigen. Als phasisch werden kurzfristige Veränderungen eines Parameters bezeichnet, wie sie etwa bei der Reaktion auf einen dargebotenen Reiz auftreten können. Sie signalisieren die Beachtung einer Reizquelle durch das Individuum.
Unter den kardiovaskulären Parametern ist die Schlagfrequenz des Herzens (Herzrate, Herzfrequenz, Pulsfrequenz) mit Sicherheit der am häufigsten eingesetzte Indikator für emotionale Erregung. Diese Größe spricht sehr schnell (u. U. im Sekundenbereich) auf emotionale Belastung an und kann dabei einen beträchtlichen Anstieg (um ca. 40 Schläge pro Minute) aufweisen. Am einfachsten lässt sich die Herzrate, wie bei der Pulsmessung, über das Auszählen der Herzschläge pro Zeiteinheit feststellen. In der Forschung und der kontrollierten therapeutischen Praxis greift man jedoch meist auf die bioelektrischen Signale des Elektrokardiogramms (EKG) zurück. Beim EKG werden mittels eines an der Körperoberfläche (meist an der Brustwand zu beiden Seiten des Herzens) angebrachten Elektrodenpaares die elektrischen Spannungsänderungen erfasst, wie sie bei der sukzessiven Kontraktion der Herzmuskelzellen auftreten. An diesen Spannungsänderungen lassen sich mehrere Merkmale unterscheiden; für die Frequenzmessung genügt das Auszählen der sog. R-Wellen (R-Zacken), die bei der eigentlichen Pumpaktivität des Herzens (Systole) auftreten. Der Abstand zwischen zwei R-Zacken liefert das Herzschlagintervall (interbeat interval), das leicht in Herzschläge pro Minute umgerechnet werden kann. Ein weiteres in jüngster Zeit verstärkt beachtetes Maß kardiovaskulärer Aktivität ist die Herzratenvariabilität (HRV; Berntson et al., 1997). Hierunter wird das Ausmaß der Variation innerhalb der Abfolge von Herzschlagintervallen verstanden. Zur Bestimmung der HRV wurden verschiedene statistische Analysen vorgeschlagen, etwa Maße, die auf der Varianz dieser Intervalle beruhen (vgl. Appelhans & Luecken, 2006). Individuelle Unterschiede in der HRV, die schon bei Neugeborenen beobachtet werden können (Porges, Arnold & Forbes, 1973), sollen verbunden sein mit Prozessen der Emotionsregulation und Stressbewältigung, wobei höhere HRV-Werte effizientere Prozesse indizieren.
Ein anderer wichtiger Indikator emotionaler Belastung ist der Blutdruck. Hierunter wird der Druck verstanden, unter dem die Wände der Arterien während der Herzaktion stehen. Während eines Herzzyklus kommt es zu ausgeprägten Druckänderungen, bei gesunden Personen von ca. 80 mmHg während der Diastole auf ca. 130 mmHg während der Systole. Belastungen führen innerhalb weniger Sekunden zu einer deutlichen Blutdruckerhöhung (bis zu 30 mm Hg), so dass der (insbesondere systolische) Blutdruck ein sensibler Indikator derartiger Zustände ist.
Periphere Blutgefäße verengen sich unter psychischer Belastung, insbesondere bei Bedrohung (Vasokonstriktion). Für die Messung in der Psychophysiologie wird hier meist das Blutvolumen an einem Fingerglied erfasst (Fingerpulsvolumen). Das ist insofern vorteilhaft, als die Motorik hier ausschließlich sympathisch innerviert ist, also nicht den bereits erwähnten Regulationsprozessen unterliegt. Die Änderung der Blutmenge in einem Fingerglied wird photoelektrisch registriert. Je mehr Blut sich in einem bestimmten Areal befindet, desto geringer ist die an dieser Stelle durchgelassene Lichtmenge. Maßeinheit ist die Pulsvolumenamplitude, d. h. die Amplitude der mit jedem Herzschlag verbundenen Volumenschwankungen. Bei Vasokonstriktion, also bei emotionaler Erregung, nimmt diese Amplitude ab. Das Fingerpulsvolumen stellt mithin für die Messung bestimmter Emotionen (z. B. Angst) einen einfach zu erhebenden und brauchbaren Indikator dar.
Elektrodermale Aktivität (EDA) bezeichnet bioelektrische Erscheinungen innerhalb der Haut, die als Änderungen der Hautleitfähigkeit (bzw. umgekehrt des Hautwiderstands) und des Hautpotentials registrierbar sind. Diese Erscheinungen wurden bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschrieben und in ihrem Zusammenhang mit emotionalen Erscheinungen analysiert (vgl. Vossel, 1990). Die EDA soll Indikator eines aversiv orientierten motivationalen Systems sein, das auf Bestrafung und frustrierende Nichtbelohnung reagiert und damit insbesondere negative Emotionen wie etwa Angst anzeigen kann (Fowles, 1983).
Zur Messung der Hautleitfähigkeit wird zwischen an der Hautoberfläche angebrachten Elektroden eine Fremdspannung an die Haut gelegt und deren Veränderung über die Zeit erfasst. Maßeinheit der Leitfähigkeit ist das Mikrosiemens (μs) bzw. Mikromho (μmho). Der Wert variiert beim Menschen etwa zwischen 2 und 100. Die Bedeutung dieser Variable für die Emotionsforschung besteht darin, dass die Haut im entspannten Zustand einen sog. Grundwiderstand aufweist. Dieser Widerstand sinkt bei steigender Erregung des Organismus. Diese Widerstandsänderung steht eindeutig im Zusammenhang mit der Aktivität der Schweißdrüsen. Für psychophysiologische Untersuchungen, bei denen eine elektrische Registrierung der Schweißdrüsenaktivität aus technischen oder organisatorischen Gründen nicht angezeigt ist, wird als einfache Methode zur Abschätzung der EDA auch die Auszählung aktiver Schweißdrüsen anhand von Fingerabdrücken empfohlen (Palm-Sweat Index, PSI; Köhler, Vögele & Weber, 1989; Malmo, 1965; Muthny, 1984).
Anders als die Hautleitfähigkeit werden Veränderungen des Hautpotentials, die ebenfalls durch die Schweißdrüsenaktivität ausgelöst werden, über eine vom Organismus selbst erzeugte Spannung, also so wie bei den meisten Biosignalen, erfasst. In der Emotionsforschung wird dieser Parameter allerdings seltener verwendet. Hier dominiert unter den EDA-Parametern eindeutig die Hautleitfähigkeit. (Für eine umfassende Darstellung der Forschung zur EDA vgl. Boucsein, 1988; Vossel, 1990.)
Die dargestellten Variablen dürfen nicht als Indikatoren betrachtet werden, die gewissermaßen austauschbar zur Messung einer bestimmten Emotion herangezogen werden können. Vielmehr muss bei der Festlegung auf eine Variable der Kontext, in dem die Erhebung stattfinden soll, berücksichtigt werden. Die einzelnen psychophysiologischen Parameter sind nämlich unterschiedlich sensitiv für verschiedene Kontextbedingungen und können deshalb nicht gewissermaßen stellvertretend füreinander verwendet werden. Die Auswahl einer bestimmten Variable hängt ganz wesentlich davon ab, welche Typen von Situationen vorliegen, wann innerhalb einer emotionsrelevanten Episode die Messung erfolgt und welche Reaktionen einem Probanden in einer Situation möglich sind bzw. von ihm verlangt werden (vgl. u. a. Bongard, 1993; Kohlmann, 1997; Stemmler 1992).
Das endokrine System steuert durch die ins Blut abgegebenen Hormone die Organfunktionen. Es wird dabei nicht nur vom Nervensystem überwacht, sondern gehört größtenteils zu diesem. In der Emotions-, speziell der Stressforschung werden insbesondere zwei Teilsysteme bzw. Achsen betrachtet, die die Reaktionen des Organismus in Belastungssituationen hormonell steuern (vgl. Berger, 1983; Gunnar & Quevedo, 2007; Netter, 2005; Schandry, 2003; Stokes, 1985; Weissman, 1990): die Hypothalamus-Nebennierenmark-Achse (SAM für sympathic-adrenomedullary system) und die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA für hypothalamic-pituitary-adrenocortical system).
Die Aktivierung der SAM-Achse im Zustand der emotionalen Belastung wurde insbesondere durch Cannons Theorie der Notfallfunktion (Cannon, 1915, 1932; vgl. hierzu auch Jänig, 2003) ins Blickfeld der Stressforschung gerückt. Bereits 1915 hatte Cannon erkannt, dass eine verstärkte Belastung des Organismus mit einer erhöhten Aktivität des Nebennierenmarks verbunden ist. Dieses schüttet die zur Gruppe der Katecholamine gehörenden Hormone Adrenalin und Noradrenalin aus, die auf Atmung, Herzleistung sowie Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel einen aktivierenden Effekt ausüben (Notfallfunktion) und somit den Organismus zu verstärkten Kampf- oder Fluchtreaktionen befähigen (»fight-or-flight reaction«).
Diese Hormone wirken auf spezielle Organe (Herzmuskel, Drüsen, glatte Muskeln in der Wand von Blutgefäßen), indem sie sich an spezielle Rezeptoren (Alpha- und Betarezeptoren) auf den Membranen der jeweiligen Effektorzellen binden (Adrenalin an Alpha- und Betarezeptoren, Noradrenalin nur an Alpharezeptoren). Über Alpharezeptoren wird in den meisten Fällen die Kontraktion und über Betarezeptoren die Erschlaffung (Dilatation) der glatten Muskelzellen bewirkt (vgl. auch Kuhlmann & Straub, 1986). Das für eine verstärkte Herz-Kreislaufaktivität typische Muster aus Anstieg der Herzrate und des systolischen Blutdrucks wie auch die verstärkte Muskelaktivität (Tab. 2.2) wird durch eine betaadrenerge Innervation des sympathischen Nervensystems verursacht (vgl. Netter, 2005, Tabelle 4.4).
Die durch diese Aktivierung bewirkte Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin, die sich im Plasma und Urin registrieren lässt, konnte inzwischen in zahlreichen Labor- und Felduntersuchungen als Reaktion auf emotionale Belastung nachgewiesen werden. So wurden etwa vermehrt Katecholamine bei Flugzeugpiloten und -passagieren, Fallschirmspringern, Autorennfahrern, Krankenhauspatienten, in Examenssituationen sowie bei furchterregenden Filmen registriert (Frankenhaeuser, 1975, 1979, 1986; Netter, 2005). Auf Probleme und zu kontrollierende Bedingungen bei der Registrierung und Interpretation des Katechol-aminniveaus weist Berger (1983) hin.
Die Aktivierung der HPA-Achse bei emotionsrelevanten, speziell aversiven, Bedingungen wurde bereits in den Pionierarbeiten Selyes zum Stress (u. a. Selye, 1946) nachgewiesen. Selye nahm dabei allerdings an, dass dieses Reaktionsmuster unspezifisch, d. h. unabhängig von der Qualität des jeweiligen Stressors, auftritt. Diese Auffassung wurde von Mason (u. a. 1975b, 1975c) mit dem Hinweis auf die Spezifität vermittelnder psychologischer Prozesse zurückgewiesen. (Zur Kontroverse zwischen Mason und Selye vgl. Laux, 1983.) Ausgangspunkt derartiger Reaktionen ist der Hypothalamus, der über das Corticotropin-Releasing Hormon (CRH) die Aktivität der Hypophyse steuert. In dieser wird über das CRH das Adrenocorticotrope Hormon (ACTH) ausgeschieden (sezerniert), welches nun seinerseits in der Nebennierenrinde u. a. das Glucocorticoid Kortisol freisetzt. Dieses bindet an die Rezeptoren der Zielzellen und entfaltet dort seine spezifische Wirkung.
Kortisol ist das bislang am intensivsten untersuchte Hormon der Nebennierenrinde. Es kann im Plasma, Urin oder Speichel nachgewiesen werden und wird besonders in Situationen vermehrt freigesetzt, die aversiv und neuartig sind. Der Zustand des Organismus kann dabei als unsicher und im Hinblick auf die Kontrolle des schädigenden Einflusses als hilflos bezeichnet werden (Frankenhaeuser, 1986; Mason, 1975a). Netter (2005) gibt eine Übersicht über Zusammenhänge des Kortisolanstiegs in aversiven Situationen mit der aktuellen und der dispositionellen Angst. Hubert (1988) weist allerdings auf die Inkonsistenz der Befundlage hin. Auf Probleme bei der Interpretation der Kortisolreaktion als Stressindikator, insbesondere auf die ausgeprägte zirkadiane Rhythmik (Kap. 3) und die episodische Ausschüttung dieses Hormons, macht Berger (1983) aufmerksam.
Anders als das SAM-System, dessen Funktion im Stressgeschehen im Wesentlichen in der Auslösung der »fight-or-flight«-Reaktion besteht, ist die Rolle des HPA-Systems komplexer. Im Gegensatz zum Adrenalin im SAM-System, das die Blut-Hirn-Schranke kaum durchdringen kann, ist das ZNS ein wesentliches Zielobjekt des Kortisols aus dem HPA-System. Das bedeutet, dass im HPA-System Bewertungen psychologischer Stressoren, bei denen insbesondere höhere Hirnstrukturen wie Cingulum und PFC beteiligt sind, eine wesentliche Rolle spielen. Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Systemen besteht darin, dass Kortisol langsamer als Adrenalin freigesetzt wird, dafür aber länger wirksam bleibt. Ein Teil seines Einflusses auf das Gehirn vollzieht sich über Veränderungen der Genexpression (Gunnar & Quevedo, 2007; s. Kap. 10 für den Zusammenhang von Stress und Genexpression).
In frühen endokrinologischen Untersuchungen wurde die Hypothese vertreten, dass die Ausschüttung einzelner Hormone, insbesondere von Adrenalin und Noradrenalin, mit unterschiedlichen emotionalen Zuständen verbunden sei. So sollte Adrenalin speziell bei Angst- und Noradrenalin bei Ärgerreaktionen auftreten (Ax, 1953; Funkenstein, 1955; Wagner, 1989). Diese Hypothese konnte nicht aufrechterhalten werden, da Adrenalin vermehrt auch bei Ärger und bei positiven Emotionen freigesetzt wird (Frankenhaeuser, 1986; Lundberg & Frankenhaeuser, 1980). Die Arbeiten von Frankenhaeuser und Kollegen haben vielmehr demonstriert, dass die Art des emotionalen Reagierens mit spezifischen Verhältnissen der Hormonausschüttung aus dem Mark und der Rinde der Nebenniere (insbesondere dem Verhältnis von Adrenalin zu Kortisol) verbunden ist. Dieses Verhältnis hängt wiederum ab von der Ausprägung zweier zentraler Komponenten des Erlebens in einer emotionalen Situation, dem Engagement (effort) und der negativen Befindlichkeit (distress).
Engagement bezeichnet das Ausmaß, in dem ein Organismus versucht, in eine problematische Situation einzugreifen und dadurch Kontrolle über diese zu erreichen und aufrechtzuerhalten (aktive Bewältigung). Negative Befindlichkeit beinhaltet Elemente wie Unzufriedenheit, Langeweile, Unsicherheit, Angst und Hilflosigkeit. Das Adrenalinniveau soll generell in belastenden Situationen erhöht sein, besonders hoch soll es aber sein, wenn aktive Bewältigung möglich ist. Dies gilt insbesondere für leistungsorientierte Personen (Bergman & Magnusson, 1979). Kortisol zeigt dagegen die spezifischere Reaktion. Es soll sehr stark auftreten in Situationen, die durch negative Befindlichkeit ohne Möglichkeit der aktiven Bewältigung gekennzeichnet sind. Kortisol soll auch noch (wenn auch weniger stark) ausgeschüttet werden in Situationen, die durch negative Befindlichkeit und aktive Bewältigung beschreibbar sind, während das Niveau bei aktiver Bewältigung ohne negative Befindlichkeit gesenkt sein soll. In diesen beiden Situationen sollte ja die Adrenalinreaktion sehr stark sein. Zum erstgenannten Typ gehören etwa anstrengende, nicht sonderlich beliebte Arbeiten, die eine Person aber beherrscht, zum zweiten Typ dagegen anspruchsvolle und mit Engagement ausgeführte Tätigkeiten (Frankenhaeuser, 1986; Netter et al, 1991).
Wenn in diesem Abschnitt auch eine Vielzahl von Parametern dargestellt werden konnte, die sich als brauchbare Indikatoren emotionaler Zustände und damit auch emotionsbezogener Persönlichkeitsmerkmale erwiesen haben, so kann die Forschung hier doch keineswegs als abgeschlossen gelten. Insbesondere in folgenden Bereichen besteht weiterhin Forschungsbedarf (vgl. u. a. Peper & Lüken, 2002): bei der Bestimmung der neuroanatomischen und endokrinen Grundlagen emotionalen Reagierens; bei der Analyse der Interaktionen der verschiedenen peripheren und zentralen Systeme, die an der Emotionsauslösung beteiligt sind; bei der Analyse der Kovariationen der subjektiven, verhaltensmäßig-expressiven und physiologischen Komponenten von Emotionen mit dem Ziel der Ausarbeitung einer multimodalen Emotionsdiagnostik; bei der Erforschung des Einflusses kognitiver (elaborierter) und automatisierter Prozesse (zum Beispiel der Bewertung von Situationen als emotionsrelevant) auf die Auslösung bestimmter physiologischer Prozesse.
2.3 Die Erfassung psychologischer Emotionsmerkmale
Bei der Erhebung psychologischer Merkmale stehen Selbsteinschätzungen und andere kognitive Prozesse des Individuums im Zentrum. Zur Messung dieser Einschätzungen werden im Wesentlichen Fragebogen herangezogen, die damit auch die am häufigsten angewendete Methode der Messung psychologischer Merkmale darstellen. Darüber hinaus wurde aber in den letzten Jahren auch eine spezielle Gruppe computergestützter Tests populär, die auf kognitiven Prozessen des Individuums beruhen. Diese experimentellen (impliziten) Verfahren werden den Probanden als Konzentrations- oder Reaktionszeittests präsentiert und sind damit insofern als objektiv zu bezeichnen, als das Ziel der Messung für die Probanden nicht durchschaubar ist. Darüber hinaus kommen vor allem im Bereich der Messung Emotionaler Intelligenz, aber auch zur Erhebung der Interozeptionsfähigkeit Fähigkeitstests zum Einsatz (Kap. 4).
Fragebogen. Zur Erfassung emotionsbezogener Merkmale auf der Ebene der Selbsteinschätzungen steht eine Vielzahl von Verfahren (insbesondere Fragebogen) zur Verfügung. Auf die für unser Thema relevanten Instrumente gehen wir bei der Darstellung der entsprechenden Konstrukte ein. An dieser Stelle wollen wir uns auf ein wichtiges Verfahren, das NEO-Inventar, konzentrieren, da sich dessen Skalen in besonderem Maße auf emotionsrelevante Persönlichkeitsmerkmale beziehen, die an unterschiedlichen Stellen in diesem Band von Bedeutung sind.
Grundlage dieses Verfahrens ist das von Costa und McCrae (1985) konstruierte NEO-Personality Inventory. Der Fragebogen erfasst fünf Persönlichkeitsdimensionen, die in jeweils sechs Facetten unterteilt sind (vgl. Tab. 2.3). In der revidierten Form (NEO-PI-R; deutsche Version von Ostendorf & Angleitner, 2004) werden diese insgesamt 30 Persönlichkeitsfacetten mit 240 Items erfasst, die auf einer fünfstufigen Skala (von »völlig unzutreffend« bis »völlig zutreffend«) beantwortet werden. Die Reliabilitäten der fünf Hauptskalen variieren von .86 bis .95, fallen aber für die Facetten naturgemäß niedriger aus (.56 bis .90). Die Stabilitäten (Zeitraum sechs Monate) sind mit Werten zwischen .86 und .91 sehr hoch (Facetten: .66 bis .92). Eine Kurzform des NEO-PI-R ist das NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI; deutsche Version: Borkenau & Ostendorf, 1993). Hier werden die fünf Faktoren (ohne Differenzierung nach Facetten) über insgesamt 60 Items erfasst (Reliabilitäten zwischen .74 und .89).
Fragebogen haben den Vorteil, dass sie das individuelle Erleben einer Person erfassen können. Auch Kognitionen über emotionsrelevante Zusammenhänge und Verhaltensweisen sind nicht objektiv beobachtbar und können daher nur mit Hilfe
Tab. 2.3: Die Dimensionen und Facetten des NEO-PI-R
Dimensionen Facetten
von Selbstbeschreibungen erhoben werden. Gleichzeitig ist diese Methode vergleichsweise ökonomisch; in wenigen Minuten kann eine Reihe verschiedener Merkmale einer Person, oder auch – in Gruppensitzungen – von mehreren Personen gleichzeitig, erfasst werden. Nachteile dieser Messmethode werden daher häufig billigend in Kauf genommen. So wird bei der Fragebogenmessung nicht nur davon ausgegangen, dass das erhobene Merkmal prinzipiell der individuellen Wahrnehmung (introspektiv) zugänglich ist, sondern es wird von den Befragten auch eine gewisse Fähigkeit zur Selbsteinsicht (Introspektionsfähigkeit) erwartet. Aber auch wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, können Fragebogenergebnisse durch individuelle Antworttendenzen verfälscht sein. Hierzu zählen unter anderem Ja- oder Nein-Sage-Tendenzen, d. h. die Tendenzen, Fragen prinzipiell eher zu bejahen oder zu verneinen, das Vermeiden extremer Antwortalternativen sowie die Tendenz zu sozial erwünschtem Antworten, d. h. das Ankreuzen solcher Antworten, von denen man glaubt, dass sie die eigene Person in einem guten Licht darstellen. Einigen dieser Probleme kann bereits bei der Konstruktion des Fragebogens vorgebeugt werden, indem beispielsweise Mehrdeutigkeit, zu starke Affektgeladenheit sowie komplexe Satzstrukturen der Items vermieden werden (vgl. Krohne & Hock, 2007).
Abhängig vom Abstraktionsniveau der Fragebogenitems wird darüber hinaus unterschiedliches Wissen zur Beantwortung eines Items herangezogen (vgl. Robinson & Clore, 2002). Wird der Proband beispielsweise nach persönlich erlebten Situationen gefragt, beruht seine Antwort auf episodischem Wissen, d. h. auf Erinnerungen an diese Situationen. Werden dagegegen im Fragebogen keine konkreten Situationen beschrieben oder hat der Proband eine angesprochene Situation noch nicht selbst erlebt, werden identitätsbezogene oder situationsspezifische Überzeugungen herangezogen. Diese enthalten prinzipielle Überzeugungen im Hinblick auf eigenes emotionales Erleben und Verhalten oder Annahmen darüber, wie bestimmte Situationen das eigene Verhalten beeinflussen. Die Nutzung verschiedener Wissensarten liefert so eine mögliche Erklärung, warum verschiedene Fragebogen zu gleichen oder ähnlichen Merkmalen nicht immer zu übereinstimmenden Ergebnissen kommen. Je nachdem, welches Wissen herangezogen wird, können zwei Fragen zum gleichen Sachverhalt unterschiedlich beantwortet werden. So finden sich etwa Geschlechtsunterschiede im Erleben von Emotionen häufiger bei retrospektiver Befragung als beim Berichten aktuellen Erlebens (z. B. Robinson, Johnson & Shields, 1998).
Implizite Tests. Aus Sicht der Probanden besitzen die meisten impliziten Tests einen klaren Leistungscharakter. Meist handelt es sich um computergesteuerte Verfahren, in denen die Probanden möglichst schnell und genau auf bestimmte Reizkonstellationen antworten müssen. Durch spezifische experimentelle Arrangements können die anfallenden Leistungsdaten – im Allgemeinen Reaktionszeiten, manchmal auch Fehler oder kombinierte Maße – so verwertet werden, dass sie Aufschluss über dispositionelle (in erster Linie emotionale und motivationale) Merkmale liefern. Einige implizite Verfahren erheben spezifische Verarbeitungsmechanismen, beispielsweise das Ausmaß der Aufmerksamkeit, das affektive Stimuli auf sich ziehen (vgl. Krohne & Hock, 2007). Daneben wurde in den letzten Jahren mit dem Impliziten Assoziationstest (IAT; Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998) ein Verfahren entwickelt, das Aspekte des Selbstkonzepts einer Person erhebt und damit auch die Messung von (umfassenderen) Persönlichkeitsmerkmalen (wie Ängstlichkeit, Extraversion oder Selbstwert) gestattet.
Beim IAT handelt es sich um einen computergestützten Reaktionszeittest, der Persönlichkeitsmerkmale über die Stärke der assoziativen Verknüpfungen kognitiver Repräsentationen erhebt. Die Aufgabe der Probanden besteht darin, in der Mitte des Bildschirms dargebotene Wörter in Kategorien einzuordnen, indem sie möglichst schnell die der jeweiligen Kategorie zugeordnete Taste drücken. Der gesamte Test setzt sich aus fünf Durchgängen zusammen, von denen der dritte und fünfte für die Auswertung herangezogen werden, während es sich bei den anderen Durchgängen um Übungsaufgaben handelt.
Im ersten Durchgang werden mit den Kategorien »selbst« und »fremd« die sogenannten Zielkonzepte eingeführt. Hier sollen Wörter wie ich, mir, mein (als Angehörige der Kategorie »selbst«) oder jene, andere, euch (Kategorie »fremd«) eingeordnet werden. Ziel dieses Durchgangs ist es, Reiz-Reaktions-Assoziationen dieser beiden Zielkonzept-Kategorien mit den ihnen zugeordneten Antworttasten zu etablieren. Im zweiten Durchgang wird in gleicher Weise die Assoziation zwischen den Kategorien hoher bzw. niedriger Ausprägung des zu messenden Persönlichkeitsmerkmals und den Tastenreaktionen gelernt. Bei einem Merkmal wie Ängstlichkeit würden z. B. Attribute wie angespannt, nervös für eine hohe und ruhig, entspannt für eine niedrige Ausprägung verwendet. Der dritte Durchgang stellt die erste Testphase dar. Hier werden die Wörter der Zielkonzept-Kategorien (z. B. ich, mir, jene, andere) und der Attribute (z. B. angespannt, ruhig) abwechselnd dargeboten. Die Probanden müssen nun sowohl bei Wörtern der hohen Merkmalsausprägung (z. B. angespannt) als auch bei Wörtern der Kategorie »selbst« die rechte und bei Wörtern der niedrigen Merkmalsausprägung (ruhig) und der Kategorie »fremd« die linke Taste drücken.
Im vierten Durchgang (Lernaufgabe) werden wieder nur Wörter der Zielkonzept-Kategorien dargeboten, wobei deren Zuordnung zu den Tasten nun aber umgekehrt ist, d. h., die Kategorie »selbst« muss mit der linken und die Kategorie »fremd« mit der rechten Taste beantwortet werden. Der fünfte Durchgang (zweite Testphase) erfordert wiederum Reaktionen auf Wörter aller vier eingeführten Kategorien. Im Gegensatz zum dritten Durchgang ist nun aber die Kombination der Kategorien hoher und niedriger Merkmalsausprägung mit den Zielkonzepten »selbst« und »fremd« vertauscht. Probanden müssen also bei Wörtern der hohen Merkmalsausprägung (z. B. angespannt) und bei Wörtern der Kategorie »fremd« (z. B. ihr) die rechte und bei Wörtern niedriger Merkmalsausprägung (entspannt) und der Kategorie »selbst« (ich) die linke Taste drücken.
Dem IAT liegt die Annahme zugrunde, dass Personen, die sich selbst (implizit) eine hohe Ausprägung des zu messenden Merkmals (z. B. Ängstlichkeit) zuschreiben, in der ersten Testphase (Durchgang 3) besonders schnell reagieren, da bei ihnen die Assoziation zwischen den hier auf einer Taste kombinierten Kategorien (z. B. »nervös« als Attribut und »ich« als Zielkonzept) stark ausgeprägt ist und ihnen diese Aufgabe damit vergleichsweise leicht fällt. Die zweite Testphase (Durchgang 5) stellt dagegen für eine derartige Person eine mit dem individuellen Assoziationsnetzwerk inkompatible Kombination der Kategorien dar (z. B. entspannt und ich), was zu längeren Reaktionszeiten führt. Ängstliche Personen würden damit in der ersten Testphase eines Ängstlichkeits-IAT deutlich schneller reagieren als in der zweiten. Das Umgekehrte gilt für Personen mit einer niedrigen Merkmalsausprägung. Die Berechnung des individuellen Testwerts erfolgt, indem die Reaktionszeit der Person in der ersten von ihrer Reaktionszeit in der zweiten Testphase abgezogen wird. (In neueren Untersuchungen wird dieser Wert an der durchschnittlichen Reaktionszeit standardisiert.) Ein hoher positiver Wert entspricht somit einer starken Ausprägung des zu messenden Merkmals.
Durch Auswahl der Reizwörter und entsprechende Benennung der Kategorien kann das IAT-Paradigma zur Messung verschiedener Eigenschaften wie Ängstlichkeit, Extraversion oder Emotionale Expressivi-tät herangezogen werden (Back, Schmukle & Egloff, 2009; Egloff & Schmukle, 2002; Tausch & Krohne, 2008). Im Gegensatz zu anderen objektiven Verfahren erreicht der IAT recht hohe Reliabilitätswerte (um .80) und erfordert zudem nur einen geringen Aufwand an Versuchsapparatur. Auch die Durchführungszeit ist mit ca. 10 Minuten pro Test vergleichsweise gering. Damit kann davon ausgegangen werden, dass dieses Verfahren Persönlichkeitsmerkmale ähnlich ökonomisch und zuverlässig erfasst wie Fragebogen.
Die Korrelationen zwischen impliziter und expliziter Messung eines Merkmals sind zwar meist positiv, aber oft nicht sehr hoch (Gawronski & Conrey, 2004; Hofmann et al., 2005). Dies belegt jedoch nicht eine mangelnde Validität einer der beiden Methoden. Vielmehr konnte gezeigt werden, dass beide Verfahren jeweils spezifische Aspekte aktuellen Verhaltens vorhersagen. So sind explizite Maße vor allem für die Vorhersage kontrollierten Verhaltens geeignet (z. B. Sprechinhalte oder Kleidungsstil), während die Ergebnisse impliziter Verfahren eher mit automatisierten (z. B. physiologischen oder nonverbalen) Reaktionen zusammenhängen (Überblick in Schmukle & Egloff, 2011).
Die unterschiedliche Vorhersage einzelner Verhaltensparameter durch explizite und implizite Verfahren wird über Zweiprozesstheorien