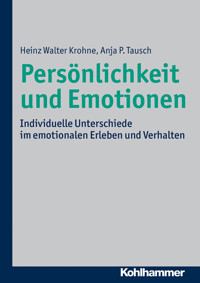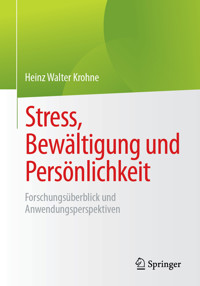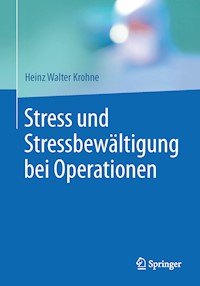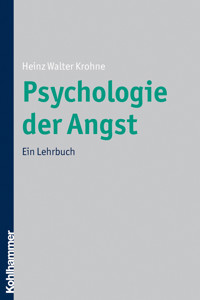
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch führt den Leser in die Grundlagen und unterschiedlichen theoretischen Ansätze der Psychologie der Angst ein. Darüber hinaus informiert es über die neuesten Fortschritte in ausgewählten Bereichen der Angstforschung, speziell der Angstmessung, der Angstbewältigung sowie der biologischen Grundlagen der aktuellen Emotion Angst und des Persönlichkeitsmerkmals Ängstlichkeit. Dem Autor gelingt es, die vielfältigen definitorischen, klassifizierenden und messmethodischen Ansätze nach einem einheitlichen Gesichtspunkt zu ordnen und hinsichtlich ihrer Qualität zu beurteilen. Anhand exemplarisch ausgewählter empirischer Befunde stellt er neuere Forschungsergebnisse zu den Entwicklungsbedingungen, Auslösern und Konsequenzen der Angst dar. Besonders eingegangen wird auf die neuesten Forschungen zu den neurobiologischen Grundlagen und Korrelaten der Angst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1036
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch führt den Leser in die Grundlagen und unterschiedlichen theoretischen Ansätze der Psychologie der Angst ein. Darüber hinaus informiert es über die neuesten Fortschritte in ausgewählten Bereichen der Angstforschung, speziell der Angstmessung, der Angstbewältigung sowie der biologischen Grundlagen der aktuellen Emotion Angst und des Persönlichkeitsmerkmals Ängstlichkeit. Dem Autor gelingt es, die vielfältigen definitorischen, klassifizierenden und messmethodischen Ansätze nach einem einheitlichen Gesichtspunkt zu ordnen und hinsichtlich ihrer Qualität zu beurteilen. Anhand exemplarisch ausgewählter empirischer Befunde stellt er neuere Forschungsergebnisse zu den Entwicklungsbedingungen, Auslösern und Konsequenzen der Angst dar. Besonders eingegangen wird auf die neuesten Forschungen zu den neurobiologischen Grundlagen und Korrelaten der Angst.
Univ.-Prof. Dr. Heinz Walter Krohne ist Professor für Psychologie am Psychologischen Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Seine Arbeitsgebiete sind Persönlichkeits-, Emotions- und Gesundheitspsychologie, speziell Forschungen zu Stress- und Stressbewältigung.
Heinz Walter Krohne
Psychologie der Angst
Ein Lehrbuch
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2010 Alle Rechte vorbehalten © 2010 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-020805-6
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-028136-3
mobi:
978-3-17-028137-0
Inhaltsverzeichnis
Vorwort und Organisation des Buches
I Konzepte und Messung
1 Der Phänomenbereich der Angst
1.1 Definitionen und zentrale Unterscheidungen
1.1.1 Angst: Persönlichkeitsmerkmal und emotionaler Zustand
1.1.2 Angst, Furcht und Stress
1.1.3 Bereichsspezifische Angstneigungen („Ängstlichkeiten“)
1.1.4 Komponenten der Angst
1.2 Zusammenfassung
2 Die Messung von Angst und Ängstlichkeit
2.1 Angst und Ängstlichkeit als hypothetische Konstrukte
2.2 Indikatoren der aktuellen Angst
2.2.1 Subjektive Maße
2.2.2 Verhaltensmäßig-expressive Reaktionen
2.2.3 Physiologische Prozesse
2.2.4 Selbstwahrnehmung körperlicher Prozesse
2.3 Die Messung des Persönlichkeitsmerkmals Ängstlichkeit
2.3.1 Die Erfassung der allgemeinen Ängstlichkeit
2.3.2 Mehrdimensionale Ängstlichkeitstests
2.3.3 Bereichsspezifische Ängstlichkeitstests
2.4 Zusammenfassung
II Angstbewältigung
3 Formen und Strategien der Angstbewältigung
3.1 Klassifikationsgesichtspunkte
3.2 Aktuelle vs. dispositionelle Angstbewältigung: eine Kontroverse
3.3 Aktuelle Angstbewältigung
3.4 Angstbewältigungsdispositionen
3.4.1 Makroanalytische Ansätze
3.4.2 Mikroanalytische Ansätze
3.4.3 Prozessorientierte Ansätze
3.5 Zusammenfassung
4 Theoretische Konzepte zur Angstbewältigung
4.1 Repression-Sensitization
4.1.1 Grundlagen des Konstrukts
4.1.2 Die Entwicklung von Messinstrumenten
4.1.3 Empirische Untersuchungen
4.1.4 Kritik am Repression-Sensitization-Konzept
4.2 Mehrdimensionale Ansätze
4.2.1 Klassifikation nach Ängstlichkeit und sozialer Erwünschtheit
4.2.2 Das Modell der Bewältigungsmodi
4.3 Zusammenfassung
III Theorien zur Angst
5 Die psychoanalytische Erklärung der Angst
5.1 Die erste Angsttheorie Freuds
5.2 Die zweite Angsttheorie
5.3 Empirische Bestätigungsversuche
5.4 Kritik der Angstauffassung Freuds
5.5 Zusammenfassung
6 Reiz-Reaktionstheorien
6.1 Grundbegriffe
6.2 Unterschiedliche Ansätze
6.3 Die Konditionierungstheorie der Furcht
6.4 Die Zweiprozesstheorie des Lernens von Vermeidung
6.5 „Neurotisches“ Verhalten als konditionierte Reaktionen
6.5.1 Die Theorie von Dollard und Miller
6.5.2 Empirische Untersuchungen
6.6 Kritik der Konditionierungstheorie von Furcht und Vermeidung
6.7 Die Triebtheorie der Angst
6.7.1 Theoretische Annahmen
6.7.2 Empirische Befunde
6.7.3 Bewertung der Theorie
6.8 Das Trait-State-Angstmodell
6.8.1 Modellannahmen
6.8.2 Empirische Befunde
6.8.3 Kritik des Modells
6.9 Zusammenfassung
7 Biopsychologische Theorien
7.1 Eysencks Theorie des Neurotizismus
7.2 Grays Theorie der Verstärkersensitivität
7.2.1 Die erste Version der RST
7.2.2 Die revidierte RST
7.2.3 Empirische Überprüfung der RST
7.3 Bewertung biopsychologischer Theorien
7.4 Zusammenfassung
8 Kognitions- und Handlungstheorien
8.1 Grundbegriffe der Handlungstheorie
8.2 Die Beziehung zwischen Person, Situation und Verhalten
8.3 Die Angstkontrolltheorie Epsteins
8.3.1 Theoretische Grundlagen
8.3.2 Empirische Befunde
8.3.3 Theoriebewertung
8.4 Die Stressbewältigungstheorie von Lazarus
8.4.1 Zentrale Konzepte und Annahmen
8.4.2 Empirische Untersuchungen
8.4.3 Theoriebewertung
8.5 Carver und Scheiers Kontrollprozesstheorie
8.5.1 Die handlungstheoretische Perspektive
8.5.2 Ein zweimodales Modell der Handlungskontrolle
8.5.3 Empirische Befunde
8.5.4 Theoriebewertung
8.6 Zusammenfassung
IV Empirische Befunde
9 Bedingungen der Angst
9.1 Proximale Antezedenzien
9.1.1 Bedingungen in der Situation
9.1.2 Bedingungen in der Person
9.2 Distale Antezedenzien
9.2.1 Biologische Faktoren
9.2.2 Demografische Merkmale
9.2.3 Sozialisationsfaktoren
9.3 Zusammenfassung
10 Konsequenzen der Angst
10.1 Proximale Konsequenzen
10.1.1 Informationsverarbeitung
10.1.2 Leistungsverhalten
10.1.3 Sozialverhalten
10.1.4 Psychophysische Anpassung
10.2 Distale Konsequenzen
10.2.1 Erhöhte Ängstlichkeit
10.2.2 Dispositionelle Angstbewältigung
10.2.3 Emotionale und Verhaltensprobleme
10.2.4 Chronische Erkrankungen
10.2.5 Auffälligkeiten im Sozialverhalten
10.2.6 Kompetenzdefizite
10.3 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Sachverzeichnis
Personenverzeichnis
Vorwort und Organisation des Buches
Die Feststellung, dass Angst zu den fundamentalen Themen menschlicher Existenz gehört, hat fast schon den Charakter einer Trivialität. Dichter und Philosophen haben sich über die Jahrhunderte zur Angst geäußert. Umso mehr überrascht es, dass sich die psychologische Forschung erst in den letzten Jahrzehnten eingehender mit diesem Thema beschäftigt hat. Gewissermaßen wie zum Ausgleich kann man dafür eine inzwischen fast unübersehbare Fülle empirischer Untersuchungen zur Angst registrieren. Dabei findet sich auch hier das für viele Themen der Psychologie typische Auf und Ab hinsichtlich der Beachtung in wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Nach dem Initialimpuls in der Mitte des vorigen Jahrhunderts durch die Neobehavioristen und die frühen kognitionspsychologisch orientierten Forscher, der ganz wesentlich von Richard Lazarus betriebenen Etablierung des Gebietes und seiner Integration in die psychologische Stressforschung in der anschließenden Dekade und schließlich seiner systematischen Ausweitung, Differenzierung und insbesondere psychometrischen Bearbeitung war im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts ein gewisses Nachlassen der Forschungsbemühungen, wenn auch weniger in der Quantität, so doch in der Originalität der Ansätze zu registrieren. Das Interesse an der allgemeinen Emotionsforschung nahm zwar deutlich zu, das am speziellen Thema Angst aber ab. Hier scheint sich allerdings in jüngster Zeit eine gewisse Wende anzubahnen. Mit dem raschen Fortschritt der biopsychologischen Forschung, dem Aufkommen der Gesundheitspsychologie sowie der Entwicklung neuerer Modelle zur Verarbeitung emotionsbezogener Information scheint auch das Interesse an Fragen aus den Bereichen Angst und Stress wiedererwacht zu sein. Das Buch versucht, diese Entwicklung aufzunehmen.
Dem Thema Angst kann man sich von vielen Seiten nähern. Für mich waren drei Zielsetzungen maßgebend. Zum einen sollten die vielfältigen definitorischen, klassifizierenden und messmethodischen Ansätze nach einem einheitlichen Gesichtspunkt geordnet und (dies gilt besonders für die Messmethoden) hinsichtlich ihrer Qualität geprüft und beurteilt werden. Zum anderen waren theoretische Ansätze zur Angst ausführlicher vorzustellen und kritisch zu analysieren. Schließlich galt es, neuere Forschungsergebnisse zu den Bedingungen und Konsequenzen der Angst jedenfalls so weit exemplarisch darzustellen, wie von ihnen fruchtbare Impulse für Forschung und Anwendung zu erwarten sind.
Organisation. Die Gliederung des Buches folgt diesen Zielsetzungen, indem zunächst Definitionen, Klassifikationen und Messmethoden zur Angst besprochen, sodann Theorien zu diesem Thema kritisch analysiert und schließlich exemplarisch ausgewählte empirische Befunde dargestellt werden. Diesen Zielsetzungen entsprechend werden in den vier Teilen des Buches unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
Der Teil I liefert in Kapitel 1 zunächst Definitionen zur Angst, Abgrenzungen von benachbarten Konzepten sowie Differenzierungen hinsichtlich der Angstkomponenten und verschiedener Angstneigungen. Zentral ist dabei die Differenzierung nach der Persönlichkeitseigenschaft Ängstlichkeit und Angst als Zustand. Für den Angstzustand werden die einzelnen „Ebenen“ seiner Manifestation sowie seine unterschiedlichen Komponenten dargestellt. Dagegen konzentriert sich die Beschreibung der Ängstlichkeit auf die verschiedenen Bereiche des Lebens (u. a. Prüfungen, soziale Situationen, körperliche Gefährdungen), in denen Menschen unterschiedlich ausgeprägte Angstneigungen entwickeln können.
Aufbauend auf diesen Differenzierungen werden sodann in Kapitel 2 Ansätze und Verfahren zur Messung der Ängstlichkeit und des Angstzustands beschrieben und kritisch bewertet. Indikatoren des aktuellen Zustands wie auch der Persönlichkeitseigenschaft lassen sich dabei den Merkmalsbereichen der subjektiven Beschreibungen, verhaltensmäßig-expressiven Reaktionen und physiologischen Prozesse zuordnen. Dieser Abgrenzung folgt auch die Gliederung der Darstellung von Erhebungsverfahren.
Im Mittelpunkt von Teil II steht das Merkmal Angstbewältigung. In Kapitel 3 stelle ich zunächst Formen und Strategien der Angstbewältigung vor und beschreibe ausgewählte Verfahren zu deren Erfassung. In gewisser Weise zeigt damit dieses Kapitel den gleichen Aufbau wie Teil I. Allerdings weiche ich bei der Darstellung der Messung von Angstbewältigung insofern von der aus Kapitel 2 bekannten Gliederung ab, als ich mich weitgehend auf die subjektive Erhebungsebene beschränke. Zwar gibt es speziell unter den sogenannten projektiven Verfahren eine Reihe von Ansätzen, die behaupten, Stile der Angstbewältigung zu erfassen. Die theoretische Grundlegung und die empirische Basis dieser Verfahren sind jedoch nach meiner Auffassung nicht geeignet, diese Behauptung überzeugend zu stützen.
In Kapitel 4 wird sodann ein Überblick über theoretische Konzepte in der Angstbewältigung gegeben. Die Darstellung beginnt mit der „Wahrnehmungsabwehr“, die unmittelbar zum „Stammvater“ dieser Konzepte, dem Repression-Sensitization-Konstrukt, geführt hat. Die Kritik an diesem Konstrukt hat schließlich zur Entwicklung einer Reihe von neueren Modellen geführt, von denen die wichtigsten dargestellt werden.
In Teil III werden die bedeutendsten Theorien zur Angst vorgestellt. Den Anfang macht als historisch erste Theorie in diesem Feld der psychoanalytische Ansatz Freuds (Kapitel 5). Ihm folgen grundlegende reiz-reaktionstheoretische (behavioristische) Ansätze, beginnend mit den Vorstellungen Watsons, über deren Erweiterung und theoretische Elaborierung durch Miller und Mowrer bis hin zu den schon deutlich kognitive Elemente enthaltenden Theorien von Spence und Taylor bzw. Spielberger (Kapitel 6). Daran schließen sich biopsychologische Theorien an, die in den letzten beiden Jahrzehnten einen starken Bedeutungszuwachs erlebt haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Grays Theorie der Verstärkersensitivität (Kapitel 7). Drei prominente neuere kognitions- und handlungstheoretische Ansätze beschließen diesen Abschnitt (Kapitel 8): die Theorie Epsteins, das inzwischen zu einer umfassenden Emotionstheorie ausgearbeitete Stressbewältigungsmodell von Lazarus sowie der von Carver und Scheier entwickelte handlungstheoretische Ansatz.
Wenn die Darstellung dabei auch der historischen Entwicklung vom psychoanalytischen über die behavioristischen zu den biopsychologischen und kognitionstheoretischen Ansätzen folgt, so ist diese Sequenz doch keineswegs als Linie eines Theoriefortschritts zu verstehen. Jeder Ansatz hat Bleibendes zum Verständnis der Angst geleistet und ist in vielen Aspekten durchaus noch aktuell.
Tatsächlich finden sich Elemente aus einem Ansatz häufig auch in den anderen Gruppen. So enthält die Theorie Freuds sowohl reiz-reaktionstheoretische als auch kognitive Elemente, während die dem Reiz-Reaktionsansatz zuzuordnende Theorie von Spence auch kognitive Erklärungskonzepte verwendet. Die Theorie von Spielberger versucht sogar explizit einen Brückenschlag zwischen behavioristischer (reiz-reaktionstheoretischer) und kognitiver Sichtweise. Die biopsychologischen Ansätze (Eysenck, Gray) sind in ihrer Terminologie eindeutig reiz-reaktionstheoretisch orientiert, öffnen sich allmählich aber auch für kognitive Konzepte. Eine gewisse Sonderstellung nimmt die Theorie Epsteins ein, die man am ehesten als eine mit kognitiven Elementen durchsetzte psychophysiologische Theorie der Angsthemmung bezeichnen kann.
In Teil IV werden Beziehungen dargestellt, die in empirischen Untersuchungen zwischen Indikatoren der Angst bzw. Ängstlichkeit und anderen psychologisch relevanten Merkmalen beobachtet wurden. Die Ordnung dieser Beziehungen differenziert einerseits zwischen Befunden, die sich primär auf Bedingungen bzw. Antezedenzien der Angst beziehen (Kapitel 9), und Daten, die die Konsequenzen der Angst betreffen (Kapitel 10). Dabei ist sowohl innerhalb der Antezedenzien als auch der Konsequenzen nochmals zwischen Bedingungen bzw. Folgen, die in relativer zeitlicher Nähe zur ausgelösten Angstemotion stehen, also proximal sind, und zeitlich entfernteren (distalen) Bedingungen bzw. Folgen zu unterscheiden.
Der aktuelle Zustand der Angst wird sowohl durch situative als auch durch personspezifische Umstände ausgelöst. Bestehen diese proximalen Antezedenzien in personspezifischen Verhaltenstendenzen, so weisen sie entweder eine biologische Basis oder eine Lerngeschichte auf, sind insofern ihrerseits wiederum auf Bedingungen zurückzuführen, z. B. auf genetische Determinanten, elterliche Erziehungsstile oder andere Sozialisationsfaktoren. Diese Umstände werden distale Antezedenzien der Angstemotion genannt.
Als Zustand hat Angst verschiedenartige Konsequenzen, beispielsweise Veränderungen der Leistung, der Aufmerksamkeit oder des Sozialverhaltens. Ich spreche hier von proximalen Konsequenzen. Eine Reihe dieser unmittelbaren Folgen zieht ihrerseits wiederum Konsequenzen nach sich, z. B. eine Chronifizierung von Minderleistung, geringe Kompetenzerwartung, festeingefahrene Formen der Vermeidung bestimmter Sachverhalte oder eine Beeinträchtigung des psychophysischen Gesundheitsstatus. Diese zeitlich länger erstreckten Phänomene bilden die distalen Konsequenzen der Angst.
Leserkreis. Dieses Buch ist nicht in dem Sinne ein Einführungstext, dass es nur einen schnellen und ersten Überblick zum Thema Angst liefert und ansonsten auf spezialisiertere Literatur verweist. Vielmehr wendet es sich sowohl an Anfänger in der Psychologie, den benachbarten Sozial- und Verhaltenswissenschaften, der Erziehungswissenschaft und der Medizin als auch an Fortgeschrittene, Dozenten und Forscher in diesen Gebieten. Es will also einführen in die Grundlagen und vielfältigen theoretischen Ansätze der Psychologie der Angst, aber den Leser auch über neueste Fortschritte in ausgewählten Bereichen der Angstforschung informieren.
Danksagung. Ich habe vielen für ihren Beitrag zur Fertigstellung dieses Buches zu danken: Michael Hock, Volker Hodapp, Lothar Laux und Andreas Schwerdtfeger haben zu einzelnen Kapiteln kritische Rückmeldungen und wesentliche Anregungen gegeben. Eigene Forschungsergebnisse, die in dieses Buch eingingen, wurden zum Teil durch Drittmittelbeihilfen ermöglicht, insbesondere durch Projektmittel der Volkswagen-Stiftung, der Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation und der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie durch Beihilfen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zu Forschungsaufenthalten in den USA. Die technische Bearbeitung des Textes, der Abbildungen und Tabellen lag in den Händen von Amara Otte und Angela Stiel. Allen, die durch ihre Hilfe dazu beigetragen haben, dass dieser Band erscheinen konnte, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Mainz, im Januar 2010
Heinz Walter Krohne
IKonzepte und Messung
1 Der Phänomenbereich der Angst
Wie Aggression, Ärger, Depression oder Sexualität gehört die Angst zu jenen von der Psychologie erforschten Themen, mit denen wohl jeder von uns bereits durch die Alltagserfahrung vertraut ist. Schenkt man einmal Aussagen von Kulturkritikern oder Meinungsforschern Glauben, dann ist unser Zeitalter nämlich geradezu durch ein Vorherrschen der Angst gekennzeichnet (Schlesinger, 1948; Zeidner, 1998).
Angst ist mithin nicht ein Thema unter anderen. Das menschliche Leben wird vielmehr in zahlreichen seiner Äußerungen als zumindest von Angst begleitet gesehen. Angst greift danach tief in unser Leben ein, aktiviert den Einzelnen entweder und spornt ihn zu besonderen Leistungen an oder hemmt, lähmt, ja zerstört ihn. Nur wer sich ihr stellt und sie meistern lernt, entwickelt sich und reift, wer einer Auseinandersetzung mit ihr ausweicht, wird gehemmt, stagniert und bleibt unreif (siehe hierzu etwa Kierkegaard, 1844/1991; May, 1950; Tillich, 1952).
Allgemeinheit und offensichtliche Bedeutsamkeit dieser Erfahrungen haben natürlich eine umfangreiche und vielschichtige Forschungstätigkeit angeregt, so dass Angst als die zentrale Emotion sowohl im Bereich der normalpsychologischen als auch der psychopathologischen Forschung und Praxis betrachtet werden kann (vgl. Laux & Glanzmann, 1996; Lazarus, 1991). Dieser Umstand ist umso erstaunlicher, als die Angstforschung innerhalb der empirisch orientierten Psychologie der letzten hundert Jahre eher ein „Newcomer“ ist. Trotz der Pionierleistungen, die Freud im Bereich der Psychopathologie (u. a. Freud, 1895/1971c, 1926/1971a), James in der Emotionspsychologie (u. a. James, 1890) und Cannon in der Stressforschung (u. a. Cannon, 1915) erbracht hatten, wird Angstforschung systematisch und in größerem Umfang eigentlich erst, und das ist sicherlich kein Zufall, seit dem Ende des zweiten Weltkriegs betrieben (siehe u. a. Basowitz, Persky, Korchin & Grinker, 1955; Grinker & Spiegel, 1945; Hoch & Zubin, 1950; Janis, 1951; Kardiner & Spiegel, 1947). Wohl zu Recht kann man deshalb mit Lazarus (Lazarus & Averill, 1972, S. 245) das bekannte Ebbinghaus -Zitat paraphrasieren: Angstforschung hat eine lange Vergangenheit, aber nur eine kurze Geschichte.
Die pointierte Gegenüberstellung von Vergangenheit und Geschichte soll den verhältnismäßig kurzen Zeitraum der empirischen Erforschung der Angst abheben von der langen, bis in die Antike zurückreichenden, Periode philosophischer Spekulation. (Für einen geschichtlichen Überblick verschiedener Auffassungen zur Angst siehe u. a. Fröhlich, 1982; McReynolds, 1975.) Zwar soll nicht in Abrede gestellt werden, dass philosophische Bemühungen für einzelne Menschen unter Umständen durchaus hilfreich gewesen sind und sein können. Generell haben sie jedoch für die Praxis der Gestaltung des täglichen Lebens von Menschen, gerade auch was den Umgang mit Angst betrifft, recht wenig Bedeutung erlangt. Für eine derartige Praxis müssten Überlegungen zur Angst etwa auch folgende Fragen beantworten können: Welche Rolle spielt die Angst bei Entstehung, Verlauf und eventueller Heilung psychischer Störungen? Welchen Einfluss hat das häufige Erleben von Angst auf den Gesundheitsstatus von Menschen? Wie bringe ich ein ängstliches Kind dazu, ohne Angst und Hemmungen zu lernen? Wie sind Angst und Leistung, etwa in der Schule oder beim Sport, aufeinander bezogen? Welche Rolle spielt Angst bei der Auslösung aggressiver Handlungen?
Nach dieser Aufzählung versteht es sich fast von selbst, dass man in einer psychologischen Veröffentlichung zu einem Thema wie der Angst heutzutage nicht mehr langwierige Erörterungen über deren „Wesen“, ihre „Grundformen“ oder ihren „Sinn“ lesen wird. Die Behandlung derartiger Fragestellungen hat sich für eine empirisch orientierte Wissenschaft als wenig fruchtbar erwiesen. Aber auch hinsichtlich der unmittelbaren praktischen Verwertbarkeit der hier dargestellten Befunde dürfen die Leser ihre Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Wenn auch die von der Psychologie behandelten Themen, wie dies bei der Angst offensichtlich der Fall ist, für den Einzelnen von ganz direktem und persönlichem Interesse sind, so dürfte es doch inzwischen allgemein akzeptiert sein, dass Lehrbücher der Psychologie, jedenfalls in der Regel, keine Handanweisungen für „Erste Hilfe“ bei seelischen Problemen sind und sein können. Das entbindet einen Autor natürlich nicht davon, die Bedeutsamkeit seiner Fragestellung und, wo dies bereits möglich ist, entsprechender empirischer Befunde für die Lösung wichtiger Probleme des menschlichen Lebens (beim Thema Angst etwa für die Beantwortung der oben gestellten Fragen) deutlich zu machen.
Bei der Behandlung des Themas Angst werde ich mich im Wesentlichen auf den Bereich „normalpsychologischer“ Phänomene beschränken, wenn auch klinische Angstformen, etwa bei der Darstellung des psychoanalytischen Ansatzes oder der Konsequenzen der Angst (→ die Kapitel 5 bzw. 10), natürlich nicht vollständig ausgespart werden können. (Für umfassendere Überblicke über „abnorme“ Ängste, z. B. Phobien, Panikattacken oder andere Angststörungen siehe etwa Antony & Swinson, 2000; Barlow, 2002; Beck & Emery, 2005; Craske, 1999; Ehlers, Margraf & Schneider, 1991; Gittelman, 1986; Noyes, Roth & Burrows, 1988; Rapee, 1996; Tuma & Maser, 1985.)
1.1 Definitionen und zentrale Unterscheidungen
1.1.1 Angst: Persönlichkeitsmerkmal und emotionaler Zustand
Der Beginn der systematischen wissenschaftlichen Erforschung der Angst kann in den ersten Arbeiten Sigmund Freuds (1893/1971b, 1895/1971c) gesehen werden. Bereits hier wurde die, für die spätere Angstforschung zentrale, begriffliche Trennung zwischen dem aktuellen emotionalen Zustand und dem als zugrundeliegend gedachten habituellen Persönlichkeitsmerkmal vorgenommen und die mögliche Beziehung zwischen den beiden Bereichen skizziert. So unterschied Freud in seinem Vortrag „Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene“ (1893/1971b) zwischen dem zeitlich kurz erstreckten Angstaffekt und den habitualisierten Persönlichkeitsmerkmalen Hysterie und Neurasthenie. „Hysteriker“ sollen danach durch die Unfähigkeit gekennzeichnet sein, ein erlebtes „psychisches Trauma“ (z. B. eine soziale Abwertung) angemessen zu verarbeiten. Angemessene (d. h. psychisch entlastende) Verarbeitungen derartiger aversiver Erfahrungen könnten etwa über motorische Reaktionen (z. B. sich kräftig „abreagieren“) oder bestimmte „innerpsychische“ Prozesse (z. B. die Angelegenheit in einem anderen Licht sehen) verlaufen. Als Konsequenz einer inadäquaten Verarbeitung soll der mit dem Trauma verbundene Affekt bei Vorliegen entsprechender Auslöser (z. B. Erinnerungen) wieder auftauchen.1
Aktuelle Angstemotion. In neueren Ansätzen wird die aktuelle Angstemotion als ein mit bestimmten Situationsveränderungen intraindividuell (innerhalb eines Individuums) variierender affektiver Zustand (state) des Organismus verstanden. Diese ist, wie jeder emotionale Zustand, durch spezifische Ausprägungen auf physiologischen, verhaltensmäßig-expressiven und subjektiven Parametern gekennzeichnet (vgl. u. a. Ekman, 1982; Gray & McNaughton, 2000; Hennig & Netter, 2005a; Krohne & Kohlmann, 1990; Schwenkmezger, 1985; Spielberger, 1966, 1972). So bestimmt Spielberger (1972) Angst als einen Zustand, der durch erhöhte Aktivität des autonomen Nervensystems sowie durch die Selbstwahrnehmung von Erregung, das Gefühl des Angespanntseins, ein Erlebnis des Bedrohtwerdens und verstärkte Besorgnis gekennzeichnet ist. Diese Definition, die in wesentlichen Zügen von Freud vorgezeichnet wurde (etwa in der 25. Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse; Freud, 1917/1969c), bildet die Grundlage aller relevanten Ansätze in diesem Bereich.
Die Vielzahl sehr verschiedenartiger Möglichkeiten, die aktuellen Angstzustände zu erfassen, könnte den Gedanken nahelegen, nach der „besten Methode“ zur Messung der Angst zu fragen bzw., falls diese Frage ohne befriedigende Antwort bleibt, die einzelnen Parameter im Hinblick auf die Zielsetzung der Angstmessung als beliebig austauschbar anzusehen. Hier muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass es weder „die beste Methode“ zur Erfassung der Angst gibt, noch dass ein bestimmtes Verfahren, z. B. die Erhebung über den Selbstbericht (subjektiver Parameter), stellvertretend für ein anderes, etwa die Registrierung der Herzrate (physiologischer Parameter), eingesetzt werden kann.
Der Grund für diese Einschränkung liegt darin, dass jedes der am Angstgeschehen beteiligten Systeme (vereinfacht gesprochen: physiologische, verhaltensmäßige und kognitive Systeme) spezifischen Erregungs- und Regulationsprozessen unterliegt. Diese Systeme werden im Verlauf einer angstinduzierenden Episode (beispielsweise wenn jemand nachts in einem Parkhaus „verdächtige“ Gestalten sieht) unterschiedlich schnell aktiviert, zeigen eine unterschiedliche zeitliche Erstreckung und scheinen auch auf verschiedenartige Aspekte der Gefahrensituation anzusprechen (vgl. Frankenhaeuser, 1986; Lang, 1985; Larsen, Berntson, Poehlmann, Ito & Cacioppo, 2008; Öhman & Mineka, 2001). So wird etwa in einer plötzlich entstandenen Gefahrensituation die Verhaltensreaktion (z. B. Flucht) schneller ausgelöst als die physiologische Reaktion (etwa die Erhöhung der Herzrate). Ferner sprechen bestimmte physiologische Parameter (z. B. die Herzrate und die Atemfrequenz) auf unterschiedliche Aspekte von Bedrohungen sehr spezifisch an (Levenson, 2003). So erhöht sich etwa die Herzrate, wenn die Aufmerksamkeit vom Gefahrenstimulus abgewendet oder auf interne Prozesse (wie z. B. beim Kopfrechnen) gerichtet werden muss (Lacey, 1959). Sie sinkt dagegen, wenn der Aufmerksamkeitsfokus auf eine externe Gefahrenquelle gerichtet ist (Hamm, Schupp & Weike, 2003). Die Atemfrequenz zeigt dagegen kein derart differenzielles Muster (Craig, 1968). Dies könnte allerdings auf die, verglichen mit der Herzrate, langsamere Aktivierung der Atemreaktion zurückzuführen sein. Darüber hinaus bestehen zwischen einzelnen Prozessen, insbesondere den physiologischen, komplexe Auslösungs- und Rückmeldungsbeziehungen (für derartige „Trigger- und Feedbackprozesse“ vgl. u. a. Axelrod & Reisinen, 1984; Jänig, 2003; Janke, 1986). So kann etwa die Selbstwahrnehmung einer autonomen Reaktion (z. B. eines beschleunigten Herzschlags) die kognitive Angstreaktion verstärken. Umgekehrt mag die vermehrte Konzentration auf externe Gefahrenhinweise die Wahrnehmung interner Zustände reduzieren (Pennebaker, 1982). Alle diese Auslösungs- und Regulationsprozesse werden zudem durch individuell unterschiedliche Erfahrungen und Strategien beim Umgang mit Gefahrensituationen sowie durch Bedingungen des situativen Kontextes moderiert (vgl. Epstein, 1972; Krohne, 1993a, 1993b; Ursin, Baade & Levine, 1978). So könnte sich etwa der Selbstbericht der Angst an dem orientieren, was ein Proband in der jeweiligen Situation als erwünscht ansieht. Verhaltensmäßig-motorische Reaktionen (z. B. Merkmale des Gesichtsausdrucks, des Sprechverhaltens oder der Handbewegung) werden sich dagegen in unterschiedlichem Maße und insgesamt schwieriger und physiologische Prozesse (zumindest für ungeübte Personen) kaum willentlich steuern lassen (Buck, 1985, 1994).
Das bedeutet, dass die Parameter aus den einzelnen „Ebenen“ bzw. „Kanälen“ der Angstbeschreibung über eine angstauslösende Episode hinweg keineswegs synchrone Verläufe zeigen müssen (vgl. Bernstein, Borkovec & Coles, 1986; Epstein, 1972; Krohne, Fuchs & Slangen, 1994; Lang, 1977). Aber selbst wenn sich bei den in einer Stichprobe aggregierten Daten parallele Veränderungen verschiedener Angstindikatoren registrieren lassen (z. B. bei Schedlowski & Tewes, 1992), dann besagt dies noch nichts über die Höhe der (interindividuellen) Korrelationen zwischen diesen Maßen. (Von interindividuellen − auf der Basis der Daten mehrerer Individuen errechneten − Korrelationen sind die intraindividuellen, bei denen für das jeweilige Einzelindividuum Zusammenhänge zwischen Variablen über die Zeit ermittelt werden, zu unterscheiden.) Die Frage, ob sich individuumsspezifische Zusammenhänge zwischen Indikatoren der einzelnen Reaktionsebenen sichern lassen, interessiert insbesondere im Zusammenhang mit der Analyse von Angstbewältigung und wird deshalb an entsprechender Stelle (→ Kapitel 4) eingehender behandelt (vgl. auch Kohlmann, 1997; Lazarus, Averill & Opton, 1974; Schwerdtfeger & Kohlmann, 2004). Über verschiedene Angstindikatoren, ihre Zusammenhänge sowie über Konzept und Problematik der Beschreibungsebenen wird ausführlicher in Kapitel 2 gesprochen.
Wenn sich die verschiedenen Indikatoren, die einen emotionalen Zustand anzeigen sollen, im Verlauf einer Episode schon nicht gleichsinnig verändern, so könnte man doch zumindest erwarten, dass sich ein bestimmter emotionaler Zustand wie etwa die Angst durch ein spezifisches Erlebnis- und Reaktionsmuster von anderen emotionalen Zuständen, beispielsweise Freude oder Ärger, unterscheiden lässt. Während diese Erwartung für die subjektive (bzw. im weiteren Sinne kognitive) Ebene natürlich erfüllt wird (der Zustand der Angst ist im Erleben der betroffenen Personen deutlich etwa von dem des Ärgers oder der Depression unterschieden; vgl. u. a. Beck & Clark, 1988), wird die Frage, ob eine Differenzierung auch auf verhaltensmäßig-expressiver und insbesondere physiologischer Ebene möglich ist, kontrovers diskutiert. So ist etwa Fahrenberg (1979, 1986) der Auffassung, dass es bislang nicht gelungen ist, für verschiedene Emotionen jeweils spezifische autonome Aktivierungsmuster reliabel zu reproduzieren (vgl. hierzu auch Stemmler, 1984, 1989). Andere Autoren (z. B. Ekman, Levenson & Friesen, 1983; Levenson, 1988; Tucker, 1970; Wagner, 1989) kommen nach Analyse einschlägiger Untersuchungen jedoch zu dem Schluss, dass Emotionen wie etwa Furcht und Ärger auf der Ebene physiologischer Parameter unterscheidbar sind (Levenson, 2003; vgl. hierzu bereits Ax, 1953; Funkenstein, 1955; Funkenstein, King & Drolette, 1957). Insgesamt scheint sich die Auffassung durchzusetzen, dass dem subjektiven Erleben von Angst ein spezifisches Muster physiologischer Vorgänge zugrunde liegt (Ekman, 1992; Levenson, 2003; Steptoe, 1991), wobei die Aktivitäten im Zentralnervensystem (ZNS) am ehesten der Ort zu sein scheinen, an dem nach emotionsspezifischen Mustern zu suchen ist (Ekman & Davidson, 1994; LeDoux, 1996).
Auch über verhaltensmäßig-expressive Variablen, insbesondere über bestimmte Merkmale des Gesichtsausdrucks, ist eine Unterscheidung einzelner Emotionen möglich (vgl. Bernstein et al., 1986; Buck, 1994; Ekman & Oster, 1979; Rinn, 1984). Die am zuverlässigsten zwischen verschiedenen emotionalen Zuständen differenzierenden Informationsquellen sind aber zweifellos die subjektiven Parameter (Barrett, Mesquita, Ochsner & Gross, 2007). Angst als emotionaler Zustand ist auf dieser Ebene, wie erwähnt, durch selbstwahrgenommene Erregung, ein Erlebnis des Bedrohtwerdens und Besorgnis gekennzeichnet (vgl. z. B. Spielberger, 1972).
Persönlichkeitsmerkmal. Für das habituelle Persönlichkeitsmerkmal wird meist der Begriff Ängstlichkeit verwendet. Er bezeichnet die intraindividuell relativ stabile, aber interindividuell variierende Tendenz (trait), Situationen als bedrohlich wahrzunehmen und hierauf mit einem erhöhten Angstzustand zu reagieren (vgl. Spielberger, 1972). So erleben einzelne (ängstliche) Personen bestimmte Situationen (z. B. die Ankündigung einer Prüfung) generell als bedrohlicher und reagieren entsprechend mit einem stärkeren Angstanstieg (erfasst etwa über subjektive Daten wie z. B. Fragebogen) als andere (nichtängstliche) Personen.
Neben dieser rein deskriptiven Konstellation bezieht sich das Konzept Ängstlichkeit auch auf Bedingungen, über die interindividuelle Unterschiede auf Parametern des Angstzustands bei objektiv gleichen situativen Bedingungen (z. B. der Ankündigung einer Prüfung) erklärt werden sollen. Eine derartige Bedingung könnte beispielsweise in der Einschätzung liegen, die weitere Entwicklung einer als gefährlich bewerteten Situation nicht vorhersagen und steuern zu können. Wie einzelne Bedingungen inhaltlich genauer zu bestimmen sind und bei der Auslösung des Angstzustands zusammenwirken, lässt sich jedoch nur auf dem Hintergrund einer jeweiligen Angsttheorie (etwa einer psychodynamischen, behavioristischen oder kognitiven Theorie) festlegen. (Siehe hierzu Teil III dieses Bandes.)
Die aktuelle Angstemotion (state) ist ein mit bestimmten Situationsveränderungen intraindividuell variierender affektiver Zustand des Organismus, der durch erhöhte Aktivität des autonomen Nervensystems sowie durch die Selbstwahrnehmung von Erregung, das Gefühl des Angespanntseins, ein Erlebnis des Bedrohtwerdens und verstärkte Besorgnis gekennzeichnet ist.
Das Persönlichkeitsmerkmal Ängstlichkeit (trait) bezeichnet die intraindividuell relativ stabile, aber interindividuell variierende Tendenz, Situationen als bedrohlich wahrzunehmen und hierauf mit einem erhöhten Angstzustand zu reagieren.
1.1.2 Angst, Furcht und Stress
Angst. Eine in vielen Ansätzen getroffene Unterscheidung ist die zwischen Angst, Furcht und Stress. Nach Izard (1972; Izard & Blumberg, 1985) bezeichnet Angst ein Muster aus verschiedenen Emotionen. Eine Emotion ist für Izard ein Gefühlszustand, mit dem bestimmte Kognitionen und Handlungstendenzen assoziiert sind. Furcht ist die zentrale, d. h. am intensivsten erlebte, Emotion in diesem Muster. Affekte wie Schmerz und affektiv-kognitive Strukturen wie Schuld-Aggression, Schüchternheit oder Scham bilden weitere Komponenten, die jeweils mit Furcht zusammen auftreten können.
Für Izard besteht der Unterschied zwischen Angst und Furcht in bestimmten strukturellen Merkmalen. Die Mehrzahl der Forscher unterscheidet Angst und Furcht allerdings nicht nach diesen strukturellen, sondern eher nach funktionalen Gesichtspunkten. So hängt für viele Autoren (Blanchard & Blanchard, 1990; Epstein, 1967, 1972; Gray & McNaughton, 2000; Lazarus, 1966, 1991) die Auslösung von Angst oder Furcht von spezifischen Hinweisreizen bzw. der Interpretation der vorliegenden situativen Bedingungen durch den Organismus ab. (Eine Darstellung verschiedener Ansätze zur Differenzierung von Angst und Furcht findet sich in Schmidt-Daffy, 2008.)
Nach Epstein etwa soll Angst dann entstehen, wenn eine Person eine Situation als bedrohlich erlebt, aber nicht zugleich angemessen, z. B. durch Flucht, reagieren kann. Die Hemmung einer adäquaten Reaktion kann mehrere Ursachen haben. So kann einmal Stimulusunsicherheit bestehen, d. h. für eine Gefahr kann keine klare Zuordnung im Hinblick auf Art, Intensität, Auftretenszeitpunkt u. ä. getroffen werden. Es kann aber auch eine Reaktionsblockierung vorliegen, d. h. trotz klarer Information über die Gefahr ist eine angemessene Reaktion momentan nicht möglich. (Für weitere Differenzierungen siehe auch Öhman, 2008.)
Furcht. Nach Auffassung vieler Autoren soll Furcht dann vorliegen, wenn die Gefahr eindeutig zu bestimmen ist und die Reaktionen der Flucht oder Vermeidung möglich sind. Unter dem Aspekt der Motivation ist Furcht also ein Flucht- bzw. Vermeidensmotiv, Angst dagegen eher das Motiv, weitere Informationen über bedrohungsrelevante Situations- und Verhaltensaspekte zu suchen. Epstein (1967, 1972) spricht deshalb auch von Angst als „unentschiedener Furcht“. Eine ähnliche Unterscheidung trifft auch Seligman (1975) im Rahmen seiner „Sicherheitssignalhypothese“ (→ Kapitel 9, Abschnitt 9.1.1). Diese Definitionen folgen im Wesentlichen Freud (1926/1971a), der Angst als unbestimmt und „objektlos“ charakterisiert und von Furcht dann spricht, wenn Angst „ein Objekt gefunden“ hat. (Siehe auch Averills Unterscheidung von Informations- und Verhaltenskontrolle, Averill, 1973; zusammenfassend auch Prystav, 1985.)2 Kimmel und Burns (1977) verbinden den Aspekt des Objektbezugs mit dem der zeitlichen Erstreckung der emotionalen Reaktion. Sie verstehen unter Furcht die kurze phasische emotionale Reaktion auf zeitlich kurz erstreckte, sporadisch auftretende Stimuli, während sie als Angst die länger erstreckte tonische Reaktion bezeichnen, die in die Zukunft gerichtet ist und entweder durch länger anhaltende Bedingungen ausgelöst wird oder überhaupt nicht auf externe Ereignisse bezogen werden kann.
Im Gegensatz zu diesen Autoren geht Scherer (1988, 1993) von einer Vielzahl von Dimensionen der Situationsbewertung (Stimulus Evaluation Checks) aus, deren jeweilige Ausprägungsmuster zwischen den Hauptemotionen, und damit auch zwischen Angst und Furcht, differenzieren sollen. So soll Angst dann entstehen, wenn die Neuigkeit entsprechender situativer Merkmale als gering und deren Relevanz im Hinblick auf wichtige Ziele und Bedürfnisse der Person als mittelhoch eingeschätzt wird. Bei der Furcht sollen dagegen beide Werte hoch sein.
In ähnlicher Weise bestimmt auch Lazarus (1991) in seinem zu einer allgemeinen Emotionstheorie erweiterten Stressbewältigungsmodell spezifische Muster aus Situations- und Ressourceneinschätzung als Basis für die Differenzierung von Emotionen (→ auch Kapitel 8 und Kapitel 9). Allerdings sind diese Unterscheidungen ausschließlich auf subjektiver Ebene angesiedelt und beziehen sich primär auf differenzierende Situationsaspekte. Überzeugender wäre es, wenn mit Veränderungen in relevanten Situationsparametern (vgl. Averill, 1973; Prystav, 1985) zugleich Unterschiede in Variablen einhergingen, die auf den anderen Beschreibungsebenen für Emotionen, speziell der biologischen Ebene, lokalisiert sind. Der Nachweis derartiger Unterschiede, insbesondere eines jeweils für Angst bzw. Furcht charakteristischen Musters von Reaktionen, ist bislang noch nicht zuverlässig gelungen (vgl. Fahrenberg, 1992; Frankenhaeuser, 1975, 1986; Martin, 1961; Mason, 1975a), obwohl einige Autoren von unterschiedlichen hormonellen Reaktionen (speziell der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin) bei Angst und Furcht berichten (siehe u. a. Kety, 1967; Mandler, 1967; Mason, 1968; Mason, Mangan, Brady, Conrad & Rioch, 1961). Die Identifizierung stabiler emotionsspezifischer Reaktionen wird durch die Existenz „individualspezifischer Reaktionsmuster“ (ISR; Fahrenberg, 1986; Marwitz & Stemmler, 1998) erschwert. Unter ISR wird die Disposition eines Individuums verstanden, in einer bestimmten Situation mit einem spezifischen psychobiologischen Subsystem zu reagieren. Fortschritte bei der Identifizierung emotionsspezifischer Reaktionsmuster sind allerdings in dem Maße zu erwarten, in dem die zentralnervösen Korrelate von Emotionen detaillierter analysiert werden (siehe u. a. Davis, 1998; LeDoux, 1996; Öhman & Mineka, 2001).
Stress. Der letzte Terminus der genannten Trias, „Stress“, wird in der Literatur in so vielfältiger, häufig allerdings auch unscharfer Weise verwendet, dass an dieser Stelle nur einige zentrale Definitionsansätze skizziert werden können. (Für umfassendere Darstellungen siehe u. a. Appley & Trumbull, 1986; Jerusalem, 1990; Krohne, 1990b; Laux, 1983; Schwarzer, 2000; für eine Kritik des Stressbegriffs vgl. Engel, 1985.) Das Stresskonzept genießt in den Verhaltenswissenschaften seit mehr als einem halben Jahrhundert große Popularität. Es wurde ursprünglich in der Physik formuliert und bezeichnet dort die Kraft (stress), die auf einen Körper einwirkt und bei diesem Beanspruchung (strain) und Deformation hervorruft. (Zur Geschichte des Stressbegriffs siehe u. a. Hinkle, 1974; Mason, 1975b, 1975c.)
In biologischen und insbesondere verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen hat sich jedoch ein Bedeutungswandel vollzogen. Stress bezeichnet hier in der Regel den körperlichen Zustand unter Belastung (z. B. Selye, 1976). Gemeint ist damit ein Extremzustand des Organismus mit den Komponenten Anspannung, Widerstand gegenüber der Belastung und, bei länger anhaltender oder häufig wiederkehrender Belastung, körperliche Schädigung. In diesem Fall werden die Kräfte, die schädigend auf den Organismus einwirken, „Stressoren“ genannt (vgl. McGrath, 1982).
Ansätze, die eine genauere Analyse der Beziehungen zwischen Stress und emotionalen Reaktionen wie etwa Angst gestatten würden, lassen sich zwei verschiedenen Bereichen zuordnen (vgl. Cofer & Appley, 1964; Scheuch & Schröder, 1990): den primär in der Psychobiologie verankerten Ansätzen zum „systemischen Stress“ (u. a. Levi, 1972; Selye, 1976) und den innerhalb der Psychologie entwickelten Vorstellungen zum „psychologischen Stress“ (Lazarus, 1966, 1991; Lazarus & Folkman, 1984b; McGrath, 1970). Während die Theorie von Selye nur wenig Raum für die Bestimmung des Einflusses psychologischer Variablen (etwa Erwartungen oder Bewertungen) auf die Stressreaktion lässt, berücksichtigt der Ansatz von Levi (u. a. Levi & Andersson, 1975) sowohl personspezifische Merkmale als auch unterschiedliche begleitende Umweltsituationen bei der Auslösung von Stress und stressbedingten emotionalen Reaktionen.
Unter den im engeren Sinne psychologischen Stresstheorien hat insbesondere der Ansatz von Lazarus große Beachtung gefunden. Seit der ersten Darstellung einer umfassenderen Theorie (Lazarus, 1966) hat Lazarus seine Konzeption mehrfach in wesentlichen Punkten revidiert (vgl. Lazarus & Launier, 1978). In seiner jüngsten Darstellung (u. a. Lazarus, 1991, 1999; Lazarus & Folkman, 1984b, 1987) wird Stress als ein relationales Konzept aufgefasst, also nicht als spezifische äußere Reizgegebenheit (situationsbezogene Definition von Stress, vgl. Laux, 1983) oder als typisches Muster von Reaktionen (reaktionsbezogene Definition), sondern als eine bestimmte Beziehung zwischen Umwelt und Person.
„Psychologischer Stress bezeichnet eine Beziehung mit der Umwelt, die vom Individuum im Hinblick auf sein Wohlergehen als bedeutsam bewertet wird, aber zugleich Anforderungen an das Individuum stellt, die dessen Bewältigungsmöglichkeiten beanspruchen oder überfordern“ (Lazarus & Folkman, 1986, S. 63).
Lazarus nennt diese spezifische Beziehung zwischen einem Individuum und seiner Umwelt „Transaktion“. Diese Definition macht deutlich, dass zwei zentrale Prozesse als Vermittler („Mediatoren“) innerhalb der stressrelevanten Person-Umweltbeziehung wie auch im Hinblick auf hieraus resultierende unmittelbare und längerfristige Konsequenzen fungieren sollen: kognitive Bewertung („appraisal“) und Stressbewältigung („coping“). Die Theorie von Lazarus wird in Kapitel 8 dargestellt.
Eine für die Analyse der Beziehung von Bewertungsprozessen zu emotionalen Reaktionen relevante Bestimmung von Stress wurde auch von Scherer (1985) vorgelegt. Danach stellt Stress einen Sonderfall emotionaler Reaktionsweisen dar. Im Unterschied zu „normalen“ Emotionen wie Freude, Ärger, Angst oder Furcht, bei denen es sich um zeitlich vergleichsweise kurz erstreckte, phylogenetisch herausgebildete, Anpassungsmechanismen des Organismus handelt, spricht Scherer von Stress, wenn „die Systemlage eines Organismus über einen längeren Zeitraum hinweg aus dem Gleichgewicht gebracht wird“ (Scherer, 1985, S. 197–198), so dass die emotionale Erregung auch nach längerer Zeit nicht wieder abklingt. Ein derart gestörter und damit stresserzeugender Emotionsverlauf könnte seine Ursache haben in einer fortdauernden, das Gleichgewicht störenden externen oder internen Stimulation, in mangelhaften Bewältigungspotenzialen im Hinblick auf die Konsequenzen eines Ereignisses oder in kognitiven Perseverationen über aktuelle oder künftige Bewältigungsanstrengungen. Dieser Ansatz gestattet möglicherweise eine genauere Bestimmung der in zunehmendem Maß ins Blickfeld der Forschung geratenden Beziehung zwischen Persönlichkeit, emotionalen Reaktionen und Gesundheitsstatus (siehe u. a. Contrada, Cather & O’Leary, 1999; Hampson & Friedman, 2008; Kohlmann, 1995; Krohne, 1990b; McEwen & Seeman, 2003).
1.1.3 Bereichsspezifische Angstneigungen („Ängstlichkeiten“)
Angstauslösende Situationen. Während sich die Begriffe Angst, Furcht und Stress im Wesentlichen auf emotionale Zustände beziehen, zielt die in jüngster Zeit verstärkt betriebene Unterscheidung von Ängsten nach den sie jeweils auslösenden Umweltgegebenheiten primär auf das Persönlichkeitsmerkmal Ängstlichkeit. Im Sinne interaktionistischer Angstmodelle (u. a. Endler, 1975, 1983; Endler & Magnusson, 1976; Mischel & Shoda, 1999) sollen sich Personen danach unterscheiden lassen, welche speziellen Situationen bzw. Umweltbereiche (z. B. Prüfungssituationen, Zahnarztbesuche, soziale Konflikte, Sportwettkämpfe) sie als stärker bedrohlich erleben und mit einer Angstreaktion beantworten.
Eine relativ grobe Unterscheidung ist die nach selbstwert- bzw. ichbedrohenden (z. B. Prüfungen) und physisch bedrohlichen Situationen (z. B. Operationen) und entsprechenden Angstneigungen (Bewertungsängstlichkeit vs. Angst vor physischer Verletzung; vgl. u. a. Glanzmann & Laux, 1978; Hodges, 1968; Kendall, 1978; Lamb, 1973; Schwenkmezger, 1985; Spielberger, 1972). In jüngster Zeit werden Situationen der sozialen Interaktion als ein weiterer wichtiger angstauslösender Bereich intensiv untersucht (Asendorpf, 1989; Buss, 1980, 1986; Leary, 1982; für eine Übersicht vgl. auch Schwarzer, 2000).
Bewertungsängstlichkeit. Die Tendenz, in Situationen, in denen die Möglichkeit des Versagens und des Selbstwertverlustes besteht, mit Angst zu reagieren, wird als Bewertungsängstlichkeit bezeichnet (Wine, 1982; Zeidner, 1998). Im Zentrum bedrohlicher Situationen steht hier die Prüfung, deren Erforschung eine breite, in den Anfang des 20. Jahrhunderts zurückreichende, Tradition besitzt (Spielberger, Anton & Bedell, 1976). Für diesen speziellen Aspekt werden deshalb häufig auch die Begriffe Testangst, Prüfungsangst oder Leistungsangst verwendet (→ Kapitel 2, Abschnitt 2.3.3). Wichtige theoretische Arbeiten wurden besonders von Irwin Sarason (1960, 1972, 1978), Mandler und Seymour Sarason (Mandler & Sarason, 1952; Sarason & Mandler, 1952) sowie Wine (1971, 1982) vorgelegt. Neuere Ansätze und Befunde werden bei Hagtvet (1992), Krohne und Laux (1982), Rost (1991), Sarason (1980), Schwarzer (2000), Schwarzer, van der Ploeg und Spielberger (1982, 1987, 1989), Schwenkmezger (1985), van der Ploeg, Schwarzer und Spielberger (1983, 1984, 1985) sowie Zeidner (1998) dokumentiert.
Soziale Ängstlichkeit. Die in sozialen Situationen ausgelöste Angst wird häufig als ein Spezialfall der Bewertungsangst angesehen. So definiert Schwarzer (2000, S. 118) soziale Angst als „die Besorgnis und Aufgeregtheit angesichts von sozialen Situationen, die als selbstwertbedrohlich erlebt werden“. Tatsächlich finden in vielen Situationen der sozialen Interaktion Bewertungen (mit der Möglichkeit des Versagens) statt. Ganz besonders ausgeprägt ist dies beim Halten einer Rede vor einer größeren Gruppe. Daneben darf aber nicht übersehen werden, dass schon sehr früh im Leben des Individuums eine spezielle soziale Angst, die Fremdenangst, beobachtet werden kann, bei der der Bewertungsaspekt nicht im Vordergrund steht (vgl. Izard, 1991). Diese zuerst im Alter von etwa acht bis neun Monaten als „Fremdeln“ auftretende Angst wird bei Abwesenheit der Mutter, in fremden Umgebungen und angesichts fremder (insbesondere männlicher) Personen ausgelöst (Sroufe, 1977). Diese Reaktion kann auch bei älteren Kindern noch auftreten (Greenberg & Marvin, 1982) und sich u. U. im späteren Leben als Schüchternheit bzw. soziale Gehemmtheit (Asendorpf, 1989) verfestigen.
Tatsächlich ist soziale Ängstlichkeit kein einheitliches Phänomen. Vielmehr lassen sich nach Buss (1980) mindestens vier Formen unterscheiden: Publikums- bzw. Sprechangst, Verlegenheit, Scham und Schüchternheit (vgl. auch Izard, 1991; Schwarzer, 2000).
Publikums- bzw. Sprechangst stellt eine Sonderform der Bewertungsängstlichkeit dar (vgl. Brüstle, Hodapp & Laux, 1985; Kriebel, 1984; Lamb, 1973). Sie wird insbesondere beim Sprechen vor einer größeren Gruppe wenig vertrauter Personen (z. B. in einem Seminar) erlebt. Verlegenheit ist eine Reaktion auf ein eingetretenes Ereignis, in der die betreffende Person gewahr wird, dass sie in einer sozialen Situation einen Fehler begangen hat (z. B. zu einem bestimmten Anlass falsch gekleidet ist) und dieser von der Öffentlichkeit (zumindest nach Einschätzung der Person) auch bemerkt wird. Scham ist eng mit Verlegenheit verbunden und wird vielfach als deren gesteigerte, insbesondere mit der Verletzung moralischer Normen verbundene, Form verstanden (u. a. Izard, 1991; Schwarzer, 2000). Wer etwa von anderen der Lüge überführt wird, schämt sich. Viele Autoren trennen zwischen Scham und Schuld. Schamgefühle entstehen nach Lazarus (1991), wenn wir bemerken, dass wir einem Ideal nicht entsprechen können und eine andere Person, an deren Meinung uns viel liegt, diesen Fehler wahrnimmt und uns eventuell dafür kritisiert. Scham hat also immer etwas mit der Enttäuschung anderer Personen (wenn auch eventuell nur in der verinnerlichten Form des Ich-Ideals) zu tun. Schuldgefühle erleben wir dagegen, wenn wir (und wenn auch nur in der Phantasie) moralische Normen verletzen. Bei Handlungen, die Schuldgefühle auslösen, muss weder ein Bezug zu den Standards anderer Personen bestehen noch müssen andere anwesend sein (vgl. auch Schwarzer, 2000). Scham soll zu einem Rückzug von bewertenden anderen Personen, Schuld dagegen zu Versuchen des Eingestehens und der Wiedergutmachung führen (Barrett, Zahn-Waxler & Cole, 1993).
Waren Verlegenheit und Scham emotionale Reaktionen auf eingetretene Umstände, so tritt Schüchternheit angesichts erwarteter Ereignisse ein, ist damit also eher eine spezielle Form der Furcht (vgl. Zimbardo, 1977). Sie entsteht, wenn eine Person in einer ihr wenig vertrauten sozialen Situation unsicher ist, ob es ihr gelingt, einen bestimmten, von ihr gewünschten Eindruck auf andere Menschen zu machen. (Zum Zusammenhang von sozialer Angst und Selbstdarstellung siehe auch Laux & Weber, 1991; Schlenker & Leary, 1982.) Schüchternheit ist immer mit Hemmung und sozialem Rückzug verbunden, weshalb Asendorpf (1989) sie auch in den größeren Kontext der sozialen Gehemmtheit einordnet. Schüchternheit bzw. soziale Gehemmtheit ist zeitlich relativ stabil, hat also Dispositionscharakter. Kagan (1994, 1997) sieht in dieser Disposition ein Temperamentsmerkmal, das seine Grundlage in individuellen Unterschieden in der biologischen Ausstattung von Individuen hat. Asendorpf (1989) schlägt demgegenüber eine Zweifaktorentheorie vor, nach der Schüchternheit sowohl auf einem Temperamentsmerkmal als auch auf häufig erlebter sozialer Ablehnung beruhen kann. (Zu den Bedingungen der Angst → Kapitel 9.)
Angst vor physischer Verletzung. Menschen unterscheiden sich hinsichtlich der Tendenz, in Situationen, in denen eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit durch andere Personen, Tiere, Naturereignisse oder materielle Gegebenheiten besteht, mit Angst zu reagieren. Auch die Angst vor Schmerzen lässt sich dieser Klasse zuordnen. Diese häufig sehr spezifischen Ängste (im Sinne der weiter vorn gegebenen Differenzierung müsste man hier eher von Furcht sprechen) sind auch die Grundlage vieler Angststörungen (insbesondere der Phobien; → hierzu Kapitel 5). Zur Klassifikation derartiger Störungen stehen für die therapeutische Praxis umfangreiche Diagnosesysteme zur Verfügung („Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“, DSM-IV; APA, 1994; Saß, Wittchen, Zaudig & Houben, 2003; „International Statistical Classification of Diseases“, ICD-10; WHO, 1993; Dilling, Mombour & Schmidt, 2005; vgl. auch Krohne & Hock, 2007, Kapitel 17).
Unter der Vielzahl der in diesem Bereich unterscheidbaren Auslöser ist besonders die Angst bei medizinischen Eingriffen (Operation, invasive Diagnose, zahnärztliche Behandlung) intensiv untersucht worden (vgl. u. a. Janis, 1958; Johnston, 1980; Sergl & Müller-Fahlbusch, 1989; Tolksdorf, 1985; Vögele, 1988). Insbesondere die Untersuchungen zur Angst bei Operationen haben dabei gezeigt, dass es sich hier nicht um eine einheitliche Klasse auslösender Bedingungen handelt. So lassen sich etwa die Ängste vor der Anästhesie, vor Schmerzen, vor möglichen negativen Folgen der Operation, vor Krankheiten allgemein sowie vor bedrohlichen Diagnosen unterscheiden (vgl. Dony, 1982; Grabow & Buse, 1990; Krohne & Schmukle, 2006; Weinman & Johnston, 1988). Ähnlich komplex scheint auch die Angst vor zahnärztlichen Behandlungen zu sein (u. a. Stouthard, Mellenbergh & Hoogstraten, 1993).
Weitere bereichsspezifische Angstneigungen. Ansätze, die über die dargestellte Einteilung des Bereichs angstauslösender Situationen hinausgehen, wurden u. a. von Endler (1975, 1983) und Becker (1997) entwickelt. So unterzogen Endler, Hunt und Rosenstein (1962) das von ihnen konstruierte „S-R Inventory of Anxiousness“, in dem Reaktionen auf elf fiktive Bedrohungssituationen anzugeben sind, einer Faktorenanalyse. Die drei dabei resultierenden Komponenten (die bereichsspezifischen Ängstlichkeiten) wurden als „Interaktion mit anderen Personen“, „Konfrontation mit einer physischen Gefahr“ und „Neue oder fremde Situationen“ bezeichnet (wobei die Bestimmung des dritten Faktors nicht eindeutig war). In einem kürzlich vorgelegten neuen Inventar, den „Endler Multidimensional Anxiety Scales“ (EMAS; Endler, Edwards & Vitelli, 1991; → Kapitel 2), wurden diesen drei Bereichen als vierter die „Täglichen Routinen“ hinzugefügt (vgl. Endler & Flett, 2002).
Auf der Basis mehrerer in der Verhaltensmodifikation eingesetzter Furchtinventare identifizierte Becker (1997) verschiedene Klassen von Gefahrenquellen (eigenes Handeln, Naturereignisse, Handeln anderer Menschen) sowie gefährdeter Zonen (körperliche Gesundheit, Leben, Selbstwert). Aus der Kreuzklassifikation beider Einteilungsgesichtspunkte ergaben sich sechs angstauslösende Bereiche (z. B. „Normen überschreiten“), zu denen Becker eine Reihe von Items konstruierte. Mithilfe einer Hauptkomponentenanalyse bestimmte er, im Wesentlichen nach dem Kriterium der Interpretierbarkeit, sechs Primärfaktoren, die er als Angst vor physischer Verletzung, Auftritten, Normüberschreitung, Erkrankung und ärztlichen Behandlungen, Selbstbehauptung sowie Abwertung und Unterlegenheit bezeichnete. Aus einzelnen dieser Primärskalen lassen sich zusätzlich vier, Sekundärfaktoren entsprechenden, Zusatzskalen bilden. Die beiden wichtigsten, Angst vor physischen und psychischen Angriffen sowie Angst vor Bewährungssituationen, decken sich im Wesentlichen mit den bereits dargestellten großen Klassen bereichsspezifischer Ängstlichkeiten.
Neben diesen weiten Klassen angstauslösender Situationen werden in jüngster Zeit zunehmend eingegrenztere Ängste beschrieben und operationalisiert. Exemplarisch seien hier nur die Mathematikängstlichkeit (Hembree, 1990; Hunsley, 1987; Ramirez & Dockweiler, 1987; Richardson & Woolfolk, 1980) sowie die Sportwettkampfängstlichkeit (Hackfort, 1986; Hackfort & Schwenkmezger, 1980; Hackfort & Spielberger, 1989; Kleine, 1990b; Krohne & Hindel, 2000; Martens, 1977; Smith, Smoll & Schutz, 1990; Vealey, 1990) genannt. Die Identifizierung relativ eng umschriebener Bereiche angstauslösender Situationen scheint sich dabei allerdings häufig weniger aus einem theoretischen Interesse an der Präzisierung grundlegender Konstruktannahmen herzuleiten als vielmehr aus dem (allerdings nicht immer erfüllten) Wunsch, dispositionsorientierte Tests mit immer besserer Vorhersageleistung für emotionale Reaktionen und darauf bezogenes Verhalten in sehr spezifischen (sog. „eigenschaftskongruenten“) Situationen zu konstruieren (vgl. Brüstle et al., 1985; Laux & Glanzmann, 1996; Laux, Glanzmann & Schaffner, 1985; Mellstrom, Cicala & Zuckerman, 1976; Mellstrom, Zuckerman & Cicala, 1978).
1.1.4 Komponenten der Angst
Die Differenzierung nach Komponenten bezieht sich nicht auf die bereits erwähnten Beschreibungsebenen der Angstemotion (die physiologische, verhaltensmäßigexpressive und subjektive), sondern auf Einteilungsgesichtspunkte innerhalb einer (meist der subjektiven, seltener auch der verhaltensmäßig-expressiven) Ebene. So unterzog Buss (1962) subjektive und fremdbeobachtete verhaltensmäßig-expressive Variablen einer Faktorenanalyse und erhielt zwei Komponenten der Angstemotion: erstens die „autonome Übererregbarkeit“ oder „somatische Angst“ mit den beobachtbaren Anzeichen Schwitzen, Erröten, flaches Atmen und den subjektiven Indikatoren körperliches Unbehagen und Schmerzen sowie zweitens die „konditionierte“ oder „psychische Angst“, die sich aus Muskelanspannung, Ruhelosigkeit und Besorgniskognitionen zusammensetzte (siehe auch Buss, Wiener, Durkee & Baer, 1955; Eysenck, 1961; Hamilton, 1959).
Fenz und Epstein (1965) sowie Fenz (1967) faktorisierten die „Manifest Anxiety Scale“ (MAS; Taylor, 1953), ein subjektives Angstmaß (→ Kapitel 2, Abschnitt 2.2.1), und konnten dabei drei auf dispositioneller Ebene angesiedelte Komponenten extrahieren: „Autonome Übererregbarkeit“, „Symptome der Spannung der quergestreiften Muskulatur“ (Anspannung, Schmerzen, Zuckungen und Zittern) und „Angstgefühle“ (Ablenkbarkeit, Besorgnis, Furcht, Schlafstörungen). Die inhaltliche Korrespondenz dieser dispositionellen Angstkomponenten mit den von Buss (1962) registrierten Faktoren aktueller Angst ist offensichtlich. Dementsprechend schlugen Schalling, Cronholm und Asberg (1975) auf der Grundlage der von Buss getroffenen Unterscheidung eine nach Disposition und emotionalem Zustand getrennte Erfassung „somatischer“ und „psychischer“ Angst vor.
Für den engeren Bereich der Selbstwertbedrohung erbrachten Faktorenanalysen des „Test Anxiety Questionnaire“ (TAQ; Mandler & Sarason, 1952), eines seinerzeit sehr häufig eingesetzten Fragebogens zur Messung von Prüfungsängstlichkeit (→ auch Kapitel 2, Abschnitt 2.3.3), durch Sassenrath (1964) zunächst sieben Faktoren, von denen sich vier auf verschiedene Aspekte der Zuversicht während einer Prüfung, zwei auf autonome Reaktionen (je ein Faktor für Schwitzen und Herzrate) und ein letzter auf Vermeidenstendenzen bezogen. Sechs dieser sieben Faktoren konnten von Sassenrath, Kight und Kaiser (1965) bestätigt werden. Gorsuch (1966) reanalysierte den Datensatz von Sassenrath mittels einer etwas anderen faktorenanalytischen Technik und fand neben den sieben Primärfaktoren zwei Sekundärfaktoren, die er „Emotionalität“ und „ängstliches Vermeiden von Prüfungen“ nannte.
Für Liebert und Morris (1967) schälten sich in diesen Analysen zwei Gruppen von Faktoren heraus: erstens Selbstzweifel und Sorgen („worry“) im Hinblick auf die eigene Leistung (Besorgniskomponente) und zweitens die Wahrnehmung autonomer Erregung (Emotionalitätskomponente). Das erste Merkmal wurde von ihnen als die kognitive und das zweite als die emotionale Komponente der Prüfungsangst bezeichnet. Auf der Grundlage dieser Analysen und nach eigener Beurteilung des Inhalts einzelner Aussagen wählten Liebert und Morris (1967) aus dem TAQ jeweils fünf Items aus, die die Komponenten Besorgnis bzw. Emotionalität besonders gut repräsentieren sollten. Diese zehn Items boten sie ihren Probanden mit einer auf die Erfassung des momentanen Angstzustands gerichteten Instruktion dar. Dabei postulierten sie eine negative Beziehung zwischen der Stärke der Erwartung, ein gutes Ergebnis in einer Prüfung zu erzielen, und dem Auftreten leistungsbezogener Besorgnisgedanken. Demgegenüber sollen Emotionalitätskognitionen den Grad unmittelbarer Unsicherheit in einer Prüfungssituation reflektieren und deshalb bei maximaler Unsicherheit über das Abschneiden (wenn Erfolg und Misserfolg subjektiv gleich wahrscheinlich sind) am stärksten sein. Empirisch bestätigen konnten Liebert und Morris jedoch nur die Hypothese zur Besorgniskomponente.
Wenn sich im Auftreten von Emotionalitätskognitionen die unmittelbare Belastung einer Person in einer aversiven Situation und in Besorgnisgedanken eher die zeitlich länger erstreckten Erwartungen an das Ergebnis einer Leistungsbewertung widerspiegeln, dann müssten sich diese verschiedenen funktionalen Beziehungen auch in unterschiedlichen Verläufen beider Angstkomponenten niederschlagen. Dieser Vermutung entsprechend fanden Spiegler, Morris und Liebert (1968), dass während einer, aus Antizipation, Konfrontation und Postkonfrontation bestehenden, Prüfungsepisode die Intensität von Emotionalitätskognitionen erst unmittelbar vor der Konfrontation anstieg, um direkt danach ebenso schnell wieder abzunehmen. Demgegenüber war keine bedeutsame Veränderung der Stärke von Besorgniskognitionen in Abhängigkeit von der Zeitdimension zu beobachten. Besorgnis variierte jedoch als Funktion sich ändernder Erwartungen hinsichtlich des Prüfungsergebnisses (vgl. auch Kim & Rocklin, 1994).
Der Befund von Spiegler et al., der allerdings empirisch nicht durchgängig bestätigt werden konnte (Deffenbacher & Deitz, 1978; Holroyd, Westbrook, Wolf & Badhorn, 1978; Lukesch & Kandlbinder, 1986), weist darauf hin, dass Emotionalitäts- und Besorgniskognitionen nicht nur unterschiedliche Verläufe während einer aversiven Episode aufweisen, sondern offenbar auch durch verschiedene Aspekte derartiger Situationen angeregt werden. So wiesen Morris und Liebert (1973) einen Anstieg der Besorgnis, nicht aber der Emotionalität als Folge einer Versagensrückmeldung nach. Bei Erwartung einer physischen Gefährdung kam es dagegen zu einer Intensivierung der Emotionalität, während das Niveau der Besorgnis hier unverändert niedrig blieb. Diesen Befunden entsprechend zeigte sich auch, dass sich Besorgniskognitionen durch positive Rückmeldung relativ leicht reduzieren lassen, während die Emotionalitätskomponente hierauf kaum anspricht (Lukesch & Kandlbinder, 1986; Morris & Fulmer, 1976; für eine ausführlichere Darstellung von Bedingungen und Auslösern der Angst → Kapitel 9).
Das in Bewertungssituationen erreichte Leistungsniveau ist in der Regel negativ mit der Intensität und Häufigkeit des Auftretens von Besorgniskognitionen vor und während der Konfrontation assoziiert. Demgegenüber sind Emotionalität und Leistung meist nur schwach korreliert. (Für eine Übersicht vgl. Deffenbacher, 1980; Hembree, 1988; Seipp, 1991.) Einige Autoren (z. B. Hodapp, 1979, 1982; Kim & Rocklin, 1994) vermuten sogar einen leistungsfördernden Einfluss der Emotionalität, der sich allerdings nur dann registrieren lässt, wenn die stets gleichzeitig vorhandene starke positive Beziehung zwischen Besorgnis und Emotionalität kontrolliert wird. (Für eine detailliertere Darstellung der Konsequenzen der Angst → Kapitel 10.) Neben Vorstellungen, in denen die Angst im Wesentlichen als Determinante des Leistungsniveaus angesehen wird, wurden in jüngster Zeit auch Konzeptionen formuliert, die die Beziehung zwischen Angst und Leistung als interdependentes System auffassen (u. a. Becker, 1983; Hodapp, 1989a).
Die vorgeschlagene Trennung zwischen Besorgniskognitionen und Emotionalität, d. h. dem subjektiven, nicht mit tatsächlicher autonomer Erregung zu verwechselnden, Erleben von Aufgeregtheit, hat inzwischen zu einer umfangreichen Forschungsaktivität geführt. (Für Übersichten und theoretische Präzisierungen siehe u. a. Deffenbacher, 1980; Dweck & Wortman, 1982; Endler, Edwards, Vitelli & Parker, 1989; Morris, Davis & Hutchings, 1981; Schwarzer, 1984, 2000; Schwenkmezger, 1985; Wine, 1982; Zeidner, 1998.) Dabei wurde deutlich, dass diese Unterscheidung nicht nur auf selbstwertbedrohliche Situationen beschränkt ist, sondern sich auch auf andere Stressoren anwenden lässt (Eysenck, 1992), z. B. auf soziale Interaktionen (Morris, Harris & Rovins, 1981), Sportwettkämpfe (Krohne & Hindel, 2000; Schwenkmezger & Laux, 1986), die Angst vor medizinischen Eingriffen (Krohne & Schmukle, 2006) oder die verhaltensmodifikatorische Behandlung der Angst (Borkovec, 1985a).
Eine Übertragung der von Liebert und Morris für den Angstzustand durchgeführten Einteilung auf die Ängstlichkeit haben Morris, Davis et al. (1981) sowie Spielberger (1980) vorgeschlagen (siehe auch Hodapp, Laux & Spielberger, 1982; Spielberger, Gonzalez, Taylor, Algaze & Anton, 1978). Dabei wurde deutlich, dass die beiden dispositionellen Dimensionen, ebenso wie die Komponenten aktueller Angst, nicht unabhängig voneinander variieren. Die habituellen Tendenzen, in bedrohlichen Situationen Besorgniskognitionen bzw. Aufgeregtheit zu manifestieren, sind vielmehr deutlich positiv assoziiert, haben allerdings unterschiedliche Einflüsse auf das nachfolgende Verhalten (vgl. u. a. Schwarzer, 1984; Ware, Galassi & Dew, 1990).
Einige Forscher haben die Differenzierung nach Komponenten mit der Einteilung nach bereichsspezifischen Angstneigungen kombiniert. So unterscheidet Wells (1994) speziell für die Besorgniskomponente zwischen „sozialer Besorgnis“, „Besorgnis über die Gesundheit“ und „Besorgnis über unkontrollierbare Gedanken“ (vgl. auch Tallis, Eysenck & Mathews, 1992).
Eine über die Differenzierung in Besorgnis- und Aufgeregtheitskognitionen hinausgehende Einteilung der Prüfungsängstlichkeit haben u. a. Sarason (1984, 1985), Hodapp (1991) sowie Rost und Schermer (1987) vorgeschlagen. Sarason unterscheidet in diesem Bereich die vier Komponenten Anspannung („distress and uneasiness“), Besorgtheit („worry“), aufgabenirrelevante Gedanken bzw. Interferenz sowie körperliche Reaktionen (z. B. Selbstwahrnehmung erhöhter Herzrate). Nach Birenbaum (1990) handelt es sich hierbei um Primärfaktoren, die in den beiden Sekundärfaktoren „Emotionalität“ und „Kognition“ aufgehen. Hodapp (1991) erweiterte das von Spielberger (1980) entwickelte „Test Anxiety Inventory“ (TAI) und konnte mithilfe von Faktoren- und Itemanalysen vier Subskalen bilden: Aufgeregtheit, Besorgtheit, Mangel an Zuversicht und Interferenz (vgl. auch Hodapp, 1996, Hodapp & Benson, 1997). Eine ebenfalls differenziertere Beschreibung der Variablen des „Motivationsprozesses“ und des „Motivationszustands“ während einer Prüfung und eine empirische Analyse ihres Zusammenhangs hat Heckhausen (1982) vorgelegt. Für sportliche Wettkampfsituationen unterschieden Krohne und Hindel (2000) nach entsprechenden empirischen Analysen die Tendenzen zu Selbstzweifel, emotionaler Anspannung und Hilflosigkeit.
Viele der dargestellten Differenzierungen im Bereich der angstauslösenden Situationen wie auch der Komponenten der Ängstlichkeit bzw. des Angstzustands verlassen sich primär auf statistische Klassifikationstechniken. Dabei wird leicht übersehen, dass statistisch gewonnene Einteilungen relativ beliebig sind, solange sie nicht durch theoretische Annahmen über die Struktur des untersuchten Sachverhalts fundiert werden. Unterschiedliche theoretische Ansätze zur Angst werden in Teil III vorgestellt.
1.2 Zusammenfassung
Dieses Kapitel befasst sich mit Definitionen und wichtigen Differenzierungen innerhalb des Phänomenbereichs der Angst. Eine zentrale Unterscheidung ist die zwischen dem Persönlichkeitsmerkmal Ängstlichkeit und dem aktuellen Angstzustand. Der Angstzustand ist dabei durch spezifische Ausprägungen auf physiologischen, verhaltensmäßig-expressiven und subjektiven Parametern gekennzeichnet. Eine weitere wichtige Differenzierung ist die zwischen Angst, Furcht und Stress. Angst soll ausgelöst werden, wenn eine Situation als gefährlich erlebt wird, ohne dass momentan angemessen reagiert werden kann. Furcht soll dagegen dann vorliegen, wenn in derartigen Situationen Reaktionen möglich sind. Stress bezeichnet in neueren psychologischen Theorien (z. B. von Lazarus) eine spezifische Beziehung zwischen Umwelt und Person, in der Anforderungen vorliegen, die die Bewältigungsmöglichkeiten der betroffenen Person stark beanspruchen.
Personen lassen sich danach unterscheiden, in welchen Situationen sie vergleichsweise leicht mit Angst reagieren. Auf diese Weise werden bereichsspezifische Angstneigungen unterschieden, von denen insbesondere die Bewertungsängstlichkeit, die soziale Ängstlichkeit (mit den Kategorien Publikums- bzw. Sprechangst, Verlegenheit, Scham und Schüchternheit) und die Angst vor physischer Verletzung intensiver untersucht wurden. Angstkomponenten differenzieren die Angstemotion nach verschiedenen Äußerungsformen. Als die wichtigsten Komponenten haben sich dabei die Besorgnis (Selbstzweifel, Sorgen und negative Erwartungen) und die Emotionalität (die Wahrnehmung von Aufgeregtheit und körperlichen Symptomen) erwiesen, wobei in Leistungssituationen insbesondere der Besorgniskomponente ein wichtiger (leistungsmindernder) Einfluss zukommt.
Weiterführende Literatur
Wichtige Arbeiten zur Differenzierung des Angstkonzepts finden sich in Lazarus (1991), LeDoux (1996) sowie Öhman und Mineka (2001).
Fragen zur Wissenskontrolle
Wie werden Angst als Persönlichkeitsmerkmal und als emotionaler Zustand definiert?
Auf welchen Ebenen lässt sich der Angstzustand beschreiben? Nennen Sie für jede Ebene beispielhaft eine Variable.
Wie werden Angst, Furcht und Stress definiert?
Nennen Sie wichtige bereichsspezifische Angstneigungen.
Welches sind die beiden zentralen Komponenten der Angstemotion?
2 Die Messung von Angst und Ängstlichkeit
In Kapitel 1 wurde ein erster Überblick über den Phänomenbereich der Angst gegeben. Nun stellen die dabei vorgeschlagenen Einteilungen und Zuordnungen nur erste Schritte bei der Erforschung eines Sachverhalts dar. Entscheidender ist die Beantwortung der Frage, welche empirischen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Aspekten dieses Phänomenbereichs, beispielsweise zwischen der durch bestimmte Tests gemessenen Bewertungsängstlichkeit und den Leistungen in einer Prüfung, bisher ermittelt werden konnten. Die Darstellung geht hier also über von der definitorisch-klassifizierenden zur deskriptiven Ebene. Ziel ist nunmehr die Beschreibung von Möglichkeiten zur Messung von Merkmalen sowie die Registrierung von Zusammenhängen mit auslösenden Bedingungen und Konsequenzen.
Während im Teil IV dieses Buches Forschungsergebnisse zu den Bedingungen und Auslösern (Kapitel 9) bzw. den Konsequenzen der Angst (Kapitel 10) dargestellt werden, sollen in diesem Kapitel zunächst die Probleme und Methoden der Messung der aktuellen Angstemotion und des Persönlichkeitsmerkmals Ängstlichkeit beschrieben werden.
2.1 Angst und Ängstlichkeit als hypothetische Konstrukte
Die aktuelle Angstemotion wird über bestimmte subjektive, verhaltensmäßig-expressive und physiologische Variablen empirisch erfasst. Im Prinzip stehen diese Variablenarten auch zur Messung der Disposition bzw. des Persönlichkeitsmerkmals Ängstlichkeit zur Verfügung, allerdings lässt sich hier in den letzten Jahren eine deutliche Präferenz für subjektive Verfahren (insbesondere Fragebogen) erkennen.
Man muss sich nun darüber im Klaren sein, dass weder der aktuelle emotionale Angstzustand als solcher noch das Persönlichkeitsmerkmal Ängstlichkeit unmittelbar beobachtet werden können. Registrieren kann man nur bestimmte Phänomene, beispielsweise, dass jemand in einer Prüfung schwitzt, stottert, errötet oder sagt, dass er „Angst habe“. Objektiv feststellen kann man auch, dass eine Person in einem bestimmten Fragebogen einzelne Feststellungen bejaht und andere verneint. Alle diese Phänomene sind im Prinzip von jedem Beobachter in gleicher Weise wahrnehm- und registrierbar. Das heißt nun aber nicht, dass damit auch schon die Bedeutung dieser Phänomene festliegt. Die Feststellung der Bedeutung der in einem bestimmten Erhebungsverfahren (etwa einem Fragebogen oder einer standardisierten Beobachtung) gezeigten Verhaltensweisen heißt Validierung dieses Verfahrens. Erst der Nachweis der Validität eines Verfahrens ermöglicht den diagnostischen Schluss, d. h. den Schluss von einem vorliegenden und begrenzten Index auf etwas Umfassenderes und nicht unmittelbar Gegebenes (Krohne & Hock, 2007, S. 2).
Um dem Beobachtbaren seine theoretische Bedeutung zu verleihen, führt die Psychologie gedankliche Konstruktionen ein, die sog. „theoretischen“ bzw. „hypothetischen“ Konstrukte. Wichtige Konstrukte der Psychologie sind Intelligenz, kognitive Stile und eben auch Angst und Ängstlichkeit. Konstrukte sind Theorien über einen bestimmten Sachverhalt, z. B. Ängstlichkeit, der in verschiedenen Beobachtungssituationen (bzw. in unterschiedlichen Erhebungsverfahren) relevant wird. Aus der Perspektive des Konstrukts fungieren diese Situationen bzw. Verfahren als dessen empirische Indikatoren, d. h. sie operationalisieren die Konstruktaussagen.
Abb. 2.1: Veranschaulichung der Beziehung eines theoretischen Konstrukts zu empirischen Indikatoren
Ein theoretisches Konstrukt ist dabei niemals mit nur einem „Strang“ in der Welt beobachtbarer Phänomene verankert (s. Abbildung 2.1). Das Konstrukt Ängstlichkeit ist also nicht identisch etwa mit Reaktionen in einem bestimmten Angstfragebogen. Vielmehr ist ein Konstrukt auf eine mehr oder weniger große Zahl unterschiedlicher Phänomene bezogen. In Abbildung 2.1 wären dies die empirischen Indikatoren A bis F. A könnte dabei ein „Ängstlichkeits“-Fragebogen sein, etwa die bereits erwähnte „Manifest Anxiety Scale“ (MAS; Taylor, 1953), B die Diagnose eines Psychiaters hinsichtlich „neurotischer Tendenz“, C die Schnelligkeit des Erlernens eines Vermeidensverhaltens in einem Konditionierungsexperiment (→ Kapitel 6, Abschnitt 6.7.2), D das Leistungsniveau unter Stress usf. (vgl. auch Hörmann, 1964). Konstrukte sind allerdings niemals vollständig durch empirische Indikatoren bestimmbar. Sie weisen gegenüber empirischen Aussagen (z. B. „der Schüler A hat im Angsttest X einen Wert von 15“) einen „Bedeutungsüberschuss“ auf, da sie auch Hypothesen über bis dahin nicht registrierte Beobachtungsdaten enthalten, z. B. über Daten, die zu anderen Zeitpunkten bzw. Situationen oder an anderen Personen erhoben werden. Konstruktaussagen enthalten also immer eine gewisse Abstraktion, z. B. von der konkreten Situation der Datenerhebung, dem dabei verwendeten Material oder der spezifischen Stichprobe. (Zum „Bedeutungsüberschuss“ bei theoretischen Aussagen siehe u. a. Herrmann, 1973.)
Wie kommt die Psychologie nun überhaupt zu einem Konstrukt und seinen empirischen Indikatoren? Im Anfangsstadium der Theoriebildung werden Konstrukte nur durch eine sehr begrenzte Anzahl empirischer Indikatoren repräsentiert. In den frühen Arbeiten Freuds wurde Ängstlichkeit etwa im Wesentlichen mit bestimmten „hysterischen“ und „neurasthenischen“ (also psychopathologischen) Merkmalen identifiziert (→ Kapitel 5). Das Ziel wissenschaftlicher Forschung, immer genauere und tragfähigere Vorhersagen über das Eintreffen bestimmter empirischer Sachverhalte zu machen, fordert jedoch die Herstellung von immer zahlreicheren Verbindungssträngen, d. h. das Auffinden neuer Zusammenhänge in einem konstruktspezifischen Bereich.
In welcher Richtung der Forscher diese Zusammenhänge zu suchen hat, das sagt ihm am Anfang der Konstruktentwicklung das „Vorverständnis“ des betreffenden Sachverhalts. So würde ihm sein Vor- bzw. Alltagsverständnis von „ängstlichen Personen“ etwa sagen, dass diese in belastenden Situationen wie Prüfungen weniger leisten als Nichtängstliche, dass sie unter Stress leicht „aufgeregt“ werden (also etwa schwitzen, mit den Händen zittern und unkonzentriert sind), sich häufig Sorgen über mögliche Misserfolge machen und außerdem zu psychosomatischen Symptomen (z. B. Schlaflosigkeit) neigen. Nach diesem Initialimpuls ist im weiteren Verlauf der Konstruktentwicklung jedoch nicht mehr dieses Verständnis die Richtschnur des Vorgehens, sondern „der Kanon einer auf verbindliche Aussagen gerichteten Wissenschaft“ (Hörmann, 1964, S. 9).
Die Bedeutung eines theoretischen Begriffs wie etwa Angst oder Ängstlichkeit ergibt sich dann aus dem Ort, den dieser in einem sich herausbildenden Netzwerk von Beziehungen, dem sog. „nomologischen Netz“ (Feigl, 1958), einnimmt. Der Prozess der Entwicklung dieses Netzwerks ist niemals abgeschlossen. Ein Konstrukt bezeichnet also nur die augenblicklich bekannte Konstellation in diesem Bereich.
Auf einen Punkt kann in diesem Zusammenhang nicht genug hingewiesen werden. Begriffe wie Ängstlichkeit beziehen sich ausschließlich auf theoretische Konstruktionen. Es handelt sich hier also nicht um „wirkliche Eigenschaften des Menschen“, die es schlicht zu entdecken gilt. Man darf also über Ängstlichkeit, Intelligenz usw. nicht so reden, als gäbe es „hinter“ dem Beobachtbaren gewissermaßen noch eine zweite Realität, die nur unglücklicherweise (zumindest mit unseren alltäglichen Methoden) der Beobachtung nicht zugänglich ist. Weil theoretische Konstruktionen in diesem Sinne nicht real (d. h. dinghaft und wirksam) sind, können sie auch nicht Ursachen beobachteten Verhaltens sein. Jemand zeigt also z. B. nicht deshalb eine erhöhte autonome Erregung, weil er die Eigenschaft Ängstlichkeit „besitzt“ (in einer derartigen Aussage würde der theoretischen Konstruktion nämlich Wirksamkeit zugeschrieben), sondern etwa, weil ihm eine Strafe angedroht wurde oder er in einer Prüfung einen Misserfolg erwartet.
2.2 Indikatoren der aktuellen Angst
Konstrukte wie aktuelle Angst oder Ängstlichkeit sind also durch „Bestimmungslinien“ mit der Welt der beobachtbaren Phänomene verbunden. Anhand dieser Linien wird festgelegt, welche Elemente zur Klasse konstruktspezifischer Merkmale gehören. Nach der in Kapitel 1 gegebenen Beschreibung des Phänomenbereichs der Angst lassen sich die Indikatoren für die Konstrukte Angst und Ängstlichkeit den Merkmalsbereichen der subjektiven Beschreibungen, der verhaltensmäßig-expressiven Reaktionen und der physiologischen Prozesse zuordnen. Dabei ist allerdings festzustellen, dass das Persönlichkeitsmerkmal Ängstlichkeit vorzugsweise über subjektiv erhobene Daten operationalisiert wird, während für die aktuelle Angstemotion Indikatoren aus allen drei Erhebungsebenen herangezogen werden. Ferner ist zu beachten, dass es insbesondere bei einigen älteren Angsttests unbestimmt ist, ob sie eher auf die Erfassung der Disposition oder des Zustands zielen. Andere Tests wiederum gestatten sowohl die Erfassung der Disposition als auch des Zustands, indem sie entweder denselben Itemsatz mit entsprechend unterschiedlich formulierten Instruktionen darbieten („wie fühlen Sie sich im Allgemeinen?“ bzw. „wie fühlen Sie sich jetzt?“) oder zur Erfassung der beiden Angstkonstrukte unterschiedliche (aber formal sehr ähnliche) Unterskalen bereitstellen. Damit sollen in diesem Abschnitt die folgenden Indikatoren der Angst besprochen werden:
Subjektive Maße
Ein-Itemskalen, Eigenschaftslisten, Fragebogen
Verhaltensmäßig-expressive Reaktionen
Mimik, Vokalisation, weitere motorische Reaktionen, makroanalytische nonverbale Erregungsanzeichen, verbale Indikatoren
Physiologische Prozesse
Zentralnervöse Parameter, peripherphysiologische Parameter, muskuläre Parameter, endokrine Parameter, immunologische Parameter