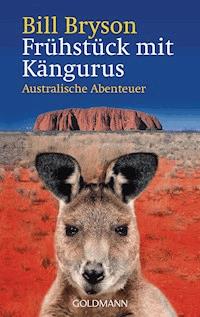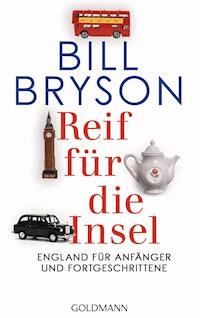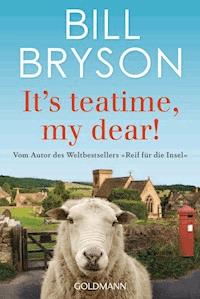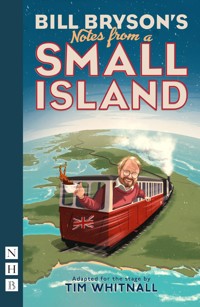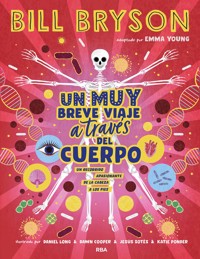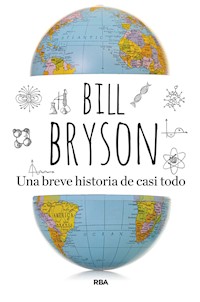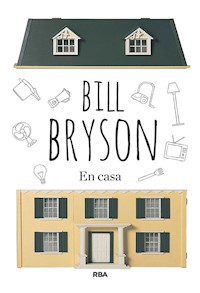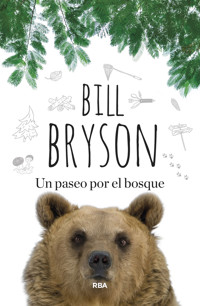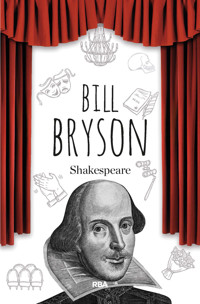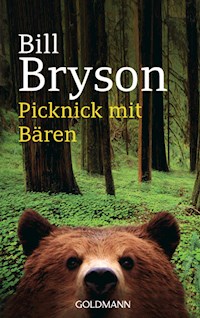
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bill Bryson will es seinen gehfaulen Landsleuten zeigen:
Gemeinsam mit seinem Freund Katz, der aufgrund gewaltiger Leibesfülle und einer festverwurzelten Leidenschaft für Schokoriegel nicht gerade die besten Voraussetzungen dafür mitbringt, will er den längsten Fußweg der Welt, den "Appalachian Trail", bezwingen. Eine abenteuerliche Reise quer durch zwölf Bundesstaaten der USA beginnt...
Ein Reisebericht der etwas anderen Art - humorvoll, selbstironisch und mit einem scharfen Blick für die Marotten von Menschen und Bären!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Buch
Anders als seine amerikanischen Landsleute, von denen Bill Bryson süffisant feststellt, sie würden sich täglich nicht mehr als 300 Meter zu Fuß bewegen, hat er sich Großes vorgenommen: Gemeinsam mit seinem alten Schulfreund Stephen Katz, der aufgrund seiner Leibesfülle und ausgesprochenen Leidenschaft für Unmengen von Snickers allerdings nicht eben die besten Voraussetzungen mitbringt, plant er eine Bezwingung des »Appalachian Trail« – jenes legendären längsten Fußweges der Welt, der sich über 3000 Kilometer durch 14 Staaten hindurch an der Ostküste Amerikas entlangwindet und dem Wanderer die spektakulärsten Naturschönheiten offenbart. Aber unberührte Wälder, verwunschene Seen und atemberaubende Schluchten sind nicht das Einzige, was dieser Trip den beiden Wagemutigen beschert: Von den Tücken einer mangelhaften Ausrüstung einmal abgesehen, lauern allerhand Gefahren im Dickicht, und da selbst die einschlägige Fachliteratur keine verläßlichen Tips für den Fall einer Bärenattacke zu geben vermag – außer, unter gar keinen Umständen Snickers bei sich zu führen –, nimmt das Bangen kein Ende. Und dann sind da auch noch die lieben Mitmenschen, die unvermeidlicherweise ihren Weg kreuzen und sie in so manch fatale Situation bringen …
Autor
Bill Bryson wurde 1951 in Des Moines, Iowa, geboren. 1977 ging er nach Großbritannien und schrieb dort mehrere Jahre u. a. für die Times und den Independent. Mit »Reif für die Insel« (Goldmann Taschenbuch 44279) gelang Bryson, der zuvor bereits Reiseberichte geschrieben hat, der ganz große Durchbruch. Bill Bryson lebt heute mit seiner Familie in Hanover, New Hampshire. Weitere Werke des Autors sind bei Goldmann in Vorbereitung.
Inhaltsverzeichnis
Für Katz.
Wen sonst.
TEIL 1
1. Kapitel
Kurz nachdem ich mit meiner Familie in eine Kleinstadt in New Hampshire gezogen war, entdeckte ich zufällig einen Wanderweg, der sich am Ortsausgang in einem Wald verlor.
Ein Schild verkündete, daß es sich hierbei nicht um einen gewöhnlichen Weg handelte, sondern um den berühmten Appalachian Trail. Mit seinen über 3.300 Kilometern durch die majestätischen und verlockenden Appalachen, entlang der amerikanischen Ostküste, zählt der AT, wie er bei Kennern heißt, zu den Altvordern unter den Fernwanderwegen. Er führt von Georgia bis nach Maine, durch 14 verschiedene Bundesstaaten, über stattliche, reizvolle Berge, deren Namen – Blue Ridge, Smokies, Cumberlands, Catskills, Green Mountains, White Mountains – schon wie eine Einladung zum Spazierengehen klingen. Wer kann schon die Worte »Great Smoky Mountains« oder »Shenandoah Valley« aussprechen, ohne dabei nicht das Bedürfnis zu verspüren, »einen Laib Brot und ein Pfund Tee in einen alten Rucksack zu werfen, über den Gartenzaun zu springen und loszuziehen«, wie es der Naturforscher John Muir ausdrückte.
Da war er also, der Weg, schlängelte sich – für mich ganz unerwartet – verführerisch durch das friedliche Nest in New England, in dem ich mich gerade niedergelassen hatte. Die Vorstellung, ich könnte von zu Hause aufbrechen und 2.800 Kilometer weit durch einen Wald bis nach Georgia wandern, oder in die andere Richtung, 700 Kilometer nach Norden, über die rauhen und gebirgigen White Mountains klettern, bis auf den sagenhaften burgähnlichen Gipfel des Mount Katahdin, die ganze Zeit über umgeben von Bäumen, durch eine Wildnis, die nur wenige Menschen je zu Gesicht bekommen haben – diese Vorstellung erschien mir so außergewöhnlich, daß sich eine leise Stimme in meinem Inneren meldete: »Hört sich toll an! Das machen wir!«
Ich legte mir eine Reihe vernünftiger Gründe zurecht, die dafür sprachen. Es würde mich nach Jahren der Faulenzerei wieder auf die Beine bringen. Es wäre eine interessante und besinnliche Art, sich nach 20 Jahren im Ausland wieder mit der Größe und Schönheit meines Heimatlandes vertraut zu machen. Es würde mir von Nutzen sein – wenn ich auch noch nicht wußte wie –, einmal zu lernen, mich in der Wildnis zurechtzufinden und für mich selbst zu sorgen. Ich brauchte mir nicht mehr wie ein Schlappschwanz vorzukommen, wenn die Männer in Tarnhosen und mit Jägerhüten im Four Aces Diner beisammensaßen und sich über ihre schaurigen Erlebnisse in der freien Natur unterhielten. Ich wollte ein bißchen von der Großspurigkeit abhaben, die sich einstellt, wenn man mit Granitaugen in die Ferne blickt und mit einem gedehnten, virilen Räuspern sagen kann: »Ja, ich kenne den Wald wie meine Westentasche.«
Es gab noch einen anderen, unwiderstehlicheren Grund. Die Appalachen sind die Heimat des größten Laubwaldes der Erde – der ausgedehnte Restbestand des üppigsten und abwechslungsreichsten Waldgebietes, das je die gemäßigte Klimazone unseres Planeten zierte –, und dieser Wald ist gefährdet. Sollte sich die Erdatmosphäre im Laufe der nächsten 50 Jahre um vier Grad Celsius erwärmen, was durchaus wahrscheinlich ist, würde sich die gesamte Wildnis der Appalachen südlich von New England in eine Savanne verwandeln. Das Baumsterben hat bereits erschreckende Ausmaße angenommen. Ulmen und Kastanien sind dort längst verschwunden; der stattliche Schierling und der blütenreiche Hartriegel sind im Verschwinden begriffen; Rottanne, Frasertanne, Eberesche und Zuckerahorn sind als nächste dran. Wenn es jemals an der Zeit war, diese einzigartige Wildnis zu erleben, dann jetzt.
Ich faßte also den Entschluß, es zu machen. Vorschnell teilte ich Freunden und Nachbarn meine Absicht mit, informierte selbstsicher meinen Verlag, sorgte für Verbreitung der Neuigkeit unter allen, die mich kannten. Sodann kaufte ich mir ein paar Bücher und redete mit Leuten, die den Trail ganz oder abschnittweise gegangen waren, und allmählich wurde mir klar, daß dieses Unternehmen alles, aber wirklich alles übertreffen würde, was ich jemals angepackt hatte.
Fast jeder, mit dem ich mich darüber unterhielt, hatte eine Geschichte über irgendeinen arglosen Bekannten parat, der sich mit großen Hoffnungen und neuen Wanderschuhen auf den Weg gemacht hatte und zwei Tage später mit einem Rotluchs als Halskrause oder einem Hemdsärmel, aus dem nur noch ein bluttriefender Stumpf ragte, zurückgetorkelt kam und heiser flüsterte: »Bär!« bevor er in tiefe Bewußtlosigkeit versank.
Die Wälder waren voller Gefahren – Klapperschlangen und Mokassinschlangen, Rotluchse, Bären, Kojoten, Wölfe und Wildschweine; gemütskranke Hinterwäldler, durch den großzügigen Konsum von Maisschnaps und sündigen Sexualpraktiken über Generationen aus der Bahn geworfen; tollwütige Stinktiere, Waschbären und sogar Eichhörnchen; unbarmherzige, rote Ameisen und wütende Kriebelmücken; gemeiner Giftsumach, kletternder Giftsumach, giftige Färbereiche und giftige Salamander; versprengte Elche, die von einem parasitären tödlichen Wurm befallen sind, der sich in ihrem Gehirn einnistet und sie dazu anstiftet, harmlose Wanderer über entlegene, sonnenbeschienene Wiesen zu jagen und sie in Gletscherseen zu treiben.
Unvorstellbare Dinge konnten einem da draußen widerfahren. Ich habe von einem Mann gehört, der nächtens zum Pinkeln aus seinem Zelt trat und von einer kurzsichtigen Eule am Kopf gestreift wurde – seinen Skalp sah er zuletzt von den Krallen des Vogels herabbaumeln, hübsch anzuschauen vor der Silhouette des Vollmonds; und von einer jungen Frau, die von einem Kitzeln am Bauch aufwachte, in ihren Schlafsack blickte und eine Mokassinschlange entdeckte, die es sich in der Wärme zwischen ihren Beinen gemütlich gemacht hatte. Ich habe vier verschiedene Versionen – stets mit einem unterdrückten Lachen vorgetragen – von ein und derselben Geschichte über das Zusammentreffen von Wanderern und Bären gehört, die sich für einen kurzen, aufreibenden Moment ein Zelt miteinander teilten; Geschichten von Leuten, die auf einem Gebirgskamm, von einem plötzlichen Sturm überrascht und von mannsdicken Blitzstrahlen getroffen, sich in Dampf auflösten (»es blieb nur noch ’n Brandfleck von ihm übrig«); Geschichten von Zelten, die von stürzenden Bäumen zerschmettert, von strömendem Regen wie auf Kugellagern ganze Abhänge hinuntergerollt, gleitschirmartig in ferne Täler getragen oder von der Wasserwand einer Sturzflut weggespült wurden; von unzähligen Wanderern, deren letzter Gedanke im Angesicht der erzitternden Erde war: »Was um Himmels willen – ?«
Bereits die oberflächliche Lektüre von Abenteuerbüchern und ein Mindestmaß an Phantasie reichten aus, um sich Situationen auszumalen, in die ich unweigerlich geraten würde: umzingelt von Wölfen, die der Hunger treibt; in die Flucht geschlagen von bissigen Ameisen, taumelnd, mir die Kleider vom Leib reißend oder wie versteinert vom Anblick des zum Leben erwachten Unterholzes, das wie ein Unterwassertorpedo auf mich zukommt und sich als schrankgroßes Wildschwein mit kalten, glänzenden Augen entpuppt, das mich, begleitet von markigen Grunzlauten, mit unstillbarem Appetit auf rosiges, schwabbeliges, vom Stadtleben verweichlichtes Menschenfleisch lustvoll verzehrt.
Dann wären da noch diverse Krankheiten zu nennen, für die der Mensch in der Wildnis anfällig ist – Giardiasis, östliche Pferdeenzephalitis, Rocky-Mountain-Fleckfieber, Lymekrankheit, Ehrlichiosis, Bilharziose, Bruzellose und die bazilläre Ruhr, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Die östliche Pferdeenzephalitis, durch einen Moskitostich hervorgerufen, greift Gehirn und Zentralnervensystem an. Man kann von Glück sagen, wenn man den Rest seines Lebens im Sessel sitzend verbringen darf, mit Lätzchen um den Hals – im allgemeinen ist die Krankheit tödlich. Ein Gegenmittel ist nicht bekannt. Nicht weniger interessant ist die Lymekrankheit, die durch den Biß einer winzigen Rotwildzecke übertragen wird. Unentdeckt kann das Virus jahrelang im menschlichen Körper schlummern, bis es sich in einem wahren Inferno Bahn bricht. Diese Krankheit ist etwas für Leute, die es wirklich wissen wollen. Zu den Symptomen zählen – ohne Garantie auf Vollständigkeit – Kopfschmerzen, Erschöpfungszustände, Fieberanfälle, Schüttelfrost, Kurzatmigkeit, Schwindelgefühl, stechende Gliederschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Gesichtslähmung, Muskelzuckungen, schwere geistige Schäden, Verlust der Kontrolle über Körperfunktionen und – was niemanden überraschen wird – chronische Depression.
Hinzu kommt die kaum bekannte Familie der Organismen, die man als Hantaviren bezeichnet. Sie tummeln sich mit Vorliebe in den Mikroschwaden, die sich über Mäuse- und Rattenkot bilden, und werden in die menschlichen Luftwege eingesogen, wenn der Betreffende versehentlich eine der Atemöffnungen in die Nähe hält – indem er sich beispielsweise auf ein Schlafpodest bettet, unter dem kürzlich ein paar Mäuse herumgetollt sind. 1993 kamen durch eine einzige Hantavirusepidemie im Südwesten der Vereinigten Staaten 32 Menschen ums Leben, und im Jahr darauf forderte die Krankheit ihr erstes Opfer auf dem AT. Ein Wanderer hatte sie sich in einer »nagetierbefallenen Schutzhütte« zugezogen, wobei gesagt werden muß, daß alle Schutzhütten auf dem Appalachian Trail von Nagetieren befallen sind. Von den bekannten Viren garantieren nur noch die Tollwut, das Ebolavirus und das HIV einen sicheren Tod. Auch für das Hantavirus gibt es kein Gegenmittel.
Zu guter Letzt gibt es immer noch die Möglichkeit, ermordet zu werden – wir leben schließlich in Amerika. Seit 1974 sind mindestens neun Wanderer auf dem AT ermordet worden, wobei die tatsächliche Zahl schwankt, je nachdem, welche Quelle man konsultiert und was man unter dem Wort Wanderer versteht. Während ich den AT entlangwanderte, starben jedenfalls zwei Frauen.
Aus diversen praktischen Gründen, die im wesentlichen mit den langen, zermürbenden Wintern im nördlichen New England zu tun haben, stehen jedes Jahr nur entsprechend wenige Monate zum Wandern zur Verfügung. Beginnt man die Wanderung im Norden, am Mount Katahdin in Maine, muß man bis Ende Mai, Anfang Juni abwarten, damit aller Schnee geschmolzen ist. Beginnt man dagegen in Georgia und arbeitet sich Richtung Norden vor, gilt es, die Wanderung zeitlich so zu legen, daß man vor Mitte Oktober, wenn der erste Schneefall einsetzt, am Ziel angelangt ist. Die meisten wandern mit Beginn des Frühjahrs von Süden nach Norden und halten idealerweise immer einen Vorsprung von einigen Tagen vor der schlimmsten Hitze und den lästigen und Krankheiten übertragenden Insekten ein. Ich beabsichtigte, Anfang März im Süden aufzubrechen und rechnete sechs Wochen für die erste Etappe.
Die Frage nach der exakten Länge des Appalachian Trail bleibt ein interessantes Rätsel. Der U.S. National Park Service, der sich immer wieder durch diverse Ungereimtheiten hervortut, bringt es fertig, die Länge des Weges in einem einzigen Prospekt mal mit 3.468 Kilometer, mal mit 3.540 Kilometer anzugeben. Die Appalachian Trail Guides, der offizielle Wanderführer, ein Schuber mit elf Büchlein, von denen jedes einen bestimmten Bundesstaat oder einen Abschnitt behandelt, spricht nach Belieben von 3.450, 3.455, 3.474 und einmal von »über 3459 Kilometern«. Die Appalachian Trail Conference legte 1993 die Länge des Wanderwegs auf genau 3.454,6 Kilometer fest, ging dann für ein paar Jahre zu der vagen Angabe »mehr als 3.460 Kilometer« über und kehrte erst kürzlich selbstbewußt zu der präzisen Angabe von 3.467,4 Kilometern zurück. Ebenfalls 1993 gingen drei Leute die gesamte Strecke mit einem Meßrad ab und kamen auf eine Distanz von 3.483,97 Kilometern. Ungefähr zur gleichen Zeit ergab eine sorgfältige Überprüfung, die auf Karten der U.S. Geological Survey basierte, eine Gesamtlänge von 3.408,98 Kilometern.
Eins ist sicher: es ist ein langer Wanderweg, und er ist, egal, an welchem Ende man startet, weiß Gott nicht leicht. Die Gipfel entlang des Appalachian Trail sind nicht gewaltig, im Vergleich zu den Alpen etwa – der höchste, Clingmans Dome in Tennessee, erreicht gerade mal 2.042 Meter –, aber sie wollen dennoch erklommen werden, und es bleibt nicht bei einem Berg. Mehr als 350 Gipfel am AT sind über 1.500 Meter hoch, und in der Umgebung befinden sich noch einmal tausend weitere. Insgesamt veranschlagt man etwa fünf Monate und fünf Millionen Schritte, um von einem Ende des Trails zum anderen zu kommen.
Natürlich muß man alles, was man unterwegs braucht, auf dem Rücken mitschleppen. Für andere mag das selbstverständlich sein, aber für mich war es ein kleiner Schock, als mir klar wurde, daß eine Wanderung entlang des AT nicht im entferntesten mit einem gemächlichen Spaziergang in den englischen Cotswolds oder im Lake District zu vergleichen ist, zu dem man mit einer Provianttasche aufbricht, die ein Lunchpaket und eine Wanderkarte enthält, und von dem man am Ende des Tages in eine gemütliche Herberge zurückkehrt, zu einem heißen Bad, einem herzhaften Abendessen und einem weichen Bett. Auf dem AT schläft man draußen und kocht sich sein Essen selbst. Kaum einem gelingt es, das Gewicht des Rucksacks auf weniger als 18 Kilogramm zu reduzieren, und wenn man so viel mit sich herumschleppt, spürt man jedes einzelne Gramm, das kann ich Ihnen versichern. 3.000 Kilometer zu wandern ist eine Sache, 3.000 Kilometer mit einem Kleiderschrank auf dem Rücken sind etwas ganz anderes.
Eine erste Ahnung davon, was für ein waghalsiges Unternehmen das werden würde, bekam ich in unserem Dartmouth Co-Op, als ich dort hinging, um mir eine Ausrüstung zu kaufen. Mein Sohn hatte gerade angefangen, nach der Schule in dem Laden zu jobben, ich hatte also strengste Anweisung, mich gut zu benehmen. Vor allem sollte ich nichts Blödes sagen oder tun, nichts anprobieren, wozu ich meinen Bauch hätte entblößen müssen, nicht sagen: »Wollen Sie mich verarschen?«, wenn mir der Preis eines Artikels genannt würde, betont unaufmerksam tun, wenn mir ein Verkäufer die richtige Pflege oder Nachbehandlung eines Produktes erläuterte, und unter gar keinen Umständen irgend etwas Unpassendes anziehen, zum Beispiel eine Skimütze für Damen aufsetzen, nur so aus Spaß.
Ich sollte nach einem gewissen Dave Mengle fragen, weil er große Abschnitte des Weges selbst gegangen war und so etwas wie ein wandelndes Lexikon in Sachen Outdoor-Bekleidung sein sollte. Mengle entpuppte sich als ein freundlicher, rücksichtsvoller Mensch, der schätzungsweise vier Tage lang ununterbrochen und mit großem Interesse über jeden Aspekt einer Wanderausrüstung dozieren konnte.
Ich war noch nie so beeindruckt und gleichzeitig so verwirrt worden. Wir gingen einen ganzen Vormittag lang sein Lager durch, und Dave konnte dabei Sätze loslassen wie etwa folgenden: »Der hier hat einen 70 Denier, verschleißresistenten Reißverschluß mit hoher Dichte und Doppelzwirnnaht. Andererseits, und in dem Punkt will ich ehrlich zu Ihnen sein« – wobei er sich zu mir hinüberbeugte, seine Stimme senkte und einen freimütigeren Ton anschlug, als wollte er mir eröffnen, besagter Reißverschluß sei einmal zusammen mit einem Matrosen auf einer öffentlichen Bedürfnisanstalt verhaftet worden –, »die Nähte sind bandisoliert statt diagonal versetzt, und das Vestibül ist ein bißchen eng.«
Da ich beiläufig erwähnt hatte, daß ich in England ein bißchen gewandert sei, unterstellte er mir eine gewisse Kompetenz. Ich wollte ihn nicht beunruhigen oder enttäuschen, so daß ich, als er mich fragte, »Was halten Sie eigentlich von Kohlenstoffasern?« nur mit einem mitleidigen Lächeln den Kopf schüttelte, angesichts dieses heiklen Dauerthemas, und antwortete: »Wissen Sie, Dave, ich bin in dem Punkt immer noch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Was meinen Sie?«
Gemeinsam diskutierten wir über Kompressionsriemen, erwogen ernsthaft die relativen Vorteile von Schneeschürzen, Klettverschlüssen, Lastentransferausgleich, Belüftungskanälen, Gewebeschlaufen und Kopfmulden für größere Bewegungsfreiheit. Das wurde bei jedem Artikel durchexerziert. Selbst bei einem Kochgeschirr aus Aluminium ließen sich Überlegungen hinsichtlich Gewicht, Kompaktheit, Thermodynamik und allgemeiner Nützlichkeit anstellen, die den Verstand stundenlang beschäftigen konnten. Zwischendurch bot sich immer wieder Gelegenheit, über das Wandern ganz allgemein zu plaudern, was sich jedoch auf die Risiken beschränkte, als da wären Steinschlag, Begegnungen mit Bären, Kocherexplosionen und Schlangenbisse, die Dave mit einem verschleierten Blick hingebungsvoll beschrieb, bevor er sich wieder dem eigentlichen Thema widmete.
Wie gesagt, er redete viel, besonders viel über Gewicht. Mir erschien es eine Idee zu pingelig, einen bestimmten Schlafsack einem anderen vorzuziehen, weil dieser ein paar Gramm leichter war, aber immer mehr Ausrüstungsgegenstände türmten sich um uns herum auf, und immer deutlicher wurde mir vorgeführt, wie aus vielen Gramm ganz allmählich ein Kilo wird. Ich hatte nicht damit gerechnet, so viel zu kaufen – ich besaß bereits Wanderschuhe, ein Schweizer Offiziersmesser und eine Kartentasche aus Plastik, die man an einer Kordel um den Hals trug; ich dachte, ich sei eigentlich bestens ausgestattet – aber je länger ich mit Dave redete, desto klarer wurde mir, daß ich dabei war, mich für eine Expedition auszurüsten.
Was mich dann wirklich schockierte, war zum einen, wie teuer alles war – jedesmal, wenn Dave ins Lager sprang oder loszog, um das Gewicht des Gewebes in der Maßeinheit Denier zu überprüfen, warf ich einen verstohlenen Blick auf die Preisschildchen und war ausnahmslos entsetzt – und zum anderen, daß jeder Ausrüstungsgegenstand unweigerlich den Erwerb eines weiteren erforderlich machte. Wenn man einen Schlafsack kaufte, brauchte man einen Packbeutel für den Schlafsack. Der Packbeutel kostete 29 Dollar. Für diese Nötigung hatte ich zunehmend weniger Verständnis.
Als ich mich schließlich nach reiflicher Überlegung für einen Rucksack entschieden hatte – einen sehr hochwertigen Gregory, vom Allerfeinsten, nach dem Motto: es bringt nichts, hier zu knausern –, fragte Dave: »Was für Gurte wollen Sie dazu haben?«
»Wie bitte?« erwiderte ich und merkte auf der Stelle, daß ich mich am Rand einer gefährlichen Krise befand, auch als Konsumverweigerung bekannt. Ab jetzt konnte ich nicht mehr unbekümmert von mir geben: »Packen Sie nur ruhig gleich sechs Stück davon ein, Dave. Und wenn ich schon mal dabei bin – von den anderen Dingern nehme ich acht Stück. Ach, was soll’s, warum nicht gleich zwölf? Man gönnt sich ja sonst nichts.« Der Haufen Klamotten, der mir eben noch verschwenderisch vorgekommen war und mich irgendwie ganz aufgeregt gemacht hatte – alles neu! alles meins! –, erschien mir plötzlich erdrückend und übertrieben.
»Gurte«, erklärte Dave. »Um Ihren Schlafsack draufzuschnallen und Sachen festzubinden.«
»Gehören die Gurte nicht dazu?« sagte ich leicht gereizt.
»Nein.« Er ließ seinen Blick über eine Wand, vollbehängt mit Kleinkram, schweifen. »Jetzt brauchen Sie natürlich auch noch einen Regenschutz.«
Ich sah ihn verständnislos an. »Einen Regenschutz? Wozu das denn?«
»Gegen den Regen.«
»Ist der Rucksack denn nicht wasserdicht?«
Er verzog das Gesicht, als müßte er einen höchst schwierigen Sachverhalt klären. »Na ja, nicht hundertprozentig …«
Das fand ich höchst seltsam. »Wirklich? Ist dem Hersteller nie in den Sinn gekommen, daß die Kunden ihre Rucksäcke gelegentlich auch mal mit nach draußen nehmen wollen? Vielleicht sogar über Nacht draußen zelten wollen? Wieviel kostet der Rucksack eigentlich?«
»250 Dollar.«
»250 Dollar? Wollen Sie mich verarsch…«
Ich unterbrach mich und schlug einen anderen Ton an. »Soll das heißen, man zahlt 250 Dollar für einen Rucksack, der keine Gurte hat und nicht wasserdicht ist?«
Dave nickte.
»Hat er wenigstens einen Boden?«
Mengle grinste verlegen. Kritik an der unerschöpflichen, vielversprechenden Welt der Wanderausrüstung oder gar Überdruß gehörte nicht zu seinem Wesen. »Die Gurte gibt es in sechs verschiedenen Farben«, bot er mir zur Versöhnung an.
Zum Schluß hatte ich so viel Ausrüstung beisammen, daß ich einen ganzen Treck Sherpas hätte beschäftigen können: Zelt für einen Drei-Jahreszeiten-Einsatz; Isoliermatte, die sich selbst aufbläst; Kombitöpfe und -pfannen; Klappbesteck; Plastikteller und -tasse; Wasserfilter mit einem komplizierten Pumpsystem; Packbeutel in allen Regenbogenfarben; Nahtdichter; Klebeflicken; Schlafsack; Spanngurte; Wasserflaschen; wasserdichter Poncho; wasserfeste Sturm-Zündhölzer; Regenschutz; ein niedlicher Schlüsselanhänger mit eingebautem Minikompaß und Thermometer; ein kleiner, zusammenklappbarer Kocher, der eindeutig Ärger zu machen versprach; Gaskartusche und Ersatzkartusche; eine Taschenlampe, die man sich wie eine Grubenlampe auf die Stirn setzt, so daß die Hände frei sind (die gefiel mir sehr gut); ein großes Messer, um Bären und andere Hinterwäldler abzumurksen; Thermo-Unterwäsche; lange Unterhosen und Unterhemden; vier große Tücher, auch als Stirnbänder zu benutzen, und jede Menge anderer Sachen, für die ich extra nochmal in den Laden zurückgehen mußte, um zu fragen, wozu sie eigentlich gut waren. Bei einem Designer-Zeltboden für 59,95 Dollar war bei mir Schluß, weil ich wußte, daß es im Supermarkt Zeltplanen für fünf Dollar gab. Ein Erste-Hilfe-Set, ein Nähset, ein Schlangenbiß-Set, eine Trillerpfeife für zwölf Dollar und einen kleinen orangefarbenen Spaten, um seine Hinterlassenschaft zu verbuddeln, ließ ich ebenfalls links liegen mit der Begründung, daß diese Dinge nicht nötig und zu teuer seien oder man sich damit der Lächerlichkeit preisgeben würde. Besonders der kleine orangefarbene Spaten schien mir zuzurufen: »Grünschnabel! Schlappschwanz! Ist sich zu fein für die eigene Scheiße!«
Um gleich alles in einem Aufwasch zu erledigen, ging ich noch nach nebenan in den Buchladen von Dartmouth und kaufte Bücher – The Thru-Hiker’s Handbook, Walking the Appalachian Trail, diverse Bücher über wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen, naturwissenschaftliche Werke, einen historischen Abriß über die geologische Entwicklung des Appalachian Trail von einem Autor mit dem köstlichen Namen V. Collins Chew, und die bereits erwähnte, vollständige Sammlung der offiziellen Appalachian Trail Guides, die elf Taschenbücher und 59 Karten umfaßt, letztere allesamt von unterschiedlicher Größe und Aufmachung und mit verschiedenen Maßstäben. Diese Anthologie stellt den gesamten Weg vom Springer Mountain bis zum Mount Katahdin dar und ist zu dem stolzen Preis von 233,45 Dollar zu haben. Beim Hinausgehen fiel mir ein Buch auf, Bären: Jäger und Gejagte in Amerikas Wildnis. Ich schlug es wahllos auf, las den Satz: »Hier haben wir ein typisches Beispiel für den nicht selten auftretenden Fall, daß ein Schwarzbär einen Menschen erblickt und beschließt, ihn zu töten und zu fressen«, und warf es gleich mit in die Einkaufstüte.
Ich brachte den Krempel nach Hause und trug ihn in mehreren Etappen runter in den Keller. Es war ungeheuer viel, und mit der ganzen Technik der Ausrüstung war ich absolut nicht vertraut; es war spannend und gleichzeitig beängstigend, hauptsächlich beängstigend. Ich setzte die Stirnlampe auf, nur so zum Spaß, zog das Zelt aus der Plastikhülle und baute es auf. Ich rollte die Isomatte aus, die sich selbst aufblies, schob sie ins Zelt und kroch dann selbst mit meinem neuen Schlafsack hinein. Dann schlüpfte ich in den Schlafsack und blieb eine ganze Weile so liegen. Dabei versuchte ich, mich in der teuren, arg begrenzten, noch seltsam neu riechenden, gänzlich ungewohnten Räumlichkeit, die schon bald mein Zuhause fern von zu Hause sein würde, zurechtzufinden. Ich versuchte mir vorzustellen, ich läge nicht in einem Keller, neben dem gemütlichen Heizungskessel mit seinem gezähmten Gebrumm, sondern draußen, auf einem hohen Gebirgspaß, lauschte dem Wind und dem Blätterrauschen, dem einsamen Heulen hundeähnlicher Geschöpfe, dem heiseren Flüstern, aus dem unüberhörbar der Dialekt aus den Bergen von Georgia herausklang: »He, Virgil, hier liegt einer. Hast du an das Seil gedacht?« Es wollte mir nicht gelingen.
Seit ich im Alter von ungefähr neun Jahren aufgehört hatte, aus Decken und Spieltischen Hütten zu bauen, hatte ich mich nicht mehr in so einer Umgebung aufgehalten. Es war sogar ziemlich urig, und wenn man sich erstmal an den Geruch, von dem ich naiverweise annahm, er würde sich im Laufe der Zeit verflüchtigen, und an die kränklich blaßgrüne Färbung gewöhnt hatte, die das Material allen Dingen um einen herum wie der Schein eines leuchtenden Radarschirms verlieh, war es gar nicht so furchtbar. Vielleicht ein bißchen klaustrophobisch, komisch riechend, aber dennoch gemütlich und urig.
Es würde schon nicht so schlimm werden, redete ich mir ein. Aber insgeheim wußte ich, daß ich mich gründlich irrte.
2. Kapitel
Am 5. Juli 1983 schlugen drei erwachsene Aufseher und eine Gruppe Jugendlicher an einer bei Wanderern beliebten Stelle am Lake Canimina mitten in einem würzig riechenden Kiefernwald westlich von Quebec, ungefähr 130 Kilometer nördlich von Ottawa, in einem Park, der sich La Vérendrye Provincial Reserve nennt, nachmittags ihr Lager auf. Sie kochten sich ein Abendessen und verstauten anschließend ihre Lebensmittelvorräte, wie es sich gehört, in einen Beutel, trugen diesen etwa 100 Meter weit in den Wald hinein und hängten ihn zwischen zwei Bäumen auf, in einer Höhe, die für Bären nicht zu erreichen war.
Um Mitternacht strich ein Schwarzbär am Rand des Lagers herum, entdeckte den Beutel und holte ihn herunter, indem er auf den Baum kletterte und einen Ast abknickte. Er plünderte den Vorrat und verschwand, kehrte aber eine Stunde später wieder zurück und betrat diesmal das Lager, angezogen von dem Geruch gebratenen Fleischs, der noch in den Kleidern und Haaren, den Schlafsäcken und Zelten der Leute hing. Es sollte eine lange Nacht für die Gruppe am Lake Canimina werden. Zwischen Mitternacht und halb vier stattete der Bär dem Lager dreimal einen Besuch ab.
Stellen Sie sich, falls Sie Masochist sind, vor, Sie liegen mutterseelenallein im Dunkeln in einem kleinen Zelt, zwischen Ihnen und der kalten Nachtluft nur eine Nylonmembran von ein paar tausendstel Millimeter Dicke, und draußen rumort dieser zentnerschwere Koloß. Stellen Sie sich vor, Sie hören sein leises Grunzen und unerklärliches Schniefen, das Schmatzen und Nagen, das Tapsen der Ballen unter den Tatzen, den schweren Atem, das Geräusch, wenn er sich an Ihrer Zeltwand reibt, das Klappern von gestapeltem Kochgeschirr, wenn er dagegentritt. Stellen Sie sich vor, was für ein heißer Adrenalinschub durch Ihren Körper geht, wie es in Ihren Achselhöhlen kribbelt – dann der plötzliche, rauhe Stoß der Schnauze des Tieres gegen die Wand am Fußende Ihres Zeltes, das alarmierend wilde Flattern Ihrer dünnhäutigen Hülle, wenn das Tier Ihren Rucksack durchwühlt, den Sie unachtsamerweise am Eingang aufgebockt haben und in dessen Seitentasche sich, wie Ihnen siedendheiß einfällt, ein Snickers befindet. Bären sind geradezu versessen auf Snickers, haben Sie mal gehört.
Und dann das dumpfe Gefühl – ach, du meine Güte –, daß Sie den Snickers-Riegel mit ins Zelt genommen haben, daß er hier irgendwo liegt, zu ihren Füßen oder unter Ihnen, oder – ach, du Scheiße, hier ist er ja! Der nächste Stoß der Schnauze, begleitet von einem Grunzen, gegen das Zelt, diesmal unweit Ihrer Schulter. Wieder das Flattern der Zeltwand. Dann Stille, eine lang anhaltende Stille, und – Moment, psssst! … jawohl! – die unsägliche Erleichterung, als Ihnen klar wird, daß der Bär hinüber auf die andere Seite des Lagers geschlurft ist oder sich zurück in den Wald verzogen hat.
Ich sage Ihnen, ich würde das nicht aushalten.
Nun stellen Sie sich vor, wie erst dem kleinen zwölfjährigen David Anderson zumute gewesen sein mußte, als um halb vier morgens, bei dem dritten Übergriff, sein Zelt urplötzlich mit einem Tatzenhieb aufgeschlitzt wurde und der Bär, von dem starken, in der Luft liegenden Geruch nach Hamburgern zur Raserei getrieben, seine Zähne in ein hastig zurückzuckendes Bein schlug und den brüllenden, strampelnden Knaben durch das Lager schleppte, hinein in den Wald. In den wenigen Sekunden, die seine Kameraden brauchten, um sich aus ihren Sachen zu schälen. Und stellen Sie sich weiter vor, was es heißt, sich aus plötzlich voluminösen Schlafsäcken herauszuwühlen, nach den Taschenlampen zu kramen, sich einen provisorischen Knüppel zu schnappen, die Zeltverschlüsse hochzuziehen und hinter dem Tier herzujagen – in diesen wenigen Sekunden hauchte der arme kleine David Anderson sein Leben aus.
Und nun stellen Sie sich vor, Sie läsen ein Sachbuch, in dem es nur so wimmelt von solchen Geschichten – wahren Geschichten, nüchtern erzählt –, kurz bevor Sie allein zu einer Wanderung durch die nordamerikanische Wildnis aufbrächen. Das Buch, von dem hier die Rede ist, heißt Bären: Jäger und Gejagte in Amerikas Wildnis, und der Verfasser ist der kanadische Wissenschaftler Stephen Herrero. Wenn das Buch nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist, dann möchte ich das letzte Wort lieber nicht erfahren. Während sich draußen in New Hampshire der Schnee auftürmte und meine Frau friedlich neben mir im Bett schlummerte, verbrachte ich ganze Nächte damit, mit angstvoll aufgerissenen Augen klinisch exakte Berichte über Menschen zu lesen, die in ihren Schlafsäcken zu Brei zermalmt, die wimmernd von Bäumen heruntergeholt worden waren, an die die Bestie sich geräuschlos herangepirscht hatte – ich wußte nicht, daß so etwas vorkam –, als sie gerade unbedarft durchs Laub schlenderten oder ihre Füße in einem kalten Gebirgsbach baumeln ließen. Über Menschen, die den verhängnisvollen Fehler begangen hatten, sich wohlriechendes Gel ins Haar zu schmieren, ein saftiges Stück Fleisch zu essen, sich für später einen Snickers-Riegel in die Brusttasche zu stecken, sich sexuell zu betätigen, zu menstruieren oder die Geruchsempfindlichkeit des hungrigen Bären in sonstwie unachtsamer Weise zu reizen. Oder deren Verhängnis, auch das gab es, schlicht darin bestand, außerordentlich großes Pech zu haben – um eine Kurve zu gehen und auf ein hungriges Bärenmännchen zu treffen, das den Weg versperrt, den Kopf erwartungsvoll hin und her wiegt, oder darin, nichts Böses ahnend in das Revier eines Bären zu tapern, der, bedingt durch Alter und Trägheit, zu alt war, um flinkere Beute zu jagen.
Ich will gleich klarstellen, daß die Wahrscheinlichkeit eines schweren Übergriffs durch einen Bären am Appalachian Trail äußerst gering ist. Zunächst einmal wütet der wirklich gefährliche amerikanische Bär, der Grizzly – Ursus horribilis, wie er anschaulich und korrekterweise bezeichnet wird –, nicht östlich des Mississippi, was immerhin von Vorteil ist, denn Grizzlys sind riesig, stark und geraten schnell in Wut. Als Meriwether Lewis und William Clark zu Beginn des letzten Jahrhunderts zu ihrer Expedition in die Wildnis aufbrachen, stellten sie fest, daß nichts die eingeborenen Indianer mehr zermürbte als ein Grizzlybär. Und das ist nicht weiter erstaunlich, denn man kann einen Grizzly mit Pfeilen durchlöchern, ihn buchstäblich damit spicken, so daß er aussieht wie ein Stachelschwein – er wird immer noch nicht aufgeben. Selbst Lewis und Clark zeigten sich erstaunt und verunsichert über die Fähigkeit des Grizzlys, ganze Geschützsalven zu verkraften, ohne auch nur leicht ins Wanken zu geraten.
Herrero berichtet von einem Fall, der die Robustheit des Grizzlys sehr schön veranschaulicht. Die Geschichte handelt von einem erfahrenen Jäger in Alaska, Alexei Pitka, der sich durch den Schnee an ein großes Männchen herangeschlichen und es mit einem gezielten Schuß ins Herz aus einem großkalibrigen Gewehr niedergestreckt hatte. Pitka hätte vorher noch einmal in den Verhaltensregeln nachlesen sollen. »Erst überprüfen, ob der Bär auch wirklich tot ist. Dann Waffe ablegen.« Er näherte sich behutsam und beobachtete ein, zwei Minuten lang, ob der Bär sich nicht rührte. Als er keine Regung feststellen konnte, lehnte er sein Gewehr gegen einen Baum (schwerer Fehler!) und trat vor, um seine Beute zu beanspruchen. Gerade wollte er das Fell berühren, da sprang der Bär auf, legte ihm seine breiten Tatzen um den Kopf, als wollte er ihm einen Kuß geben, und riß ihm mit einem Ruck das Gesicht weg.
Pitka überlebte wie durch ein Wunder. »Ich weiß auch nicht, wieso ich das Scheißgewehr an den Baum gestellt habe«, sagte er später. (Eigentlich war nur »Mnnnpfffnnnndgnnn« zu verstehen, da Pitka weder über Lippen, Zähne, Nase, Zunge noch über ein anderes Stimmorgan mehr verfügte.)
Sollte ich betätschelt und angeknabbert werden – was mir immer wahrscheinlicher erschien, je mehr ich las –, dann von einem Schwarzbären, Ursus americanus. Es gibt ungefähr eine halbe Million Schwarzbären in Amerika, vielleicht sogar eine dreiviertel Million. Sie sind sehr verbreitet in den Bergen entlang des Appalachian Trail, ja sie benutzen den Weg sogar gern, weil er so bequem ist, und ihre Zahl ist im Steigen begriffen. Die Zahl der Grizzlybären dagegen beläuft sich, bezogen auf ganz Nordamerika, auf höchstens 35.000; davon entfallen gerade einmal 1.000 auf das Herzland der Vereinigten Staaten, hauptsächlich auf den Yellowstone National Park und Umgebung. Schwarzbären sind in der Regel kleiner (das ist allerdings relativ zu sehen, denn ein Schwarzbärmännchen kann immer noch 300 Kilo auf die Waage bringen), und sie sind eindeutig zurückhaltender.
Schwarzbären greifen selten von sich aus an, aber manchmal eben doch. Alle Bären sind behende, schlau und unglaublich stark, und sie haben immer Hunger. Sie können einen Menschen töten und fressen, wenn sie wollen, und sie tun es auch – wenn sie wollen. Es kommt nicht oft vor, aber – und das ist der springende Punkt: einmal reicht. Herrero gibt sich alle Mühe, darauf hinzuweisen, daß Schwarzbärattacken zahlenmäßig selten sind. Für den Zeitraum von 1900 bis 1980 konstatierte er lediglich 23 Tötungen von Menschen durch einen Schwarzbären (das sind halb so viele Tötungen wie durch Grizzlybären), und die meisten ereigneten sich im Westen oder in Kanada. In New Hampshire hat jedenfalls seit 1784 kein unprovozierter tödlicher Übergriff eines Bären auf einen Menschen mehr stattgefunden, und in Vermont sogar noch nie.
Ich hätte mich von diesen quasi Versprechungen ja gerne trösten lassen, aber mir fehlte es an der nötigen Glaubenskraft. Der Aussage, daß zwischen 1960 und 1980 500 Menschen von Schwarzbären angegriffen und verletzt wurden – 25 Übergriffe pro Jahr, bei einer Population von mindestens einer halben Million Bären –, fügt Herrero hinzu, die meisten Verletzungen seien nicht schwer gewesen. »Die typischen, von einem Bären zugefügten Verletzungen«, schreibt er kühl, »sind nur geringfügiger Natur und beschränken sich für gewöhnlich auf ein paar Kratzer oder leichte Bißwunden.« Was, bitteschön, ist eine leichte Bißwunde? Geht es hier um spielerische Ringkämpfe und Nasenstüber? Wohl kaum. Und sind 500 nachgewiesene Übergriffe tatsächlich eine so bescheidene Zahl, wenn man bedenkt, daß nur wenige Menschen die Wälder Nordamerikas je betreten? Und wie blöd muß man sein, damit einen die Information, in Vermont und New Hampshire sei seit 200 Jahren kein Mensch mehr von einem Bären getötet worden, beruhigen kann? Die Angriffe blieben ja nicht aus, weil die Bären ein Abkommen mit den Menschen ausgehandelt hatten. Es spricht nichts dagegen, daß sie nicht schon morgen ein kleines Massaker anrichten.
Stellen wir uns also vor, ein Bär in der Wildnis hätte es auf uns abgesehen. Wie soll man sich verhalten?
Interessanterweise sind die empfohlenen Tricks bei Grizzly beziehungsweise Schwarzbärattacken genau gegensätzlich. Bei dem Überfall eines Grizzlybären sollte man den nächsten hohen Baum aufsuchen, da Grizzlys keine guten Kletterer sind. Wenn kein Baum in Reichweite ist, sollte man langsam rückwärts gehen und dabei den Blickkontakt vermeiden. Alle Bücher raten einem, auf keinen Fall zu rennen, wenn der Grizzly auf einen zukommt. Solche Ratschläge können nur von Schreibtischtätern kommen. Lassen Sie sich gesagt sein: Wenn Sie sich in einem offenen Gelände befinden und keine Waffe dabei haben, dann nehmen Sie besser die Beine in die Hand. Was bleibt Ihnen schon anderes übrig? So haben Sie in den letzten sieben Sekunden Ihres Lebens wenigstens etwas zu tun. Sollte der Grizzly Sie jedoch einholen, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Fall sein wird, lassen Sie sich auf den Boden fallen und stellen Sie sich tot. An einem schlaffen Körper knabbert der Grizzly nur ein bißchen herum, im allgemeinen verliert er nach wenigen Minuten die Lust und schlurft davon. Bei Schwarzbären dagegen ist der Trick, sich tot zu stellen, vergeblich, denn sie knabbern weiter an einem herum, bis auch der beste plastische Chirurg später nichts mehr ausrichten kann. Auf einen Baum zu klettern wäre ebenfalls ziemlich töricht, denn Schwarzbären sind geschickte Kletterer, und man würde den Kampf gegen den Bären lediglich auf den Baum verlagern, wie Herrero trocken feststellt.
Am besten, schlägt Herrero vor, sollte man einen Höllenlärm veranstalten, um einen aggressiven schwarzen Bären zu vertreiben, auf Töpfe und Pfannen schlagen, mit Stöcken und Steinen werfen und »auf den Bär zulaufen«. (Bitte. Wenn Sie als erster gehen, Herr Professor!) Andererseits, fügt er vernünftigerweise hinzu, könnten diese Tricks »den Bären erst recht provozieren«. Vielen Dank auch. An anderer Stelle empfiehlt Herrero, als Wanderer solle man daran denken, gelegentlich Krach zu machen, zum Beispiel ein Lied zu singen, um einen Bären vor seiner Anwesenheit zu warnen, da ein überraschter Bär höchstwahrscheinlich wütender sein wird. Doch dann mahnt er ein paar Seiten weiter, daß »es gefährlich sein könnte, Krach zu machen«, da er einen hungrigen Bären anlocken könnte, der einen sonst übersehen hätte.
Tatsache ist: Keiner kann einem sagen, was man machen soll. Bei Bären weiß man vorher nie, wie sie reagieren, und was bei dem einen klappt, ist bei dem anderen vielleicht verhängnisvoll. Im Jahre 1973 hatten sich zwei Teenager, Mark Seeley und Michael Whitten, zu einer Wanderung durch den Yellowstone National Park aufgemacht und gerieten unterwegs unabsichtlich zwischen eine Schwarzbärmutter und ihre Jungen. Nichts bringt eine Bärenmutter mehr in Rage als Menschen, die sich in der Nähe ihrer Brut aufhalten. Wütend drehte sie sich um und eröffnete die Jagd – trotz des etwas tapsigen Gangs können Bären bis zu 60 Stundenkilometer schnell laufen – und die beiden Jungen erkletterten den nächsten Baum. Der Bär sprang Whitten hinterher, faßte mit dem Maul seinen rechten Fuß und zog ihn langsam und geduldig von seinem Hochsitz herunter. (Spüren Sie da auch, wie sich Ihre Fingernägel in der Rinde verkrallen, oder geht das nur mir so?) Auf der Erde fing der Bär an, den Jungen übel zuzurichten. Seeley versuchte, das Tier von seinem Freund wegzulocken und brüllte es an, worauf es losließ und auch ihn von seinem Baum herunterholte. Beide Jungen stellten sich daraufhin tot – nach den Verhaltensmaßregeln genau das Verkehrte –, und der Bär verschwand.
Ich möchte nicht behaupten, daß ich wie besessen von dem Thema war, aber es beschäftigte meine Gedanken während der Monate, in denen ich darauf wartete, daß endlich der Frühling käme. Mein besonderer Schrecken – die lebhafte Phantasie, die mich Nacht für Nacht die Baumschatten an der Schlafzimmerdecke anstarren ließ – war die Vorstellung, ich läge in einem kleinen Zelt, allein in der pechschwarzen Wildnis, hörte draußen einen Bär, der auf Futtersuche wäre, und hätte keine Ahnung, was er nun vorhatte. Vor allem ein Amateurfoto in Herreros Buch faszinierte mich. Es war spät nachts von einem Camper auf einem Lagerplatz irgendwo im Westen der USA mit Blitzlicht aufgenommen worden. Der Fotograf hatte vier Schwarzbären erwischt, die sich darüber den Kopf zerbrachen, wie sie an einen Vorratsbeutel kommen sollten, der von einem Ast herunterhing. Die Bären wirkten zwar überrascht – von dem Blitzlicht vermutlich – , aber sie waren nicht im geringsten erschrocken. Es war weniger die Größe oder das Verhalten der Bären, was mich beunruhigte – sie sehen komischerweise völlig harmlos aus, wie vier junge Männer, deren Frisbeescheibe im Baum gelandet war – als ihre Zahl. Bis dahin hatte ich mir nicht klargemacht, daß Bären auch in Rudeln herumstrolchen konnten. Was um Himmels willen sollte ich machen, wenn plötzlich vier von diesen Ungeheuern in mein Lager kämen? Na, was schon? Ich würde natürlich sterben. Buchstäblich tausend Tode sterben, mir in die Hose machen vor Angst, mir den Schließmuskel aus dem Hintern pusten, so wie die Luftschlangen, die man auf Kindergeburtstagen bekommt – ich glaube, es würde das Tier nicht im geringsten beeindrucken – und in meinem Schlafsack jämmerlich verbluten.
Herreros Buch erschien 1985. Seit damals haben, nach einem Artikel in der New York Times, die Übergriffe durch Bären in Nordamerika um 25 Prozent zugenommen. In dem Artikel hieß es außerdem, Bären gingen im Frühjahr nach einer schlechten Beerenernte wesentlich häufiger auf Menschen los als sonst. Die Beerenernte im Vorjahr war katastrophal ausgefallen. Das gefiel mir alles nicht.
Dann gab es noch die ganzen Probleme und speziellen Gefahren, die durch die Einsamkeit bedingt sind. Ich habe immer noch meinen Blinddarm und jede Menge anderer, lebenswichtiger Organe, die in der Wildnis aufplatzen oder auslaufen könnten. Was sollte ich in so einem Fall machen? Was, wenn ich von einem Felsvorsprung stürzen und mir das Rückgrat brechen würde? Wenn ich mich bei Nebel oder in einem Schneesturm verirren würde, von einer giftigen Schlange gebissen, bei der Durchquerung eines Flusses auf einem bemoosten Stein den Halt verlieren oder mir nach einem Sturz eine Gehirnerschütterung zuziehen würde? Man kann auch in einer fünf Zentimeter tiefen Wasserlache ertrinken oder an einem verstauchten Fußgelenk sterben. Nein, nein, das gefiel mir alles ganz und gar nicht.
Meine Weihnachtsgrüße an Freunde und Bekannte versah ich mit der Einladung, doch mit mir zu wandern, und wenn es nur ein Teil des Weges wäre. Natürlich reagierte keiner darauf. Dann bekam ich eines Tages im Februar, der Termin meiner Abreise rückte immer näher, einen Anruf. Er war von einem alten Schulfreund, Stephen Katz. Katz und ich waren zusammen in Iowa aufgewachsen, aber ich hatte so ziemlich jeden Kontakt zu ihm verloren. Diejenigen unter Ihnen – mehr als fünf werden es wohl nicht sein – die Neither Here nor There gelesen haben, kennen Katz bereits aus den Geschichten über meine jugendlichen Abenteuer als meinen Reisegefährten in Europa. In den 25 Jahren, die seitdem vergangen sind, bin ich ihm drei-, viermal bei Besuchen zu Hause begegnet, aber sonst hatten wir nie mehr etwas miteinander zu tun. Wir waren Freunde geblieben, im theoretischen Sinn, aber unsere Lebenswege hätten verschiedener nicht sein können.
»Ich habe erst gezögert«, sagte er langsam. Er suchte nach Worten. »Die Sache mit dem Appalachian Trail – könnte ich da vielleicht mitkommen?«
Ich wollte meinen Ohren nicht trauen. »Willst du wirklich mitkommen?«
»Also, wenn du was dagegen hättest – das würde ich verstehen.«
»Was dagegen?« sagte ich. »Nein. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich bin heilfroh.«
»Wirklich?« Das schien ihn aufzuheitern.
»Klar.« Ich konnte es nicht fassen. Ich brauchte nicht allein zu gehen. Ich stimmte innerlich einen Freudengesang an. Ich brauch’ nicht mehr allein zu gehen. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie überglücklich ich bin.«
»Das ist ja schön«, sagte er, mehr als erleichtert, und fügte dann in bekennendem Tonfall hinzu: »Ich dachte, vielleicht willst du mich nicht dabeihaben.«
»Wieso denn nicht?«
»Weil ich dir immer noch 600 Pfund schulde, von unserer Reise damals durch Europa.«
»He, meine Güte, das kann nicht sein … schuldest du mir wirklich 600 Pfund?«
»Ich habe mir fest vorgenommen, sie dir zurückzuzahlen.«
»He!« sagte ich. »He.« Ich konnte mich an diese 600 Pfund gar nicht mehr erinnern. Ich hatte noch nie jemandem in meinem Leben Schulden in dieser Höhe erlassen, und es dauerte eine Weile, bis ich die Worte herausbrachte: »Kein Problem. Komm einfach mit wandern. Weißt du auch, worauf du dich einläßt?«
» Klar.«
»Und wie ist deine körperliche Verfassung?«
»Ziemlich gut. Ich gehe nur noch zu Fuß.«
»Wirklich?« Das ist sehr ungewöhnlich für amerikanische Verhältnisse.
»Na ja, mein Wagen wurde beschlagnahmt. Deswegen.«
»Ach so.«
Wir redeten noch über dies und das, seine Mutter, meine Mutter, Des Moines. Ich erzählte ihm alles, was ich über den Trail wußte, was nicht viel war, und über das Leben in der Wildnis, das uns erwartete. Wir verblieben so, daß er nächsten Mittwoch nach New Hampshire fliegen sollte, wir uns zwei Tage Zeit für Vorbereitungen nehmen und uns dann auf den Weg machen würden. Zum ersten Mal seit Monaten hatte ich ein rundum gutes Gefühl, was unser Unternehmen betraf. Katz klang außerdem recht optimistisch für jemanden, der das Ganze eigentlich nicht mitzumachen brauchte.
Zuletzt fragte ich ihn: »Und? Wie stehst du zu Bären?«
»Bis jetzt haben sie mich jedenfalls noch nicht gekriegt.«
Das ist die richtige Einstellung, dachte ich. Mensch, Katz, altes Haus. Du kommst mir wie gerufen.
Mir wäre jeder recht gewesen, der diesen Elan hatte und den festen Willen, mit mir loszuziehen. Nachdem ich aufgelegt hatte, fiel mir ein, daß ich vergessen hatte ihn zu fragen, warum er eigentlich mitwollte. Katz war der einzige Mensch auf der Welt, bei dem ich mir vorstellen konnte, daß er sich vor jemandem verstecken mußte, vor Leuten, die Julio hießen oder Mister Big. Egal. Ich brauchte jedenfalls nicht allein zu gehen.
Ich ging zu meiner Frau, die in der Küche am Spülbecken stand, und überbrachte ihr die gute Nachricht. Ihre Begeisterung fiel reservierter als erwartet aus.
»Du willst also wochenlang mit einem Menschen, den du seit 25 Jahren nicht mehr gesehen hast, durch die Wildnis wandern. Hast du dir das auch gründlich überlegt?« (Als hätte ich mir je etwas gründlich überlegt.) »Ich dachte, ihr beiden wärt euch in Europa gehörig auf die Nerven gegangen.«
»Nein.« Das stimmte nicht ganz. »Wir sind uns bloß am Anfang auf die Nerven gegangen. Zum Schluß hatten wir nur noch Verachtung füreinander übrig. Aber das ist lange her.«
Sie warf mir einen zutiefst zweifelnden Blick zu. »Ihr beide habt nichts gemein. Ihr seid völlig verschieden.«
»Wir sind überhaupt nicht verschieden. Wir sind beide 44 Jahre alt. Wir werden uns über unsere Hämorrhoiden unterhalten, unsere Schmerzen im unteren Rückenbereich und darüber, daß wir ständig vergessen, wo wir irgend etwas hingelegt haben. Und dann frage ich ihn am nächsten Abend, sag mal, habe ich dir schon von meinen Rückenproblemen erzählt?, und er sagt, nein, ich glaube nicht, und wir kauen das Thema wieder von vorne durch. Es wird bestimmt toll.«
»Es wird grauenvoll.«
»Ja, ich weiß«, sagte ich.
Eine Woche später fand ich mich an unserem kleinen Flughafen ein und beobachtete, wie die Konservenbüchse mit Katz an Bord aufsetzte und auf der Rollbahn knapp 20 Meter vor dem Terminal zum Stehen kam. Das Brummen der Propeller wurde für einen Moment noch einmal lauter, verstummte dann stotternd, die Tür öffnete sich und die Gangway wurde heruntergeklappt. Ich versuchte mir ins Gedächtnis zurückzurufen, wann ich Katz das letzte Mal gesehen hatte. Nach unserer Europareise im Sommer war er nach Des Moines zurückgekehrt und dort zu Iowas Drogenguru aufgestiegen. Jahrelang war sein Leben ein einziges, rauschendes Fest gewesen, bis keiner mehr zum Mitfeiern übriggeblieben war, so daß er nur noch mit sich allein feierte, in seiner Wohnung, in T-Shirt und Boxer-Shorts, mit einem Vorrat an Marihuana, vor einem Fernseher mit Zimmerantenne. Jetzt erinnerte ich mich auch, daß ich ihn zuletzt vor fünf Jahren in Dennys Restaurant gesehen hatte, wohin ich meine Mutter zum Frühstück eingeladen hatte. Er saß ein paar Tische weiter, zusammen mit einem verhärmten Kerl, der aussah, als hieße er Virgil Starkweather oder so ähnlich, er stocherte in seinen Pfannkuchen herum und trank gelegentlich einen verbotenen Schluck aus einer Flasche, die in einem Papierbeutel steckte. Es war acht Uhr morgens, und Katz sah sehr zufrieden aus. Er war immer zufrieden, wenn er betrunken war, und er war fast immer betrunken.
Wie ich später erfuhr, fand ihn die Polizei zwei Wochen später in einem Auto, das sich auf einem Stoppelfeld außerhalb der Kleinstadt Mingo überschlagen hatte. Er hing noch im Sicherheitsgurt, mit dem Kopf nach unten, das Steuerrad fest umklammert, und sagte zu dem Polizisten: »Irgendwelche Probleme, Officer? « Im Handschuhfach wurde eine geringe Menge Kokain gefunden, und Katz wurde vorsorglich für 18 Monate in Sicherheitsverwahrung genommen. Während dieser Zeit fing er an, regelmäßig zu den Treffen der Anonymen Alkoholiker zu gehen. Zu unser aller Überraschung, nicht zuletzt seiner eigenen, hatte er seitdem keinen Tropfen Alkohol oder andere Drogen mehr angerührt.
Nach seiner Entlassung bekam er einen kleinen Job, ging halbtags wieder aufs College und zog mit einer Friseuse namens Patty zusammen. Die letzten drei Jahre hatte er ein unbescholtenes Leben geführt und, wie ich gleich feststellen konnte, als er geduckt durch die Tür trat, sich einen Bauch zugelegt. Katz war erstaunlich breit geworden im Vergleich zum letzten Mal. Er war immer schon ein wenig pummelig, aber jetzt mußte man gleich an Orson Welles nach einer durchzechten Nacht denken, wenn man ihn sah. Er humpelte leicht und atmete schwerer, als nach einem Weg von 20 Metern zu erwarten wäre.
»Mann, hab’ ich einen Hunger«, sagte er, ohne ein Wort der Begrüßung, und übergab mir sein Handgepäck. Ich hätte mir beinahe den Arm ausgerenkt.
»Was hast du denn da drin?« keuchte ich.
»Nur ein paar Kassetten und anderen Kram für unterwegs. Gibt es hier irgendwo ein Dunkin Donuts in der Nähe? Ich habe seit Boston nichts mehr gegessen.«
»Boston? Da kommst du doch gerade erst her.«
»Ja. Ich muß jede Stunde was essen, sonst kriege ich meine – wie soll ich sagen? – Anwandlungen.«
»Was denn für Anwandlungen?« Es war nicht gerade das Wiedersehen, das ich mir ausgemalt hatte. Ich stellte mir vor, wie er den Appalachian Trail entlanghüpfte, wie ein Spielzeug zum Aufziehen, das auf den Rücken gefallen war.
»Die kriege ich regelmäßig, seit ich vor zehn Jahren mal verseuchtes Anilin eingenommen habe. Mit ein paar Doughnuts ist die Sache normalerweise erledigt.«
»In drei Tagen sind wir mitten in der Wildnis, Stephen. Da gibt es keine Doughnuts.«
Er strahlte stolz übers ganze Gesicht. »Ich habe vorgesorgt.« Er zeigte auf seine Tasche an der Gepäckausgabe, einen grünen Army-Seesack, und deutete mir an, ich solle ihn hochheben. Er wog mindestens 30 Kilo. Er sah meinen verwunderten Gesichtsausdruck. »Snickers«, erklärte er. »Ein ganzer Sack voll Snickers.«
Wir machten einen Umweg über Dunkin Donuts, bevor wir nach Hause fuhren. Meine Frau und ich setzten uns mit ihm an den Küchentisch und sahen zu, wie er fünf Boston-Cream-Doughnuts verputzte, die er mit zwei Bechern Milch hinunterspülte. Dann sagte er, er wolle sich ein bißchen ausruhen. Er brauchte mehrere Minuten, um die Treppe nach oben zu bewältigen.
Meine Frau sah mich mit einem Ausdruck heiterer Verständnislosigkeit an.
»Bitte, sag jetzt nichts«, bat ich sie.
Nachdem er seinen Mittagsschlaf gehalten hatte, suchten wir Dave Mengle in dem Outdoor-Laden auf, kauften eine Ausstattung für Katz – Rucksack, Zelt, Schlafsack und den ganzen anderen Kram, – anschließend gingen wir zu Kmart und besorgten einen Zeltboden, Thermounterwäsche und noch ein paar Kleinigkeiten. Danach mußte er sich wieder hinlegen.
Am Tag darauf gingen wir in einen Supermarkt, um Proviant für die erste Woche unserer Wanderung einzukaufen. Ich hatte keine Ahnung vom Kochen, aber Katz versorgte sich seit Jahren selbst und hatte ein festes Repertoire an Gerichten (hauptsächlich Erdnußbutter, Thunfisch und brauner Zucker, alles in einem Topf vermengt), die seiner Meinung nach auch ganz gut zur Zeltlageratmosphäre paßten, aber er packte noch eine Menge anderer Sachen in seinen Einkaufswagen – vier große Salamiwürste, fünf Pfund Reis, diverse Kekspackungen, Haferflocken, Rosinen, M&Ms, Büchsenfleisch, noch mehr Snickers, Sonnenblumenkerne, Grahamplätzchen, Instant-Kartoffelpüree, mehrere Streifen gedörrtes Rindfleisch, ein paar Käsestücke, Dosenschinken und die gesamte Auswahl unverderblicher Kuchen und Doughnuts, die der Hersteller Little Debbie im Angebot hat.
»Ich glaube nicht, daß wir das alles tragen können«, gab ich ängstlich zu bedenken, als er auch noch eine kummetgroße Mortadella in den Einkaufswagen legte.
Katz begutachtete den Wageninhalt mißmutig. »Du hast recht«, pflichtete er mir bei. »Fangen wir nochmal von vorne an.«
Er ließ den Wagen einfach stehen und ging los, um sich einen neuen zu holen. Wir drehten nochmal eine Runde und versuchten, diesmal eine intelligentere Auswahl zu treffen, hatten aber zum Schluß immer noch viel zu viel.
Wir brachten alles nach Hause, teilten es auf und machten uns ans Packen – Katz in dem Gästezimmer, wo auch sein übriger Kram lag, und ich in meinem Hauptquartier im Keller. Ich packte zwei Stunden lang, aber ich schaffte es nicht, alles reinzukriegen. Ich legte Bücher, Notizblöcke und die ganze Ersatzkleidung beiseite und probierte alle möglichen Kombinationen aus, aber jedesmal, wenn ich fertig war, entdeckte ich ein großes und wichtiges Teil, das übriggeblieben war. Schließlich ging ich nach oben, um zu sehen, wie Katz zurechtkam. Katz lag auf dem Bett und hatte seinen Walkman auf. Sein Zeug lag überall verstreut im Zimmer herum. Der neue Rucksack stand schlaff und vernachlässigt da. Ein leises rhythmisches Zischen tönte aus dem Kopfhörer.
»Willst du nicht packen?« sagte ich.
»Jaah.«
Ich wartete eine Minute lang. Ich dachte, er würde sich vom Bett erheben, aber er rührte sich nicht. »Entschuldige bitte, Stephen, aber ich habe den Eindruck, daß du dich hingelegt hast.«
»Jaah.«
»Kannst du mich eigentlich verstehen?«
»Jaah. Es dauert nur noch eine Minute.«
Ich seufzte und ging wieder runter in den Keller.
Beim Abendessen sprach Katz nur wenig und verschwand danach gleich wieder in seinem Zimmer. Wir hörten nichts weiter von ihm im Laufe des Abends, erst vor Mitternacht, als wir schon im Bett lagen, drang Lärm durch die Wand zu uns herüber – ein Poltern und Murmeln, Geräusche, als würden Möbel im Zimmer verrückt, und kurze heftige Wutausbrüche, gefolgt von lang anhaltenden Phasen der Stille. Ich hielt die Hand meiner Frau fest und wußte nicht, was ich sagen sollte. Am nächsten Morgen klopfte ich bei Katz an und steckte schließlich, da er nicht antwortete, den Kopf durch die Tür. Er schlief noch, angezogen, auf einem Haufen zerwühlter Bettwäsche. Die Matratze war ein Stück vom Bettkasten gerutscht, als hätte er sich mit irgendwelchen nächtlichen Eindringlingen herumgeschlagen. Sein Rucksack war voll, aber nicht zugebunden, und seine persönlichen Sachen lagen immer noch weiträumig im ganzen Zimmer verstreut. Ich sagte ihm, wir müßten in einer Stunde losfahren, wenn wir unseren Flug nicht verpassen wollten.
»Jaah«, sagte er.
20 Minuten später kam er die Treppe herunter, schwerfällig und unter leisem Gefluche. Man hörte, ohne hinzusehen, daß er seitlich und übervorsichtig ging, als wären die Stufen vereist. Den Rucksack hatte er aufgesetzt. Hinten und an beiden Seiten, überall waren irgendwelche Sachen festgebunden – ein Paar versiffte Turnschuhe, ein zweites Paar, offenbar normale Alltagsschuhe, dazu Töpfe und Pfannen, eine Laura-Ashley-Einkaufstasche, die er im Kleiderschrank meiner Frau gefunden und sich angeeignet hatte und die jetzt mit wer weiß was gefüllt war. »Besser habe ich es nicht hingekriegt«, sagte er. »Ich mußte ein paar Sachen hierlassen. «
Ich nickte. Ich mußte auch ein paar Sachen zu Hause lassen. An erster Stelle waren die Haferflocken zu nennen, die ich sowieso nicht mag, und die etwas ekligeren Kuchen von Little Debbie, will sagen, alle Kuchen von Little Debbie.
Meine Frau brachte uns bei dichtem Schneetreiben zum Flughafen nach Manchester, und wir verharrten in dem eigentümlichen Schweigen, das einer langen Trennung vorausgeht. Katz saß auf dem Rücksitz und aß Doughnuts. Am Flughafen überreichte mir meine Frau ein Geschenk der Kinder, einen Spazierstock mit Knauf, dem sie eine rote Schleife umgebunden hatten. Ich hätte in Tränen ausbrechen können – am liebsten wäre ich gleich wieder in den Wagen gestiegen und zurückgefahren. Katz mühte sich derweil noch stirnrunzelnd mit den vielen Gurten ab. Meine Frau kniff mich in den Arm, lächelte verlegen und ging.
Ich schaute ihr hinterher, dann betrat ich mit Katz den Terminal. Der Mann am Abfertigungsschalter warf einen Blick auf unsere Tickets nach Atlanta und sagte in einem – wie ich fand – ziemlich alarmierenden Ton für einen Menschen, der im Winter mit kurzärmeligem Hemd herumlief: »Haben Sie vor, den Appalachian Trail entlangzuwandern?«
»Und ob!« sagte Katz mit stolzgeschwellter Brust.
»Die haben gerade eine Menge Ärger mit den Wölfen, da unten in Georgia.«
»Tatsächlich?« Katz spitzte die Ohren.
»Ja, ja. Sind kürzlich ein paar Leute angefallen worden. Ziemlich übel zugerichtet, wie ich gehört habe.« Er ließ sich noch etwas Zeit mit den Tickets und den Gepäckanhängern.
»Hoffentlich haben Sie genug lange Unterhosen eingepackt.«
Katz verzog schmerzlich das Gesicht. »Gegen die Wölfe?«
»Nein, gegen das Wetter. Es soll die nächsten vier, fünf Tage eine Rekordkälte geben. Weit unter null Grad heute abend in Atlanta. «
»Na wunderbar«, sagte Katz und stieß einen verzweifelten Seufzer aus. Er sah den Mann herausfordernd an. »Sonst noch Neuigkeiten für uns? Anruf vom Krankenhaus, wir hätten Krebs, oder so?«
Der Mann strahlte und knallte die Tickets auf den Schalter. »Nein, das wär’s. Trotzdem gute Reise. Ach, noch etwas«, er wandte sich direkt an Katz, senkte dabei die Stimme, »hüten Sie sich vor den Wölfen, denn ganz im Vertrauen, Sie sehen aus wie ein richtiger Leckerbissen.« Er zwinkerte scherzhaft.
»Meine Güte«, sagte Katz mit kaum hörbarer Stimme und wirkte plötzlich sehr, sehr trübsinnig.
Wir fuhren mit dem Aufzug zu unserem Flugsteig. »Und dann geben sie einem auf diesem Flug nicht mal was Anständiges zu essen«, stellte er abschließend mit ungewöhnlicher Bitterkeit fest.
3. Kapitel
Alles nahm seinen Anfang mit einem Mann namens Benton MacKaye, einem sanftmütigen, freundlichen, unendlich wohlmeinenden Visionär, der im Sommer 1921 seinem Freund Charles Harris Whitaker, Herausgeber einer führenden Architekturzeitschrift, den ehrgeizigen Plan für einen Fernwanderweg unterbreitete. Die Behauptung MacKayes Leben sei zu diesem Zeitpunkt nicht zufriedenstellend verlaufen, wäre eine harmlose Untertreibung. In dem Jahrzehnt davor war er von diversen Posten in Harvard und dem National Forest Service entlassen und, mangels einer besseren Stelle, auf die man ihn hätte abschieben können, mit dem unklar umrissenen Auftrag, Ideen zur Steigerung der Effizienz und der Moral zu entwickeln, in ein Büro des amerikanischen Ministeriums für Arbeit gesteckt worden. Pflichtbewußt, wie er war, arbeitete er ehrgeizige und unrealistische Entwürfe aus, die mit Erheiterung zur Kenntnis genommen wurden und anschließend gleich im Papierkorb landeten. Im April 1921 stürzte sich seine Frau, die berühmte Pazifistin und Suffragette Jessie Hardy Stubbs, von einer Brücke in New York in den East River und ertrank.
Soweit die Vorgeschichte. Gerade einmal zehn Wochen nach dem tragischen Ereignis eröffnete MacKaye seinem Freund Whitaker die Idee für einen Wanderweg durch die Appalachen, und im Oktober wurde der Vorschlag in einem dafür eigentlich ungeeigneten Forum, der Zeitschrift von Whitaker, dem Journal of the American Institute of Architects, veröffentlicht. Der Appalachian Trail war nur ein Aspekt von MacKayes weitreichender Vision. Er sah den AT als eine Art roten Faden, um »Arbeitslager« auf den Berggipfeln miteinander zu verbinden. In diese sogenannten Workcamps sollten die blassen, erschöpften Arbeiter aus den Städten zu Tausenden strömen und sich im Geiste der Selbstlosigkeit in gesundheitsfördernder Schufterei ergehen und sich an der freien Natur ergötzen. Herbergen, Rasthäuser und Studienzentren sollten errichtet werden, schließlich sogar ganze Walddörfer, die dauerhaft bewohnt sein sollten, Kooperativen »in Selbstverwaltung«, deren Bewohner sich mit »nichtindustrieller Tätigkeit«, basierend auf Handwerk, Forst- und Landwirtschaft, ihren Lebensunterhalt verdienen sollten. Das Ganze sollte nach MacKayes überschwenglicher Beschreibung ein »Rückzug vom Profitdenken« sein – eine Vorstellung, in der andere »die Geißel des Bolschewismus« erkannten, um mit den Worten eines Biographen zu sprechen.
Zu dem Zeitpunkt, als MacKaye seine Idee entwickelte, existierten bereits mehrere Wandervereine im Osten der Vereinigten Staaten – der Green Mountain Club, der Dartmouth Outing Club und der altehrwürdige Appalachian Mountain Club, um nur einige zu nennen. Diese eher elitären Organisationen besaßen und unterhielten Hunderte Kilometer Forst- und Wanderwege, hauptsächlich in New England. 1925 kamen Vertreter der führenden Vereine in Washington zusammen und gründeten die Appalachian Trail Conference, zu dem Zweck, einen fast 2.000 Kilometer langen Pfad anzulegen, der die beiden höchsten Gipfel im Osten, den 2037 Meter hohen Mount Mitchell in North Carolina und den 120 Meter niedrigeren Mount Washington in New Hampshire , miteinander verbinden sollte. Tatsächlich geschah in den nächsten fünf Jahren erst einmal gar nichts, hauptsächlich deswegen, weil MacKaye damit beschäftigt war, seine Pläne weiter auszuarbeiten und zu verfeinern, bis er selbst und seine Vision den Kontakt zur Realität verloren hatten.
Erst als 1930 der junge Seerechtler und begeisterte Wanderer Myron Avery aus Washington die Weiterentwicklung des Projekts in die Hand nahm, konnte die Arbeit richtig beginnen und machte plötzlich rasche Fortschritte. Avery muß offenbar kein sonderlich liebenswerter Mensch gewesen sein. Er hinterließ zwischen Maine und Georgia zwei Spuren, wie sich ein Zeitgenosse ausdrückte. »Die eine war eine Spur der Verwüstung, verletzter Gefühle und gekränkter Eitelkeiten. Die andere war der Appalachian Trail.« Avery besaß keine Geduld im Umgang mit MacKaye und seinen »quasi mystischen Sprüchen«; jedenfalls kamen die beiden nicht miteinander klar. 1935 hatten sie einen erbitterten Streit über die Erschließung des Shenandoah National Parks – Avery war bereit, den Bau einer landschaftlich schönen Schnellstraße durch die Berge zuzulassen, MacKaye empfand das als Verrat grundlegender Prinzipien –, danach wechselten die beiden kein Wort mehr miteinander.