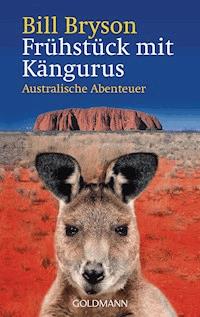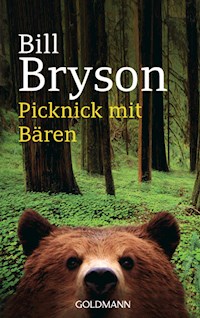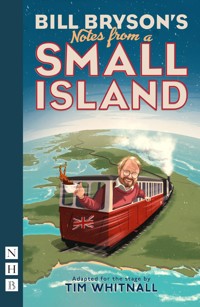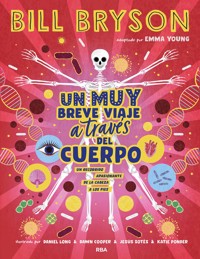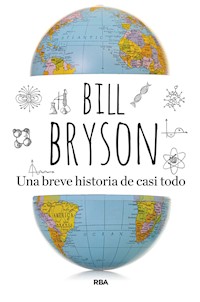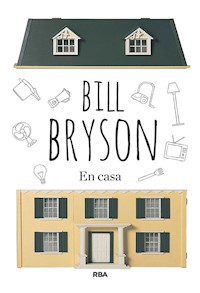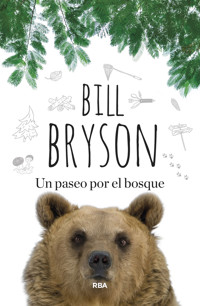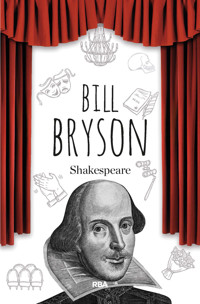10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jubiläumsausgabe des internationalen Bestsellers
Wie groß ist eigentlich das Universum? Was wiegt unsere Erde? Und wie ist das überhaupt möglich – die Erde zu wiegen? Auf diese und viele andere Fragen hat Bestsellerautor Bill Bryson in der Schule nie Antworten erhalten. Um das für zukünftige Schüler zu ändern, hat er sich selbst auf die Suche nach ihnen gemacht und dabei eine atemberaubende Reise durch Raum und Zeit angetreten. Dabei entstand ein faktenreiches, kluges und höchst vergnügliches Buch über die Wunder der Welt – geschrieben mit all dem Witz und Charme, die Bryson zu einem der beliebtesten Sachbuchautoren unserer Zeit gemacht haben! Nach einer Erfolgsgeschichte von 20 Jahren ist der Weltbestseller nun in der Jubiläumsausgabe mit neuem Vorwort erhältlich.
»Eine Enzyklopädie für den Lustleser.« – Stern
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 958
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Wie groß ist eigentlich das Universum? Was wiegt unsere Erde? Und wie ist es überhaupt möglich, die Erde zu wiegen? Auf diese und viele andere Fragen hatte Bestsellerautor Bill Bryson in der Schule nie Antworten erhalten. Langweilige Schulbücher, staubtrockener Unterricht, unverständliche Theorien – die Naturwissenschaften blieben für ihn wie für viele andere Menschen auch ein Buch mit sieben Siegeln. Aber die Frage, warum alles so geworden ist, wie es ist, und woher wir das eigentlich wissen, ließ ihn nie los. Getrieben von seiner unersättlichen Neugier, wagte Bill Bryson sich schließlich auf eine Reise durch Raum und Zeit. In seinem preisgekrönten Bestseller nimmt er uns mit auf diese atemberaubende Exkursion, erklärt uns den Himmel und die Erde, die Sterne und die Meere und nicht zuletzt die Entstehungsgeschichte des Menschen. Es ist ein ebenso unterhaltsamer wie informativer Streifzug durch die Naturwissenschaften, mit dem Bill Bryson das scheinbar Unmögliche vollbracht hat: das Wissen der Welt in dreißig Kapitel zu packen, die für interessierte Leser*innen auch ohne besondere Vorkenntnisse verständlich sind.
Das ideale Buch für alle, die das Universum und die Geschichte der Erde verstehen möchten – und dabei auch noch Spaß haben wollen.
Ausgezeichnet mit dem renommierten
Aventis-Price for Science Books 2004.
Autor
Bill Bryson wurde 1951 in Des Moines, Iowa, geboren. 1977 zog er nach Großbritannien und schrieb dort mehrere Jahre u. a. für die Times und den Independent. Mit seinem Englandbuch »Reif für die Insel« gelang Bryson der Durchbruch, er wurde in seiner Heimat einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren der Gegenwart. Seine Bücher sind in viele Sprachen übersetzt worden und stürmten stets die internationalen Bestsellerlisten. 1996 kehrte Bill Bryson mit seiner Familie in die USA zurück, seit 2003 lebt er wieder in England.
Außerdem von Bill Bryson bei Goldmann erschienen:
Reif für die Insel. England für Anfänger und Fortgeschrittene · Picknick mit Bären · Streifzüge durch das Abendland. Europa für Anfänger und Fortgeschrittene · Straßen der Erinnerung · Streiflichter Amerikas. Die USA für Anfänger und Fortgeschrittene · Frühstück mit Kängurus. Australische Abenteuer · Mein Amerika · Shakespeare – wie ich ihn sehe · Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge · Sommer 1927 · It’s teatime, my dear! · Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers
Bill Bryson
Eine kurze Geschichte von fast allem
Mit einem aktuellen Vorwort zur Neuausgabe
Aus dem Amerikanischen von Sebastian Vogel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Erweiterte Taschenbuchausgabe Mai 2024
Copyright © 2003 der Originalausgabe by Bill Bryson
Copyright © 2024 dieser Ausgabe: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2004 der deutschsprachigen Erstausgabe: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Originalverlag: Broadway Books, New York
Titel der englischen Originalausgabe: »A Short History of Nearly Everything«
Umschlag: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic®, München
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
KF ∙ CB
ISBN 978-3-641-31725-6V003
www.goldmann-verlag.de
Für Meghan und Chris. Willkommen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Neuausgabe
Einleitung
TEIL I Verloren im Kosmos
1. Bauanleitung für ein Universum
2. Willkommen im Sonnensystem
3. Das Universum des Reverend Evans
TEIL II Die Größe der Erde
;4. Das Maß der Dinge
5. Die Steineklopfer
6. Wissenschaft, rot an Zähnen und Klauen
7. Elemente der Materie
TEIL III Ein neues Zeitalter bricht an
8. Einsteins Universum
9. Das mächtige Atom
10. Weg mit dem Blei!
11.Muster Marks Quarks
12. Die Erde bewegt sich
TEIL IV Der gefährliche Planet
13. Peng!
14. Feuer von unten
15. Gefährliche Schönheit
TEIL V Das Leben als solches
16. Der einsame Planet
17. In die Troposphäre
18. Die elementare Verbindung
19. Der Aufstieg des Lebens
20. Eine kleine Welt
21. Das Leben geht weiter
22. Tschüss zusammen
23. Die Reichlichkeit des Seins
24. Zellen
25. Darwins einzigartiger Gedanke
26. Der Stoff, aus dem das Leben ist
TEIL VI Der Weg zu uns
27. Eiszeit
28. Der rätselhafte Zweibeiner
29. Der unermüdliche Affe
30. Auf Wiedersehen
Danksagung
Anmerkungen
Literatur
Register
Einmal kündigte der Physiker Leo Szilard seinem Freund Hans Bethe an, er wolle eventuell ein Tagebuch führen: »Ich habe nicht vor, etwas zu veröffentlichen. Ich möchte die Tatsachen nur festhalten, damit Gott Bescheid weiß.« Daraufhin fragte Bethe: »Glauben Sie nicht, dass Gott die Tatsachen schon kennt?« – »Ja«, erwiderte Szilard, »die Tatsachen kennt er. Aber diese Version der Tatsachen kennt er noch nicht.«
Hans Christian von Baeyer, Das Atom in der Falle
Vorwort zur Neuausgabe
In der Schule war ich in Naturwissenschaften nie gut. Offensichtlich hatte ich dafür einfach nicht den richtigen Kopf. Sobald die Lehrerin sich umdrehte und eine Formel oder Gleichung an die Tafel schrieb – und naturwissenschaftlicher Unterricht bestand anscheinend meistens aus kaum etwas anderem als einer riesigen Wandtafel, die von einer Lehrerin mit quietschender Kreide vollgekritzelt wurde –, war ich mehr oder weniger aufgeschmissen.
Ich weiß es noch genau: Es erschien mir erstaunlich und geradezu wundersam, dass ein Haufen seltsamer Symbole eine solche Fülle von Informationen enthalten sollte, jedenfalls für diejenigen, die sie verstanden – aber zu denen gehörte ich nicht.
Und doch war ich von Wissenschaft fasziniert: Sie sagt uns so vieles darüber, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen, was wir tun müssen, wenn es unserer Spezies weiterhin gut gehen soll. Auf irgendeiner Ebene, davon war ich überzeugt, musste ich mich mit Wissenschaft beschäftigen und ihr Wunder verstehen können, ohne mich in Gleichungen, Formeln und anderen schwierigen Fachkenntnissen zu verlieren.
Von den Ergebnissen dieser Überzeugung handelt das vorliegende Buch. Es ist mein Versuch, unsere Welt und das Universum um sie herum vom Augenblick ihrer Entstehung bis heute zu verstehen. Etwa vier Jahre lang habe ich mich nahezu ausschließlich darum bemüht, die Wissenschaft und ihre Errungenschaften zu verstehen. Ich bin in elf Länder auf fünf Kontinenten gereist, habe eine Menge Bücher, Zeitschriften und Aufzeichnungen gelesen und unglaublich freundlichen, geduldigen Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Fachgebieten und den führenden Wissenschaftsinstitutionen der Welt unzählige Fragen gestellt.
Dabei hatte ich kein bestimmtes Ergebnis im Sinn, kein Hühnchen mit irgendjemandem zu rupfen oder so etwas. Ich wollte nur in einen leeren Kopf so viele Informationen hineinstopfen, wie er aufnehmen konnte. Dabei faszinierte es mich besonders, wie man Dinge in der Wissenschaft herausfindet. Woher weiß man, wie die Kontinente vor 300 Millionen Jahren lagen, wie heiß es auf der Oberfläche der Sonne ist, was im Inneren eines Gens vorgeht oder was in den ersten drei Minuten des Universums geschah? Woher weiß man, dass es überhaupt diese ersten drei Minuten gab und dass das Universum nicht schon immer da war? Wie haben Menschen alle diese Dinge herausgefunden? Damit ist das Buch zu einer Art Suche geworden: Es will nicht nur wissen, was wir wissen, sondern auch, woher wir es wissen.
Wie man sich leicht vorstellen kann, habe ich dabei eine Menge gelernt, und traurigerweise habe ich auch eine Menge nahezu sofort wieder vergessen. Aber eine einfache und doch tiefgründige Erkenntnis hat mich seither immer begleitet: Im Universum ist alles faszinierend. Alles.
Wenn Sie das Buch zu Ende gelesen haben, hoffe ich, dass auch Sie das Gleiche empfinden werden.
Bill Bryson, 2023
Einleitung
Willkommen. Und herzlichen Glückwunsch. Es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es war nicht einfach, so weit zu kommen, ich weiß. Ich vermute sogar, es war noch schwieriger, als Ihnen klar ist.
Damit Sie da sein können, mussten sich zunächst einmal ein paar Billionen unstete Atome auf raffinierte, verblüffend freundschaftliche Weise zusammenfinden und Sie erschaffen. Es ist eine hoch spezialisierte, ganz besondere Anordnung – sie wurde noch nie zuvor ausprobiert und existiert nur dieses eine Mal. Während der nächsten vielen Jahre (das hoffen wir jedenfalls) werden diese winzigen Teilchen klaglos an den Milliarden komplexer, gemeinschaftlicher Anstrengungen mitwirken, die notwendig sind, damit Sie unversehrt bleiben und jenen höchst angenehmen, allgemein aber unterschätzten Zustand erleben können, den man Dasein nennt.
Warum Atome so viel Mühe auf sich nehmen, ist eigentlich ein Rätsel. Ich oder du zu sein, ist auf atomarer Ebene kein lohnendes Erlebnis. Bei allem Engagement kümmern die Atome sich in Wirklichkeit nicht um Sie – sie wissen nicht einmal, dass es Sie gibt. Und sie wissen auch nicht, dass es sie gibt. Es sind ja nur geistlose Teilchen, und sie selbst sind nicht einmal lebendig. (Es ist schon eine faszinierende Vorstellung: Würden wir uns selbst mit einer Pinzette Atom für Atom auseinandernehmen, bliebe ein Haufen feiner Atomstaub übrig. Nichts davon wäre lebendig, und doch wäre alles zuvor »wir« gewesen.) Dennoch gehorchen sie für die Zeit Ihres Daseins einem einzigen, übergeordneten Impuls: Sie sorgen dafür, dass Sie Sie bleiben.
Das Unangenehme dabei: Atome sind launisch, und ihr Engagement ist etwas Vorübergehendes – sogar etwas sehr Vorübergehendes. Selbst ein langes Menschenleben summiert sich nur auf rund 650 000 Stunden. Und jenseits dieses bescheidenen Meilensteins oder an einem anderen Punkt irgendwo in der Nähe machen die Atome Ihnen aus unbekannten Gründen den Garaus – sie fallen in aller Stille auseinander, gehen ihrer Wege und werden etwas anderes. Was Sie betrifft, war’s das dann.
Dennoch können Sie sich darüber freuen, dass es überhaupt geschieht. In der Regel tut es das im Universum nämlich nicht, soweit wir wissen. Das ist ausgesprochen seltsam, denn die Atome, die sich so zwanglos und sympathisch zusammentun und Lebewesen bilden, sind auf der Erde genau die gleichen wie anderenorts, wo sie es verweigern. Was das Leben sonst auch sein mag, auf der Ebene der Chemie ist es erstaunlich profan: Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, ein wenig Calcium, ein Schuss Schwefel, eine kleine Prise von ein paar anderen ganz gewöhnlichen Elementen – nichts, was man nicht in jeder normalen Apotheke finden würde –, das ist alles, was man braucht. Das einzig Besondere an den Atomen, die Sie bilden, besteht darin, dass sie Sie bilden. Und das ist natürlich das Wunder des Lebens.
Ob Atome nun in anderen Winkeln des Universums etwas Lebendiges bilden oder nicht, in jedem Fall bilden sie vieles andere; sie bilden sogar alles andere. Ohne sie gäbe es weder Wasser noch Luft oder Gestein, weder Sterne noch Planeten, weder weit entfernte Gaswolken noch Spiralnebel, und keines von den anderen Dingen, die das Universum zu etwas so Nützlich-Materiellem machen. Atome sind so zahlreich und notwendig, dass wir eines leicht übersehen: Es müsste sie eigentlich nicht geben. Kein Gesetz verlangt, dass das Universum sich mit kleinen Materieteilchen füllt oder dass es Licht, Schwerkraft und die vielen anderen physikalischen Phänomene hervorbringt, von denen unser Dasein abhängt. Es müsste sogar überhaupt kein Universum geben. Die meiste Zeit war es nicht da. Es gab keine Atome und kein Universum, in dem sie herumschwirren konnten. Es gab nichts – einfach nichts, nirgendwo.
Also können wir froh über die Atome sein. Aber die Tatsache, dass Sie aus Atomen bestehen und dass sie sich so bereitwillig zusammenfinden, erklärt Ihr Dasein nur zum Teil. Damit Sie da sind, im 21. Jahrhundert leben und so klug sind, dass Sie es auch wissen, mussten Sie außerdem zum Nutznießer einer außergewöhnlichen Verkettung glücklicher biologischer Ereignisse werden. Überleben ist auf der Erde ein erstaunlich schwieriges Geschäft. Von den Milliarden und Abermilliarden biologischer Arten, die seit Anbeginn der Zeit existiert haben, sind die meisten – 99,99 Prozent – nicht mehr da. Sie sehen: Das Leben auf der Erde ist nicht nur kurz, sondern auch schrecklich empfindlich. Es ist ein wahrhaft seltsamer Aspekt unseres Daseins: Wir stammen von einem Planeten, der Leben sehr gut hervorbringen und noch besser auslöschen kann.
Eine biologische Art bleibt auf der Erde im Durchschnitt nur vier Millionen Jahre erhalten. Wer also Jahrmilliarden überstehen will, muss so launenhaft sein wie die Atome, aus denen wir bestehen. Man muss bereit sein, sich in allem zu verändern – in Form, Farbe, Spezies-Zugehörigkeit, einfach in allem –, und das immer und immer wieder. Das ist leichter gesagt als getan, denn die Veränderung ist ein Zufallsprozess. Um vom »protoplasmatischen urtümlichen Atomkügelchen« (wie es in einem Lied von Gilbert und Sullivan heißt) zu einem fühlenden, aufrecht gehenden Jetzt-Menschen zu werden, mussten Sie durch Mutationen immer wieder neue Eigenschaften erwerben, und das auf zeitlich genau abgestimmte Weise über ausgesprochen lange Zeit hinweg. Während verschiedener Phasen innerhalb der letzten 3,8 Milliarden Jahre haben Sie den Sauerstoff zunächst verabscheut und dann geliebt, Flossen und Gliedmaßen und flotte Flügel getragen, Eier gelegt, die Luft mit einer gespaltenen Zunge gefächelt, glatte Haut und einen Pelz besessen, unter der Erde und auf Bäumen gelebt, sich zwischen der Größe eines Hirsches und einer Maus bewegt und Millionen Dinge mehr. Die winzigste Abweichung bei einer dieser entwicklungsgeschichtlichen Wandlungen, und Sie würden jetzt vielleicht Algen von Höhlenwänden lecken, sich wie ein Walross an einer Felsküste rekeln oder durch ein Blasloch oben auf dem Kopf die Luft ausstoßen, bevor Sie wegen eines Mauls voller leckerer Sandwürmer 20 Meter in die Tiefe tauchen.
Sie hatten nicht nur das Glück, dass Sie seit undenklichen Zeiten Teil einer bevorzugten Evolutions-Abstammungslinie geblieben sind, sondern das Schicksal war Ihnen auch in Ihrer persönlichen Abstammung auf äußerste – um nicht zu sagen wundersame – Weise hold. Überlegen wir nur: 3,8 Milliarden Jahre lang – eine Zeit, die länger ist als das Alter der Gebirge und Flüsse und Ozeane – waren alle Ihre Vorfahren mütterlicher- und väterlicherseits so attraktiv, dass sie einen Partner gefunden haben, aber auch so gesund, dass sie sich fortpflanzen konnten, und von Schicksal und Umständen so begünstigt, dass sie lange genug lebten und das alles tun konnten. Kein einziger unserer unmittelbaren Vorfahren wurde erschlagen, gefressen, ertränkt, ausgehungert, ausgesetzt, festgehalten, zur Unzeit verwundet oder auf andere Weise daran gehindert, die Aufgabe seines Lebens zu erfüllen und ein winziges Päckchen genetisches Material im richtigen Augenblick an den richtigen Partner abzugeben, um so die einzig mögliche Abfolge von Erbkombinationen weiterzureichen, die – am Ende, erstaunlicherweise und für allzu kurze Zeit – Sie hervorbringen.
Dieses Buch handelt davon, wie sich das alles abgespielt hat – insbesondere von der Frage, wie der Weg vom Garnichts zum Etwas verlaufen ist, wie ein klein wenig von diesem Etwas zu uns geworden ist, und auch ein wenig von den Vorgängen dazwischen und seitdem. Das sind natürlich eine Menge Themen, und deshalb heißt das Buch Eine kurze Geschichte von fast allem, auch wenn das eigentlich nicht ganz stimmt. Es kann nicht stimmen. Aber wenn wir Glück haben, wird es uns am Ende so vorkommen, als ob es stimmt.
Mein eigener – vielleicht unmaßgeblicher – Ausgangspunkt war ein illustriertes Buch über Naturwissenschaft, das uns in der vierten oder fünften Klasse als Unterrichtsmaterial diente. Es war ein ganz normales Schulbuch im Stil der fünfziger Jahre – zerfleddert, ungeliebt, schrecklich dick –, aber fast ganz am Anfang enthielt es eine Abbildung, die mich fesselte: ein Schnittbild des Erdinneren; es sah aus, als hätte jemand mit einem großen Messer in den Planeten geschnitten und dann vorsichtig einen Keil herausgezogen, der ungefähr ein Viertel der Gesamtmasse ausmachte.
Man kann sich kaum vorstellen, dass es eine Zeit gab, in der ich noch nie ein solches Bild gesehen hatte, aber offensichtlich war es so: Ich weiß noch ganz genau, wie verblüfft ich war. Ehrlich gesagt, gründete sich mein Interesse wahrscheinlich anfangs auf ein ganz persönliches Bild: ein Strom argloser Autofahrer aus den Staaten des amerikanischen Mittelwestens, die nach Osten fahren und plötzlich, zwischen Mittelamerika und dem Nordpol, über eine 6000 Kilometer hohe Klippe stürzen. Aber es dauerte nicht lange, dann wandte sich mein vernünftigeres Interesse dem wissenschaftlichen Gehalt der Zeichnung zu, und mir wurde klar, dass die Erde aus drei Schichten besteht, mit einer glühenden Kugel aus Eisen und Nickel in der Mitte, die der Bildlegende zufolge so heiß ist wie die Sonnenoberfläche. Ich weiß noch, wie ich mich mit echtem Erstaunen fragte: »Woher wissen die das?«
Dass die Information stimmte, bezweifelte ich keinen Augenblick – noch heute neige ich dazu, den Aussagen von Naturwissenschaftlern genauso zu vertrauen wie denen von Ärzten, Klempnern und anderen Besitzern abgelegener, privilegierter Kenntnisse –, aber um nichts in der Welt konnte ich mir vorstellen, wie der Geist eines Menschen herausfinden kann, was sich Tausende von Kilometern unter uns befindet, wie das aussieht und aufgebaut ist, was noch kein Auge gesehen hat und kein Röntgenstrahl durchdringen kann. Das war für mich ein echtes Wunder. Und die gleiche Einstellung zur Naturwissenschaft habe ich noch heute.
Aufgeregt nahm ich das Buch an jenem Nachmittag mit nach Hause, und vor dem Abendessen schlug ich es auf – wobei ich damit rechnete, dass meine Mutter mir die Hand auf die Stirn legen und sich erkundigen würde, ob mit mir noch alles stimmte. Auf der ersten Seite fing ich an zu lesen.
Jetzt kommt’s. Es war überhaupt nicht spannend. Es war nicht einmal verständlich. Und vor allem gab es keinerlei Antwort auf die Fragen, die eine solche Zeichnung für jeden normal denkenden Geist aufwarf: Wie kommt die Sonne in die Mitte unseres Planeten? Und wenn sie dadrinnen brennt, warum ist der Boden unter unseren Füßen nicht so heiß, dass wir ihn nicht anfassen können? Und warum schmilzt das übrige Erdinnere nicht – oder schmilzt es vielleicht doch? Und wenn der Kern eines Tages ausgebrannt ist, stürzt die Erde dann in den leeren Raum, sodass an der Oberfläche ein riesiges Loch entsteht? Und woher weiß man das? Wie hat man es herausgefunden?
Was solche Einzelheiten anging, hüllte der Autor sich in ein seltsames Schweigen – er schwieg eigentlich über alles außer Antikline, Synkline, Axialbrüche und Ähnliches. Es war, als wollte er das Beste für sich behalten, indem er alles völlig unergründlich machte. Im Laufe der Jahre schöpfte ich den Verdacht, dass er damit nicht nur einem persönlichen Impuls folgte. Anscheinend gab es unter den Lehrbuchschreibern eine geheimnisvolle, allgemeine Verschwörung: Sie wollten dafür sorgen, dass ihre Themen nie auch nur entfernt in die Sphäre des mäßig Interessanten gerieten, und vom Hochinteressanten waren sie erst recht stets meilenweit entfernt.
Heute weiß ich, dass es eine angenehme Vielzahl von Wissenschaftsautoren gibt, die eine glänzende, spannende Prosa zu Papier bringen – Timothy Ferris, Richard Fortey und Tim Flannery sind drei, die mir an einer einzigen Station des Alphabets einfallen (ganz zu schweigen von dem verstorbenen, aber wahrhaft göttlichen Richard Feynman) –, aber leider schrieb keiner von ihnen ein Lehrbuch, das ich irgendwann einmal zur Hand nahm. Meine Bücher waren stets von Männern (Männer waren es immer) verfasst, die eine interessante Vorstellung hatten: Sie glaubten, alles werde klar, wenn man es in eine Formel fasst, und sie gaben sich der amüsanten Täuschung hin, amerikanische Kinder würden es zu schätzen wissen, wenn am Ende jedes Kapitels ein Abschnitt mit Fragen stand, über die sie in ihrer Freizeit grübeln konnten. Deshalb wuchs ich in der Überzeugung auf, Naturwissenschaft sei ausgesprochen langweilig; gleichzeitig hatte ich den Verdacht, dass es nicht unbedingt so sein musste, aber ich dachte eigentlich nicht darüber nach, ob ich dazu etwas beitragen könnte. Auch das sollte lange Zeit so bleiben.
Viel später – ungefähr vor vier oder fünf Jahren – starrte ich während eines langen Fluges über den Pazifik träge aus dem Fenster auf den mondbeschienenen Ozean. Plötzlich kam mir mit geradezu unangenehmer Aufdringlichkeit der Gedanke, dass ich von dem einzigen Planeten, auf dem ich jemals leben würde, eigentlich keine blasse Ahnung hatte. Ich wusste zum Beispiel nicht, warum die Meere salzig sind, die großen Seen in Nordamerika aber nicht. Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Ich wusste nicht, ob die Ozeane im Laufe der Zeit salziger oder weniger salzig werden und ob ich mir um ihren Salzgehalt Sorgen machen sollte. (Zu meiner Freude kann ich berichten, dass auch die Wissenschaft auf diese Fragen bis Ende der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts keine Antwort hatte. Es wurde nur nicht laut darüber geredet.)
Und der Salzgehalt der Ozeane war natürlich nur ein winziger Bruchteil meiner Unwissenheit. Ich wusste nicht, was ein Proton oder ein Protein ist, konnte ein Quark nicht von einem Quasar unterscheiden, begriff nicht, wie ein Geologe sich in einer Schlucht eine Gesteinsschicht ansehen kann und dann weiß, wie alt sie ist. Ich wusste eigentlich überhaupt nichts. In aller Stille ergriff mich ein ungewohnter Drang, ein wenig mehr über solche Dinge zu wissen und zu verstehen, wie man sie herausgefunden hatte. Das war für mich nach wie vor das größte aller Wunder: Wie finden Naturwissenschaftler etwas heraus? Woher weiß man, wie viel die Erde wiegt oder wie alt ihre Steine sind oder was sich da unten in ihrem Mittelpunkt befindet? Woher weiß man, wann das Universum begann und wie es damals aussah? Woher weiß man, was in einem Atom vorgeht? Und dann – oder vielleicht vor allem: Wie kommt es, dass Wissenschaftler fast alles zu wissen scheinen, und dann können sie ein Erdbeben doch nicht vorhersehen und uns nicht einmal sagen, ob wir nächsten Mittwoch zum Pferderennen einen Regenschirm mitnehmen sollen?
Also entschloss ich mich, einen Teil meines Lebens – drei Jahre sind es bisher geworden – dem Lesen von Büchern und Fachzeitschriften zu widmen. Außerdem wollte ich mir sanftmütige, geduldige Fachleute suchen, die bereit waren, eine Fülle außergewöhnlich dummer Fragen zu beantworten. Letztlich wollte ich wissen, ob man die Wunder und Errungenschaften der Naturwissenschaft nicht verstehen und schätzen oder sogar bestaunen und bejubeln kann, und das auf einer Ebene, die einerseits nicht zu fachlich und anspruchsvoll, auf der anderen aber auch nicht zu oberflächlich ist.
Das waren meine Ideen und Hoffnungen, und diese Absichten verfolge ich mit dem vorliegenden Buch. Aber es gibt viele Themen abzuhandeln, und wir haben dazu viel weniger als 650 000 Stunden Zeit. Also fangen wir an.
TEIL I
Verloren im Kosmos
Sie befinden sich alle in derselben Ebene. Alle kreisen in derselbenRichtung … Es ist vollkommen, wissen Sie. Es ist großartig.Es ist fast unheimlich.
Der Astronom Geoffrey Marcy über das Sonnensystem
1. Bauanleitung für ein Universum
Wir können uns noch so viel Mühe geben – niemals werden wir begreifen, wie winzig, wie räumlich bescheiden ein Proton ist. Dazu ist es einfach viel zu klein.
Ein Proton ist ein letzter Baustein eines Atoms, und auch das ist natürlich kein greifbares Gebilde. Protonen sind so klein, dass ein kleiner Fleck Druckerschwärze, beispielsweise der Punkt auf diesem i, ungefähr 500 000 000 000 von ihnen Platz bietet, das sind mehr als die Sekunden in einer halben Million Jahre.[1] Protonen sind also, gelinde gesagt, überaus mikroskopisch.
Nun stellen wir uns vor (was wir natürlich nicht können), eines dieser Protonen würde auf ein Milliardstel seiner normalen Größe schrumpfen und einen so kleinen Raum einnehmen, dass ein Proton daneben riesengroß wirkt. Und in diesen winzig kleinen Raum packen wir nun ungefähr 30 Gramm Materie. Ausgezeichnet. Jetzt können wir ein Universum gründen.[2]
Natürlich gehe ich davon aus, dass wir ein inflationäres Universum bauen wollen. Wer stattdessen das altmodische Standard-Urknalluniversum bevorzugt, braucht zusätzliches Material. Dann müssen wir sogar alles zusammensammeln, was es gibt – jedes kleine Fitzelchen und Teilchen der Materie von hier bis zu den Rändern der Schöpfung –, und alles in einen so unendlich kompakten Punkt zusammenpressen, dass er überhaupt keine Dimensionen hat. So etwas bezeichnet man als Singularität.
So oder so müssen wir uns auf einen richtig großen Knall vorbereiten. Dabei würden wir uns natürlich gern an einen sicheren Ort zurückziehen und das Schauspiel von dort aus beobachten. Leider können wir aber nirgendwo Zuflucht suchen, denn außerhalb der Singularität gibt es kein Wo. Wenn die Ausdehnung des Universums beginnt, füllt sich damit keine größere Leere. Es existiert nur ein einziger Raum: der Raum, der während des Vorganges erschaffen wird.
Sich die Singularität als eine Art schwangeren Punkt vorzustellen, der in einer dunklen, grenzenlosen Leere hängt, ist zwar eine natürliche, aber auch falsche Vorstellung. Es gibt weder Raum noch Dunkelheit. Um die Singularität herum ist nichts. Dort existiert kein Raum, den sie einnehmen könnte, kein Ort, an dem sie sich befindet. Wir können noch nicht einmal fragen, wie lange sie schon dort ist – ob sie wie eine gute Idee gerade erst ins Dasein getreten ist oder ob sie schon immer da war und in aller Ruhe auf den richtigen Augenblick gewartet hat. Die Zeit existiert nicht. Es gibt keine Vergangenheit, aus der sie hervortreten könnte.
Und so, aus dem Nichts, nimmt unser Universum seinen Anfang.
In einem einzigen blendenden Stoß, in einem Augenblick der Prachtentfaltung, der für jede Beschreibung mit Worten viel zu schnell und umfangreich ist, nimmt die Singularität himmlische Dimensionen an und wird zu einem unvorstellbar großen Raum. In der ersten, lebhaften Sekunde (und viele Kosmologen widmen ihre gesamte Berufslaufbahn dem Versuch, diese Sekunde in noch dünnere Scheiben zu zerlegen) entstehen die Schwerkraft und die anderen beherrschenden Kräfte der Physik. Nach noch nicht einmal einer Minute hat das Universum einen Durchmesser von weit mehr als einer Million Milliarden Kilometern, und es wächst schnell. Wärme ist jetzt reichlich vorhanden, zehn Milliarden Grad, genug, damit die Kernreaktionen beginnen und leichte Elemente entstehen lassen – im wesentlichen Wasserstoff und Helium mit einem Schuss (ungefähr einem unter hundert Millionen Atomen) Lithium. Nach drei Minuten sind 98 Prozent aller Materie entstanden, die existiert oder jemals existieren wird. Wir haben ein Universum. Es ist ein Ort der erstaunlichsten und lohnendsten Möglichkeiten, und wunderschön ist es auch. Und alles ist ungefähr in der Zeit geschehen, die man zur Zubereitung eines Sandwichs braucht.
Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Selbst die Vorstellung vom Urknall ist noch relativ neu. Die Idee als solche geisterte schon seit den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts herum, als der belgische Priester und Gelehrte Georges Lemâitre sie erstmals vorsichtig äußerte, aber in der Kosmologie spielt sie erst seit Mitte der sechziger Jahre eine größere Rolle. Damals machten zwei junge Radioastronomen eine außergewöhnliche, unerwartete Entdeckung.
Die beiden – sie hießen Arno Penzias und Robert Wilson – wollten 1965 mit einer großen Funkantenne arbeiten, die den Bell Laboratories gehörte und in Holmdel, New Jersey, stand. Dabei störte sie aber ein ständiges Hintergrundgeräusch – ein ununterbrochenes Zischen, das jede experimentelle Arbeit unmöglich machte. Es war ein erbarmungsloser, unbestimmter Lärm, der Tag und Nacht, zu allen Jahreszeiten, von allen Stellen des Himmels kam. Ein Jahr lang versuchten die jungen Astronomen alles, was ihnen in den Sinn kam, um die Ursachen des Geräusches ausfindig zu machen und zu beseitigen. Sie überprüften sämtliche elektrischen Geräte. Sie bauten Instrumente um, prüften Stromkreise, spielten mit Kabeln herum, staubten Stecker ab. Sie kletterten in die Antennenschüssel und brachten Klebeband auf allen Schweißnähten und Nieten an. Sie kletterten noch einmal in die Schüssel, dieses Mal mit Besen und Bürsten, und schrubbten alles ab, was sie in einem späteren Fachaufsatz als »weißes dielektrisches Material« bezeichneten – normalerweise nennt man es Vogelscheiße. Aber was sie auch versuchten, es nützte nichts.[5]
Was sie nicht wussten: Nur 50 Kilometer entfernt, an der Princeton University, suchte ein Wissenschaftlerteam unter Leitung von Robert Dicke genau nach dem, was die beiden mit so viel Mühe loszuwerden versuchten. Die Forscher in Princeton waren von einem Gedanken ausgegangen, den der in Russland geborene Astrophysiker George Gamow schon in den vierziger Jahren geäußert hatte: Danach musste man nur weit genug in den Weltraum blicken, dann würde man eine kosmische Hintergrundstrahlung finden, die vom Urknall übrig geblieben war. Nachdem diese Strahlung die Weiten des Universums durchquert hatte, sollte sie nach Gamows Berechnungen in Form von Mikrowellen auf die Erde treffen. In einem späteren Fachaufsatz hatte er sogar ein Instrument genannt, das sich für ihren Nachweis eignete: die Bell-Antenne in Holmdel.[6] Leider hatten weder Penzias und Wilson noch irgendjemand aus der Arbeitsgruppe in Princeton diesen späteren Artikel gelesen.
Natürlich hatten Penzias und Wilson genau das Geräusch gehört, das Gamow postuliert hatte. Sie hatten den Rand des Universums gefunden, oder zumindest den Rand seines sichtbaren Teils, der 150 Milliarden Billionen Kilometer entfernt ist.[7] Sie »sahen« die ersten Photonen, das älteste Licht des Universums, das allerdings über Zeit und Entfernung hinweg zu Mikrowellen geworden war, genau wie Gamow es vorausgesagt hatte. Wenn wir diese Entdeckung im richtigen Licht betrachten wollen, hilft uns ein Vergleich, den Alan Guth in seinem Buch Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts anstellte: Wenn man sich den Blick in die Tiefen des Universums als Blick vom 100. Stock des Empire State Building vorstellt (wobei der 100. Stock die Gegenwart und die Straße den Augenblick des Urknalls darstellt), befanden sich die am weitesten entfernten Galaxien zur Zeit von Wilsons und Penzias’ Entdeckung ungefähr im 60. Stock, und die am weitesten entfernten Objekte überhaupt – die Quasare – lagen ungefähr in Höhe des 20. Geschosses. Mit ihrer Entdeckung erweiterten die beiden unsere Kenntnisse über das sichtbare Universum bis auf einen Zentimeter über dem Bürgersteig.[8]
Wilson und Penzias wussten immer noch nicht, woher die Geräusche kamen; sie riefen Dicke in Princeton an, beschrieben ihm ihr Problem und hofften, er würde eine Lösung vorschlagen. Dicke war sofort klar, was die beiden jungen Männer gefunden hatten. Als er den Hörer aufgelegt hatte, sagte er zu seinen Kollegen: »So Jungs, man hat uns überrundet.«
Kurz darauf erschienen im Astrophysical Journal zwei Artikel: In dem einen beschrieben Penzias und Wilson ihre Erfahrungen mit dem Zischen, in dem anderen erklärte Dickes Arbeitsgruppe, worum es sich dabei handelte. Obwohl Penzias und Wilson nicht nach der kosmischen Hintergrundstrahlung gesucht hatten, obwohl sie sie nicht erkannten, nachdem sie sie gefunden hatten, und obwohl sie auch ihre Eigenschaften in keinem Fachaufsatz beschrieben oder interpretiert hatten, erhielten sie 1978 den Nobelpreis für Physik. Den Wissenschaftlern in Princeton blieben nur freundliche Worte. Dazu schrieb Dennis Overbye in Das Echo des Urknalls, Penzias und Wilson hätten die wahre Bedeutung ihrer Entdeckung erst verstanden, als sie darüber etwas in der New York Times gelesen hätten.
Nebenbei bemerkt: Die Auswirkungen der kosmischen Hintergrundstrahlung hat jeder von uns schon einmal erlebt. Man braucht nur den Fernseher auf einen nicht belegten Kanal einzustellen: Das »Schneegestöber«, das man dort sieht, wird zu ungefähr einem Prozent von diesem uralten Überbleibsel des Urknalls hervorgerufen.[9] Wer sich das nächste Mal beschwert, dass es im Fernsehen nichts zu sehen gibt, sollte daran denken, dass man immer bei der Geburt des Universums zusehen kann.
Obwohl alle vom Urknall reden, werden wir in vielen Büchern gewarnt, man solle sich darunter keine Explosion im üblichen Sinn vorstellen. Es war vielmehr eine riesige, sehr plötzliche Ausdehnung von ungeheuren Ausmaßen. Aber wodurch wurde sie ausgelöst?
Eine Vorstellung besagt, die Singularität sei vielleicht der Überrest eines früheren, zusammengebrochenen Universums – danach wären wir nur Teil eines ewigen Kreislaufs, in dem sich Universen ausdehnen und zusammenziehen wie der Blasebalg an einem Sauerstoffgerät. Andere führen den Urknall auf ein so genanntes »falsches Vakuum«, ein »Skalarfeld« oder eine »Vakuumenergie« zurück – in jedem Fall auf eine Qualität oder ein Etwas, das in das bestehende Nichts ein gewisses Maß an Instabilität hineinbrachte. Dass aus dem Nichts ein Etwas hervorgeht, erscheint unmöglich, aber die Tatsache, dass vorher nichts da war und jetzt ein Universum existiert, ist der Beweis, dass es möglich ist. Vielleicht ist unser Universum nur ein Teil vieler größerer Universen, von denen manche in anderen Dimensionen existieren, und vielleicht laufen ständig und überall Urknalle ab. Möglicherweise hatten Raum und Zeit auch vor dem Urknall eine völlig andere Form, die wir uns in ihrer Fremdartigkeit nicht vorstellen können, und der Urknall stellt eine Art Übergangsphase dar, in der das Universum sich von einer unbegreiflichen Form in eine andere verwandelte, die wir beinahe verstehen können. »Das sind schon fast religiöse Fragen«, erklärte der Kosmologe Dr. Andrei Linde aus Stanford im Jahr 2001 der New York Times.[10]
In der Urknalltheorie geht es eigentlich nicht um den Urknall selbst, sondern um das, was danach geschah. Nicht lange danach, wohlgemerkt. Nachdem die Wissenschaftler eine Menge Mathematik betrieben und genau zugesehen haben, was in Teilchenbeschleunigern vor sich geht, können sie heute nach eigenen Angaben bis 10-43 Sekunden nach dem Augenblick der Schöpfung zurückblicken – damals war das Universum noch so klein, dass man es nur mit dem Mikroskop hätte sehen können. Wir brauchen nicht jedes Mal in Ohnmacht zu fallen, wenn uns ungewöhnliche Zahlen begegnen, aber von Zeit zu Zeit sollten wir vielleicht doch innehalten und uns daran erinnern, wie erstaunlich und unbegreiflich sie sind. 10-43 ist gleichbedeutend mit 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1 oder einer zehn millionstel billionstel billionstel billionstel Sekunde. 1[11]
Was wir heute über die ersten Augenblicke des Universums wissen oder zu wissen glauben, geht zum größten Teil auf die »Inflationstheorie« zurück, einen Gedanken, der erstmals 1979 von einem jungen Teilchenphysiker namens Alan Guth geäußert wurde. Guth – er arbeitete damals in Stanford und ist heute am Massachusetts Institute of Technology tätig – war damals 32 und hatte nach eigenem Eingeständnis zuvor noch nicht viel zuwege gebracht.[12] Vermutlich wäre er nie auf seine großartige Idee gekommen, wenn er nicht einen Vortrag über den Urknall gehört hätte, den ausgerechnet Robert Dicke hielt. Der Vortrag weckte bei Guth das Interesse für Kosmologie und insbesondere für die Entstehung des Universums.[13]
Am Ende kam dabei die Inflationstheorie heraus. Sie besagt, das Universum habe einen kurzen Augenblick nach Anbeginn der Schöpfung eine drastische Ausweitung erlebt. Es wurde »aufgeblasen« – eigentlich lief es vor sich selbst davon, und seine Größe verdoppelte sich alle 10-34 Sekunden.[14] Die ganze Episode dürfte nicht länger als 10-30 Sekunden gedauert haben – eine millionstel millionstel millionstel millionstel millionstel Sekunde –, aber in dieser Zeit wurde das Universum von einem Gebilde, das man in der Hand halten konnte, zu etwas mindestens 10 000 000 000 000 000 000 000 000 Mal Größerem.[15] Die Inflationstheorie erklärt die Wellen und Wirbel, die unser Universum möglich machen. Ohne sie gäbe es keine Materieklumpen und damit auch keine Sterne, sondern nur treibende Gase und immerwährende Dunkelheit.
Wenn Guths Theorie stimmt, entstand nach ungefähr einem Zehnmillionstel einer billionstel billionstel billionstel Sekunde die Schwerkraft. Nach einem weiteren lächerlich kurzen Zeitraum kamen der Elektromagnetismus sowie die starken und schwachen Kernkräfte hinzu – das Material der Physik. Einen Augenblick später folgten Schwärme von Elementarteilchen – das Material der Materie. Aus dem Nichts gab es plötzlich Schwärme von Photonen, Protonen, Elektronen, Neutronen und vieles andere – von jedem nach der Standard-Urknalltheorie etwa 1079 bis 1089 Stück.
Das sind natürlich unvorstellbare Mengen. Wir brauchen uns nur zu merken, dass nach einem einzigen entscheidenden Augenblick plötzlich ein riesiges Universum da war – es hat nach der Theorie einen Durchmesser von mindestens 100 Milliarden Lichtjahren, könnte aber auch noch viel größer oder sogar unendlich groß sein. Dieses Universum bot alle Voraussetzungen für die Entstehung der Sterne, Galaxien und anderer komplizierter Systeme.[16]
Aus unserer Sicht ist besonders bemerkenswert, wie sich für uns alles zum Guten gewendet hat. Hätte das Universum bei seiner Entstehung nur ein kleines bisschen anders ausgesehen – wäre die Schwerkraft geringfügig stärker oder schwächer gewesen oder wäre die Ausdehnung nur ein wenig schneller oder langsamer vonstatten gegangen –, dann hätte es wahrscheinlich nie stabile Elemente gegeben, die dich und mich und die Erde, auf der wir stehen, hätten bilden können. Bei einer geringfügig stärkeren Gravitation wäre wahrscheinlich das ganze Universum wie ein schlecht aufgestelltes Zelt in sich zusammengebrochen, und ohne genau die richtigen Werte hätte es weder die richtigen Dimensionen und Bestandteile noch die richtige Dichte gehabt. Bei einer schwächeren Gravitation dagegen hätte sich nichts zusammenfinden können, und das Universum wäre für alle Zeiten eine langweilige, gleichmäßig verteilte Leere geblieben.
Das ist einer der Gründe, warum manche Experten glauben, es habe noch viele andere Urknalle gegeben, vielleicht sogar Billionen und Aberbillionen, die sich über die gewaltige Zeitspanne der Ewigkeit verteilen; dass wir gerade in diesem einen existieren, liegt demnach daran, dass es der Einzige ist, in dem wir existieren können. Edward B. Tryon von der Columbia University formulierte es einmal so: »Als Antwort auf die Frage, warum es passierte, unterbreite ich den bescheidenen Vorschlag, dass unser Universum schlicht und einfach eines von diesen Dingen ist, die von Zeit zu Zeit passieren.« Und Guth fügt hinzu: »Obwohl die Entstehung des Universums äußerst unwahrscheinlich erscheinen mag, hat niemand, wie Tryon betonte, die fehlgeschlagenen Versuche gezählt.«[17]
Nach Ansicht des britischen Astronomen Martin Rees gibt es viele Universen, möglicherweise sogar eine unendlich große Zahl, in denen unterschiedliche Eigenschaften jeweils in anderen Kombinationen vorkommen, und wir leben einfach in demjenigen, dessen Merkmalskombination uns die Existenz ermöglicht. Als Vergleich nennt er ein sehr großes Bekleidungsgeschäft: »Wenn ein sehr großer Vorrat von Kleidungsstücken vorhanden ist, wundert man sich nicht, wenn man einen passenden Anzug findet. Findet man viele Universen, die jemals von unterschiedlichen Zahlenkombinationen beherrscht werden, dann gibt es auch eines, dessen Kombination sich für das Leben eignet. Und in diesem einen befinden wir uns.«[18]
Rees weist darauf hin, dass insbesondere sechs Zahlen unser Universum beherrschen; würde sich nur der Wert von einer davon geringfügig ändern, könnte nichts mehr so sein, wie es ist. Damit das Universum in seiner uns bekannten Form existieren kann, muss Wasserstoff sich ständig in einem genau festgelegten, vergleichsweise großen Umfang in Helium verwandeln – nämlich so, dass sich sieben Tausendstel seiner Masse in Energie verwandeln. Wäre dieser Wert nur geringfügig niedriger – beispielsweise nicht 0,007, sondern 0,006 Prozent –, könnte keine Umwandlung mehr stattfinden: Dann würde das Universum aus Wasserstoff und nichts anderem bestehen. Ein geringfügig höherer Wert – 0,008 Prozent – und die Verschmelzung würde so heftig ablaufen, dass der Wasserstoff schon längst aufgebraucht wäre. So oder so würde die geringste Abwandlung der Zahlen dazu führen, dass es das Universum, wie wir es kennen und brauchen, nicht gäbe.[19]
Ich sollte sagen: Bisher ist alles genau richtig. Auf lange Sicht könnte sich die Gravitation als ein wenig zu stark erweisen, und eines Tages bringt sie die Ausdehnung des Universums vielleicht zum Stillstand, sodass es in sich zusammenbricht und zu einer neuen Singularität zusammengedrängt wird – möglicherweise beginnt dann das Ganze wieder von vorn.[20] Andererseits könnte sie aber auch zu schwach sein, sodass das Universum für alle Zeiten auseinanderstrebt, bis alles so weit voneinander entfernt ist, dass keine Aussichten auf Materie-Wechselwirkungen mehr bestehen. Dann wird das Universum zu etwas Trägem und Totem, das aber sehr geräumig ist. Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass die Gravitation tatsächlich genau richtig ist – die Kosmologen sprechen von der »kritischen Dichte« – und das Universum in den richtigen Abmessungen zusammenhält, sodass alles unendlich weiterlaufen kann. In lockeren Momenten bezeichnen die Kosmologen so etwas manchmal als Goldilock-Effekt: Alles ist genau richtig. (Nur der Vollständigkeit halber: Diese drei Möglichkeiten werden geschlossenes, offenes und flaches Universum genannt.)
Jetzt kommt die Frage, die wir uns alle schon irgendwann einmal gestellt haben: Was geschieht, wenn wir zum Rand des Universums reisen und dort den Kopf durch den Vorhang stecken? Wo wäre der Kopf, wenn er sich nicht mehr im Universum befindet? Was ist dahinter? Die enttäuschende Antwort lautet: Man gelangt nie an den Rand des Universums. Nicht weil es zu lange dauern würde – das natürlich auch –, sondern weil man nie eine Außengrenze erreicht, selbst wenn man sich hartnäckig und unendlich lange in gerader Richtung fortbewegt. Stattdessen wäre man irgendwann wieder am Ausgangspunkt (und dort würde man wahrscheinlich die Lust verlieren und aufgeben). Der Grund: Das Universum ist in Übereinstimmung mit Einsteins Relativitätstheorie (auf die wir zu gegebener Zeit noch zurückkommen werden) gekrümmt, und zwar auf eine Weise, die wir uns nicht richtig vorstellen können. Vorerst reicht die Erkenntnis, dass wir nicht in einer großen, sich ständig ausweitenden Blase schweben. Der Raum ist vielmehr gekrümmt, und zwar so, dass er zwar endlich, aber grenzenlos ist. Eigentlich kann man nicht einmal behaupten, dass der Raum sich ausdehnt, denn wie der Physiker und Nobelpreisträger Steven Weinberg richtig anmerkt, expandieren weder Sonnensysteme und Galaxien noch der Raum selbst. Stattdessen entfernen die Galaxien sich voneinander.[21] Das alles ist für unsere Vorstellungskraft eine echte Herausforderung. Oder, in einer berühmten Formulierung des Biologen J. B. S. Haldane: »Das Universum ist nicht nur merkwürdiger, als wir annehmen; es ist merkwürdiger, als wir überhaupt annehmen können.«
Wenn man die Krümmung des Raumes erklären will, stellt man sich zum Vergleich in der Regel ein Wesen aus einem Universum mit flachen Oberflächen vor, das nie eine Kugel gesehen hat und dann auf die Erde gebracht wird. Ganz gleich, wie weit es über die Oberfläche des Planeten streift, es wird nie einen Rand finden. Schließlich ist es wieder am Ausgangspunkt und kann sich natürlich überhaupt nicht erklären, wie so etwas möglich ist. In der gleichen Lage wie unser verblüffter Flachländer sind auch wir, nur werden wir in einer höheren Dimension an der Nase herumgeführt.
Genau wie man nirgendwo einen Rand des Universums finden kann, so gibt es auch keinen Ort, an dem man sich in die Mitte stellen und sagen könnte: »Hier hat alles angefangen. Hier ist der Mittelpunkt von allem.« Wir sind alle im Mittelpunkt von allem. Eigentlich wissen wir noch nicht einmal das ganz genau; mathematisch lässt es sich nicht beweisen. Die Wissenschaftler nehmen einfach an, dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums sein können – man denke nur daran, welche Folgerungen sich daraus ergeben würden –, sondern dass alle Beobachter an allen Orten das gleiche Phänomen erleben würden. Aber letztlich wissen wir es nicht.[22]
Für uns reicht das Universum so weit, wie das Licht in den Jahrmilliarden seit seiner Entstehung gewandert ist. Dieses sichtbare Universum – das Universum, das wir kennen und über das wir reden können – hat einen Durchmesser von 1,6 Millionen Millionen Millionen Millionen (1 600 000 000 000 000 000 000 000) Kilometern.[23] Aber nach den meisten Theorien ist das gesamte Universum – das Meta-Universum, wie es manchmal genannt wird – noch bei weitem geräumiger. Die Zahl der Lichtjahre bis zum Rand dieses größeren, unsichtbaren Universums, so Rees, hat dann »nicht zehn und auch nicht hundert Nullen, sondern viele Millionen«.[24] Kurz gesagt existiert mehr Raum, als man sich vorstellen kann, auch wenn man nicht die Mühe auf sich nimmt, sich ein zusätzliches Dahinter auszumalen.
Die Urknalltheorie hatte lange Zeit eine große Lücke, über die sich viele Fachleute Sorgen machten: Sie konnte nicht einmal ansatzweise erklären, wie wir entstanden sind. Zwar wurden 98 Prozent aller vorhandenen Materie mit dem Urknall erschaffen, aber diese Materie bestand ausschließlich aus leichten Gasen: dem Helium, Wasserstoff und Lithium, von denen bereits die Rede war. Aus dem Gasgebräu der Schöpfung ging kein einziges Teilchen der schwereren Substanzen hervor, die für unser eigenes Dasein so unentbehrlich sind – Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter. Andererseits aber – und das ist das Beunruhigende – braucht man die Wärme und Energie eines Urknalls, damit sich diese schweren Elemente bilden. Aber es gab nur einen Urknall, und bei dem entstanden sie nicht. Woher also kommen sie?
Der Mann, der die Antwort auf diese Frage fand, war interessanterweise ein Kosmologe, der die Urknalltheorie von ganzem Herzen ablehnte. Er prägte sogar den Begriff »Big Bang« ursprünglich als Ironie, mit der er sich darüber lustig machen wollte. Wir werden in Kürze auf ihn zurückkommen, aber bevor wir uns mit der Frage befassen, warum wir hier sind, sollten wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen und überlegen, was »hier« eigentlich bedeutet.
2. Willkommen im Sonnensystem
Die Astronomen vollbringen heutzutage erstaunliche Dinge. Würde jemand auf dem Mond ein Streichholz anzünden, könnten sie die Flamme sehen. Aus dem winzigsten Wackeln und Schwanken weit entfernter Sterne ziehen sie Schlüsse über Größe, Eigenarten und sogar die mögliche Bewohnbarkeit von Planeten, die viel zu weit entfernt sind, als dass man sie sehen könnte – mit einem Raumschiff würden wir eine halbe Million Jahre brauchen, um sie zu erreichen.[1] Mit ihren Radioteleskopen fangen sie das Flüstern einer so ungeheuer schwachen Strahlung ein, dass die Gesamtmenge der Energie, die sie alle gemeinsam seit dem Beginn der Beobachtungen (im Jahr 1951) aufgefangen haben, geringer ist als die Energie einer einzigen Schneeflocke, die auf den Boden trifft, wie Carl Sagan es formulierte.[2]
Kurz gesagt, gibt es im Universum nicht mehr viel, was die Astronomen nicht finden könnten, wenn sie es darauf anlegen. Umso bemerkenswerter ist es deshalb, dass bis 1978 niemand den Mond des Planeten Pluto bemerkt hatte. Im Sommer jenen Jahres, bei einer Routineuntersuchung von Fotos des Pluto, fiel dem jungen Astronomen James Christy vom U. S. Naval Observatory in Flagstaff, Arizona, etwas auf – es war verschwommen und unscharf, aber der Pluto war es eindeutig nicht.[3] Nachdem er sich mit seinem Kollegen Robert Harrington beraten hatte, gelangte er zu dem Schluss, dass er einen Mond gefunden hatte. Und es war nicht irgendein Mond, sondern im Verhältnis zu seinem Planeten der größte des Sonnensystems.
Seine Entdeckung stellte sogar die Einstufung des Pluto als Planet, die eigentlich nie besonders hieb- und stichfest gewesen war, in Frage. Zuvor hatte man geglaubt, das von dem Mond und Pluto selbst eingenommene Volumen sei ein und dasselbe – die neue Entdeckung bedeutete also, dass der Pluto viel kleiner war, als irgendjemand bis dahin angenommen hatte, kleiner sogar als der Merkur.[4] Sogar sieben Monde im Sonnensystem, darunter unser eigener, sind größer.
Nun stellt sich natürlich die Frage, warum es so lange gedauert hat, bis jemand in unserem Sonnensystem einen Mond fand. Die Antwort: Solche Entdeckungen hängen zum Teil davon ab, wohin die Astronomen ihre Instrumente richten, zum Teil auch davon, für welche Beobachtungen diese Instrumente konstruiert sind; in gewisser Weise lag es aber auch am Pluto selbst. Entscheidend ist vor allem, wohin man Instrumente richtet. Oder, wie der Astronom Clark Chapman es formulierte: »Die meisten Leute glauben, ein Astronom geht nachts ins Observatorium und sucht den Himmel ab. Das stimmt nicht. Fast alle Teleskope, die wir auf der Erde besitzen, sind zur Betrachtung winziger Himmelsabschnitte konstruiert, damit man in weiter Ferne einen Quasar sehen, nach schwarzen Löchern suchen oder eine weit entfernte Galaxie untersuchen kann. Das einzige echte Netz von Teleskopen, das den Himmel systematisch absucht, wurde vom Militär geplant und gebaut.«[5]
Künstlerische Abbildungen von Planeten haben uns dazu verleitet, der Astronomie eine Schärfe der Wiedergabe zu unterstellen, die in Wirklichkeit nicht existiert. Der Pluto ist auf Christys Aufnahme sehr schwach und unscharf zu sehen – eine Art kosmisches Stäubchen –, und sein Mond ist nicht der romantisch angestrahlte, scharf umrissene Trabant, den man auf einer Zeichnung von National Geographic sehen würde, sondern ein winziges, fast nicht zu unterscheidendes Fleckchen zusätzlicher Unschärfe. Die Unschärfe war sogar so groß, dass noch sieben Jahre vergehen sollten, bis wieder jemand den Mond sah und seine Existenz unabhängig bestätigen konnte.[6]
Christys Entdeckung hatte einen besonders hübschen Aspekt: Sie ereignete sich in Flagstaff, genau da, wo man den Pluto 1930 überhaupt erst gefunden hatte. Dieses bahnbrechende wissenschaftliche Ereignis war im Wesentlichen dem Astronomen Percival Lowell zu verdanken. Lowell stammte aus einer der ältesten und reichsten Bostoner Familien (sie kommt in einem bekannten kleinen Gedicht über Boston als Heimat von Bohnen und Kabeljau vor, wo die Lowells nur mit den Cabots und die Cabots nur mit Gott sprechen) und finanzierte das berühmte Observatorium, das seinen Namen trägt; unvergessen ist er aber insbesondere wegen seiner Ansicht, es gebe auf dem Mars ein Netz von Kanälen, welche die fleißigen Marsbewohner gebaut hätten, um Wasser aus den Polargebieten in das fruchtbare Land am Äquator zu leiten.
Lowells zweite unabänderliche Überzeugung besagte, es gebe irgendwo jenseits des Neptun einen noch unentdeckten neunten Planeten, den er als Planet X bezeichnete. Seine Ansicht stützte sich auf Unregelmäßigkeiten, die er in den Umlaufbahnen von Uranus und Neptun entdeckt hatte, und die letzten Jahre seines Lebens verwendete er auf die Suche nach dem Gasriesen, der dort nach seiner Auffassung existieren musste. Leider starb er 1916 sehr plötzlich – unter anderem sicher, weil er von der Suche erschöpft war –, und seine Forschungen wurden eine Zeit lang zurückgestellt, weil die Lowell-Erben sich um seinen Grundbesitz stritten. Im Jahr 1929 jedoch entschlossen sich die Direktoren des Lowell-Observatoriums, die Suche wieder aufzunehmen – unter anderem wohl deshalb, weil sie die Aufmerksamkeit von dem Märchen um die Marskanäle ablenken wollten, das zu jener Zeit bereits zu einer schwerwiegenden Peinlichkeit geworden war. Zu diesem Zweck stellten sie Clyde Tombaugh ein, einen jungen Mann aus Kansas.
Tombaugh besaß keine offizielle Ausbildung als Astronom, aber er war gewissenhaft und klug. Nachdem er ein Jahr lang geduldig gesucht hatte, stieß er irgendwie auf den Pluto, einen schwachen Lichtpunkt am funkelnden Firmament.[7] Seine Entdeckung grenzte geradezu an ein Wunder, und noch verblüffender war, dass die Beobachtungen, von denen Lowell bei seinen Aussagen über den Planeten jenseits des Neptun ausgegangen war, sich als vollständig falsch erwiesen. Tombaugh erkannte sofort, dass es sich bei dem neuen Planeten keineswegs um die riesige Gaskugel handelte, die Lowell vorausgesagt hatte, aber wenn er oder irgendjemand anderes im Zusammenhang mit den Eigenschaften des neuen Planeten noch Zurückhaltung übte, so wurde sie schon bald von der Begeisterung hinweggefegt, die in jenem leicht erregbaren Zeitalter fast jede Sensationsmeldung begleitete. Zum ersten Mal hatte ein Amerikaner einen Planeten entdeckt, und da wollte sich niemand mit dem Gedanken aufhalten, dass es sich eigentlich nur um einen weit entfernten Eisklumpen handelte. Den Namen Pluto erhielt er zumindest teilweise deshalb, weil die beiden ersten Buchstaben Lowells Initialen waren. Der Astronom wurde nun posthum als Genie ersten Ranges gefeiert, und Tombaugh geriet weitestgehend in Vergessenheit, außer bei den Astronomen, die sich auf die Planeten spezialisiert haben: Sie verehren ihn noch heute.
Manche Astronomen sind nach wie vor überzeugt, dass es einen Planeten X geben könnte – einen riesigen Brocken, vielleicht mit der zehnfachen Größe des Jupiters, aber so weit entfernt, dass wir ihn nicht sehen können.[8] (Er würde so wenig Sonnenlicht einfangen, dass er fast nichts reflektiert.) Nach dieser Vorstellung handelt es sich nicht um einen normalen Planeten wie Jupiter oder Saturn – dazu ist er viel zu weit weg, wir reden hier über mehr als sieben Billionen Kilometer –, sondern eher um eine Sonne, die es nie ganz geschafft hat. Die meisten Sternsysteme im Kosmos sind Doppelsterne, und das lässt unsere einsame Sonne ein wenig seltsam aussehen.
Was den Pluto selbst angeht, so weiß niemand ganz genau, wie groß er ist, woraus er besteht, was für eine Atmosphäre er besitzt oder was er überhaupt für ein Gebilde darstellt. Viele Astronomen halten ihn nicht für einen Planeten, sondern nur für das größte bisher entdeckte Objekt im Kuiper-Gürtel, einem Bereich mit galaktischen Trümmern. Der Kuiper-Gürtel wurde schon 1930 von dem Astronomen F. C. Leonard theoretisch vorausgesagt;[9] seinen Namen aber trägt er zu Ehren des Niederländers Gerard Kuiper, der in den Vereinigten Staaten arbeitete und die Idee weiter ausbaute. Aus dem Kuiper-Gürtel stammen die so genannten periodischen Kometen, die sich in recht regelmäßigen Abständen blicken lassen und deren berühmtester der Halley-Komet ist. Die schwerer fassbaren nichtperiodischen Kometen (unter ihnen Hale-Bopp und Hyakutake, die kürzlich bei uns zu Besuch waren) stammen aus der weiter entfernten Oort-Wolke, mit der wir uns in Kürze noch genauer beschäftigen werden.
Eines ist sicher richtig: Pluto verhält sich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Planeten. Er ist nicht nur klein und rätselhaft, sondern in seinen Bewegungen auch so launisch, dass niemand genau weiß, wo er sich in 100 Jahren befinden wird. Während die Umlaufbahnen der anderen Planeten alle mehr oder weniger in derselben Ebene liegen, ist die von Pluto in einem Winkel von 17 Grad gekippt wie die Krempe eines Hutes, den sich jemand verwegen schief auf den Kopf gesetzt hat. Seine Umlaufbahn ist so unregelmäßig, dass er uns während beträchtlicher Abschnitte auf seiner einsamen Kreisbahn näher ist als der Neptun. Während großer Teile der achtziger und neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts war Neptun eigentlich der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Erst am 11. Februar 1999 kehrte Pluto auf die Überholspur zurück, wo er während der nächsten 228 Jahre bleiben wird.[10]
Wenn Pluto also wirklich ein Planet ist, dann mit Sicherheit ein sehr seltsamer. Er ist winzig: Seine Masse beträgt nur ein Viertelprozent der Erdmasse. Auf die Vereinigten Staaten gelegt, würde er noch nicht einmal die Hälfte der 48 zusammenhängenden Bundesstaaten bedecken. Schon das macht ihn zu etwas Ungewöhnlichem: Es bedeutet, dass unser Planetensystem aus vier inneren Gesteinsplaneten, vier äußeren Gasriesen und einem winzigen, einsamen Eisbrocken besteht. Außerdem haben wir allen Grund zu der Annahme, dass wir schon bald in der gleichen Raumregion noch andere, größere Eiskugeln finden werden. Dann allerdings werden sich wirklich Probleme ergeben. Nachdem Christy den Pluto-Mond ausfindig gemacht hatte, musterten die Astronomen den fraglichen Bereich des Kosmos eingehender, und schon Anfang Dezember 2002 hatten sie mehr als 600 weitere Trans-Neptun-Objekte gefunden, oder Plutinos, wie sie auch genannt werden.[11] Eines davon, Varuna genannt, ist fast so groß wie der Pluto-Mond. Die Astronomen gehen heute davon aus, dass es Milliarden derartiger Objekte gibt. Die Schwierigkeit besteht nur darin, dass viele von ihnen entsetzlich dunkel sind. In der Regel haben sie nur eine Albedo (Reflexionskraft) von vier Prozent, ungefähr ebenso viel wie ein Stück Kohle[12] – und diese Kohleklumpen sind natürlich rund sieben Milliarden Kilometer entfernt.
Wie weit ist das eigentlich? Man kann es sich fast nicht vorstellen. Der Weltraum ist nun einmal riesig – einfach riesig. Malen wir uns um der Erbauung und Unterhaltung willen einmal aus, wir würden mit einer Rakete eine Reise unternehmen. Wir fliegen nicht besonders weit – nur bis an den Rand unseres eigenen Sonnensystems –, aber wir müssen uns eine Vorstellung davon machen, wie groß der Weltraum ist und welch kleinen Teil davon wir besetzen.
Und jetzt kommt die schlechte Nachricht: Ich fürchte, bis zum Abendessen werden wir nicht zurück sein. Selbst mit Lichtgeschwindigkeit würden wir mehrere Stunden brauchen, bis wir beim Pluto ankommen. In Wirklichkeit können wir natürlich nicht einmal annähernd mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Wir müssen mit der Geschwindigkeit eines Raumschiffs vorliebnehmen, und das ist wirklich ein Schneckentempo. Die höchste Geschwindigkeit, die ein von Menschen gebauter Gegenstand jemals erreichte, ist die der Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2: Sie entfernen sich mit rund 57 000 Stundenkilometern von uns.[13]
Dass die Voyager-Sonden gerade damals (im August und September 1977) gestartet wurden, hatte einen besonderen Grund: Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun standen in einer Linie, eine Anordnung, die sich nur alle 175 Jahre ergibt. Deshalb konnten die beiden Raumfahrzeuge sich mit Unterstützung der Schwerkraft nacheinander von einem Gasriesen zum anderen schwingen. Dennoch brauchten sie neun Jahre, um den Uranus zu erreichen, und erst nach zwölf weiteren kreuzten sie die Umlaufbahn des Pluto. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Wenn wir bis zum Januar 2006 warten (in diesem Monat soll einem vorläufigen Zeitplan zufolge die NASA-Raumsonde New Horizons zum Pluto starten), können wir eine günstige Position des Jupiters ausnutzen, und dann sind wir – auch wegen einiger technischer Fortschritte – in ungefähr zehn Jahren dort. Der Rückweg, so befürchte ich, wird aber wesentlich länger dauern. So oder so ist es eine lange Reise.
Unterwegs würden wir als Erstes erkennen, dass der leere Raum tatsächlich sehr leer und entsetzlich ereignislos ist. Unser Sonnensystem mag auf vielen Billionen Kilometern das lebhafteste Gebilde sein, aber die gesamte darin enthaltene sichtbare Materie – die Sonne, die Planeten mit ihren Monden, die vielleicht eine Milliarde treibenden Felsblöcke des Asteroidengürtels, die Kometen und alle anderen schwebenden Trümmerteile – füllen nicht mal ein Billionstel des zur Verfügung stehenden Raumes aus.[14] Ebenso wird uns klar werden, dass keine schematische Darstellung des Sonnensystems, die wir jemals gesehen haben, auch nur entfernt maßstabsgerecht gezeichnet war. Die meisten Schulbuchabbildungen zeigen die Planeten als Nachbarn mit regelmäßigen Abständen – in vielen Bildern werfen die äußeren Riesenplaneten sogar Schatten –, aber das ist nur eine notwendige Verfälschung, damit man sie alle auf einem Blatt Papier unterbringen kann. In Wirklichkeit liegt der Neptun keineswegs kurz hinter dem Jupiter, sondern sehr, sehr weit hinter dem Jupiter – fünfmal weiter, als der Jupiter von uns entfernt ist, und so weit weg, dass er nur drei Prozent des Sonnenlichts abbekommt, das auf den Jupiter fällt.
Die Entfernungen sind sogar so groß, dass es unter praktischen Gesichtspunkten völlig unmöglich ist, das Sonnensystem maßstabsgerecht zu zeichnen. Selbst wenn man in Lehrbücher viele Seiten zum Ausklappen einfügen oder ein wirklich langes Stück Plakatpapier verwenden würde, käme man nicht einmal annähernd zurecht. In einer maßstabsgerechten Schemazeichnung des Sonnensystems, in der die Erde ungefähr den Durchmesser einer Erbse hat, wäre der Jupiter mehr als 300 Meter entfernt, und den Pluto würden wir erst nach zweieinhalb Kilometern finden (außerdem hätte er ungefähr die Größe einer Bakterienzelle, das heißt, man könnte ihn ohnehin nicht sehen). Proxima Centauri, unser nächstgelegener Fixstern, wäre im gleichen Maßstab mehr als 15 000 Kilometer entfernt. Und selbst wenn man alles so weit verkleinert, dass der Jupiter so groß ist wie der Punkt am Ende dieses Satzes und der Pluto nicht größer als ein Molekül, wäre Pluto immer noch mehr als 100 Meter von uns entfernt.
Das Sonnensystem ist also wirklich riesengroß. Wenn wir den Pluto erreichen, sind wir von der Sonne – unserer geliebten, warmen, bräunenden, Leben spendenden Sonne – so weit entfernt, dass sie auf die Größe eines Stecknadelkopfes geschrumpft ist. Eigentlich ist sie dann nur noch ein heller Stern. Angesichts einer derart einsamen Leere versteht man besser, wie selbst die bedeutendsten Objekte – beispielsweise der Pluto-Mond – der Aufmerksamkeit so lange entgehen konnten. Der Pluto steht in dieser Hinsicht sicher nicht allein. Bis zu den Voyager-Missionen glaubte man, Neptun habe zwei Monde; Voyager fand sechs weitere. Als ich klein war, kannte man im Sonnensystem insgesamt 30 Monde. Heute steht diese Zahl bei »mindestens 90«, und ungefähr ein Drittel davon wurde erst in den letzten zehn Jahren entdeckt.[15]
An eines müssen wir dabei natürlich immer denken: Wenn wir das Universum als Ganzes betrachten, wissen wir eigentlich noch nicht einmal, was alles zu unserem eigenen Sonnensystem gehört.
Wenn wir am Pluto vorüberfliegen, bedeutet es nichts anderes, als dass wir den Pluto jetzt hinter uns haben. Denken wir an unseren Reiseplan: Es soll ein Ausflug an den Rand des Sonnensystems werden, und ich fürchte, dort sind wir noch lange nicht angekommen. Pluto mag das letzte Objekt sein, das in den Schulbüchern eingezeichnet ist, aber das System endet dort noch nicht. Das Ende ist noch nicht einmal absehbar. An den Rand des Sonnensystems gelangen wir erst, wenn wir die Oort-Wolke durchquert haben, eine riesige, himmlische Domäne treibender Kometen. Und die Oort-Wolke erreichen wir erst – tut mir leid – nach weiteren 10 000 Jahren.[16] Pluto kennzeichnet also keineswegs den äußeren Rand des Sonnensystems, wie die Schulbücher so schamlos behaupten, sondern er liegt auf einem Fünfzigtausendstel des Weges dorthin.
In Wirklichkeit besteht natürlich keinerlei Aussicht auf eine solche Reise. Schon ein Ausflug von 360 000 Kilometern zum Mond ist für uns ein großes Unternehmen. Die bemannte Marsmission, die der erste Präsident Bush in einem kurzen Augenblick der Unbesonnenheit forderte, ließ man stillschweigend fallen, nachdem jemand ausgerechnet hatte, dass sie 450 Milliarden Dollar kosten würde und wahrscheinlich den Tod aller Besatzungsmitglieder zur Folge hätte[17] (weil energiereiche Teilchen von der Sonne, die sich nicht abschirmen lassen, ihre DNA in Stücke reißen würden).
Auf Grund dessen, was wir heute wissen und uns vernünftigerweise ausmalen können, besteht absolut keine Aussicht, dass Menschen irgendwann einmal – und zwar wirklich irgendwann – den Rand unseres eigenen Sonnensystems besuchen werden. Er ist einfach zu weit weg. Selbst mit dem Hubble-Teleskop können wir nicht in die Oort-Wolke hineinsehen, und deshalb wissen wir nicht einmal, ob sie sich wirklich dort befindet. Dass sie existiert, ist wahrscheinlich, aber es handelt sich um eine reine Hypothese. 2
Über die Oort-Wolke kann man nur eines mit Sicherheit sagen: Sie beginnt irgendwo jenseits des Pluto und erstreckt sich etwa zwei Lichtjahre weit in den Kosmos. Die Grundeinheit für Entfernungen im Sonnensystem ist die astronomische Einheit (astronomical unit oder AU): Sie entspricht der Entfernung von der Sonne zur Erde. Pluto ist ungefähr 40 AU von uns entfernt, zum Mittelpunkt der Oort-Wolke sind es 50 000 AU. Mit einem Satz: Sie ist weit weg.
Aber nehmen wir noch einmal an, wir hätten es bis in die Oort-Wolke geschafft. Als Erstes würde uns wahrscheinlich auffallen, wie friedlich hier draußen alles ist. Wir sind jetzt von allem anderen weit entfernt – so weit von unserer Sonne, dass sie nicht einmal der hellste Stern am Himmel ist. Es ist schon ein bemerkenswerter Gedanke: Dieses winzige, blinzelnde Ding hat so viel Schwerkraft, dass es alle Kometen auf ihren Umlaufbahnen hält. Stark ist die Bindung nicht – die Kometen bewegen sich sehr behäbig mit nur rund 350 Stundenkilometern.[18]