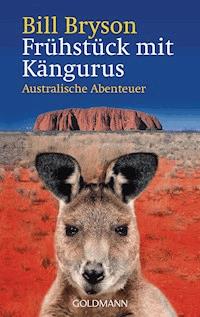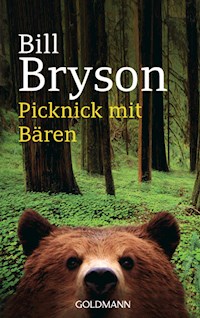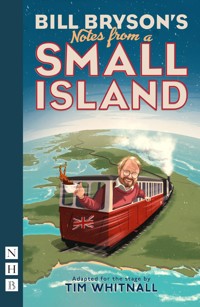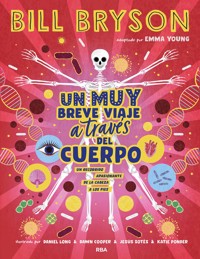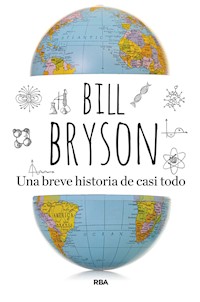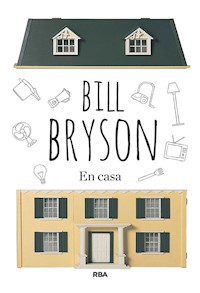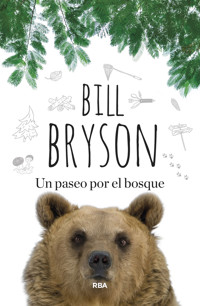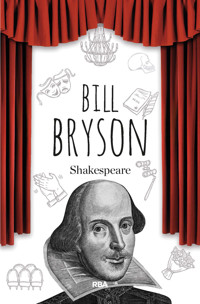15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Planet Mensch - ein Reiseführer
In seinem neuen Buch erzählt Weltbestsellerautor Bill Bryson die grandiose Geschichte des menschlichen Körpers, von der Haarwurzel bis zu den Zehen. Das ganze Leben verbringen wir in unserem Körper, doch die wenigsten haben eine Ahnung davon, wie er funktioniert, welche erstaunlichen Kräfte darin wirken und was tief im Inneren ab- und manchmal auch schiefläuft. »Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers« lädt ein zu einer unvergleichlichen Forschungsreise durch unseren Organismus. Mit ansteckender Entdeckerfreude erzählt Bryson vom Wunder unserer körperlichen und neurologischen Grundausstattung. Alles, was man wissen muss, faszinierend, mitreißend, witzig und leicht verständlich erzählt: ein echter Bryson!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 770
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Das ganze Leben verbringen wir in unserem Körper, doch die wenigsten haben eine Ahnung davon, wie er funktioniert, welche erstaunlichen Kräfte darin wirken und was tief im Inneren ab- und manchmal eben auch schiefläuft. Bill Bryson erzählt die grandiose Geschichte des menschlichen Körpers von der Haarwurzel bis zu den Zehen mit ansteckender Entdeckerfreude!
»Köstlich, lehrreich und höchst unterhaltsam.« THE NEW YORK TIMES
Weitere Informationen zu Bill Bryson finden Sie am Ende des Buches.
BILL BRYSON
EINE KURZE GESCHICHTE DES MENSCHLICHEN KÖRPERS
Aus dem Englischen von Sebastian Vogel
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Body. A Guide For Occupants« bei Doubleday, einem Imprint von Transworld Publishers, London, in der Verlagsgruppe Penguin Random House UK.Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2019 der Originalausgabe by Bill Bryson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Originalverlag: Doubleday
Covergestaltung: UNO Werbeagentur München
Coverabbildung: FinePic®, München
Illustrationen Kapitelaufmacher: Neil Gower
Bildredaktion: Sarah Hopper/Anka Hartenstein
Redaktion: Eckard Schuster
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-11184-7V004
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1Bauanleitung für einen Menschen
Kapitel 2Die Außenseite: Haut und Haare
Kapitel 3Meine Mikroben und ich
Kapitel 4Das Gehirn
Kapitel 5Der Kopf
Kapitel 6Runter damit: Mund und Rachen
Kapitel 7Herz und Blut
Kapitel 8Die chemische Abteilung
Kapitel 9Im Seziersaal: Das Skelett
Kapitel 10Unterwegs: Aufrechter Gang und Bewegung
Kapitel 11Im Gleichgewicht
Kapitel 12Das Immunsystem
Kapitel 13Tief Luft holen: Lunge und Atmung
Kapitel 14Essen, Essen, Essen
Kapitel 15Das Gedärm
Kapitel 16Schlaf
Kapitel 17Jetzt wird’s intim
Kapitel 18Wie es anfängt: Empfängnis und Geburt
Kapitel 19Nerven und Schmerzen
Kapitel 20Wenn etwas schiefgeht: Krankheiten
Kapitel 21Wenn etwas völlig schiefgeht: Krebs
Kapitel 22Gute Medizin, schlechte Medizin
Kapitel 23Das Ende
Dank
Anmerkungen zu den Quellen
Literatur
Bildteil
Personenregister
Sachregister
Autor
Kapitel 1 BAUANLEITUNG FÜR EINEN MENSCHEN
Wie ähnlich einem Gott!
WILLIAM SHAKESPEARE[1]
Vor langer Zeit war ich Schüler an einer amerikanischen Junior High School. Ich weiß noch, wie unser Biologielehrer uns erzählte, dass man alle Chemikalien, die den menschlichen Körper bilden, für fünf Dollar oder so ähnlich in einem Baumarkt kaufen kann. Wie hoch der Betrag genau war, weiß ich nicht mehr. Es hätten auch 2,97 oder 13,50 Dollar sein können, aber es war selbst nach der Kaufkraft der 1960er-Jahre wenig Geld, und ich staunte darüber, dass ein so schwerfälliges, pickliges Etwas wie ich fast nichts kostete.
Es war eine derart krasse, demütigende Erkenntnis, dass sie mich seither all die Jahre begleitet hat. Die Frage lautete: Stimmt das? Sind wir wirklich so wenig wert?
Viele Experten (was möglicherweise »Studienanfänger in den Naturwissenschaften, die am Freitag kein Date haben« bedeutet) haben zu verschiedenen Zeiten und meist nur aus Jux ausgerechnet, wie hoch die Materialkosten für das Zusammenbauen eines Menschen wären. Den vielleicht seriösesten und umfassendsten Versuch der letzten Jahre unternahm die britische Royal Society of Chemistry (RSC) im Rahmen des Cambridge Science Festival 2013: Sie rechnete aus, was es kosten würde, alle Elemente zum Zusammenbauen des Schauspielers Benedict Cumberbatch zu kaufen. (Cumberbatch war in diesem Jahr der Gastdirektor des Festivals und praktischerweise ein durchschnittlich großer Mensch.)
Nach den Berechnungen der RSC braucht man insgesamt 59 chemische Elemente, um einen Menschen zusammenzubauen.1 Sechs davon – Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Calcium und Phosphor – machen zusammen 99,1 Prozent unserer Substanz aus, aber der Rest ist in vielen Fällen ein wenig überraschend. Wer hätte gedacht, dass wir unvollständig sind, wenn sich in uns nicht ein wenig Molybdän befindet oder Vanadium, Mangan, Zinn und Kupfer? An diesen Elementen, das muss man sagen, haben wir nur einen höchst bescheidenen Bedarf, der sich in Millionsteln (parts per million) oder sogar nur Milliardsteln (parts per billion) bemisst. So brauchen wir beispielsweise nur 20 Kobalt- und 30 Chrom-Atome auf jeweils 999.999.999 ½ Atome von allem anderen.2
Den größten Bestandteil jedes Menschen bildet mit 61 Prozent des vorhandenen Volumens der Sauerstoff. Dass wir zu fast zwei Dritteln aus einem geruchlosen Gas bestehen sollen, mag ein wenig der Intuition widersprechen. Schließlich sind wir im Gegensatz zu einem Ballon nicht leicht und elastisch. Das liegt daran, dass der Sauerstoff zum größten Teil an Wasserstoff gebunden ist (der weitere zehn Prozent von uns ausmacht). Das Ergebnis ist Wasser – und jeder, der schon einmal ein Kinderplanschbecken verschieben wollte oder auch nur in nasser Kleidung herumgelaufen ist, weiß: Wasser ist erstaunlich schwer. Es ist ein wenig paradox: Sauerstoff und Wasserstoff, zwei der leichtesten Stoffe in der Natur, bilden im Verbund einen der schwersten. Aber so ist die Natur nun einmal. Sauerstoff und Wasserstoff in uns gehören auch zu den billigeren Elementen. Der ganze Sauerstoff kostet uns nur rund 10,30 Euro und der Wasserstoff ein wenig mehr als 18,50 (vorausgesetzt, der Mensch ist ungefähr so groß wie Benedict Cumberbatch). Der Stickstoff (2,6 Prozent von uns) ist noch preiswerter: nur 31 Cent pro Person. Aber von jetzt an wird es ziemlich teuer.
Wir brauchen knapp 14 Kilo Kohlenstoff, und die kosten nach Angaben der Royal Society of Chemistry ungefähr 51400 Euro. (Bei der RSC verwenden sie alle Substanzen immer nur in hochreiner Form. Aus billigem Zeug würde die Gesellschaft nie einen Menschen herstellen.) Calcium, Phosphor und Kalium werden zwar nur in sehr viel kleineren Mengen gebraucht, aber insgesamt können wir für sie weitere 54500 Euro ansetzen. Der Rest ist je Volumeneinheit noch teurer, aber glücklicherweise sind davon nur mikroskopisch kleine Mengen erforderlich. Thorium kostet fast 2300 Euro pro Gramm, macht aber nur 0,0000001 Prozent von uns aus, also können wir die benötigte Menge für nur 24 Cent kaufen. Das gesamte Zinn in unserem Körper gehört uns für fünf Cent, Zirkonium und Niob kosten jeweils knapp über zwei Cent. Für die 0,000000007 Prozent Samarium eine Rechnung zu schreiben, lohnt sich offensichtlich überhaupt nicht. Es ist in den Unterlagen der RSC mit Kosten von 0,00 Pfund verzeichnet.
Von den 59 Elementen, die in uns vorkommen, werden 24 traditionell als »essentielle« oder »lebenswichtige« Elemente bezeichnet, weil wir ohne sie wirklich nicht auskommen. Die anderen sind ein ziemlicher Mischmasch. Manche sind eindeutig nützlich, manche mögen nützlich sein, aber wir wissen noch nicht genau warum, wieder andere sind weder schädlich noch nützlich, sondern nur zufällig dabei, und wenige sind wirklich schlecht. Cadmium zum Beispiel steht in der Häufigkeit der Elemente in unserem Körper an 23. Stelle: Es macht 0,1 Prozent unserer Masse aus, ist aber hochgiftig. Wir haben es nicht deshalb in uns, weil unser Körper danach verlangt, sondern weil es aus dem Boden in die Pflanzen übergeht, die wir anschließend essen. Wer in Nordamerika wohnt, nimmt in der Regel ungefähr 80 Mikrogramm Cadmium am Tag zu sich, und nichts davon tut irgendwie gut.
Erstaunlich viel von dem, was auf der Ebene der Elemente vorgeht, ist noch Gegenstand der Forschung. Wir können fast jede beliebige Zelle aus unserem Körper entnehmen, und immer wird sie mindestens eine Million Selen-Atome enthalten, aber bis vor kurzer Zeit hatte niemand eine Ahnung, wozu sie gut sind. Heute wissen wir, dass Selen zwei lebenswichtige Enzyme bildet, deren Fehlen mit Bluthochdruck, Arthritis, Anämie, manchen Krebsformen und möglicherweise sogar einer verminderten Spermienzahl in Verbindung gebracht wird.3 Es ist also eindeutig eine gute Idee, ein wenig Selen in sich zu haben (das Element kommt besonders in Nüssen, Vollkornbrot und Fischen vor), aber andererseits kann man die Leber auch unheilbar vergiften, wenn man zu viel davon zu sich nimmt.4 Wie bei so vielen Dingen im Leben ist es auch hier eine heikle Angelegenheit, das richtige Gleichgewicht zu finden.
Insgesamt liegen die Kosten für das Zusammenbauen eines neuen Menschen vom Schlage des hilfsbereiten, als Vorbild dienenden Benedict Cumberbatch nach Angaben der RSC bei genau 96546,79 britischen Pfund – das sind ungefähr 112000 Euro. Arbeitslohn und Mehrwertsteuer würden die Kosten natürlich weiter steigen lassen. Vermutlich hätten wir Glück, wenn wir einen Benedict Cumberbatch zum Mitnehmen für unter 250000 Euro bekämen – unter Berücksichtigung aller Umstände kein riesiges Vermögen, aber eindeutig auch nicht die paar mageren Dollars, von denen mein Lehrer an der Junior High School gesprochen hatte. Gleichwohl stellte die langjährige Wissenschaftsreihe Nova des amerikanischen Fernsehsenders PBS im Jahr 2012 für eine Episode namens »Jagd auf die Elemente« genau die gleiche Analyse an und gelangte dabei auf einen Betrag von 168 Dollar für die Grundbestandteile des menschlichen Körpers.5 Hier stoßen wir auf eine Erkenntnis, die im weiteren Verlauf des vorliegenden Buches unausweichlich werden wird: Wenn es um den Organismus des Menschen geht, sind die Details oft erstaunlich unsicher.
In Wirklichkeit spielt das natürlich kaum eine Rolle. Ganz gleich, was wir bezahlen oder wie sorgfältig wir das Material zusammenstellen, wir werden keinen Menschen erschaffen können. Wir könnten die klügsten Köpfe zusammentrommeln, die heute leben oder jemals gelebt haben, und ihnen das gesamte Wissen der Menschheit zur Verfügung stellen – es hilft nichts: Sie alle gemeinsam könnten keine einzige lebende Zelle herstellen, ganz zu schweigen von einem kopierten Benedict Cumberbatch.
Das ist zweifellos der erstaunlichste Aspekt an uns: Wir sind nur eine Sammlung unbelebter Bestandteile; die gleichen Substanzen würden wir auch in einem Abfallhaufen finden. Ich habe es bereits in einem anderen Buch gesagt, aber nach meiner Überzeugung lohnt es sich, noch einmal darauf zurückzukommen: An den Elementen, aus denen wir bestehen, ist nichts Besonderes, außer dass wir daraus bestehen. Das ist das Wunder des Lebendigen.
In diesem warmen Fleischklumpen existieren wir also und halten das fast immer für etwas Selbstverständliches. Wie viele unter uns wissen auch nur ungefähr, wo die Milz liegt oder was sie tut? Wer kennt den Unterschied zwischen Sehnen und Bändern? Wer weiß, wozu die Lymphknoten da sind? Was glauben Sie, wie viele Male am Tag Sie mit den Augen zwinkern? Fünfhundertmal? Tausendmal? Natürlich, Sie haben keine Ahnung. Nun, Sie blinzeln ungefähr 14000-mal am Tag – so oft, dass Sie die Augen jeden Tag 23 Minuten geschlossen haben, obwohl Sie wach sind.6 Und doch müssen Sie nie darüber nachdenken, denn in jeder Sekunde jedes Tages erfüllt Ihr Körper buchstäblich unzählige Aufgaben – eine Billiarde, eine Nonillion, eine Quindecillion, eine Vigintillion (das sind die tatsächlichen Zahlen); in jedem Fall ist es eine Zahl, die unser Vorstellungsvermögen bei Weitem übersteigt – und alles geschieht, ohne dass wir auch nur einen Augenblick lang unsere Aufmerksamkeit darauf richten müssten.
In der einen Sekunde, seit Sie begonnen haben, diesen Satz zu lesen, hat Ihr Körper eine Million rote Blutzellen produziert. Sie strömen bereits in Ihnen herum, kreuzen durch Ihre Blutgefäße, halten Sie am Leben. Jede dieser roten Blutzellen wird ungefähr 150000-mal die Runde durch Sie machen; immer wieder wird sie Sauerstoff an Ihre Zellen liefern, und dann, wenn sie verschlissen und nutzlos ist, wird sie sich anderen Zellen darbieten, die sie zum Wohl des großen Ganzen in aller Stille töten.
Insgesamt sind 7 Milliarden Milliarden Milliarden (7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 oder 7 Quadrilliarden) Atome notwendig, um einen Menschen aufzubauen. Warum diese 7 Milliarden Milliarden Milliarden einen so dringenden Wunsch haben, ein Mensch zu sein, weiß niemand. Schließlich sind es geistlose Teilchen, die weder einen einzigen Gedanken noch eine Vorstellung von irgendetwas haben. Und doch sorgen sie über die gesamte Dauer unseres Daseins hinweg für Aufbau und Instandhaltung all der unzähligen Systeme, die notwendig sind, damit Sie funktionieren, damit Sie Sie sind; sie bilden die Strukturen, die Ihnen Form und Gestalt geben und es Ihnen gestatten, den seltenen, ungeheuer angenehmen Zustand zu genießen, den wir Leben nennen.
Das ist eine viel größere Leistung, als uns klar ist. Ausgepackt sind Sie riesig. Ihre Lunge würde ausgebreitet einen Tennisplatz bedecken, und die Luftwege darin würden sich von London bis nach Moskau erstrecken. Ihre Blutgefäße würden hintereinandergelegt zweieinhalbmal um die Erde reichen.7 Aber der bemerkenswerteste Teil von allen ist Ihre DNA. Ein Meter davon ist in jeder Ihrer Zellen verpackt, und da Sie aus so vielen Zellen bestehen, würde die DNA in Ihrem Körper als einzelner feiner Faden 16 Milliarden Kilometer weit reichen, bis jenseits des Pluto.8 Das muss man sich einmal vorstellen: Von Ihnen gibt es so viel, dass es über das Sonnensystem hinausreicht. Sie sind ganz buchstäblich kosmisch.
Doch Ihre Atome sind nur Bausteine und als solche nicht lebendig. Wo das Leben im Einzelnen beginnt, lässt sich nicht so genau sagen. Die Grundeinheit des Lebendigen ist die Zelle – darüber sind sich alle einig. In der Zelle wimmelt es von allen möglichen Dingen – Ribosomen und Proteinen, DNA, RNA, Mitochondrien und vielen anderen mikroskopisch kleinen Wunderwerken –, aber keines davon ist als solches lebendig. Die Zelle selbst ist nur ein Abteil, eine Art kleines Zimmer, eben eine Zelle: Sie enthält das alles und ist selbst ebenso wenig lebendig wie jedes andere Zimmer. Aber wenn alle diese Dinge zusammenkommen, haben wir irgendwie Leben. Das ist der Teil, den die Wissenschaft nicht zu fassen bekommt. Ich hoffe, es wird immer so bleiben.
Am bemerkenswertesten ist vielleicht, dass nichts das Sagen hat. Jeder Zellbestandteil spricht auf Signale anderer Bestandteile an, alle stoßen und puffen sich wie Autoscooter, und doch führen die ganzen Zufallsbewegungen zu einer reibungslosen, koordinierten Tätigkeit, und das nicht nur in der Zelle, sondern im ganzen Körper, denn die Zellen kommunizieren mit anderen Zellen in den unterschiedlichen Teilen Ihres persönlichen Kosmos.
Das Herzstück der Zelle ist der Zellkern. Er enthält die DNA – und die ist, wie wir bereits festgestellt haben, ungefähr einen Meter lang und liegt zusammengedrängt in einem Raum, den wir mit Fug und Recht als winzig klein bezeichnen können. Dass so viel DNA in einen Zellkern passt, liegt daran, dass sie ungeheuer dünn ist. 20 Milliarden DNA-Fäden müsste man nebeneinander legen, um die Breite des dünnsten menschlichen Haares zu erreichen.9 Jede Zelle in unserem Körper (genauer gesagt: jede Zelle mit einem Zellkern) enthält zwei Kopien unserer DNA. Deshalb haben wir insgesamt genug davon, um die Strecke bis zum Pluto und darüber hinaus abzudecken.
Die DNA existiert nur zu einem einzigen Zweck: um neue DNA zu erzeugen. Ihre DNA ist einfach eine Gebrauchsanweisung, nach der Sie hergestellt werden. Ein DNA-Molekül – daran werden Sie sich mit ziemlicher Sicherheit aufgrund unzähliger Fernsehsendungen und vielleicht auch aus dem Biologieunterricht erinnern – besteht aus zwei Strängen, die durch Sprossen verbunden sind und die berühmte, unter dem Namen Doppelhelix bekannte verdrehte Leiter bilden. Sie ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die man Chromosomen nennt, und die wiederum enthalten kürzere Einheiten, die Gene. Die Gesamtheit all unserer Gene ist das Genom.
Die DNA ist äußerst stabil. Sie kann Zehntausende von Jahren überdauern. Mit ihrer Hilfe können Wissenschaftler heute die Menschheitsgeschichte in der sehr fernen Vergangenheit erforschen. Vermutlich wird nichts von dem, was Sie heute besitzen – kein Brief, kein Schmuck, kein hochgeschätztes Familienerbstück – in einigen tausend Jahren noch existieren, aber Ihre DNA wird mit ziemlicher Sicherheit noch da sein und sich wiederentdecken lassen, falls jemand sich die Mühe macht, danach zu suchen. Die DNA gibt Information mit außergewöhnlicher Originaltreue weiter. Sie macht ungefähr nur einen Fehler unter einer Milliarde kopierter Buchstaben. Und doch summiert sich das auf ungefähr drei Fehler oder Mutationen je Zellteilung. Die meisten derartigen Veränderungen kann der Organismus ignorieren, doch gelegentlich haben sie auch eine dauerhafte Bedeutung. Das ist Evolution.
Alle Bestandteile des Genoms haben nur einen einzigen Zweck: Sie sollen die Abstammungslinie unseres Daseins weiterführen. Der Gedanke macht ein wenig demütig: Die Gene, die wir in uns tragen, sind uralt und möglicherweise – jedenfalls bisher – unsterblich. Wir selbst werden sterben und dahinschwinden, aber unsere Gene werden immer weiterleben, solange wir und unsere Nachkommen weiterhin Nachwuchs hervorbringen. Und es ist in der Tat erstaunlich, wenn man bedenkt, dass unsere persönliche Abstammungslinie in den drei Milliarden Jahren, seit es das Leben gibt, kein einziges Mal unterbrochen war. Damit wir heute hier sein können, musste jeder unserer Vorfahren sein genetisches Material an eine neue Generation weitergeben, bevor er dahingerafft oder auf andere Weise aus dem Fortpflanzungsprozess ausgeschlossen wurde. Eine ganz schöne Erfolgsgeschichte.
Im Einzelnen besteht die Tätigkeit der Gene darin, Anweisungen für den Aufbau von Proteinen zu liefern. Die meisten nützlichen Bestandteile in unserem Organismus sind Proteine. Manche beschleunigen chemische Veränderungen – dann nennt man sie Enzyme. Andere übermitteln chemische Nachrichten und heißen Hormone. Wieder andere greifen Krankheitserreger an und werden als Antikörper bezeichnet. Das größte unserer Proteine, das Titin, trägt zur Steuerung der Muskelelastizität bei. Sein chemischer Name hat 189819 Buchstaben; damit wäre es das längste Wort der englischen Sprache, nur werden chemische Namen von den Wörterbüchern nicht verzeichnet.10 Wie viele verschiedene Proteintypen es in uns gibt, weiß niemand genau; die Schätzungen reichen von einigen hunderttausend bis zu einer Million oder mehr.11
Es ist das große Paradox der Genetik, dass wir alle sehr unterschiedlich und gleichzeitig genetisch praktisch identisch sind. Alle Menschen haben 99,9 Prozent ihrer DNA gemeinsam, und doch sind zwei Menschen niemals gleich.12 Meine DNA und Ihre DNA unterscheiden sich an drei bis vier Millionen Stellen – das ist nur ein kleiner Anteil der Gesamtzahl, doch es reicht für eine Fülle von Unterschieden zwischen uns.13 Auch Sie selbst haben ungefähr 100 persönliche Mutationen in sich,14 Abschnitte mit genetischen Anweisungen, die nicht ganz genau mit irgendeinem der von Ihren Eltern ererbten Gene übereinstimmen; diese Gene gehören nur Ihnen allein.
Wie das alles im Einzelnen funktioniert, ist in großen Teilen immer noch ein Rätsel. Nur zwei Prozent des menschlichen Genoms codieren Proteine, das heißt, nur zwei Prozent bewirken irgendetwas, was nachweislich und eindeutig einem praktischen Zweck dient. Was der Rest macht, ist nicht bekannt. Ein großer Teil davon, so scheint es, ist einfach nur da wie Sommersprossen. Manches hat überhaupt keinen Sinn. Eine besonders kurze Sequenz, Alu-Element genannt, wiederholt sich im Genom mehr als eine Million Mal, manchmal auch inmitten wichtiger proteincodierender Gene.15 Solche DNA-Abschnitte sind nach allem, was wir heute wissen, völliges Kauderwelsch, und doch machen sie zehn Prozent unseres gesamten genetischen Materials aus. Eine Zeit lang bezeichnete man diesen rätselhaften Teil als »DNA-Schrott«, heute wird er eleganter »dunkle DNA« genannt, das heißt, wir wissen nicht, was er tut, oder warum es ihn gibt. Ein Teil davon ist an der Steuerung der Gene beteiligt, aber wozu der Rest dient, ist weitgehend unbekannt.
Unser Körper wird häufig mit einer Maschine verglichen, aber in Wirklichkeit ist er viel mehr. Er arbeitet jahrzehntelang 24 Stunden am Tag, und dabei benötigt er (jedenfalls meistens) weder eine regelmäßige Wartung noch Ersatzteile; er läuft mit Wasser und wenigen organischen Verbindungen, ist weich und ziemlich hübsch, angenehm beweglich und flexibel, pflanzt sich mit Begeisterung fort, macht Witze, spürt Zuneigung, weiß einen roten Sonnenuntergang und eine kühlende Brise zu schätzen. Wie viele Maschinen, die Sie kennen, können auch nur eines davon? Da gibt es keine Frage: Der Mensch ist wirklich ein Wunder. Aber man muss sagen: Das ist ein Regenwurm auch.
Und wie feiern wir unser prächtiges Dasein? Nun, die meisten von uns tun es, indem sie sich möglichst wenig bewegen und möglichst viel essen. Denken wir nur an den ganzen Müll, den wir uns in den Rachen werfen, und daran, welch großen Teil unseres Lebens wir hingelümmelt und in einem beinahe vegetativen Zustand vor einem flimmernden Bildschirm verbringen. Aber auf eine freundliche und irgendwie wundersame Weise kümmert sich unser Körper um uns, gewinnt Nährstoffe aus dem Mischmasch an Lebensmitteln, die wir uns in den Mund stecken, und hält uns irgendwie jahrzehntelang und im Allgemeinen auf einem ziemlich hohen Niveau zusammen. Mit der Lebensweise Selbstmord zu begehen, dauert Jahrzehnte.
Selbst wenn wir fast alles falsch machen, bleibt unser Organismus intakt und hält uns aufrecht. Davon zeugen die meisten Menschen auf die eine oder andere Weise. Fünf von sechs Rauchern bekommen keinen Lungenkrebs.16 Die meisten Menschen, die Musterkandidaten für einen Herzinfarkt wären, bekommen keinen Herzinfarkt. Jeden Tag, so eine Schätzung, werden zwischen einer und fünf von unseren Zellen krebsartig, aber das Immunsystem fängt sie ein und tötet sie ab.17 Daran sollte man immer denken. Mehrere Dutzend Male in der Woche, weit über tausendmal im Jahr bekommt jeder von uns die am meisten gefürchtete Krankheit unserer Zeit, und jedes Mal rettet uns unser Organismus. Selbstverständlich entwickelt sich ein Krebs gelegentlich zu einer etwas ernsthafteren Angelegenheit und wirkt möglicherweise tödlich, doch insgesamt sind Krebserkrankungen selten: Die meisten Zellen in unserem Körper verdoppeln sich Milliarden und Abermilliarden Male, ohne dass etwas schiefgeht. Krebs mag eine häufige Todesursache sein, aber ein häufiges Ereignis im Leben ist er nicht.
Unser Organismus ist ein Universum aus 37,2 Billionen[2] Zellen, die mehr oder weniger perfekt koordiniert mehr oder weniger ständig zusammenwirken.18 Schmerzen, ein verdorbener Magen, hin und wieder ein blauer Fleck oder ein Pickel – das ist nahezu alles, womit sich unsere Unvollkommenheit unter normalen Umständen bemerkbar macht. Tausende von Ursachen können uns umbringen19 – nach der von der Weltgesundheitsorganisation zusammengestellten »Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme« (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD) sind es etwas mehr als 8000 –, und ihnen allen mit Ausnahme von einer entgehen wir. Für die meisten Menschen ist das kein schlechtes Geschäft.
Wir sind alles andere als perfekt, weiß Gott. Unsere Weisheitszähne brechen verspätet oder gar nicht durch, weil unsere Kieferknochen in der Evolution so klein geworden sind, dass sie nicht alle Zähne aufnehmen können, mit denen wir ausgestattet sind, und unser Becken ist so klein, dass Kinder nur unter entsetzlichen Schmerzen hindurchgleiten können. Wir sind hoffnungslos anfällig für Rückenschmerzen. Unsere Organe können sich zum größten Teil nicht selbst reparieren. Wenn das Herz eines Zebrafisches geschädigt ist, wächst neues Gewebe nach. Wenn unser Herz Schaden nimmt – hm, Pech gehabt. Fast alle Tiere produzieren ihr eigenes Vitamin C, nur wir sind dazu nicht in der Lage. Der Entstehungsprozess läuft zwar auch in uns in allen Teilen ab, nur fehlt unerklärlicherweise der letzte Schritt, die Produktion eines einzigen Enzyms.20
Das Wunder des menschlichen Lebens besteht nicht darin, dass wir ein paar Schwächen haben, sondern dass wir durch sie nicht untergehen. Vergessen wir nicht, dass unsere Gene von Vorfahren stammen, die während der meisten Zeit nicht einmal Menschen waren. Manche von ihnen waren Fische. Viele andere waren winzige, pelzige Tiere und lebten in unterirdischen Bauten. Das sind die Lebewesen, von denen wir unseren Körperbauplan geerbt haben. Wir sind das Produkt einer Evolution, die drei Milliarden Jahre lang herumgedoktert hat. Es würde uns allen viel besser gehen, wenn wir einfach von vorn anfangen und uns mit einem Körper ausstatten könnten, der speziell für unsere Bedürfnisse als Homo sapiens gebaut ist – dann könnten wir aufrecht gehen, ohne Knie und Rücken kaputt zu machen, wir könnten schlucken, ohne Gefahr zu laufen, uns zu verschlucken, und wir könnten Babys zur Welt bringen, als kämen sie aus einem Verkaufsautomaten. Aber dafür sind wir nicht gebaut. Unseren Weg durch die Geschichte haben wir als einzellige Klumpen angetreten, die in warmen, seichten Meeren schwammen. Seither war alles ein langer, interessanter Zufall, aber auch ein ziemlich prachtvoller – das, so hoffe ich, wird auf den nachfolgenden Seiten deutlich werden.
[1] Hamlet II, 2; Übers. v. A. W. Schlegel
[2] Diese Angabe ist natürlich eine begründete Vermutung. Die Zellen des Menschen unterscheiden sich in Typ, Größe und Dichte stark, und man kann sie buchstäblich nicht zählen. Zu der Zahl von 37,2 Billionen gelangte ein europäisches Wissenschaftlerteam unter Leitung von Eva Bianconi von der Universität im italienischen Bologna im Jahr 2013; berichtet wurde darüber in den Annals of Human Biology.
Kapitel 2 DIE AUSSENSEITE: HAUT UND HAARE
Schönheit ist nur so tief wie die Haut, aber das Hässliche geht bis auf die Knochen.
Dorothy Parker
I
Auch wenn es ein wenig überraschend klingt: Die Haut ist unser größtes Organ und möglicherweise auch das vielseitigste. Sie hält unser Inneres zusammen und schlechte Dinge fern. Sie polstert Schläge ab. Sie gibt uns den Berührungssinn, bringt uns Lust und Wärme und Schmerzen und auch nahezu alles andere, was uns lebendig macht. Sie produziert Melanin und schützt uns so vor der Sonnenstrahlung. Sie repariert sich selbst, wenn wir sie misshandeln. Sie ist für alle Schönheit verantwortlich, zu der wir imstande sind. Sie sorgt für uns.
Die Haut hat eine Größe von ungefähr zwei Quadratmetern und wiegt alles in allem ungefähr zwischen viereinhalb und sieben Kilo, aber das hängt naturgemäß auch davon ab, wie groß jemand ist und wieviel Po und Bauch sie abdecken muss. Am dünnsten (nur ein vierzigstel Millimeter) ist sie an den Augenlidern, am dicksten an den Hand- und Fußballen. Im Gegensatz zu Herz oder Nieren versagt die Haut nie. »Unsere Nähte platzen nicht, und wir bekommen nicht von selbst plötzlich Löcher«, sagt Nina Jablonski, Professorin für Anthropologie an der Pennsylvania State University und maßgebliche Expertin für alles, was mit der Haut zu tun hat.1
Die Haut besteht aus einer Innenschicht, auch Dermis oder Lederhaut genannt, und der darüber liegenden Epidermis. Die äußere Oberfläche der Epidermis, die Hornschicht oder Stratum corneum, besteht ausschließlich aus abgestorbenen Zellen. Es ist ein faszinierender Gedanke: Alles, was uns schön macht, ist tot. Wo Körper und Luft zusammentreffen, ist jeder von uns eine Leiche. Diese äußeren Zellen werden jeden Monat ersetzt. Wir schaben ständig Haut ab, und das, fast ohne es zu merken:2 In jeder Minute sind es rund 25000 Schuppen, mehr als eine Million in der Stunde. Wir brauchen nur einmal mit dem Finger über ein staubiges Regalbrett zu fahren, und schon ziehen wir zu einem großen Teil eine Schneise durch unser früheres Ich. In aller Stille und unerbittlich verwandeln wir uns in Staub.
Jeder von uns hinterlässt pro Jahr rund ein halbes Kilo Hautschuppenstaub.3 Wenn man den Inhalt eines Staubsaugerbeutels verbrennt, bemerkt man vor allem jenen unverkennbaren Geruch, den wir mit brennenden, versengten Haaren in Verbindung bringen. Haut und Haare bestehen nämlich im Wesentlichen aus dem gleichen Material: aus Keratin.
Unter der Epidermis liegt die Dermis. Sie ist fruchtbarer: Hier sind alle aktiven Anteile der Haut angesiedelt: Blut- und Lymphgefäße, Nervenfasern, die Wurzeln der Haarfollikel, der ganze Vorrat an Drüsen für Schweiß und Talg. Noch tiefer finden wir das Unterhautfettgewebe (Subcutis) vor. Genau genommen gehört es nicht zur Haut, aber es ist ein wichtiger Körperteil, denn es speichert Energie, sorgt für Isolation und verbindet die Haut mit dem darunter liegenden Körper.
Wie viele Löcher unsere Haut hat, weiß niemand genau, aber wir sind ziemlich gründlich perforiert. Die meisten Schätzungen legen die Vermutung nahe, dass wir Haarfollikel irgendwo in der Größenordnung von zwei bis fünf Millionen und vielleicht doppelt so viele Schweißdrüsen besitzen. Die Haarfollikel haben eine doppelte Funktion: Sie lassen die Haare wachsen und geben Talg ab (der aus den Talgdrüsen stammt); dieser vermischt sich mit dem Schweiß und bildet auf der Oberfläche eine fettige Schicht. So trägt er dazu bei, dass die Haut flexibel bleibt und für viele fremde Organismen unbewohnbar wird. Manchmal werden die Poren von kleinen Pfropfen aus abgestorbener Haut und getrocknetem Talg verstopft – dann entsteht ein Mitesser. Wenn der Follikel sich dann zusätzlich infiziert und entzündet, ist das Ergebnis der bei Jugendlichen gefürchtete Pickel. Junge Menschen werden einfach deshalb von Pickeln heimgesucht, weil ihre Talgdrüsen – wie alle Drüsen – besonders aktiv sind. Wird der Zustand chronisch, sprechen wir von Akne. Woher das Wort stammt, ist nicht gesichert:4 Möglicherweise ist es mit dem griechischen acme verwandt, der Bezeichnung für eine große, bewundernswerte Leistung, aber das passt eigentlich nicht zu einem Gesicht voller Pickel. Wie die beiden Wörter zueinander in Verbindung stehen, ist nicht geklärt. Auf Englisch taucht das Wort erstmals 1743 in einem britischen Medizinwörterbuch auf.
Darüber hinaus drängen sich in der Dermis auch die verschiedensten Rezeptoren, die uns im wahrsten Sinne des Wortes mit der Welt in Kontakt bringen. Wenn eine leichte Brise unsere Wangen umspielt, setzen uns unsere Meissner-Körperchen[3] darüber in Kenntnis. Legen wir die Hand auf eine heiße Herdplatte, schreien die Ruffini-Körperchen auf. Merkel-Zellen sprechen auf konstanten Druck an, Vater-Pacini-Körperchen auf Vibrationen.
Jedermanns Liebling sind die Meissner-Körperchen. Sie nehmen leichte Berührungen wahr und sind insbesondere in unseren erogenen Zonen und anderen Regionen mit erhöhter Empfindlichkeit sehr zahlreich:5 an Fingerspitzen, Lippen, Zunge, Klitoris, Penis und so weiter. Benannt sind sie nach dem deutschen Anatomen Georg Meissner, dem das Verdienst zugeschrieben wird, sie 1852 entdeckt zu haben. Sein Kollege Rudolf Wagner behauptete allerdings, in Wirklichkeit sei er der Entdecker. Die beiden entzweiten sich über das Thema, womit bewiesen wäre, dass auch in der Wissenschaft kein Detail zu klein für Animositäten ist.
Alle diese Rezeptoren sind überaus fein darauf abgestimmt, uns die Welt spüren zu lassen. Vater-Pacini-Körperchen nehmen schon eine Bewegung von 0,00001 Millimeter wahr, also eine Bewegung, die eigentlich keine ist. Darüber hinaus müssen sie mit dem Material, das sie interpretieren, noch nicht einmal in Berührung kommen. Darauf machte David A. Linden in der Fachzeitschrift Touch aufmerksam: Wenn man einen Spaten in Kies oder Sand stößt, spürt man den Unterschied zwischen den beiden Materialien, obwohl man nichts außer dem Spaten berührt.6 Seltsamerweise haben wir keine Rezeptoren für Nässe.7 Als Leitfaden dienen uns vielmehr die Wärmesensoren. Wenn wir uns auf eine feuchte Stelle setzen, können wir deshalb in der Regel nicht unterscheiden, ob sie wirklich nass oder nur kalt ist.
Was die taktile Empfindsamkeit an den Fingern angeht, sind Frauen viel besser als Männer, aber das liegt möglicherweise nur daran, dass sie kleinere Hände und damit ein dichteres Netzwerk von Sensoren haben.8 Interessant ist am Tastsinn, dass das Gehirn uns nicht nur sagt, wie sich etwas anfühlt, sondern auch, wie es sich anfühlen sollte. Das ist der Grund, warum die Liebkosung einer geliebten Person sich großartig anfühlt, während die gleiche Berührung von einem Fremden uns gruselig oder entsetzlich vorkommt. Und es ist auch der Grund, warum es so schwierig ist, sich selbst zu kitzeln.
Eines der denkwürdigsten und unerwartetsten Ereignisse, die ich während der Vorbereitungen zu diesem Buch erlebte, spielte sich in einem Seziersaal an der medizinischen Fakultät der University of Nottingham ab: Der Chirurg und Professor Ben Ollivere (dem wir zu gegebener Zeit wieder begegnen werden) nahm am Arm einer Leiche einen zarten Einschnitt vor und schälte eine rund einen Millimeter dicke Hautschicht ab. Sie war so dünn, dass das Licht hindurchfiel. »Das«, sagte er, »ist der Ort, an dem sich die gesamte Hautfarbe befindet. Das ist alles, was die Rasse ausmacht – eine dünne Schicht der Epidermis.«
Wenig später erwähnte ich mein Erlebnis gegenüber Nina Jablonski, als wir uns in ihrem Büro im State College in Pennsylvania trafen. Sie reagierte mit einem energisch zustimmenden Nicken. »Es ist schon ungewöhnlich, dass einem so geringfügigen Aspekt unseres Körperbaues so große Bedeutung beigemessen wird«, sagte sie. »Die Leute benehmen sich, als würde die Hautfarbe über den Charakter bestimmen, obwohl sie doch in Wirklichkeit nur eine Reaktion auf das Sonnenlicht ist. Biologisch betrachtet gibt es so etwas wie Rassen nicht – nichts im Hinblick auf Hautfarbe, Gesichtsmerkmale, Haartypus, Knochenbau oder irgendetwas anderes, was zwischen den einzelnen Völkern eine definierende Eigenschaft darstellt. Aber schauen Sie nur, wie viele Menschen im Laufe der Geschichte wegen ihrer Hautfarbe versklavt, gehasst, gelyncht oder grundlegender Rechte beraubt wurden.«
Jablonski ist eine große, elegante Frau mit kurz geschnittenen silbernen Haaren. Sie arbeitet heute in einem sehr aufgeräumten Büro in der vierten Etage des Gebäudes für Anthropologie auf dem Campus der Pennsylvania State University, aber ihr Interesse an der Haut erwachte schon vor fast dreißig Jahren. Damals war sie eine junge Primatenforscherin und Paläobiologin an der University of Western Australia in Perth. Als sie einen Vortrag über die Unterschiede zwischen der Hautfarbe von Primaten und von Menschen vorbereitete, wurde ihr klar, dass man über das Thema erstaunlich wenig wusste, und ließ sich auf etwas ein, was ihr zur lebenslangen Forschungstätigkeit werden sollte. »Was als kleines, recht harmloses Projekt begann, nahm am Ende einen großen Teil meines Berufslebens in Anspruch«, sagt sie. Im Jahr 2006 erschien ihr hoch angesehenes Buch Skin: A Natural History, und sechs Jahre später folgte Living Color: The Biological and Social Meaning of Skin Color.
Wie sich herausstellte, ist die Frage nach der Hautfarbe wissenschaftlich komplizierter, als irgendjemand es sich ausgemalt hatte. »Bei Säugetieren sind an der Pigmentierung mehr als 120 Gene beteiligt«, sagt Jablonski, »und die alle zu entwirren ist wirklich schwierig.« Eines können wir allerdings sagen: Die Haut erhält ihre Farbe durch verschiedene Pigmente, aber das weitaus wichtigste davon ist eine Substanz, die offiziell Eumelanin heißt, allgemein aber einfach als Melanin bekannt ist.9 Melanin ist eines der ältesten Moleküle in der Biologie und findet sich in der gesamten Welt des Lebendigen. Es färbt nicht nur die Haut, sondern verleiht auch Vögeln die Farbe ihres Gefieders, Fischen die Oberflächenbeschaffenheit und das Glitzern ihrer Schuppen, Tintenfischen das Schwarzviolett ihrer Tinte. Es wirkt sogar mit, wenn Früchte braun werden. Bei uns Menschen färbt es auch die Haare. Seine Produktion verlangsamt sich mit fortschreitendem Alter beträchtlich, und das ist der Grund, warum ältere Menschen in der Regel graue Haare bekommen.10
»Melanin ist ein hervorragendes natürliches Sonnenschutzmittel«, sagt Jablonski.11 »Die Zellen, in denen es produziert wird, heißen Melanozyten. Jeder Mensch besitzt unabhängig von der Rasse die gleiche Anzahl von ihnen. Der Unterschied liegt nur in der Menge des produzierten Melanins.« Melanin reagiert auf Sonnenlicht häufig ganz ungleichmäßig; das Ergebnis sind Sommersprossen, mit dem Fachbegriff Epheliden genannt.12
Die Hautfarbe ist ein klassisches Beispiel für konvergente Evolution, wie dies genannt wird: An zwei oder mehreren Orten haben sich während der Evolution ähnliche Eigenschaften entwickelt. Dass beispielsweise die Menschen in Sri Lanka und in Polynesien hellbraune Haut haben, liegt nicht an einer unmittelbaren genetischen Verbindung; vielmehr hat ihre Evolution sie unabhängig voneinander in die Lage versetzt, mit ihren Lebensbedingungen zurechtzukommen. Früher glaubte man, der Pigmentverlust sei vielleicht vor 10000 oder 20000 Jahren eingetreten, aber dank der Genomforschung wissen wir heute, dass er sich viel schneller abspielen kann – vielleicht in nur zwei- oder dreitausend Jahren. Außerdem wissen wir, dass er sich mehrfach ereignet hat. Helle Haut – oder »depigmentierte Haut«, wie Jablonski sie nennt – hat sich in der Evolution mindestens dreimal entwickelt. Das hübsche Farbenspektrum, das Menschen vorzuweisen haben, ist stetiger Veränderung unterworfen. Oder, wie Jablonski es formuliert: »Wir stecken mitten in einem neuen Experiment der menschlichen Evolution.«
Man hat die Vermutung geäußert, die helle Haut könne durch die Wanderungsbewegungen der Menschen und den Aufstieg der Landwirtschaft entstanden sein. Dahinter steht die Überlegung, dass Jäger und Sammler einen großen Teil ihres Vitamin D aus Fischen und Wildfleisch bezogen und diese Zufuhr stark zurückging, als die Menschen anfingen, Nutzpflanzen anzubauen, insbesondere als sie dann noch in nördlichere Breiten einwanderten. Damit wurde die helle Haut zu einem großen Vorteil, ermöglichte sie doch die Synthese von mehr Vitamin D.
Vitamin D ist für die Gesundheit unentbehrlich. Es trägt zum Aufbau kräftiger Knochen und Zähne bei, stärkt das Immunsystem, bekämpft Krebs und unterstützt das Herz. Es ist eine durch und durch gute Substanz. Wir können es auf zwei Wegen aufnehmen: aus der Nahrung oder durch das Sonnenlicht. Dabei stellt sich nur das Problem, dass eine zu starke Einwirkung der UV-Strahlen im Sonnenlicht die DNA in unseren Zellen schädigt und Hautkrebs verursachen kann. Die richtige Menge aufzunehmen ist ein heikler Balanceakt. Die Menschen haben sich der Herausforderung gestellt, indem sich während ihrer Evolution eine ganze Bandbreite von Tönungen der Haut entwickelte, die zur Intensität der Sonnenstrahlung in unterschiedlichen Breitengraden passen. Der Prozess, durch den ein menschlicher Organismus sich auf veränderte Umstände einstellt, wird als phänotypische Plastizität bezeichnet. Unsere Hautfarbe ändert sich ständig – beispielsweise wenn wir uns im strahlenden Sonnenschein bräunen oder verbrennen, oder wenn wir aus Scham erröten. Dass wir bei Sonnenbrand rot werden, liegt an den winzigen Blutgefäßen in den betroffenen Bereichen: Sie füllen sich übermäßig mit Blut, sodass die Haut sich bei Berührung heiß anfühlt.13 Der fachsprachliche Name für Sonnenbrand lautet Erythem.14 Bei schwangeren Frauen werden häufig die Brustwarzen und ihre Höfe dunkler, manchmal auch andere Körperteile wie Bauch und Gesicht. Die Ursache ist auch hier eine verstärkte Melaninproduktion. Der Prozess wird als Melasma oder Hyperpigmentierung bezeichnet, aber welchem Zweck er dient, weiß man nicht.15 Dass wir rot werden, wenn wir wütend sind, widerspricht ein wenig der Intuition. Wenn der Organismus sich auf einen Kampf einstellt, wird das Blut vorwiegend in die Bereiche gelenkt, wo es wirklich gebraucht wird: in die Muskeln. Warum dennoch viel Blut ins Gesicht fließt, wo es keinen erkennbaren physiologischen Nutzen hat, bleibt ein Rätsel. Jablonski hat die Vermutung geäußert, das könne in irgendeiner Weise zur Regulation des Blutdrucks beitragen. Vielleicht ist es auch einfach ein Signal, dass ein Gegner sich zurückziehen soll, weil man wirklich wütend ist.
Jedenfalls erfüllte die langsame Evolution der verschiedenen Hautfärbungen ihren Zweck, solange die Menschen an einem Ort blieben oder nur langsam wanderten. Heute jedoch hat sich die Mobilität verstärkt, und deshalb leben viele Menschen an Orten, an denen Sonneneinstrahlung und Hautfärbung nicht zueinanderpassen. In Regionen wie Nordeuropa und Kanada kann man in den Wintermonaten aus dem schwachen Sonnenlicht nicht so viel Vitamin D gewinnen, dass die Gesundheit erhalten bleibt, ganz gleich, wie hell die Haut der Menschen ist; das Vitamin D muss also mit der Nahrung aufgenommen werden, und das tut kaum ein Mensch in ausreichender Menge – was auch nicht verwunderlich ist. Um den Bedarf allein mit der Nahrung zu decken, müsste man jeden Tag 15 Eier oder fast drei Kilo Schweizer Käse essen oder – was plausibler, aber nicht schmackhafter ist – einen halben Esslöffel Lebertran schlucken. In Amerika wird Milch mit Vitamin D angereichert; das ist zwar nützlich, aber auch damit wird der Bedarf eines Erwachsenen nur zu einem Drittel gedeckt. Deshalb leiden Schätzungen zufolge weltweit etwa 50 Prozent der Menschen zumindest während eines Teils des Jahres an Vitamin-D-Mangel.16 In den nördlichen Klimazonen dürfte der Anteil bei bis zu 90 Prozent liegen.
Als die Haut der Menschen im Laufe der Evolution immer heller wurde, entwickelten sich auch hellere Augen und Haare – aber das geschah erst vor recht kurzer Zeit.17 Die hellere Augen- und Haarfarbe entstand vor rund 6000 Jahren irgendwo rund um die Ostsee. Warum das geschah, ist nicht leicht zu erklären. Die Haar- und Augenfarbe hat keine Auswirkungen auf den Vitamin-D-Stoffwechsel und übrigens auch auf keinen anderen physiologischen Vorgang – ein praktischer Nutzen war damit also anscheinend nicht verbunden. Man vermutet, dass solche Merkmale als Kennzeichen der Stammeszugehörigkeit selektioniert wurden oder auch deshalb, weil die Menschen sie attraktiver fanden. Wenn jemand blaue oder grüne Augen hat, dann nicht, weil diese Farben in der Iris in größerer Menge vorhanden wären als bei anderen Menschen, sondern einfach weil die Menge der anderen Farben geringer ist. Durch das Fehlen anderer Pigmente bleiben die Augen blau oder grün.
Die Hautfarbe wandelt sich schon seit viel längerer Zeit, nämlich seit mindestens 60000 Jahren. Allerdings war das kein geradliniger Prozess.18 »Manche Menschen haben sich depigmentiert, andere haben sich repigmentiert«, sagt Jablonski. »Bei manchen Menschen hat sich die Hautfärbung während der Wanderungen in neue geografische Breiten stark verändert, bei anderen kaum.«
Die indigenen Bevölkerungsgruppen Südamerikas beispielsweise sind hellhäutiger, als man es aufgrund der Breitengrade, in denen sie wohnen, erwarten würde.19 Das liegt daran, dass sie nach den Maßstäben der Evolution erst vor kurzer Zeit dort eingewandert sind. »Sie konnten schnell in die Tropen gelangen und hatten bereits viel Ausrüstung, darunter auch Kleidung«, sagte mir Jablonski. »Also haben sie eigentlich die Evolution ausgebremst.« Schwieriger ist die Erklärung bei den Khoi-San-Völkern im südlichen Afrika.20 Sie haben immer unter der Wüstensonne gelebt und sind nie über größere Entfernungen gewandert, und doch ist ihre Haut um 50 Prozent heller, als man es aufgrund der Umwelt vorhersagen würde. Heute sieht es so aus, als hätten Außenstehende irgendwann während der letzten 2000 Jahre eine genetische Mutation für hellere Haut eingeschleppt. Wer diese rätselhaften Außenstehenden waren, ist nicht bekannt.
Nachdem man in den letzten Jahren neue Methoden zur Analyse sehr alter DNA entwickelt hat, lernen wir derzeit ständig Neues hinzu, und vieles davon ist überraschend – manches aber auch verwirrend und umstritten. Anfang 2018 gaben Wissenschaftler des Londoner University College und des britischen Natural History Museum auf Grundlage von DNA-Analysen zum allgemeinen Erstaunen bekannt, ein vorzeitlicher Brite, der sogenannte Cheddar Man, habe »dunkle bis schwarze« Haut gehabt.21 (In Wirklichkeit sagten sie, er habe mit einer Wahrscheinlichkeit von 76 Prozent dunkle Haut besessen.) Außerdem hatte er anscheinend blaue Augen. Der Cheddar Man gehörte zu den ersten Menschen, die vor etwa 10000 Jahren, nach dem Ende der letzten Eiszeit, nach Großbritannien zurückkehrten. Seine Vorfahren hatten 30000 Jahre in Europa gelebt und damit mehr als genug Zeit für die Evolution einer hellen Haut gehabt; wenn er wirklich dunkelhäutig war, wäre das also eine echte Überraschung. Andere Experten haben allerdings die Vermutung geäußert, die untersuchte DNA sei möglicherweise zu stark abgebaut gewesen, und unsere Kenntnisse über die genetischen Hintergründe der Pigmentierung seien zu unsicher, als dass man irgendwelche Aussagen über die Haut- und Augenfarbe des Cheddar Man machen könne.22 Zumindest aber ruft er uns in Erinnerung, wie vieles wir noch nicht wissen. »Was die Haut betrifft, stehen wir in vielerlei Hinsicht noch ganz am Anfang«, sagte mir Jablonski.
Es gibt zweierlei Formen der Haut: die behaarte und die haarlose. Der Anteil der haarlosen Haut ist relativ gering. Wirklich unbehaart sind nur Lippen, Brustwarzen und Geschlechtsorgane sowie die Handflächen und Fußsohlen. Der übrige Körper ist entweder mit dem sichtbaren Terminalhaar bedeckt, wie zum Beispiel der Kopf, oder er trägt das Vellushaar, den Flaum, den man beispielsweise auf den Wangen eines Kindes findet. Eigentlich sind wir ebenso stark behaart wie unsere Menschenaffenvettern,23 nur sind unsere Haare viel zarter und dünner. Insgesamt besitzen wir schätzungsweise fünf Millionen Haare, die Zahl schwankt aber je nach Alter und Umständen, und ohnehin ist sie nur eine Schätzung.24
Haare gibt es nur bei Säugetieren. Wie die darunterliegende Haut, so dienen auch sie vielfältigen Zwecken: Sie sorgen für Wärme, Polsterung und Tarnung, schirmen das ultraviolette Licht ab und ermöglichen es den Mitgliedern einer Gruppe, sich gegenseitig mitzuteilen, dass sie wütend oder erregt sind.25 Manche dieser Funktionen erfüllen sie allerdings weniger gut, wenn man nahezu unbehaart ist. Bei Kälte ziehen sich rund um die Haarfollikel aller Säugetiere kleine Muskeln zusammen, ein Vorgang, der mit dem Fachbegriff als Pilo-Erektion bezeichnet wird, allgemein aber als Gänsehaut bekannt ist. Bei Säugetieren mit einem Fell schafft der Vorgang eine nützliche, isolierende Luftschicht zwischen Haaren und Haut,26 beim Menschen hat er aber absolut keinen physiologischen Nutzen, sondern er erinnert uns nur daran, wie vergleichsweise kahl wir sind. Außerdem richtet sich die Behaarung der Säugetiere durch die Gänsehaut auf, sodass die Tiere größer und gefährlicher aussehen. Das ist der Grund, warum wir eine Gänsehaut bekommen, wenn wir verängstigt oder nervös sind, aber auch dies hat natürlich bei Menschen kaum eine Wirkung.27
Im Zusammenhang mit der Behaarung stellen sich vor allem zwei hartnäckige Fragen: Wann wurden die Menschen mehr oder weniger haarlos, und warum haben wir an einigen wenigen Stellen eine sichtbare Behaarung behalten? Was die erste Frage angeht, können wir keine eindeutige Aussage darüber treffen, wann die Menschen ihre Haare verloren, denn Haare und Haut sind in den Fossilien nicht erhalten geblieben. Genetische Studien deuten allerdings darauf hin, dass die dunkle Pigmentierung aus der Zeit vor 1,2 bis 1,7 Millionen Jahren stammt.28 Als unsere Vorfahren noch ein Fell hatten, war dunkle Haut nicht notwendig; dies ist also ein gewichtiger Hinweis für die zeitliche Einordnung der Haarlosigkeit. Die Frage, warum wir an einigen Körperteilen immer noch Haare tragen, ist im Hinblick auf den Kopf recht einfach zu beantworten, für andere Körperteile ist es jedoch nicht so klar. Haare auf dem Kopf bieten eine gute Isolation bei kaltem Wetter und reflektieren Wärme, wenn es heiß ist. Nach Angaben von Nina Jablonski sind stark gelockte Haare am wirksamsten, »denn durch sie wird der Zwischenraum zwischen der Oberfläche der Haare und der Kopfhaut dicker, sodass die Luft besser hindurchwehen kann«.29 Dass die Kopfbehaarung erhalten geblieben ist, hat aber auch noch einen anderen, nicht weniger wichtigen Grund: Sie ist seit undenklichen Zeiten ein Mittel der Verführung.
Schwieriger ist die Sache mit der Scham- und Achselbehaarung. Sich vorzustellen, wie Achselhaare das Dasein der Menschen bereichern könnten, ist nicht einfach. Einer Vermutung zufolge dient diese sekundäre Behaarung dazu, Sexualduftstoffe, auch Pheromone genannt, aufzufangen oder zu verbreiten (je nach der Theorie). Diese Hypothese wirft nur das Problem auf, dass Menschen allem Anschein nach keine Pheromone besitzen.30 In einer Studie, die 2017 in Royal Society Open Science erschien, gelangten Forscher aus Australien zu dem Schluss, dass es Pheromone bei Menschen vermutlich nicht gibt und dass sie mit Sicherheit keine nachweisbare Rolle für die Attraktivität spielen. Eine andere Hypothese besagt, die sekundäre Behaarung würde die darunterliegende Haut vor dem Wundscheuern schützen, aber heute entfernen sich viele Menschen sämtliche Haare vom Körper, ohne dass Hautreizungen nennenswert zunehmen. Eine vielleicht plausiblere Theorie besagt, die sekundäre Behaarung diene der Zurschaustellung und zeige die sexuelle Reife an.31
Jedes Haar auf unserem Körper hat seinen Wachstumszyklus mit einer Wachstums- und einer Ruhephase. Bei den Gesichtshaaren ist ein solcher Zyklus normalerweise nach vier Wochen abgeschlossen, ein Kopfhaar dagegen begleitet uns vielleicht sechs oder sieben Jahre. Ein Haar in der Achselhöhle bleibt wahrscheinlich etwa sechs Monate erhalten, ein Beinhaar zwei Monate. Haare wachsen ungefähr um einen Drittelmillimeter am Tag, die Wachstumsgeschwindigkeit hängt aber auch vom Alter, vom Gesundheitszustand und sogar von der Jahreszeit ab. Die Haarentfernung – durch Schneiden, Rasieren oder mit Wachs – wirkt sich nicht auf die Vorgänge an der Haarwurzel aus. Jedem von uns wachsen während seines Lebens ungefähr acht Meter Haare,32 aber da sie alle irgendwann ausfallen, kann kein einzelner Strang länger als ungefähr einen Meter werden. Da unsere Haarwachstumszyklen versetzt ablaufen, fällt es uns in der Regel kaum auf, wenn wir Haare verlieren.
II
Im Oktober 1902 wurde die Pariser Polizei zu einer Wohnung in der Rue du Faubourg Saint-Honoré Nummer 157 gerufen; die wohlhabende Wohngegend liegt im 8. Arrondissement nur wenige Hundert Meter vom Triumphbogen entfernt. Ein Mann war ermordet worden, und man hatte einige Kunstwerke gestohlen. Der Mörder hinterließ keine offensichtlichen Spuren, aber die Polizisten hatten Glück: Sie konnten auf Alphonse Bertillon zurückgreifen, ein Genie für die Identifizierung von Verbrechern.
Bertillon hatte ein Identifizierungssystem entwickelt, das er selbst als Anthropometrie bezeichnete; in der bewundernden Öffentlichkeit wurde es jedoch als Bertillonage bekannt. Er führte damit das Konzept des Polizeifotos ein und mit ihm auch die noch heute auf der ganzen Welt angewandte Praxis, das Gesicht jeder festgenommenen Person sowohl von vorn als auch im Profil fotografisch festzuhalten.33 Bekannt wurde die Bertillonage jedoch durch die akribischen Messungen. Bei jedem Delinquenten wurden elf seltsam anmutende Eigenschaften vermessen, darunter die Größe im Sitzen, die Länge des linken kleinen Fingers und die Breite der Wangen; Bertillon hatte sie ausgewählt, weil sie sich mit fortschreitendem Alter nicht ändern. Er entwickelte sein System nicht so sehr zur Überführung von Verbrechern, sondern vielmehr, um Wiederholungstäter dingfest zu machen. Da Mehrfachtäter in Frankreich strenger bestraft wurden (häufig verbannte man sie sogar auf weit entfernte feuchtheiße Außenposten wie die Teufelsinsel), versuchten viele Verbrecher verzweifelt, als Ersttäter durchzugehen. Bertillons System war darauf angelegt, sie zu identifizieren, und das gelang ihm sehr gut. Im ersten Jahr, in dem es angewandt wurde, konnte er 241 Betrüger entlarven.
Die Erkennung von Fingerabdrücken war eigentlich nur ein Zufallsbestandteil von Bertillons System, aber als er auf einem Fensterrahmen in der Rue du Faubourg Saint-Honoré Nummer 157 einen einzigen Fingerabdruck fand und mit seiner Hilfe einen gewissen Henri-Léon Scheffer als Mörder identifizieren konnte, war das nicht nur in Frankreich, sondern für die ganze Welt eine Sensation. Fingerabdrücke wurden daraufhin sehr schnell überall zu einem grundlegenden Hilfsmittel der Polizeiarbeit.
Dass jeder Mensch einzigartige Fingerabdrücke hat, wurde im Westen erstmals im 19. Jahrhundert von dem tschechischen Anatomen Jan Purkinje nachgewiesen.34 Die Chinesen hatten die gleiche Entdeckung aber schon über 1000 Jahre früher gemacht, und japanische Töpfer hatten ihre Produkte schon seit Jahrhunderten gekennzeichnet, indem sie vor dem Brennen einen Finger in den Ton drückten. Charles Darwins Vetter Francis Galton hatte den Vorschlag, Fingerabdrücke zum Fangen von Verbrechern zu verwenden, schon Jahre vor Bertillon geäußert, und das Gleiche hatte auch Henry Faulds getan, ein schottischer Missionar in Japan. Bertillon war nicht einmal der Erste, der einen Mörder mithilfe eines Fingerabdrucks überführte – das war schon zehn Jahre zuvor in Argentinien geschehen –, aber ihm wird bis heute das Verdienst zugeschrieben.
Welche evolutionäre Notwendigkeit war die Ursache, dass wir Kringel an den Enden unserer Finger haben? Die Antwort lautet: Das weiß niemand. Unser Körper ist ein einziges großes Mysterium. Vieles von dem, was auf und in uns geschieht, spielt sich aus unbekannten Gründen ab – und zweifellos gibt es sehr oft überhaupt keine Gründe. Schließlich ist Evolution ein Zufallsprozess. Die Vorstellung, jeder Fingerabdruck sei einzigartig, ist eigentlich nur eine Vermutung. Niemand kann mit absoluter Sicherheit behaupten, kein anderer habe Fingerabdrücke, die mit meinen eigenen übereinstimmen. Man kann nur eines sagen: Man hat noch nie zwei Fingerabdrücke gefunden, die genau gleich sind.
Der Fachausdruck für die Fingerabdrücke lautet Dermatoglyphen. Die hervorstehenden Linien, die den Fingerabdruck erzeugen, sind die Papillarleisten. Man geht davon aus, dass sie für den »Grip« hilfreich sind wie ein Reifenprofil, das auf der Straße die Traktion verbessert, aber wirklich bewiesen hat das noch niemand.35 Es gibt auch andere Hypothesen: Die Kringel auf den Fingern lassen vielleicht das Wasser besser ablaufen, machen die Haut dehnbarer und flexibler oder verbessern die Empfindlichkeit, aber auch das sind nur Vermutungen. Ebenso hat noch nie jemand auch nur ansatzweise erklärt, warum unsere Finger runzelig werden, wenn wir ein langes Bad nehmen.36 Nach der Erklärung, die am häufigsten angeführt wird, tragen die Runzeln dazu bei, dass das Wasser besser abläuft und man besser greifen kann. Aber das ist eigentlich nicht sonderlich plausibel. Am dringendsten brauchen Menschen sicher dann gute Greiffähigkeit, wenn sie gerade ins Wasser gefallen sind, und nicht, wenn sie schon seit einiger Zeit im Wasser liegen.
In sehr, sehr seltenen Fällen werden Menschen mit vollständig glatten Fingerspitzen geboren, ein Zustand, den man Adermatoglyphie nennt.37 Solche Personen haben auch geringfügig weniger Schweißdrüsen als andere. Dies scheint auf einen genetischen Zusammenhang zwischen Schweißdrüsen und Fingerabdrücken hinzudeuten, aber um was für einen Zusammenhang es sich dabei handelt, bleibt noch zu klären.
Was die Eigenschaften der Haut betrifft, sind die Fingerabdrücke etwas ziemlich Banales. Weit wichtiger sind die Schweißdrüsen. Man würde es vielleicht nicht glauben, aber das Schwitzen ist ein entscheidender Teil des Menschseins. Oder, wie Nina Jablonski es formulierte: »Der gute alte unauffällige Schweiß hat die Menschen zu dem gemacht, was sie heute sind.« Schimpansen haben nur halb so viele Schweißdrüsen wie wir und können deshalb Wärme nicht so schnell abgeben wie Menschen. Die meisten vierbeinigen Tiere kühlen sich durch Hecheln ab, aber das verträgt sich insbesondere für Pelztiere in heißem Klima nicht mit anhaltendem Laufen und der damit verbundenen schweren Atmung.38 Viel besser macht man es wie wir und gibt eine wässerige Flüssigkeit auf die nahezu nackte Haut ab, wo sie verdunstet, den Körper abkühlt und uns damit zu einer Art lebender Klimaanlage macht. Jablonski schrieb dazu: »Der Verlust eines großen Teils unserer Körperbehaarung und die dazugewonnene Fähigkeit, überschüssige Körperwärme durch äußeres Schwitzen abzugeben, trugen zu der drastischen Vergrößerung unseres temperaturempfindlichsten Organs bei: des Gehirns.«39 Auf diese Weise, so erklärt sie, hat der Schweiß mitgeholfen, uns zu Gehirnwesen zu machen.
Auch in Ruhe schwitzen wir zwar unauffällig, aber stetig, und wenn körperliche Anstrengung und schwierige Bedingungen hinzukommen, leeren sich unsere Wasservorräte sehr schnell. Wie Peter Stark in seinem Buch Last Breath: Cautionary Tales from the Limits of Human Endurance [dt. Zwischen Leben und Tod: extreme Erfahrungen, letzte Abenteuer] erläutert, enthält ein Mensch, der ungefähr 70 Kilo wiegt, etwas mehr als 40 Liter Wasser.40 Wenn er nichts tut außer sitzen und atmen, verliert er pro Tag ungefähr 1,5 Liter Wasser durch Schwitzen, Atmung und Urinproduktion. Strengt er sich aber an, kann der Verlust auf bis zu 1,5 Liter in der Stunde steigen. So etwas wird unter Umständen schnell gefährlich. Unter schwierigen Bedingungen – beispielsweise wenn man bei Sonnenhitze wandert – schwitzt man gleich zehn bis zwölf Liter Wasser am Tag aus. Da ist es kein Wunder, dass wir bei heißem Wetter viel trinken müssen.
Wenn der Flüssigkeitsverlust nicht aufgehalten oder ausgeglichen wird, leidet der Betroffene nach dem Verlust von nur drei bis fünf Litern Flüssigkeit bereits an Kopfschmerzen und Teilnahmslosigkeit. Nach einem nicht ersetzten Verlust von sechs bis sieben Litern kommt es zu geistigen Ausfällen. (Deshalb verlassen dehydrierte Wanderer manchmal den Weg und verirren sich in der Wildnis.) Übersteigt der Verlust bei einem Menschen von 70 Kilo ungefähr zehn Liter, tritt ein Schockzustand ein, und der Betroffene stirbt. Während des Zweiten Weltkrieges gingen Wissenschaftler der Frage nach, wie lange Soldaten in der Wüste ohne Wasser marschieren können (wobei man davon ausging, dass sie zu Beginn ausreichend Wasser zu sich genommen hatten); dabei gelangte man zu dem Ergebnis, dass sie bei einer Temperatur von 28 Grad eine Strecke von rund 72 Kilometern zurücklegen können; bei 38 Grad sind es nur noch 24 und bei 49 Grad elf Kilometer.
Unser Schweiß besteht zu 99,5 Prozent aus Wasser. Der Rest ist ungefähr zur Hälfte Salz, und zur Hälfte besteht er aus anderen Substanzen. Aber auch wenn das Salz nur einen winzigen Teil der gesamten Schweißmenge ausmacht, können wir davon bei heißem Wetter an einem einzigen Tag bis zu zwölf Gramm (drei Teelöffel) verlieren. Das ist ebenfalls eine gefährlich große Menge, und deshalb ist es wichtig, nicht nur Wasser, sondern auch Salz zu ersetzen.41
Aktiviert wird die Schweißproduktion durch die Ausschüttung von Adrenalin – das ist der Grund, warum wir Schweißausbrüche haben, wenn wir gestresst sind.42 Die Handflächen schwitzen im Gegensatz zum übrigen Körper nicht bei körperlicher Anstrengung oder Wärme, sondern nur bei Stress. Das gefühlsbedingte Schwitzen wird im Lügendetektortest gemessen.43
Es gibt zwei Typen von Schweißdrüsen: die ekkrinen und die apokrinen. Die ekkrinen Drüsen sind zahlreicher und produzieren den wässrigen Schweiß, der unser Hemd an einem schwülen Tag durchnässt. Die apokrinen Drüsen beschränken sich vor allem auf Leistenbeuge und Achselhöhlen (mit dem Fachbegriff Axillae genannt) und produzieren einen dickflüssigen, klebrigen Schweiß.
Der ekkrine Schweiß an den Füßen – oder genauer gesagt: die chemischen Abbauprodukte, die Bakterien aus dem Fußschweiß erzeugen – ist die Ursache des starken Geruchs. Schweiß als solcher ist eigentlich geruchlos. Damit der typische Schweißgeruch entsteht, sind Bakterien notwendig. Die beiden chemischen Substanzen, die für den Geruch verantwortlich sind – Isovaleriansäure und Methandiol – entstehen auch, wenn Bakterien auf manche Käsesorten einwirken; das ist der Grund, warum Füße und Käse oftmals ähnlich riechen.44
Die Mikroorganismen auf unserer Haut sind etwas äußerst Persönliches. Welche Kleinstlebewesen auf uns zu Hause sind, hängt erstaunlich stark davon ab, was für Seife oder Waschmittel wir benutzen, ob wir lieber Baumwoll- oder Wollkleidung tragen und ob wir vor oder nach der Arbeit duschen. Manche unserer Mikroben sind Dauerbewohner, andere beziehen für eine Woche oder einen Monat auf uns Quartier und verschwinden dann wie ein Nomadenstamm in aller Stille.
Auf jedem Quadratzentimeter unserer Haut leben ungefähr 100000 Mikroorganismen, und ohne Weiteres ausrotten lassen sie sich nicht. Einer Studie zufolge steigt die Zahl der Bakterien auf uns nach dem Baden oder Duschen sogar an, weil sie aus Falten und Verstecken herausgespült werden.45 Aber auch wenn wir versuchen, uns peinlich sauber zu halten, ist das nicht einfach. Um die Hände nach einer medizinischen Untersuchung gründlich zu reinigen, muss man sie mindestens eine volle Minute lang mit Seife und Wasser waschen – ein Standard, der unter praktischen Gesichtspunkten für jeden, der es mit vielen Patienten zu tun hat, nahezu nicht einzuhalten ist.46 Das ist ein wichtiger Grund dafür, warum sich jedes Jahr rund zwei Millionen Amerikaner im Krankenhaus eine schwere Infektion zuziehen (und warum 90000 von ihnen daran sterben). »Die größte Schwierigkeit«, schrieb Atul Gawande, »besteht darin, Mediziner wie mich zu der einzigen Maßnahme zu veranlassen, mit der sich die Ausbreitung von Infektionen regelmäßig zum Stillstand bringen lässt: zum Händewaschen.«
Eine 2007 erschienene Studie der New York University kam zu dem Schluss, dass die meisten Menschen ungefähr 200 verschiedene Arten von Mikroorganismen auf der Haut tragen, aber die Zahl ist von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Nur vier Typen kamen bei allen untersuchten Personen vor. Eine andere Studie, über die vielfach berichtet wurde, war das Belly Button Biodiversity Project von Wissenschaftlern der North Carolina State University: Dabei ließen sich 60 zufällig ausgewählte Amerikaner den Bauchnabel auswischen, und es wurde untersucht, was darin mikrobiologisch angesiedelt war. Der Studie zufolge fanden sich dort 2368 Bakterienarten, 1458 davon waren der Wissenschaft unbekannt. (Das entspricht durchschnittlich 24,3 wissenschaftlich unbekannten Arten in jedem Bauchnabel.) Die Zahl der Arten pro Person schwankte zwischen 29 und 107. Eine Versuchsperson beherbergte einen Mikroorganismus, den man außerhalb Japans noch nie beobachtet hatte – und in Japan war der Mann nie gewesen.47
Antibakterielle Seife wirft das Problem auf, dass sie auf der Haut nicht nur die schlechten, sondern auch die guten Bakterien abtötet.48 Das Gleiche gilt für Desinfektionsmittel für die Hände. Im Jahr 2016 verbot die US-Arzneimittelbehörde FDA 19 Bestandteile, die gewöhnlich in antibakterieller Seife enthalten waren. Die Begründung: Die Hersteller hatten nicht bewiesen, dass sie langfristig ungefährlich seien.
Mikroorganismen sind nicht die einzigen Bewohner unserer Haut. In diesem Augenblick weiden in den Vertiefungen Ihrer Kopfhaut (und auch an anderen Stellen unserer fettigen Oberfläche, vor allem aber auf dem Kopf) winzige Milben namens Demodex folliculorum. Sie sind nicht nur unsichtbar, sondern glücklicherweise auch in der Regel harmlos. Die Milben leben schon so lange auf Menschen, dass man ihre DNA einer Studie zufolge nutzen kann, um die Wanderungsbewegungen unserer Vorfahren vor Hunderttausenden von Jahren nachzuzeichnen.49 Angesichts ihrer Größe ist unsere Haut für sie eine riesige Schüssel voller schmackhafter Cornflakes. Wenn man die Augen schließt und die Fantasie spielen lässt, kann man die Kaugeräusche fast hören.
Auch etwas anderes tut die Haut häufig aus Gründen, die man nicht immer versteht: Sie juckt. Vielfach lässt sich das Jucken zwar leicht erklären (beispielsweise mit Mückenstichen, Ausschlag oder dem Kontakt mit Brennnesseln), ein entsetzlich großer Anteil der Fälle entzieht sich aber der Erklärung. Wenn Sie diesen Abschnitt lesen, empfinden Sie vielleicht den Drang, sich an verschiedenen Stellen zu kratzen, obwohl sie derzeit gar nicht jucken, und alles nur, weil ich das Thema angesprochen habe. Niemand kann erklären, warum wir im Hinblick auf das Jucken so leicht beeinflussbar sind oder warum es überhaupt auftritt, obwohl keine Hautreizungen erkennbar sind. Für das Jucken ist im Gehirn nicht eine einzelne Stelle zuständig, und deshalb ist es nahezu unmöglich, das Phänomen neurologisch zu erforschen.
Das Jucken (der medizinische Fachbegriff lautet Pruritus) ist auf die äußere Hautschicht und wenige feuchte Vorposten beschränkt – vor allem auf Augen, Rachen, Nase und Anus. Ganz gleich, woran wir leiden, unsere Milz wird niemals jucken. Studien über das Kratzen haben gezeigt, dass die Erleichterung am längsten anhält, wenn man den Rücken kratzt, aber am angenehmsten ist die Erleichterung beim Kratzen der Fußgelenke.50 Chronisches Jucken tritt bei allen möglichen Krankheiten auf – bei Gehirntumoren, Schlaganfall, Autoimmunkrankheiten, als Nebenwirkung von Medikamenten und vielem anderen. Zu den unerträglichsten Formen gehört das Phantomjucken, das häufig eine Begleiterscheinung von Amputationen ist und dem armen Betroffenen einen ständigen Juckreiz beschert, den er einfach nicht stillen kann. Die vielleicht ungewöhnlichste Form eines unstillbaren Leidens erlebte aber eine Patientin, die als »M« bekannt wurde: Es handelte sich um eine Frau aus Massachusetts Ende dreißig, auf deren Stirn sich nach einem Anfall von Gürtelrose ein unerträglicher Juckreiz entwickelte.51 Er wurde so heftig, dass sie sich die Kopfhaut auf einem Abschnitt mit einem Durchmesser von ungefähr vier Zentimetern völlig abrieb. Medikamente halfen nicht. Besonders heftig rieb sie an der Stelle, wenn sie schlief – und das so stark, dass sie eines Morgens beim Aufwachen Gehirnflüssigkeit auf dem Gesicht hatte. Sie hatte sogar den Schädelknochen durchgekratzt und war bis zum Gehirn vorgedrungen. Heute, mehr als ein Dutzend Jahre später, kommt sie den Berichten zufolge mit dem Juckreiz zurecht, ohne sich selbst schweren Schaden zuzufügen, aber verschwunden ist er nie. Besonders rätselhaft ist, dass sie praktisch alle Nervenfasern in dem betroffenen Hautabschnitt zerstört hat, und doch ist der unerträgliche Juckreiz immer noch vorhanden.