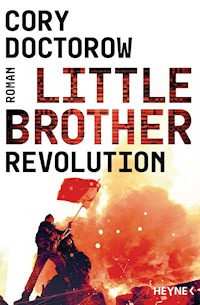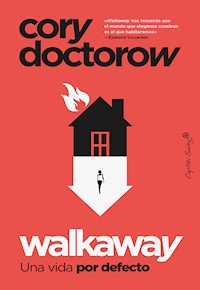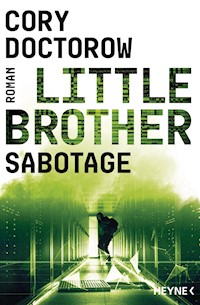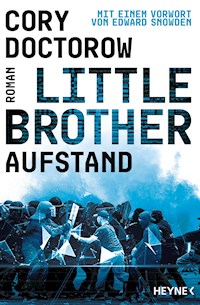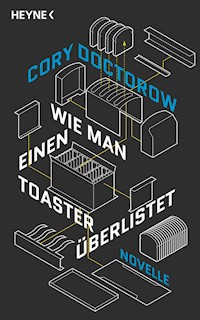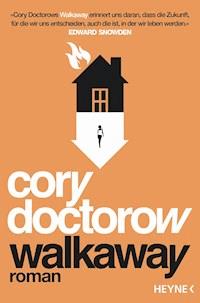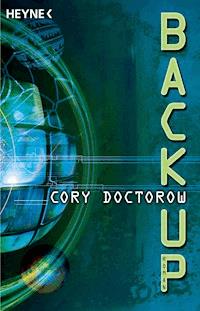11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit
Trent McCauley ist sechzehn und ein Genie: Aus dem Internet lädt er sich Blockbuster herunter und bastelt aus dem Material neue Filme. Dass das illegal ist, kümmert ihn wenig. Bis er erwischt wird. In seiner Verzweiflung flüchtet er nach London, in der Hoffnung, dass ihn in der Großstadt erst mal niemand entdeckt. In der Künstler- und Aktivistenszene findet er Unterschlupf – und erfährt, dass die Regierung ein neues Gesetz plant: Selbst kleinste Urheberrechtsverletzungen im Internet sollen mit drakonischen Strafen geahndet werden. Trent und seine neuen Freunde ahnen, dass dahinter einige mächtige Medienkonzerne stecken, die das Internet zu ihrem Herrschaftsgebiet erklären wollen. Doch da haben sie nicht mit Trent gerechnet, der genau das tut, was er am besten kann: einen Film produzieren, diesmal zum Zwecke der Aufklärung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Ähnliche
CORY DOCTOROW
PIRATE CINEMA
Roman
Aus dem Amerikanischen von
Oliver Plaschka
Die Originalausgabe ist unter dem Titel
Pirate Cinema
bei Tor Teen, New York, erschienen.
Copyright © 2012 by Cory Doctorow
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Usch Kiausch
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-09296-2
www.heyne-fliegt.de
www.diezukunft.de
Für Walt Disney:
Remixkünstler, Verrückter, Getriebener,
begeisterter Nutzer der Public Domain
Prolog
Ein Star findet die wahre Liebe / Jemand klopft an die Tür / Eine Familie wird ruiniert / Unterwegs / Allein
Nie werde ich den Tag vergessen, an dem man meine Familie vom Internet abschnitt. Ich hatte mich wie üblich nach der Schule in mein Zimmer verkrochen und saß vor meinem Laptop, den ich aus dritter Hand gekauft und mit massig Ersatzteilen, Flüchen und Schweiß wieder aufgepäppelt hatte.
Wir summten gerade beide guter Dinge vor uns hin – denn ich war im Begriff, Scot Colford seine Jungfräulichkeit zu nehmen.
Scot Colford kennt wohl so ziemlich jeder. Seine Filme liefen schon im Fernsehen und im Kino, als meine Mutter noch ein kleines Mädchen war, und damals war er bereits tot. Doch tot oder nicht, der arme kleine Scotty würde heute trotzdem entjungfert werden, und zwar von Monalisa Fiore-Oglethorpe.
Dass Scot und Monalisa mal wirklich eine Bettszene hatten, ist schon deutlich weniger bekannt. Das war vor über fünfzig Jahren, als beide noch Teeniestars waren. Damals spielten sie die Hauptrollen in einem absolut schrecklichen Film namens Ohne Hoffnung, in dem zwei rausgeputzte Jugendliche trotz aller Klassenunterschiede zusammenfinden. Der Film landete später natürlich als kultiger Trash im Netz. Es ist eine üble Schmonzette, und sämtliche Nebenrollen (wie der Vater, die Mutter, der beste Freund, der Pfarrer, der Lehrer usw.) sind so austauschbar, dass man sie wahrscheinlich als therapeutisches Mittel zum Löschen traumatischer Erinnerungen gebrauchen könnte.
Zwischen Scot und Monalisa aber herrschte schon eine gewisse Chemie (und ehrlicherweise muss gesagt sein, dass Monalisa auch über geografische Vorzüge verfügte – Hügel, Täler, alles da). Sie schmachteten einander an, wie bloß Teenager das fertigbringen, bis oben hin voll mit Hormonen und scharf drauf, die jüngsten Errungenschaften ihres Körpers zum Einsatz zu bringen. Erwachsene tun ja gern so, als ob Sex etwas wäre, das erst mit achtzehn ein Thema wird – aber selbst bei Romeo und Julia reden wir eigentlich eher von dreizehn.
Allerdings engagierten Scot und Monalisa damals auch ganz gern Doubles (für die 3D-Fassung von Equus zum Beispiel wollte er nicht die Hosen runterlassen, und sie machte sich einen Kopf wegen der Flecken auf ihrem Rücken und ließ sich für Bikinistress in Little Blackpool doubeln). Diese Doubles, Dan Cohen und Alana Dinova, spielten wiederum in einem Film mit, der noch mal deutlich dümmer war als alle anderen. Dieser Film hieß Summer Heat, und da ging’s dann so richtig zur Sache.
Mir waren diese seltsamen Verbindungen zwischen Ohne Hoffnung, Bikinistress und Summer Heat schon länger aufgefallen, und ich hatte es mir immer witzig vorgestellt, mal eine kleine, kreative Entjungferungsszene mit Scot und Monalisa zusammenzuschneiden – wo sie es beide damals doch so bitter nötig gehabt hatten (und wer weiß, vielleicht sind sie am Set ihren Anstandsdamen ja auch eine Weile entkommen und hatten ihren Spaß?).
DenAnstoßgabjedochdieEntdeckung,dassScotundMonalisaimzartenAltervonsechsJahrenschoneinmalgemeinsamvorderKameragestandenhatten:ineinemWerbespotfüreinenPartyservice,indemsieeinandermitWasserspritzpistolendurcheinenMittelklassegartenjagen,dieGesichtermitKuchenundEiscremeverschmiert.IchfanddiesesliebenswerteVideoaufeinemTorrenttrackerirgendwoinOsteuropa(GoogleTranslatewolltenichtsdavonwissen,weileraufeinerschwarzenListevonRaubkopienstand;RogueTranshieltdieSeitefürUkrainisch,kannteabertrotzdem kaum die Hälfte der Wörter, von daher, wer weiß?).
Es war dieser kleine Werbespot, der mich zu meinem Film inspirierte. Denn nun hatte ich die fehlende Zutat, die aus einem vorhersagbaren Mashup etwas wirklich Bewegendes machte: ein Flashback auf sorglose Zeiten, bevor dieses ganze Geschmachte anfing und einem plötzlich überall Haare wuchsen. Die Tatsache, dass der Werbespot natürlich eine viel schlechtere Qualität hatte als die Filme, machte es noch besser, denn so wirkte die Rückblende wirklich wie aus einer anderen Zeit. Ich verstärkte diesen Heimvideo-Wackelkamera-Charme noch mit Software von einer weiteren zwielichtigen Seite, diesmal aus Tadschikistan oder Kirgisistan – jedenfalls aus einem all dieser Stans.
Und wie ich da also in meiner Besenkammer von einem Zimmer saß, die Kopfhörer zum Schutz vor dem Hundegebell aus der Wohnung der Albertsons fest auf den Ohren, die Handgelenke vor lauter Rumgeklicke schon ganz steif, während sich in der Ecke meines Schirms die Pop-ups sammelten, die mich an meine Hausaufgaben erinnern wollten – da klopfte es auf einmal draußen an der Tür.
Es war die Art von Klopfen, für das man bei Krimis einen Geräuschmacher verpflichtet, mit viel bedrohlichem Hall, banng, banng, banng. Der Donner der Autorität auf zwei Beinen. Es drang sogar durch meine Kopfhörer und fuhr mir bis in die Weichteile. Irgendwie ahnte ich, dass gleich etwas Furchtbares passieren würde. Panisch zog ich die Kopfhörer ab und sperrte meinen Laptop. Die verschlüsselten Laufwerke wurden ausgehängt und machten einem blitzsauberen Betriebssystem Platz, auf dem sich nur ein paar Hausaufgaben und zufallsgenerierte Mails an meine Freunde befanden, alles total harmlos und sogar halbwegs glaubhaft. Ich hoffte einfach, das würde reichen. Ich konnte zwar Videos wie ein Weltmeister bearbeiten und eine Anleitung im Netz so gut wie jeder andere befolgen, aber mit diesem ganzen Kryptokram kannte ich mich ehrlich gesagt nicht so aus. Eigentlich wusste ich kaum, wie ein Computer wirklich funktionierte – jedenfalls ging es mir damals noch so.
Ich stahl mich raus auf den Flur und verfolgte, wie meine Mutter zur Wohnungstür ging.
»Kann ich Ihnen helfen?«
»Mrs. McCauley?«
»Ja?«
»Lawrence Foxton, Police Community Support Officer hier in der Wohnsiedlung. Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet.«
Police Community Support Officers, kurz PCSOs: Aushilfsbullen. Freiwillige, die sich ihren kleinen, lachhaften Brotkrumen Macht über ihre Nachbarn krallten. Sie durften einen rumkommandieren, Ausgehverbote durchsetzen und einen zur echten Polizei schleppen, wenn man nicht tat, was sie wollten. Ich kannte Larry Foxton. Meine Freunde und ich waren ihm schon mehr als einmal entwischt. Mit seiner stichfesten Weste und den ganzen Plastikfesseln, dem Pfefferspray und dem Taser am Gürtel, kam er zum Glück immer rasch aus der Puste.
»Nein, bisher nicht, Mr. Foxton.« Mum hatte denselben strengen, ungeduldigen Tonfall drauf, wie wenn sie sich von Cora oder mir verschaukelt fühlte.
»Es tut mir sehr leid, dass wir uns unter diesen Umständen kennenlernen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Internetzugang gesperrt wird, und zwar …« Er warf einen demonstrativen Blick auf sein stoßsicheres Polizeihandy. »… mit sofortiger Wirkung. Von Ihrer Adresse aus wurden mehrere Urheberrechtsverstöße durch illegale Downloads begangen. Man hat Sie bereits zweimal über diese Verstöße in Kenntnis gesetzt. Die Strafe für einen dritten ist eine einjährige Internetsperre. Sie haben das Recht, diese Maßnahme anzufechten. Dazu müssen Sie sich binnen achtundvierzig Stunden beim örtlichen Amtsgericht einfinden.« Er machte sich an einem kleinen Thermodrucker an seinem Gürtel zu schaffen und überreichte ihr einen Papierstreifen. »Bringen Sie das hier mit.« Sein Tonfall wurde noch hochtrabender. »Haben Sie alles verstanden?« Er baute sich vor ihr auf, damit die Überwachungskamera an seinem Helm auch ein gutes Bild von ihr bekam.
Mum wurde immer kleiner und hielt sich am Türrahmen fest. Ihre schwachen Knie drohten schlappzumachen. Seit sie wegen chronischer Schmerzen ihren Job hatte kündigen müssen, wurde es immer schlimmer. »Sie machen Witze. Das kann doch nicht Ihr Ernst …«
»Vielen Dank«, sagte er. »Schönen Tag noch.« Er machte auf dem Absatz kehrt und marschierte davon. Seine Schritte klickten wie die eines Spielzeughunds. Mum stand noch mit zitternden Beinen in der Tür, den Papierstreifen in der Hand, als er schon lange außer Sicht war.
Und so verloren wir unseren Internetzugang.
»Anthony!«, rief sie. Und wieder: »Anthony!«
Dad, der sich im Schlafzimmer verschanzt hatte, gab keine Antwort.
»Anthony!«
»Einen Moment, okay? Das verdammte Telefon geht nicht, und die machen mich einen Kopf kürzer, wenn …«
Sie stolperte durch den Flur und riss die Tür auf. »Anthony, die haben uns das Internet abgestellt!«
Ich flüchtete zurück in mein Zimmer und versuchte, das wahre Ausmaß dieses riesengroßen Eimers Scheiße zu ermessen, in den ich da gefallen war. Meine dumme, blöde Besessenheit von einem toten Filmstar hatte meiner Familie gerade die Existenz zerstört.
Durch die dünnen Wände konnte ich sie streiten hören – keine Wörter, nur den Klang. Mum war den Tränen nahe, und Dads Zustand wandelte sich von Unverständnis über Ungläubigkeit zu mörderischer Wut.
»Trent!«
Es war genau wie die Szene aus Der Fremde im Keller, dem Slasher-Film, in dem sich Scot auf der Flucht im Wandschrank versteckt. Der Mörder hat gerade seinen Bruder erledigt und ist der Garage entkommen, wo sie ihn eingesperrt hatten. Unter Wutgeschrei stürmt er den Flur entlang, und Scot sitzt keuchend in seinem Schrank, die Augen so groß, dass sie fast nur aus Weiß zu bestehen scheinen. Der Zuschauer macht sich vor Angst fast in die Hosen, und die Szene zieht sich hin wie Kaugummi auf heißem Pflaster …
»Trent!«
MeineZimmertürwurdesoheftigaufgestoßen,dassmireinpaarBüchervomRegalpurzelten.EinstrafmichanderWange,ichtaumeltezurückundstießmirdenKopfamschmuddeligenFensterrahmen.SchützendlegteichdieHändevorsGesichtundzogmichindieEckezurück.
Dad packte mich mit seinen Pranken. In meinem Alter war er ein Boxer und polizeibekannter Schläger gewesen. Seit er dank seines Sprachtrainings den Telefonjob hatte, war er etwas aus der Form gegangen, doch mir kam es immer noch so vor, als ginge ich ihm gerade mal bis zum Knie. Er riss mir die Hände weg und pinnte mich an die Wand.
Erst hatte ich ihn für wütend gehalten, und das war er sicher auch, doch als er mir jetzt in die Augen sah, begriff ich, dass er vor allen Dingen Angst hatte. Mehr Angst noch als ich. Davor, dass er ohne Internet seinen Job verlor. Dass Mum keine Stütze vom Sozialamt mehr bekam, wenn sie sich nicht jede Woche einloggte. Und dass meine Schwester Cora ohne Netzzugang ihre Hausaufgaben nicht mehr machen konnte.
»Trent.« Sein Atem ging schwer. »Trent, was hast du da angestellt?« Ihm standen Tränen in den Augen.
IchsuchtenachdenrechtenWorten.Bloß,waswirallemachen,wollteichsagen.Dutustesauch.Ichmussteganzeinfach.DochalsichdenMundaufmachte,kamnichtsheraus.DadsHändeschlossensichnochfesterummeineArme,undeinenMomentlangwarichsicher,dassermichvermöbelnwürde,sowieesmancheandereVäterhierinderSiedlungmitihrenKinderntaten.Dannaberließermichlos,drehtesichumundstürmteausderWohnung.MumstandgegendenTürrahmengelehnt,dieAugengerötet,dasGesichtganzverzerrtvorBestürzung.Wiederwollteichetwassagen,dochwiedergelangesmirnicht.
Ich war sechzehn. Mir fehlten die Worte, meine Leidenschaft für Filme zu erklären und weshalb ich gar nicht anders konnte, als immer mehr davon runterzuladen. Filme waren mir wichtiger als alles andere. Ich hatte mal gelesen, dass viele große Regisseure – Hitchcock, Lucas, Smith – sich den Arsch aufgerissen und ihre Gesundheit und ihre Familien ruiniert hatten, bloß, um diesen einen Film aus ihrem Kopf und auf die Leinwand zu bringen. Mir kam es so vor, als wäre ich einer von ihnen: Als wäre ich von einem heiligen Feuer erfüllt, das mich verbrennen würde, wenn ich ihm keine Richtung wies. Ich musste diesen verdammten Film einfach aus meinem Schädel kriegen.
Und das alles hatte sich auch richtig nobel, aufregend und heroisch angefühlt – zumindest bis zu dem Moment, als der Aushilfsbulle bei uns aufkreuzte, uns das Internet nahm und unser Leben kaputtmachte. Da klang das alles dann plötzlich sehr dumm, kindisch und selbstverliebt.
Ich ging diesen Abend nicht heim, sondern hing einfach in der Gegend herum. Halb hoffte ich, Mum und Dad würden mich suchen kommen, doch beim Gedanken, ihnen gegenüberzutreten, packte mich wieder die Angst. Also saß ich erst unter der Rutsche auf dem Spielplatz, zwischen Jointstummeln und alten Hundehaufen. Dann, als mir kalt wurde, ging ich zum Kulturzentrum, zahlte mein Pfund Eintritt und sah den Kids dort geistesabwesend beim Billard und Tischtennis zu. Als das Zentrum dichtmachte, versuchte ich mich durch ein paar Pubs zu mogeln, wo man es nicht so genau mit der Ausweiskontrolle nahm. Dort war man aber auch nicht gerade scharf drauf, dass ein offensichtlich Minderjähriger zahlenden Kunden den Platz wegnahm. Also wanderte ich schließlich ziellos durch die Straßen von Bradford, wo die wirklich fertigen Jungs und Mädels abhingen, deren Vorstellung von Spaß darin bestand, sich mit Alkopops volllaufen zu lassen und so lange gegenseitig anzuschreien, bis sich irgendein sinnloses Handgemenge daraus ergab.
Ich hatte mein ganzes Leben in Bradford verbracht. Bei helllichtem Tag war ich in der ganzen Stadt zu Hause, ich kannte hier jede Ecke. Doch im gelben Schein der Straßenlaternen und des kränklichen Monds kam ich mir wie ein völlig Fremder vor. Wie ein verängstigter, sehr armseliger und hilfloser Fremder.
Schließlich kauerte ich mich auf einer Bank im Peel Park zusammen, deckte mich mit ein paar knittrigen Zeitungen zu und schlief gefühlte zehn Sekunden, ehe ein PCSO mich unsanft wachrüttelte und mir seine helle Taschenlampe ins Gesicht hielt. Also wanderte ich weiter durch die Straßen. Mittlerweile dämmerte es schon wieder, mir war kalt bis auf die Knochen, und an meiner Nasenspitze sammelte sich der Rotz, wie oft ich ihn auch wegwischte. Ich war nur noch ein elendes, erschöpftes Wrack, als ich endlich umkehrte und mich nach Hause schleppte. Das uralte, störrische Netzwerk unserer Mietskaserne akzeptierte zögerlich meinen Schlüssel, dann trat ich ein.
Auf Zehenspitzen schlich ich mich durchs Wohnzimmer, in Richtung meines Zimmers, wo mein wunderbares, weiches Bett auf mich wartete. Ich war schon fast an der Tür, als jemand mir vom Sofa aus etwas zuzischte. Vor Schreck fuhr ich so zusammen, dass ich fast hingefallen wäre. Ich wirbelte herum und sah meine Schwester Cora vor mir. Cora war zwei Jahre jünger als ich und im Gegensatz zu mir in der Schule eine richtige Überfliegerin. Die Arbeiten, die sie heimbrachte, waren voller Häkchen und Smileys, und die Lehrer baten sie häufig, den dümmeren Schülern doch ein wenig unter die Arme zu greifen. Als sie zehn war, hatte ich ihr die Bedienung meiner Software beigebracht, und mittlerweile war sie fast so gut darin wie ich. Die Videos, die sie als Hausaufgaben machte, waren legendär.
Mit dreizehn war Cora ein etwas pummeliges und unsicheres Mädchen gewesen, das wie ein kleines Kind Werbung für seine Lieblingsbands auf dem Shirt trug. Jetzt, mit vierzehn, hatte sie sich quasi über Nacht in einen richtigen Teenie mit Rundungen an den üblichen Stellen verwandelt und trug Sachen, die sie und ihre Freundinnen sich im Jugendzentrum aus alten Klamotten zusammengenäht hatten. Irgendwie lungerte auf einmal auch immer irgendein Junge in ihrer Nähe herum, pickelige Typen, die sie mit Hormonen geradezu bewarfen. Das wiederum hatte eine merkwürdige brüderliche Ader in mir geweckt, die ich gar nicht erwartet hätte. Damit meine ich, dass ich mir die Kerle am liebsten vorgeknöpft und ihnen erzählt hätte, ich würde ihnen beide Beine brechen, falls sie meiner kleinen Schwester zu nahe kamen.
Wenn wir unter uns waren, brachte mir Cora immer noch denselben Respekt wie damals entgegen, als wir noch Kinder gewesen waren und sie mich als den großen Bruder für unfehlbar gehalten hatte. In der Öffentlichkeit freilich war ich es mittlerweile nicht einmal mehr wert, dass man mich wahrnahm – aber das war schon okay, ich verstand das. An diesem Morgen allerdings war da von Respekt keine Spur. Eher schon schäumte sie vor lauter Abscheu.
»Arschloch!«, spuckte sie mir entgegen.
»Cora …« Ich streckte beschwichtigend die Hände hoch. Meine Arme waren schwer wie Blei. »Pass auf …«
»Vergisses«,zischtesie.»Istmiregal,wasduzusagenhast!DuhättestdichwenigstensschlaueranstellenundeinenProxyverwendenkönnenoderdasNetzwerkvonjemandanderem.«Dahattesierecht.ZwarhattendieAlbertsonsvonnebenanihrWLAN-Passwortirgendwanngeändert,undmeineLieblingsproxyswarenmittlerweileallevonderGroßenFirewallgeblockt,aberichwaraucheinfachzufaulgewesen,meineSpurenordentlichzuverwischen.»Wasistdennjetztmitmir?IchmachbaldmeinemittlereReife.WiesollichbisdahinmeineHausaufgabenmachen?SollichjetztindieBibliothekzumLernen,oderwas?«CoralernteinjederfreienMinute,oftzuunmöglichenUhrzeiten,eheirgendwersonstüberhauptwachwar,oderwennsiespätabendsvomBabysittenkam.DienächstgelegeneBibliothekschlossumhalbsechsundhattedankderjüngstenHaushaltskürzungennurvierTagedieWochegeöffnet.
»Ichweiß,ichweiß.Ichwerdganzeinfach…«Ichwinkteab.AndemPunktwarichheuteNachtschoneinpaarHundertMalgewesen.Ichwürdeeinfach–ja,waseigentlich?MichbeiUniversalPicturesundWarnerBrothersentschuldigen?MichmitdemoberstenPiratenjägerverbindenlassenundumdenInternetanschlussmeinerFamiliebetteln?Daswardochlächerlich.IrgendsoeinemKerlinKalifornienwaren meine Familie oder unser Anschluss doch scheißegal.
»Gar nichts wirst du machen.« Sie stand auf und marschierte zu ihrem Zimmer. Ehe sie die Tür hinter sich schloss, warf sie mir noch einen finsteren Blick zu. »So wie immer.«
Zwei Wochen später haute ich ab.
Es waren nicht die enttäuschten Blicke meines Vaters oder der Ton wachsender Verzweiflung, in dem er und meine Mutter über unsere finanzielle Lage tuschelten. Auch nicht die boshaften Kommentare meiner lieben kleinen Schwester.
Es war der Film.
Genau genommen war es die Tatsache, dass ich meinen Film immer noch machen wollte. Man kann ja auch nicht ewig in seinem Zimmer sitzen und Trübsal blasen. Irgendwann fuhr ich also meinen Laptop hoch und nahm die verzwickte Arbeit wieder auf, die so rüde unterbrochen worden war. Nicht lange, und ich war wieder vollauf damit beschäftigt, Scot Colford seine Unschuld zu klauen. Kurz darauf merkte ich, dass ich zusätzliches Material brauchte, um das Projekt abzuschließen: die eine Szene aus Bikinistress, in der Monalisa mit schwülheißem Blick eine Eiswaffel verdrückt, käme als die »Szene danach« einfach unglaublich gut. Automatisch startete ich meinen Downloader und machte mich auf, das Netz danach zu durchforsten.
Klar, dass es nicht funktionierte – wir hatten ja kein Netz. Als die Fehlermeldung auf meinem Schirm erschien, kehrten all mein Elend und meine Schuldgefühle auf einen Schlag zurück. Es fühlte sich an wie eine gigantische Last auf meinen Schultern, die mich erdrückte. Ich kam mir wie der Abschaum der Welt vor und erstickte fast an diesem Gefühl. Ich wünschte, ich würde einfach sterben.
Ich schloss die Augen so fest ich konnte und wiederholte die Worte innerlich immer wieder: Ich will sterben, sterben, sterben. Wenn das allein reichen würde, den Löffel abzugeben, wäre ich auf der Stelle tot umgekippt, und man hätte mich über dem Laptop gefunden, die Augen geschlossen, das rastlose Hirn endlich ruhiggestellt. Vielleicht würde meine Familie mir dann ja vergeben. Sie könnten zum Richter gehen und sich ihren Anschluss zurückholen. Dad hätte wieder einen Job und Mum ihre Stütze vom Sozialamt, die arme Cora könnte mit Bestnoten abschließen und später in Oxford oder Cambridge studieren, wo sich alle Schlaumeier früher oder später trafen und die künftige Regierung Englands unter sich ausmachten.
Mir war’s früher schon dreckig gegangen, aber noch nie so. Ich hatte noch nie mit jeder Zelle meines Körpers darauf gehofft, dass es einfach vorbeiging. Auf einmal merkte ich, dass ich zu atmen aufgehört hatte, und schnappte nach Luft. Und da wurde mir klar, dass ich so, selbst wenn ich nicht starb, nicht weitermachen konnte. Ich wusste, was ich zu tun hatte.
Ich hatte mir fast hundert Pfund zusammengespart und in einem hohlen Buch versteckt – eine alte Ausgabe von Dracula, ausgemistet von unserer Bücherei. Mit unserem schärfsten Küchenmesser hatte ich ein Rechteck aus der Mitte jeder Seite geschnitten, dann hatte ich die Ränder zusammengeklebt und das Buch zwei Tage unter einen Bettpfosten geklemmt, bis das Versteck einem nicht mehr auffiel. Sorgfältig packte ich drei saubere Unterhosen, eine Ersatzjeans, einen warmen Kapuzenpulli, meine Zahnbürste, Zahnseide und das Zeug gegen Pickel in meinen Rucksack. Außerdem auch das Nähset, das Cora mir mal mit einer liebevollen Karte zum Geburtstag geschenkt hatte (irgendwas von wegen, dass ich endlich lernte sollte, meine Scheißknöpfe selbst anzunähen). Fast wunderte ich mich, wie leicht es mir fiel. Wahrscheinlich hatte ich tief in meinem Innersten geahnt, dass ich eines Tages eine kleine Tasche packen und weggehen würde; dass unter anständigen Menschen einfach kein Platz für mich war.
Vielleicht war ich auch bloß ein Teenager wie viele andere, die sich in ihr eigenes Drama verstricken. Auf jeden Fall aber gab mein schlechtes Gewissen endlich Ruhe. Solange ich nur in Bewegung blieb und auf mein Ziel hinarbeitete, jammerte es mir nicht mehr die Ohren voll.
Niemand bekam mit, dass ich ging. Dem Abendessen war ich wie üblich ferngeblieben. Sobald alle anderen fertig waren, schlich ich mich in die Küche, um mir auch was zu machen. Mum kochte noch immer mit Leidenschaft, auch wenn ihr Essen zunehmend aus dem bestand, was im Supermarkt gerade am billigsten war. Oder es gab was von der »Tafel«, einer sozialen Einrichtung der örtlichen Kirche. Erst kürzlich hatte sie eine ganze Palette völlig übersalzener Ramen-Nudeln in grellbunter kambodschanischer Verpackung mitgebracht und versucht, sie mit gekochtem Ei oder fettigem Billighackfleisch aufzuwerten.
Es hatte nicht den Anschein, als hätte mich jemand beim Essen vermisst, also zog ich mich mit einer Tasse heißgemachter Instantnudeln auf mein Zimmer zurück. Dann spülte ich die Tasse und stellte sie zum Trocknen hin, während die anderen im Wohnzimmer fernsahen. Cora schaffte es auch nur noch selten zum Essen, aber das lag nicht daran, dass sie sich in ihrem Zimmer verschanzte; im Moment war sie bei einer Freundin, um sich über eine riskante Netzverbindung freien Zugang zum Internet zu verschaffen (da sämtliche unserer Netzwerkkarten nur für die Nutzung innerhalb des eigenen Blocks vorgesehen, dort registriert, aber jetzt gesperrt waren, klappte das nur, wenn ihre Freundin für sie illegale Software auf dem eigenen Rechner installierte, die Cora sich runterladen konnte. Und dann konnten die beiden nur beten, dass die Netzgötter nicht mitbekamen, was sie da trieben).
Und so hörte niemand mich gehen, als ich mich aus der Tür schlich und auf den Weg zum Busbahnhof machte. Dort besorgte ich mir im Kiosk noch eine neue Prepaid-SIM, zerschnipselte die alte Karte mit der Schere aus dem Nähset und verteilte sie auf drei verschiedene Mülleimer. Dann kaufte ich mir eine Fahrkarte nach London, Victoria Terminal. Ich kannte London und Victoria Station noch von einem Schulausflug und einem Sommerurlaub mit der Familie im Jahr davor. Den Busbahnhof dort hatte ich als groß, geschäftig und überaus aufregend in Erinnerung. Und mit diesem Bild im Kopf nahm ich neben einer schniefenden alten Frau Platz, die die ganze Fahrt über in ihrer Bibel las, jede Zeile mit dem Finger abfuhr und lautlos die Worte vor sich hin flüsterte.
Der Bus hatte ein langsames Netzwerk und Steckdosen unter dem Sitz, also schloss ich meinen Laptop an und loggte mich ein. Ich zahlte mit einer Prepaidkarte, die ich mir ebenfalls im Kiosk am Busbahnhof gekauft hatte, und zwar unter meinem bevorzugten Künstlernamen, Cecil B. DeVil. Das ist eine Hommage an Cecil B. DeMille, einen gleichermaßen großartigen wie furchtbaren Regisseur, der vielleicht einer der ersten Superstars seines Fachs war. In den jungen Jahren der Filmindustrie war sein Name mal gleichbedeutend mit Kino an sich gewesen.
Sobald ich wieder an der Arbeit saß, verging die Fahrt nach London wie im Fluge. Meine fehlende Szene bekam ich über einen Proxy in Teheran, der nicht sonderlich zimperlich war, was das Urheberrecht anging (anders sah es da mit Porno-Sites oder allem Übrigen aus, was das Missfallen des durchschnittlichen Mullahs erregen mochte).
Als der Bus schließlich in London Victoria einfuhr, war der Clip endlich perfekt. Und ich meine so richtig perfekt, mit blinkenden Lichtern und fröhlicher Musik, P-E-R-F-E-K-T. Er dauerte insgesamt zwei Minuten und fünfundzwanzig Sekunden. Ehe der Bus ankam, war mir zwar keine Zeit geblieben, den Clip auf YouTube oder anderswo einzustellen, aber das war schon okay. Das konnte ich später tun. Ich hatte ein ganz warmes Gefühl im Bauch, so als hätte ich an einem Tag, so kalt, dass einem der Rotz an der Nase gefror, eine schöne dicke heiße Schokolade getrunken.
Ich schwebte wie auf Wolken aus dem Bus.
Und legte eine ziemlich harte Landung hin.
Als ich das letzte Mal hier gewesen war, am Morgen, hatte London Victoria vor Leben nur so gewuselt: überall eilige Pendler, schreiende, herumrennende Kinder in Schuluniformen, dazu ein paar streng dreinschauende Bobbys mit ihren lächerlich großen Helmen, die mich immer irgendwie an riesige Pimmel erinnerten (nur dass sie mit jeder Menge winziger Objektive ausgestattet waren, die in alle Richtungen schauten).
Doch heute, an einem Mittwochabend kurz nach neun, war Victoria Station wie verwandelt. Es pisste in Strömen, richtig dicke, eklige Tropfen, und die paar Leute, die ich sah, wirkten einfach viel … grimmiger. Übellaunig, ja zum Teil geradezu feindselig, wie der bärtige Kauz in seinem alten Regenmantel, der mir zur Begrüßung einen hasserfüllten Fluch entgegenspie. Auch die Bullen sahen nicht mehr freundlich oder lächerlich aus, sondern behielten mich mit ihren harten Augen argwöhnisch im Blick.
Da stand ich also unter der hohen Decke, umgeben vom Gemurmel und Gefurze der nächtlichen Meute und den Nachtzügen, und hatte nicht die leiseste Ahnung, was ich als Nächstes anstellen sollte.
Was nun? Ich wanderte eine Weile im Bahnhof umher, kaufte mir eine heiße Schokolade (die das warme Gefühl aber nicht zurückbrachte) und starrte planlos mein Handy an. Mir war völlig klar, was ich hätte tun sollen: mich schleunigst auf den Rückweg machen und die ganze Sache vergessen. Doch das tat ich nicht.
Stattdessen machte ich mich auf nach London – das echte London. Das wilde, nächtliche London, das ich aus tausend Filmen, TV-Shows und Videos kannte; das London, wo funkelnde Menschen unter funkelnden Lichtern liefen und sich schwarze Taxis durch die Straßen zwängten, verfolgt von attraktiven Jungs und Mädchen auf ihren Motorrädern oder Rollern. Das London eben.
Mein erstes Ziel war Leicester Square. Mein Handy glaubte, einen ziemlich guten Weg dorthin zu kennen, bloß zwanzig Minuten zu Fuß. Doch dann hätte ich mich an die Hauptverkehrsstraßen halten müssen, wo die vorbeifahrenden Autos auf dem nassen Asphalt so viel Lärm machten, dass es einen sogar beim Denken störte. Also suchte ich mir meinen eigenen Weg, über holprig gepflasterte Nebenstraßen und Gassen, die sich seit den Zeiten King Edwards oder Queen Victorias nicht mehr verändert hatten; abgesehen höchstens von den wild montierten Satellitenschüsseln, die alle in dieselbe Richtung schauten – wie eine Gruppe rundgesichtiger Idioten, die alle über dasselbe Spektakel am nächtlichen Himmel staunten.
Und wie ich da federnden Schrittes durch die engen, nassen Gassen lief, all meine Besitztümer auf dem Rücken, und auf den Rhythmus der großen Stadt, den Klang der nahen Hauptverkehrsstraßen lauschte, kam ich mir auf einmal wie im Vorspann eines Films vor: des Films über das Leben von Trent McCauley, mit Trent McCauley als Trent McCauley, Gastauftritten von Trent McCauley und Trent McCauley und vielleicht auch einem überraschenden Cameo von Scot Colford als loyalem Sidekick. Es war die große Eröffnungsszene, in der ich gestiefelt und gespornt aus einer schäbigen Straße auf den berühmten Platz namens Leicester Square hinaustrat.
Alle Lichter waren an. Auf jedem Quadratmeter standen mindestens vier Leute, und alle lachten oder schrien wie wild durcheinander, kifften, tranken oder bewarben auf riesigen Schildern die dubiosesten Dinge. Manche taten all das zugleich. Die Männer trugen Klamotten wie die Gangster im Kino, und die Frauen sahen in ihren nassen Sachen, die an ihren Körpern klebten, wie durchgebrannte Models oder Darstellerinnen aus Softpornos aus. Beim Anblick ihrer Kurven wäre Monalisa Fiore-Oglethorpe vor Scham errötet.
Einen Moment stand ich da wie ein Schwimmer am Beckenrand. Dann sprang ich hinein.
Ich wurde von der Menge hierhin und dorthin geschubst, prallte mit anderen Leuten zusammen und kam mir dabei vor wie ein Gummiball in einem Raum, der nur aus Ecken und Trampolinen bestand. Ein älterer Typ mit dicken gelben Fingernägeln und einem Gesicht wie ein Pavianarsch reichte mir einen Joint. Ich inhalierte das duftende Gras, dann noch einmal, hörte das Knistern des Papiers selbst über die Millionen Gespräche und Regentropfen hinweg. Das Stumpenende war ganz aufgeweicht von all den Fremden, die es schon im Mund gehabt hatten. Ich reichte den Joint an zwei Mädchen mit pink glitzernden Bowlerhüten und Engelsflügeln weiter, die, wie die Sticker unter ihren tiefen Ausschnitten besagten, gerade ihren Junggesellinnenabschied feierten. Eine gab mir zum Dank einen Kuss auf die Wange. Ich spürte ihre Zunge, roch den Alkohol in ihrem Atem und taumelte selig weiter voran. Oh London, du Glorreiche!
Aus einem Kino ergossen sich bestimmt noch einmal achthundert Menschen auf den nächtlichen Platz, riesige Becher mit sprudelnden Getränken in der Hand, und verbreiteten Aftershave- und Parfümwolken. Sofort stürzten sich die Stadtstreicher wie die Fliegen auf sie, und Adligen gleich, die Almosen unter ihren Bauern verteilen, warfen sie ihnen ein paar Münzen vor die Füße. Dabei redeten alle nur über eins: Filme, Filme, Filme. Die Tafel über dem Kino verriet auch, was sie gesehen hatten: Weißt du noch, wie dumm wir waren und wie viel Spaß wir dabei hatten?– das jüngste und dämlichste Beispiel für die lächerlich langen Titel in letzter Zeit. Ich hatte durchaus Gutes über den Film gehört und mir die ersten zwanzig Minuten auch mal runtergeladen, als er anlief; am liebsten hätte ich mich einfach unter diese schwatzenden Kinogänger gemischt und ein bisschen mit ihnen gefachsimpelt.
Doch es war nass, und alle hatten es eilig, ins nächste Taxi und nach Hause zu verschwinden. Dann begann auch schon die nächste Vorstellung. Auf einen Schlag leerte sich der Platz. Zurück blieben nur die obdachlosen Bettler, die Bullen, die Typen mit ihren Werbetafeln … und ich.
Der Vorspann war durch, die erste große Szene vorbei, und die Kamera zoomte auf unseren Helden, der im Begriff war, etwas Entschlossenes, Heldisches zu wagen – irgendwas, das ihn seiner Bestimmung näher bringen würde.
Bloß dass ich immer noch keinen blassen Schimmer hatte, was das sein konnte.
Ich tat die ganze Nacht kein Auge zu. Ich lief weiter nach Soho, wo die Clubs noch massenhaft glückliche Menschen ausspien, und hing bis etwa drei Uhr früh in verschiedenen Cafés rum. Solange ich mich unter größere Gruppen mogelte, fiel es nicht auf, dass ich nur da war, um mich aufzuwärmen oder das Klo zu benutzen. Dann aber zerstreuten sich die Menschen allmählich. Zwar wusste ich mit Sicherheit, dass es in London Partys rund um die Uhr gab, hatte aber leider keine Ahnung, wo. Und ohne die nötige Deckung anderer Menschen kam ich mir vor wie mit einem Umhängeschild: NEUHIER, MINDERJÄHRIG, BARGELDDABEI. WEHRLOSUNDGUTGLÄUBIG. BITTEAUSNUTZEN.
Aus dunklen Gassen starrten mich Gesichter an, boten mir im Flüsterton Drogen und Sex an oder zischten nur: »Komm her, na los, schau mal, was ich hier habe.« Ich wollte aber gar nicht wissen, was sie da hatten. Ehrlich gesagt, wollte ich nur meine Mum um mich haben.
Schließlich ging die Sonne auf, und die ersten Jogger und Hundehalter machten sich auf den Weg. Verschlafene Väter schoben mit ausdruckslosen Gesichtern ihre Kinderwagen an mir vorbei, aus denen das Gebrüll putzmunterer Babys drang. Mit einem seltsam schwerelosen Gefühl in den Beinen trottete ich in westlicher Richtung die Oxford Street entlang. Der Schatten, den ich auf die Straße warf, war im Licht der hinter mir aufgehenden Sonne so lang und dünn wie ein Pfeifenreiniger.
Schließlich erreichte ich den Marble Arch am Hyde Park. Noch mehr Jogger, dazu Radfahrer und kleine Kinder in Sporthosen, die einen Ball durch die Gegend traten. Der Morgen war so frisch, dass sich Dampfwölkchen bildeten, wenn sie keuchend ein- und ausatmeten. Ich setzte mich zu ein paar müden Eltern ins feuchte Gras, schaute ihrem Ballwechsel zu und lauschte auf den Jubel, wenn sie einander mal wieder ausgetrickst hatten. Als die Sonne langsam höher stieg und mir das Gesicht wärmte, machte ich mir ein Kissen aus Jacke und Rucksack, ließ mich zurücksinken und schloss die Augen. In meinem Kopf ging alles durcheinander, tausend Stundenkilometer schnell. Ich wollte einen Plan schmieden – was sollte ich nun tun, allein in der großen Stadt? Doch all meine Angst kam nicht mehr gegen meinen völlig übermüdeten Körper an, und ehe ich mich’s versah, war ich auch schon eingeschlafen.
Es war ein wunderbarer, süßer Schlaf, nur gelegentlich vom Lachen fröhlicher Passanten unterbrochen. Bellende Hunde, die Bälle jagten, spielende Kinder im Gras, das Röhren eines Busses oder Taxis in der Ferne. Als ich wieder aufwachte, lag ich eine Weile einfach nur da und nahm die Schönheit dieses ganzen Wunderwerks in mich auf. Ich war in London, ich war jung, und ich stellte nicht länger eine Gefahr für meine eigene Familie dar. Das Abenteuer meines eigenständigen Lebens hatte begonnen. Es würde schon alles gut ausgehen.
Und in ebendiesem Moment stellte ich fest, dass mir im Schlaf irgendwer den Rucksack unterm Kopf weggestohlen hatte. Mein Laptop, meine spärlichen Klamotten, meine Zahnbürste – alles weg.
1
Nicht mehr allein / Die Jammie Dodgers / Nette Bude Stromentnahme
Von da an machte mir mein Abenteuer schon deutlich weniger Spaß. Wenigstens war ich clever genug, mir bis zum Abend eine Anlaufstelle für Ausreißer zu suchen, die von einer Kirche in Shoreditch betrieben wurde. Nach meinem Alter gefragt, sagte ich achtzehn, denn wenn ich zugab, dass ich erst sechzehn war, würden sie mich vielleicht wieder heimschicken. Ich war mir ziemlich sicher, dass die nette ältere Frau hinterm Tresen meine Lüge durchschaute, aber es schien ihr egal zu sein. Sie hatte einen starken Yorkshire-Akzent, der streng und zugleich warmherzig klang.
MeineZimmergefährten–allesJungs,dieMädchenwarenuntersich–wirktenteilsangsteinflößend,teilsselbsttotalverängstigt.ManchewarenrichtigharteKerle,nurGangstertalküberMesser,Prügeleienundsoweiter.Anderesahennochjüngerausalsich,hatteneinengehetztenBlickundzucktenvorAngstschonzusammen,wennnurjemanddieStimmehob.WirwarenzuachtaufdemZimmerundschliefeninEtagenbetten,diekaumbreitgenugfürmeineschmächtigenSchulternwaren.AmnächstenMorgendurfteichmireinpaarKlamottenundeinenRucksackauseinemBergvonSpendenauswählen.DieKlamottenwarenfastbesseralsdie,indenenichangekommenwar;anscheinendhinkteBradfordderModevonShoreditchgutfünfJahrehinterher.DeshalbwarendieseabgelegtenKleidungsstückevomletztenJahrschickeralsalles,wasichjebesessenhatte.
Dann gab es ein geschmacksneutrales, aber sättigendes Frühstück aus Haferflocken und fettem Schinkenspeck, sodass mir ein Stein im Magen lag, als man mich schließlich vor die Tür setzte. Es war acht Uhr früh, und alle Welt war auf dem Weg zur U-Bahn oder zum Bus; bloß ich schien kein Ziel zu haben. Ich hatte noch knapp vierzig Pfund in der Tasche, doch damit würde ich in diesem Viertel, wo schon der Kaffee drei Pfund kostete, nicht weit kommen. Und ich hatte auch keinen Laptop mehr (beim Gedanken an das verlorene Video, das nun nie auf YouTube hochgeladen werden würde, für immer verschollen, krampfte sich immer noch alles in mir zusammen).
Ich schaute der Menge zu, wie sie in der Old Street Station verschwand, sah zu, wie die Leute die Treppe hinunterklapperten, einen Bogen um die Zeitungswerber schlugen, die kostenlose Exemplare verteilten (ich ließ mir von jedem ein kostenloses Probeexemplar andrehen, damit ich nachher was zu lesen hatte), den Bettlern mit den rasselnden Bechern auswichen, die den Schutzwall der Sonnenbrillen und Kopfhörer zu durchstoßen versuchten, um an das einsame Gewissen darunter zu appellieren. Sie hatten allerdings nicht sonderlich viel Erfolg damit.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!