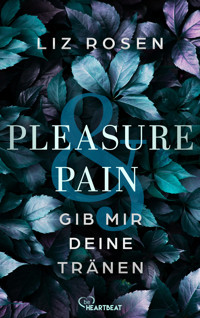
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Niemand anders hatte dafür gesorgt, dass ich mich stark fühlte, obwohl ich schwach war. Kein anderer hatte mir das Lächeln geschenkt, das ich verloren hatte.
Als Grace von ihrem Freund ausgerechnet an ihrem Geburtstag in den exklusiven BDSM-Club Pleasure and Pain geschleppt und verletzt wird, kommt ihr Miles Marshall, einer der Eigentümer, zur Hilfe. Statt Grace auf die Straße zu setzen, wo ihr Ex auf Rache sinnt, erlaubt er ihr, als Kellnerin im Club zu bleiben - vorausgesetzt, sie lässt sich von ihm seine Welt zeigen. Und Miles hat etwas an sich, was Grace nicht nur Sicherheit gibt, sondern auch ihr Herz gefährlich aus dem Takt bringt ...
Der dritte Band der heißen und düsteren Dark-Romance-Reihe um einen exklusiven Club, in dem die geheimsten Fantasien wahr werden.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Triggerwarnung
Playlist
Prolog: Miles
Kapitel 1: Grace
Kapitel 2: Miles
Kapitel 3: Grace
Kapitel 4: Miles
Kapitel 5: Grace
Kapitel 6: Miles
Kapitel 7: Grace
Kapitel 8: Miles
Kapitel 9: Grace
Kapitel 10: Grace
Kapitel 11: Miles
Kapitel 12: Grace
Kapitel 13: Miles
Kapitel 14: Grace
Kapitel 15: Miles
Kapitel 16: Grace
Kapitel 17: Miles
Epilog: Grace
Triggerwarnung
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Niemand anders hatte dafür gesorgt, dass ich mich stark fühlte, obwohl ich schwach war. Kein anderer hatte mir das Lächeln geschenkt, das ich verloren hatte.
Als Grace von ihrem Freund ausgerechnet an ihrem Geburtstag in den exklusiven BDSM-Club Pleasure and Pain geschleppt und verletzt wird, kommt ihr Miles Marshall, einer der Eigentümer, zur Hilfe. Statt Grace auf die Straße zu setzen, wo ihr Ex auf Rache sinnt, erlaubt er ihr, als Kellnerin im Club zu bleiben – vorausgesetzt, sie lässt sich von ihm seine Welt zeigen. Und Miles hat etwas an sich, was Grace nicht nur Sicherheit gibt, sondern auch ihr Herz gefährlich aus dem Takt bringt ...
Der dritte Band der heißen und düsteren Dark-Romance-Reihe um einen exklusiven Club, in dem die geheimsten Fantasien wahr werden.
Liz Rosen
Gib mir deine Tränen
Für alle, die denken, sie müssten ihre Tränen zurückhalten, um nicht schwach zu wirken. Vergieße jeden einzelnen Tropfen mit Stolz, bis deine Feinde daran ersticken!
Besser sie als du.
Triggerwarnung
Willkommen zurück im Pleasure and Pain. Bist du bereit für eine letzte Runde in der Welt aus Schmerz, Liebe und Lust? Wie im BDSM üblich, müssen wir uns aber zuerst beide versichern, dass unser Spiel ungefährlich ist und keine bleibenden Schäden verursacht. Sieh deshalb bitte auf der letzten Seite bei den Triggerwarnungen vorbei, ehe du dich ins Vergnügen stürzt.
Playlist
Birds of Feather – Lilith Max
Aphrodite – Sam Short
Salvatore – Lana Del Rey
Miracle – Bad Omens
Praying – Kesha
Peasant´s Throne – Lilith Max
Hellgirl – Ari Abdul
Lost – Linkin Park
Vampire – Billie Eilish
Naked – Sam Short
People you know – Selena Gomez
No Limits – Royal Deluxe
Have a Drink on me – AC/DC
Rebel Yell – Billy Idol
Girl with one Eye – Florence and the Machine
So schön kaputt – SDP
Wait a minute my girl – Volbeat
In the air tonight – State of Mine
Voices in my head – Falling in Reverse
Prolog: Miles
Das ist das Ende, Sugar. Das Ende deines Schmerzes. Das Ende des Leids. Du hast genug ertragen, hast für jemanden gelitten, dem du nicht mehr wert warst als sein eigenes Vergnügen. Er hat deine Schreie durch seine Schläge verstärkt, dein Wimmern durch einen Knebel unterdrückt und deinen Ungehorsam mit Tritten bestraft. Dabei werde ich nicht länger zusehen. Nicht, wenn du unglücklich aussiehst, während er die Peitsche schwingt und sie auf deinen nackten Rücken schnalzen lässt. Ich will dich lächeln sehen, Sugar. Strahlen. Und gleichzeitig weinen. Dicke Tränen sollen über deine Wangen laufen, während du um mehr bettelst. Mich anflehst, dir mehr zu geben. Alles. Schmerz, Lust, Verlangen, Respekt und Glück. Alles auf einmal und gleichzeitig nichts davon, weil nur ein einziges Gefühl zählt. Liebe.
Jeder Moment würde mich berauschen, mein Herz schneller schlagen lassen – im gleichen Takt wie deines. Also tritt näher, Sugar! Komm in meinen Club! An meine Seite! Und ich verspreche, dich nie wieder gehen zu lassen. Du wirst mir gehören wie ich dir. Ich werde dafür sorgen, dass du es nicht bereust. Du sollst alles haben, wovon du immer geträumt hast. Ein Zuhause. Eine Familie. Ein Leben.
Du musst dich allerdings schnell entscheiden. Für den Kampf und gegen die Gewohnheit. Für die Liebe statt dem Pflichtgefühl. Für oder gegen mich. Es ist deine Entscheidung und nur deine, auch wenn sie uns beiden das Herz brechen könnte.
Ich habe nur eine Bitte an dich, Sugar. Am Ende sollst du nicht um die Zeit weinen, die du damit zugebracht hast, den falschen Mann zu wählen. Um das Leben, das wir gemeinsam hätten haben können. Oder um mich. Wein lieber um die Momente, die du damit verschwendet hast, nicht glücklich zu sein. Denn das würde auch mich zum Weinen bringen.
Kapitel 1: Grace
»Du sollst still sein!« Der Befehl traf mich genauso unvorbereitet wie der Schmerz, der erneut durch meinen Körper fuhr. Stechend. Quälend. Es klatschte laut, als die Peitsche wieder auf meiner Haut auftraf. Der Ton hallte in dem kleinen Raum wider, den ich jetzt schon hasste. Ein weiterer Schlag löste einen Knall aus. Und noch einer.
Die Hiebe kamen unregelmäßig. Jedes Mal war ich unvorbereitet, obwohl ich mittlerweile daran gewöhnt sein sollte. Keine Ahnung, ob Simon es absichtlich tat, aber er schlug nie zweimal auf dieselbe Stelle, und die Abstände zwischen den Schlägen waren nie gleich. Es störte mein Bedürfnis nach Sicherheit, nach einem Rhythmus und sorgte dafür, dass meine Muskeln sich instinktiv zwischen den Hieben anspannten. Es war ihm allerdings egal. Er schlug einfach weiter zu, bis mein Körper zitterte und ich nur noch eines wollte: nach Hause.
Anfangs hatte sich die Idee, einen BDSM-Club zu besuchen, noch gut angehört. Aufregend. Es war etwas gewesen, das ich in meinem Leben unbedingt ausprobieren wollte. Jetzt war ich anderer Meinung. Ich hätte darauf verzichten können. Alles tat weh. Jede Berührung, jeder Schlag. Nicht auf die gute, kribbelnde Weise. Nein, die Hiebe stachen unangenehm.
»Ich war still.« Das war ich wirklich gewesen. Kein Wimmern, kein Laut hatte meinen Mund verlassen. Dabei war alles, was ich tun wollte, zu schreien. Vor Leid. Vor Verzweiflung. Ich wollte nicht mehr. Es sollte endlich aufhören. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wie lange ich bereits mit gespreizten Beinen still stand und die Schläge über mich ergehen ließ. Simon hatte mir das Kleid über den Kopf gezogen und mich in eine der Ecken des Raumes gestoßen.
Der grüne Stoff lag nicht weit von mir entfernt, war aber für mich unerreichbar, durch die Schnüre, die um meine Handgelenke lagen und meine Arme mit einer Öse, die oben an der Decke befestigt war, verband. Die Kordel bohrte sich in meine Haut und schnürte mir das Blut ab. Meine Finger kribbelten inzwischen nur noch, worüber ich froh war.
Noch vor ein paar Minuten hatten meine Arme geschmerzt, als hätte sie jemand über einem Feuer gebraten. Es hatte sich angefühlt, als würden sie in Flammen stehen. Dennoch war mir eiskalt gewesen und die Kälte war bisher nicht verschwunden. Sie hatte sich in meinem Inneren eingenistet und egal, was ich tat, sie wollte nicht vergehen. Dabei war es angenehm warm in dem dunklen Kellergewölbe, in dem das Pleasure and Pain –der berühmteste BDSM-Club der Stadt – untergebracht war. Selbst in meinem String und dem zu engen BH, der es kaum schaffte, meine Brüste im Körbchen zu behalten, hätte ich nicht frieren sollen. Aber ich tat es. Weil die Kälte nicht von außen kam, sondern aus meinem Herzen, das mit jedem weiteren Schlag mehr zu Eis zu werden schien.
Ich hatte Simon geliebt. Irgendwann. Doch ich konnte nicht mehr. Sah er das nicht? Es war zu viel! Mein Körper machte das nicht mit. Egal, wie sehr es ihm gefiel, es ihn erregte, mich leiden zu sehen, er musste doch bemerken, wie schwer es mir fiel, mich aufrecht zu halten. BDSM sollte Spaß machen und niemanden verletzen. Zumindest nicht so, dass irreparable Schäden entstanden.
Doch Simon kümmerte sich nicht darum. Die Narben auf meiner Haut bewiesen das. Sie machten mir Angst. Angst, wie weit ich gegangen war, damit Simon mich mochte. Damit ich ein Dach über dem Kopf hatte. Damit ich mir einbilden konnte, dass es wenigstens einem Menschen auf dieser Welt nicht egal war. Doch das war alles nur Schein. Eine Illusion. Simon kümmerte sich einen Dreck um mich.
»Gib keine Widerworte!« Wie zur Bestätigung schlug er erneut zu. Die Peitsche gab wieder einen Laut von sich, der mich zusammenzucken ließ. Die Geräusche waren noch schlimmer als der Schmerz. Zu dem Klatschen mischte sich das Stöhnen der Zuschauer, die Simon eingeladen hatte, unserem Spiel beizuwohnen. Es waren Freunde von ihm. Ich kannte keinen davon, aber das war mir nur recht. Ich wollte ihre Namen nicht wissen oder mir ihre Gesichter merken.
»Willst du, dass ich dich bestrafe?«
»Nein!« Ich schrie automatisch auf, weil mir jetzt schon alles zu viel war. Meine Haut war überreizt, mein Herzschlag lief auf Hochtouren, mein Puls schoss durch die Decke.
»Ich brauche eine Pause.« Nun verließ doch ein Keuchen meinen Mund. Nicht vor Lust, sondern vor Anstrengung. Das ständige Anspannen meiner Muskeln war kräftezehrend, doch es geschah instinktiv. Es gab nichts, was ich dagegen tun konnte. Ich musste die Situation aussitzen. Wenigstens noch eine Weile. Richtig?
Nein, eigentlich sollte es nicht so sein. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Es würde keine Subs mehr geben, wenn sich alle während des Spielens nur annähernd so fühlen würden wie ich in diesem Augenblick. Tränen schossen mir in die Augen. Meine Sicht verschwamm. Viel änderte das allerdings nicht. Ich sah ohnehin nichts anderes als die einzelnen Ziegelsteine der Wand.
»Jetzt schon? Du blamierst mich.« Simons Worte trafen mich tief. Ich wollte es gut machen. Verstand er das nicht? Ich bemühte mich. Wirklich. Ich tat alles, aber es war ... zu viel. Zu schmerzhaft. Ich konnte es einfach nicht. Ich ... ich ... versagte.
»Ich spüre meine Arme nicht mehr.« Es war nicht gelogen. Sie fühlten sich taub an. Das Kribbeln löste sich langsam auf und ließ ein stumpfes, nichtssagendes Gefühl zurück, das meine Panik weiter anstachelte, bis ich ein zitterndes, ängstliches Bündel war und nichts mehr mitbekam außer meinem rasenden Herz, das schmerzhaft fest gegen meine Rippen hämmerte.
»Nur noch ein paar Minuten. Ich weiß, dass du das kannst.« Simon ließ die Peitsche über meine Haut gleiten. Das Klatschen vermischte sich mit einem Schmerzensschrei. Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, dass er von mir kam.
»Simon, bitte!« Ich hatte wirklich geglaubt, dass ich das Glück auf Erden gefunden hatte, als Simon mich vom Straßenrand auflas und mit zu sich nahm, nachdem ich von meinem Stiefvater geflohen war. Ich hatte ausgesehen wie ein Geist. Ausgemergelt, verletzt, blutend. Es war die Hölle gewesen, aus der ich geflohen war, nur um im Fegefeuer zu landen.
Nun – drei Jahre später – fragte ich mich, ob es nicht besser gewesen wäre, zu bleiben. Vielleicht hätte es mir erspart, zu werden, was ich heute war. Ein Schatten. Ich gehörte jemandem, ohne ihn verlassen zu können. Ich wurde gesehen und gleichzeitig auch nicht. Niemand interessierte sich für mich und jeder verließ mich – selbst die Sonne, auch wenn das bedeutete, dass ich mich immer weiter auflöste, bis nichts mehr von mir übrig war.
»Ja, heilige Scheiße, fleh für mich!« Simon stöhnte und lachte gleich darauf lauthals. Er trat näher an mich heran und schlug erneut zu. Seine Jeans streifte meinen verletzten Hintern, der noch von der Session gestern verletzt gewesen war.
Die erste Träne quoll über meine Wange. Der Schmerz war überwältigend. Ich riss fester an meinen Fesseln, aber sie gaben nicht nach. Stattdessen fraßen sie sich fester in meine Handgelenke. Meine Knie gaben unter mir nach.
Ich knallte mit den Schienbeinen voran auf den Boden. Meine Hände wurden weiter nach oben gezogen. Die Haare fielen mir übers Gesicht und die Oberarme.
Weitere Tränen liefen mir über die Wangen. Sie fühlten sich heiß in meinem Gesicht an. Es war fast schon angenehm gegen die Kälte, die ich empfand.
»Sie scheint sehr kratzbürstig zu sein.« Einer von Simons Freunden stimmte in sein Gelächter mit ein. Konnte er die Qualen nicht sehen, die mich heimsuchten wie ein Schreckgespenst? Oder war es ihm einfach egal?
»Ich mag es, wenn mein Mädchen ein wenig bratty ist. Dann macht das Spielen gleich viel mehr Spaß.« Im Gegensatz zu mir log Simon. Niemand der anderen hörte es, aber ich kannte den Unterschied in seiner Stimme.
Außerdem wusste ich die Wahrheit. Er hasste Ungehorsam. Das bewies auch der viel zu feste Griff in meine Haare. Seine Finger wühlten in meinen Strähnen, packten mich daran und zogen meinen Kopf gewaltsam nach hinten. Peitschenartig fielen meine Haare wieder über meinen nackten Rücken.
»Bestrafst du das Mädchen auch gut? Nicht, dass sie dir zu aufsässig wird.« Ein anderer Kerl lachte ebenfalls. Dabei mussten meine Tränen nun für jeden ersichtlich sein.
Sie kümmerten sich allerdings nicht darum. Genau wie Simon.
»Wollen wir zeigen, wie brav du sein kannst, mein Mädchen?« Simon verfestigte den Griff in meinen Haaren. Der Druck an meiner Kopfhaut wurde schmerzhaft und ich befürchtete für einen Moment, dass er mir einzelne Strähnen ausreißen würde.
»Simon! Hör auf, bitte! Das tut weh!« Mein Flehen war leise, nur ein Flüstern. Es war nur für ihn bestimmt, damit er – wenn er aufhörte – nicht sein Gesicht vor seinen Freunden verlor. Ich wollte ihm entgegenkommen, die Situation für uns beide so angenehm wie möglich machen, aber es hatte keinen Zweck.
»Es soll wehtun.« Simon schnaubte und verzog das Gesicht, als hätte ich den Verstand verloren, weil ich überhaupt daran dachte, wegen der Pein aufzuhören. Wusste er, wie schlimm die Qualen waren? Hatte er jemals zugelassen, dass jemand ihn so stark schlug, dass er blutete? Versuchten Doms ihre Behandlung zuerst an sich selbst, ehe sie anderen Menschen all die Schläge zumuteten? Ich wusste, dass es keine Ausbildungspflicht für Doms gab, aber inzwischen erschien mir das fahrlässig.
Simon würde das nicht tun, wenn er wüsste, wie ich mich fühlte. Klein. Entbehrlich. Erschöpft. Unwichtig. Ungeliebt. Es war fürchterlich. Erniedrigend. Ich wollte nur noch, dass es vorbei war.
So hatte ich mir meinen zweiundzwanzigsten Geburtstag nicht vorgestellt. Keinen meiner Geburtstage. Eigentlich keinen Tag in meinem Leben.
Simon grunzte. Es hörte sich an wie der Laut eines quiekenden Schweins, bevor es seine Schnauze in den Futtertrug steckte und fraß. Verlangend und gleichzeitig erleichtert. Er entließ seine Finger aus meinen Haaren, strich fest über mein Rückgrat, sodass seine Nägel über meine Haut kratzten, und hob im gleichen Moment den anderen Arm mit der Peitsche in der Hand.
Die Peitsche landete auf meinem Steißbein. Schmerz durchzuckte mich. Mein Körper verkrampfte sich. Simon sah es und lachte.
»Verflucht, dein Arsch ist ein Geschenk. Wollen wir sehen, wie viele Farben ich darauf zaubern kann? Zu dem grün, gelb und blau würde noch ein feuriges Rot fehlen, findest du nicht?«
»Simon.« Ich krächzte. Weitere Tränen benetzten meine Wange. Mir drehte es den Magen wieder um. Er kugelte in alle Richtungen und sorgte dafür, dass ich mich übergeben wollte.
»Ich brauche wirklich eine Pause.« Das Zittern meines Körpers wurde stärker. Ich konnte es nicht verhindern, nicht kontrollieren. Meine Glieder machten sich selbstständig. Als hätten sie begriffen, dass ich machtlos war und ihnen nicht gegen die Tortur helfen würde.
»Schlag sie härter!« Das Grölen von Simons Freunden trat in den Hintergrund. Ich blendete es so gut wie möglich aus, während ich mich auf meine Atmung konzentrierte. Ein und aus. Ein und aus.
Kurz glaubte ich tatsächlich, Gott oder irgendwer sonst hätte meine Gebete erhört, als Simon endlich die Peitsche fallen ließ. Sie knallte mit einem dumpfen Ton neben mir auf den Boden, ehe Simon mich an den Hüften packte und grob nach oben zerrte.
Meine Knie protestierten. Ein Stich jagte durch mein Becken, doch ich richtete mich wieder auf, bis ich nicht mehr länger vor ihm im Staub kroch, sondern erneut mit dem Hintern nach oben und gebeugtem Rücken dastand.
»Gib mir den Stab!«, forderte Simon, und eine nie zuvor da gewesene Härte legte sich in seine Stimme. Ich konnte nicht sehen, wie er die Hand ausstreckte und den Rohrstock entgegennahm, doch kurz darauf spürte ich das Holz, das über meinen Hintern strich. Ich schluckte schwer.
Nein, nein, nein, nein. Bitte nicht. Nicht auch das noch.
»Jetzt wird es interessant.« Vorfreude erklang in der Stimme von einem von Simons Freunden. Sie alle gierten danach zu sehen, wie Simon mich bearbeitete, bis ich durchdrehte. Und das würde ich. Das hier war nämlich kein Spiel mehr um Dominanz und Unterwerfung. Es war Folter. Einfach nur Folter.
»Simon.« Ich legte all die Emotionen, die ich empfand, in seinen Namen. Bettelnd, traurig, flehend, ängstlich sagte ich die fünf Buchstaben. Aber das nutzte nichts. Er machte weiter. Immer weiter. Und ich konnte ihn nicht stoppen.
»Bereit, Baby?« Simon fragte, doch er wartete nicht auf eine Antwort. Im Grunde war es ihm wohl egal, was ich dazu zu sagen hatte. Er hatte einen Plan, und den verfolgte er bis zum bitteren Ende.
Wie hatte ich auch so dumm sein können, mich von ihm fesseln zu lassen? Ich hätte es besser wissen müssen. Doch er war unglaublich nett gewesen, als wir im Club angekommen waren, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich zugestimmt hatte, mit ihm zu spielen. Dann hatte sich seine liebevolle Haltung verändert und er hatte mir klargemacht, dass ich wieder auf seine Scharade reingefallen war. Würde ich jemals dazulernen? Ja. Das hatte ich schon. Ich wusste inzwischen, dass wir keine Zukunft miteinander haben würden.
Der Schlag traf mich. Ich war darauf vorbereitet, das machte es jedoch nicht weniger schlimm. Nicht weniger schmerzhaft. Das Holz schnalzte gegen meine geschundene Haut. Ich versuchte auszuweichen und mich von Simon wegzubewegen, doch es hatte keinen Zweck. Mir fehlte der Bewegungsspielraum und die Fesseln an meinen Armen ließen nicht zu, dass ich mich weiter von Simon entfernte.
»Das sieht doch schön aus«, lobte Simon und zum ersten Mal an diesem Abend spürte ich seine Hand an meinem nackten Hintern. Seine Finger streichelten über die Backen und fuhren die Striemen entlang.
Eine Gänsehaut bildete sich wegen der plötzlichen Zärtlichkeit auf meinem Körper. Ein wenig entspannten sich meine Muskeln und ein Seufzen verließ meinen Mund, weil es sich gut anfühlte. Schön. Es war ein guter Ausgleich zu dem Schmerz, der nicht nur in meinem Körper pochte, sondern auch in meiner Seele.
Wusste Simon nicht, dass ich vieles von dem, was er begehrte, gern über mich ergehen lassen würde, wenn er dafür ... Wenn er mich lieben würde. Nur ein wenig. War es so schwer, zwischen den Spielen netter zu mir zu sein? Mich zu behandeln, als wäre ich wichtig? Mich zu respektieren und Rücksicht darauf zu nehmen, wenn mein Körper es einfach nicht mehr ertragen konnte?
Offensichtlich, denn selbst die liebevollen Streicheleinheiten dienten nur dazu, an meinen String zu kommen. Simons Finger strichen über meinen Hintern und zu dem dünnen Stoff, der eine letzte Barriere zwischen meiner intimsten Stelle und der Außenwelt bildete. Dieser Fetzen gab mir das Gefühl von Sicherheit. Mehr als es Simon tat. Und genau das wollte er mir nun auch noch wegnehmen.
»Schwarz!«, plärrte ich aus vollem Hals und betete zu jedem, der es hören wollte, dass Simon auf mich hören und aufhören würde. Nur einmal. Dieses eine Mal. Weil er Mitleid hatte. Weil mein Geburtstag war. Weil ich das nicht wollte. Nicht so.
Schwarz. Nach drei Jahren hatte ich immer noch kein individuelles Safeword. Das war für mich allerdings in Ordnung. Schwarz war gut. Es war eine starke Farbe. Dunkel und düster.
Es erinnerte mich an Beerdigungen, weshalb es mir passend erschien, genau diese Farbe als Safeword zu verwenden. Ich nutzte es dann, wenn auch noch das letzte bisschen Erregung starb. Genau wie mein Wille weiterzumachen. Vielleicht wäre auch Weiß eine Option gewesen, immerhin fühlte es sich wie eine Kapitulation an. Die Farbe war allerdings egal, solange Simon aufhörte. Er tat es jedoch nicht.
»Ich liebe deinen Hintern«, flüsterte er mir zu, griff nach meinem String und zog ihn von meiner Haut, nur um den Stoff gleich darauf gegen meinen Körper schnalzen zu lassen. Normalerweise hätte es nicht wehgetan, doch inzwischen schmerzte auch nur die kleinste Berührung.
Ich schniefte. »Simon, schwarz!«, wiederholte ich. Lauter diesmal, weil ein Teil von mir tatsächlich hoffte, er hätte mich nur nicht gehört.
Simons Lachen wurde lauter. Der Rohrstock zischte durch die Luft und traf mich noch härter als davor. »Was? Hast du schon genug? Dabei haben wir gerade erst angefangen.« Ein rauer Unterton mischte sich in Simons Stimme. Er lallte ein wenig und zeigte damit, wie viel er schon getrunken hatte. Der Alkohol schien jedoch mit jeder Minute mehr zu wirken und aus der Angst, die mich fest im Griff hatte, wurde Panik. Ich hatte mein Safeword gesagt. Laut und deutlich. Doch es kümmerte Simon nicht. Er ignorierte es einfach, obwohl er beim letzten Mal versprochen hatte, das nie wieder zu tun.
»Simon!« Ich zerrte fester an dem Seil um meine Hände. Fanatisch versuchte ich mich zu befreien. Ohne Erfolg. Zeitgleich traf mich wieder der Rohrstock.
»Wenn du noch reden kannst, ist es nicht so schlimm.« Simon gab wieder einen amüsierten Ton von sich. Als wäre das alles ein Witz. Lustig. Für jeden. Nur nicht für mich.
Mein Atem stockte. Der nächste Schlag traf mich. Wieder brachen meine Beine unter mir weg. Ich fiel erneut.
Simon ließ mich für eine Weile auf dem Boden sitzen. Seine schwere Hand legte sich auf meinen Rücken und er drückte mich nach vorne, bis meine Nase beinahe den Grund berührte. Durch die neue Position tropften meine Tränen direkt auf den Marmor.
»Schwarz! Schwarz! Schwarz! Simon! Bitte!«, bettelte ich, doch alles, was ich bekam, waren noch mehr Schläge. Unzählige. Irgendwann vergaß ich zu zählen. Der Schwindel wurde schlimmer. Ich atmete durch die Nase ein und durch den Mund aus in der Hoffnung, dass es besser werden würde. Das wurde es jedoch nicht.
»Verdammt, das Mädchen kann schreien.« Ein weiterer Mann grölte belustigt. Oder war es der gleiche, der beim ersten Mal gesprochen hatte? Ich hatte keine Ahnung. Die Stimmen vermengten sich zu einer einzigen Geräuschkulisse. Ich vernahm Gelächter, Pfiffe, ein Klatschen.
»Bereit für das große Finale, Baby?« Simon glitt mit der Spitze des Rohrstocks meinen Hintern entlang und nach oben. Er zeichnete meine Wirbelsäule mit dem Holzstab nach und brachte mich damit wieder zum Zittern.
Bei jedem Millimeter befürchtete ich, dass er den Stock heben und auf einen meiner Wirbel schlagen würde.
»Nein.« Ich schluchzte. Meine Tränen vermischten sich mit der Flüssigkeit, die aus meiner Nase lief.
»Happy Birthday, Baby, das hast du dir verdient.« Simons Lippen drückten sich auf meinen Rücken. Sein schwerer Atem blies gegen meine Haut, auf der ein Schweißfilm lag. Einzelne Schweißtropfen kitzelten auch an meinen Schläfen. Ich wollte sie wegwischen. Doch meine Arme hingen nutzlos in den Fesseln.
Ich hatte aufgehört, die Schnürung lösen zu wollen. Es kostete mich nur Kraft und führte zu nichts.
»Simon, mach mich los! Schwarz!«, rief ich noch einmal, aber es war, als würde ich überhaupt nichts sagen.
»Du scheinst nicht fest genug geschlagen zu haben«, murrte einer von Simons Freunden, und ich hätte ihm gern über die Schulter einen bösen Blick zugeworfen.
Nein, mehr als das. Ich wollte meine Hände um seinen Hals legen und zudrücken, bis er keine Luft mehr bekam, damit er nur annähernd die Panik verstand, die meinen Organismus flutete. Vielleicht würde er dann nie wieder solche Dinge sagen.
»Ich sagte, du sollst aufhören! Das ist nicht Teil des Spiels! Ich brauche Hilfe! HILFE!« Mein Kreischen hallte durch den Raum und übertönte hoffentlich die Musik, die im Hintergrund gespielt wurde. Sie drang aus dem Hauptraum zu uns nach hinten in das abgegrenzte Zimmer, das Simon nur den roten Raum genannt hatte.
»Muss ich dich erst knebeln, damit du die Klappe hältst? Ich sagte, du sollst ruhig sein!« Simon schnaubte. Er schlug mich erneut mit dem Rohrstock und traf wieder auf mein Steißbein. Erneut zuckte ich zusammen, sodass mir erst einen Moment später die Ironie in seinen Worten auffiel.
Nein, er hatte zuerst befohlen, dass ich still war, mich dann bestraft, obwohl ich keinen Ton von mir gegeben hatte, und als ich mich verteidigt hatte, war es ihm egal gewesen, dass ich gesprochen hatte, bis er einen Grund gebrauchte hatte, um mich nun weiter zu verprügeln und zu erniedrigen.
Seine Befehle waren nicht linear. Er legte sie aus, wie sie für ihn passten, sodass ich nichts richtig machen konnte. Es war frustrierend und gab mir das Gefühl, nie genug zu sein. Egal, was ich tat. Ich konnte mich noch so bemühen, es würde niemals reichen.
Ich hob den Kopf an. »Simon, bitte! Nur eine kurze Pause, ich ... Mir ist schwindelig.« Ich bekam keine Luft. Das Atmen fiel mir schwer. Ich schnappte nach Sauerstoff, zog ihn in meine Lunge, aber das Organ verengte sich statt sich zu weiten. Ich spürte, wie sich in mir alles verkrampfte. Meine Lider fielen zu.
»Du sollst aufrecht stehen.« Simon packte meine Hüfte und wollte mich wieder nach oben ziehen. Es klappte jedoch nicht. Zwar schaffte er es, dass mein Körper sich in die ursprüngliche Position zwingen ließ, doch sobald Simon seine Hände von mir nahm und mich nicht mehr stützte, fiel ich wieder zu Boden.
»Ich fühle mich nicht gut.« Als ich diesmal würgte, wurde der bittere Geschmack in meinem Mund stärker. Mit aller Kraft öffnete ich die Augen wieder. Die Tränen waren mittlerweile versiegt. Nicht, weil ich nicht mehr traurig war, sondern mein Körper keine Energie mehr hatte.
»Weiter, Baby, du machst das großartig!« Simon machte einfach weiter. Er musste bemerken, dass etwas nicht stimmte. Keine Ahnung, was gerade mit meinem Körper geschah, aber es war nicht gut.
»Wenn du brav bist und das für mich aushältst, ficke ich dich danach noch und lasse dich kommen.«
»Und wenn nicht?« Die Worte kamen erschöpft und trotzig über meine Lippen. Meinen Kopf legte ich auf meinen Oberarmen ab. Er fühlte sich schwer an. Wie eine Last, obwohl er ein Teil von mir war.
»Dann darf mein Mädchen mir wenigstens den Schwanz lutschen.« Simon ließ es wie etwas klingen, über das ich mich freuen sollte. Doch allein der Gedanke daran widerte mich an. Abgesehen davon schmerzte mein Kiefer noch vom letzten Mal. Genau wie meine Mundwinkel, die eingerissen waren. Ich hatte die Stellen mit Lippenstift verdeckt, aber ich spürte das Ziehen bei jeder Bewegung meines Mundes.
»Hör auf!« Diesmal klangen die Worte nicht wie ein Flehen oder eine Bitte, sondern wie ein Befehl. Er sollte aufhören. Sofort.
»Ich will das nicht.« Nichts davon. Nie wieder. Ich wollte nicht mehr hier sein. Nicht bei ihm. Er sollte mich einfach in Ruhe lassen. Ich hatte mir einen Partner gewünscht, der mich liebte und mit dem ich ausprobieren konnte, was genau mir gefiel.
Simon hatte mir nur gezeigt, was ich nicht wollte. Und damit war Schluss. Es musste Schluss sein. Ansonsten ... wusste ich nicht mehr, was ich tun sollte.
»Verdammt, runter mit diesem Slip!«, forderte Simon, packte meinen String und zog daran, als würde er seine Drohung gleich jetzt wahrmachen wollen. Er würde mich ficken. Ohne meine Zustimmung. In diesem roten Raum. Gefesselt. Vor all den Männern, die ich vor dieser Nacht noch nie gesehen hatte.
»Nein, bitte! Du machst mir Angst!« Das tat er wirklich. Simon war nicht viel größer als ich und auch nicht muskelbepackt, dennoch war er mir körperlich überlegen und leider nicht nur physisch. Auch sonst.
Er hatte Geld, das mir fehlte. Er hatte eine Familie, Beziehungen, Freunde, während ich die letzten drei Jahre auf seinen Wunsch das Haus nicht verlassen hatte. Zuerst hatte ich nicht gewollt aus Panik, meinem Stiefvater zu begegnen, aber dann hatte Simon immer gute Gründe genannt, wieso ich nicht rausgehen sollte.
Und das Ende vom Lied war, dass ich weder eine eigene Unterkunft noch einen Job, noch meine alten Freunde hatte. Niemanden, auf den ich mich verlassen konnte. Keinen, der mir half. Ich war allein. Mutterseelenallein.
»Bitte, Schwarz! Hör auf!«, bettelte ich und hob schwerfällig den Kopf. Ich warf ihm über die Schulter einen Blick zu, doch er bemerkte ihn nicht einmal. »Hör auf!«
»Sei still!«, befahl Simon und ließ endlich den Rohrstock fallen. Dass er es nur tat, damit er mit beiden Händen nach meiner Unterwäsche greifen konnte, erkannte ich erst, als seine Finger bereits daran zerrten. »Bei deinem Geheule kann ich dich kaum verstehen.«
»Simon«, kreischte ich und zeitgleich begannen wieder die Tränen zu fließen. Ein letztes Mal, bevor der Stoff des Strings nachgab und in Fetzen gerissen wurde, die auf den Boden segelten, sodass er mir auch noch das letzte bisschen Sicherheit nahm. Luft drang an meine Mitte. Mein Körper erbebte. Ergeben schloss ich die Augen und wartete darauf, dass Simon ...
»Was ist hier los?«
Simon hielt inne. Die Schläge hörten auf. Endlich. Dennoch hämmerte mein Herz weiterhin rasend schnell in meiner Brust. Diesmal lag es jedoch nicht an der Angst, die Simon verursacht hatte, sondern an dem rauen, anklagenden Unterton in der fremden Stimme.
Scham überkam mich, als mir klar wurde, dass mein Retter mich auf diese Weise sehen konnte. Gefesselt, schreiend, nackt. Was er wohl über mich dachte?
Vermutlich war es besser, es nicht zu wissen. Eines war mir allerdings sofort klar. Auf keinen Fall wollte ich, dass mich jemals wieder jemand in so einer Lage sah. Schwach, machtlos, weinend und unglücklich.
Ich musste von Simon weg. Ihn verlassen. Selbst wenn es am Ende mein Leben kostete, denn es war besser auf der freien Straße zu sterben als angekettet in einem Keller.
Kapitel 2: Miles
»Du machst mir Angst!« Die zarte, panische Stimme drang nur leise durch die Musik des Clubs und das Klirren, das die Gläser von sich gaben, an mein Ohr, während ich den Geschirrspüler ausräumte und eine Bestellung nach der anderen entgegennahm. Sie war nicht mehr als ein Wimmern. Kaum wahrnehmbar. Als würde ich sie mir nur einbilden.
Shit, wahrscheinlich tat ich das auch, doch sie ließ mich dennoch nicht los. Ich servierte das nächste Bier an einen bulligen Mann in einem Lederoutfit, das er wohl gebraucht gekauft hatte, weil es an einigen Stellen zu eng war, doch im Hinterkopf hatte ich immer noch die mysteriöse Stimme.
Wie eine kaputte Schallplatte spielten sich die Worte wieder und wieder in meinem Kopf ab. Vielleicht hatten Elijah, Eileen und Aiden doch recht. Vermutlich sollte ich wirklich in Therapie gehen, wenn ich begann, mir Stimmen einzubilden, die nicht da waren.
Allerdings konnte ich mir nicht vorstellen, noch mehr Zeit meines Lebens in einem kleinen Raum zu sitzen und über meine Gefühle zu sprechen. Im letzten halben Jahr hatte ich kaum etwas anderes getan. Nichts davon würde mir Amanda zurückbringen. Sie war weg. Für immer. Und ich war noch hier. Damit musste ich umgehen. Irgendwie.
Nicht nur für mich, sondern auch für meine Geschwister. Sie brauchten mich, so wie ich sie brauchte. Ich hatte versucht, alles ohne sie zu machen, doch daran war ich gescheitert. Es hatte dafür gesorgt, dass ich mich am Ende allein, schwach und nutzlos gefühlt hatte. Etwas, das ich nie wieder empfinden wollte.
Deshalb schob ich den Gedanken an die Stimme beiseite und machte weiterhin meine Arbeit. Dafür war ich schließlich hier. Wir hatten zu wenig Personal und bis sich das änderte, musste irgendjemand Eileen hinter der Theke helfen. Ich war zwar immer noch der Meinung, dass jeder andere besser dafür geeignet wäre als ich, aber das hatte meine Geschwister wenig interessiert. Sie sagten, sie wollten mich in der Nähe haben – jetzt, wo ich wieder zu Hause war.
Die Wahrheit sah jedoch anders aus. Sie wollten mich im Auge behalten für den Fall, dass ich wieder durchdrehte. Wir alle wussten das, auch wenn es keiner aussprach. Mich rührte ihre Sorge, auch wenn sie unbegründet war. Es ging mir ... passabel. Nicht gut, das wäre übertrieben, aber ich hatte nicht mehr das Bedürfnis, eine der Flaschen zu exen in der Hoffnung, dass der Schmerz verschwinden würde, den ich empfand.
Nein, ich hatte mich lange genug betäubt. Das Leben musste weitergehen. Wenigstens das von mir, wenn Amanda schon nicht mehr die Möglichkeit hatte, sich ihre Träume zu erfüllen. Ich liebte den Club. Mehr als alles andere. Und ich würde seinem Ansehen nicht länger schaden, nur weil ich nicht aufhören konnte, zu trinken und danach mit Menschen zu streiten, die mir am Arsch vorbei gehen konnten.
Egal, wie schwer mir das auch fallen mochte. Ich musste ein besserer Mensch sein. Stärker. Alkohol war keine angemessene Strategie. Das hatte ich bei meinem Aufenthalt im Entzug gelernt. Das und die Tatsache, dass ich manche Dinge einfach nicht ändern konnte. Nicht, wenn ich nicht darin involviert war.
Ich hatte nichts mit Amandas Tod zu tun gehabt. Sie hatte selbstständig diese Welt verlassen wollen, ohne mit mir über ihre Probleme zu sprechen. Das war ihre Entscheidung gewesen. Ich hätte nichts dagegen tun können, weil ich nicht gewusst hatte, was sie quälte. Es war nicht meine Schuld.
Rational wusste ich das mittlerweile, und dennoch ... Es war schwer, das Gefühl abzulegen. Sie war weg. So wie alles, was ich gekannt hatte. Alles hatte sich gewandelt. Ein halbes Jahr war überraschend lang, wenn man es abgeschieden von der Welt in einer Klinik verbrachte, um trocken zu werden.
Tief seufzte ich und füllte das nächste Glas. Wenigstens hatte sich hinter der Bar nichts verändert, auch wenn der Rest des Clubs seit der Expansion kaum wiederzukennen war.
Doch zumindest die Flaschen standen noch an ihrem alten Platz, sodass meine Hände wie von selbst nach den richtigen Hälsen griffen und ich den Cocktail mischte, den die Dame im roten Kleid bestellt hatte. Zu ihren Füßen saß ein Mann, dem wohl das Wasser gehören würde, das dazu geordert worden war. Wasser. Trinken.
Richtig, ich sollte auch irgendwas trinken. Automatisch griff ich nach einem Bier. Meine Finger legten sich um die kühle Flasche, doch ich hielt sofort inne. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Erst jetzt merkte ich, wie ausgetrocknet sich mein Mund anfühlte. Im Club war es heute stickiger als sonst. Wir hatten auch mehr Besucher. Nach unserer kurzen Sommerpause, die Elijah im letzten halben Jahr neu eingeführt hatte, um die Bauarbeiten in Ruhe beenden zu können, hatten viele Clubmitglieder ihren Weg zur großen Eröffnung wieder hergefunden.
Ich atmete durch. Ein und aus. Dann löste ich meine Hand von der Flasche und schnappte mir stattdessen zwei Gläser. Ich füllte sie auf, schob eines davon mit dem fertigen Cocktail zu dem Paar auf der anderen Seite der Theke und leerte anschließend das übrig gebliebene Wasserglas. Die Flüssigkeit fühlte sich angenehm kühlend in meinem Mund an und verdeutlichte die Hitze, die sich in meinem Körper angestaut hatte.
Schweiß perlte über meine Stirn. Ich wischte die Tropfen mit meinem Handrücken zur Seite und sah mich suchend nach Eileen um, damit sie mich ablöste. Ich brauchte dringend eine Pause. Nur für einen Moment. Nicht unbedingt, weil mir die Luft ausging oder ich den Ansturm der Gäste nicht allein hätte bewältigen können, sondern weil mir die vielen Geräusche, die große Masse an Menschen und die feierliche Atmosphäre nicht behagten.
Die Musik war zu laut, die Gäste zu nah und ich wollte nur noch weg, weil mich trotz der ganzen Veränderungen alles an Amanda denken ließ. Wie oft hatte sie hinter dieser Theke gestanden und die gleichen Handgriffe getätigt? Wie häufig hatte sie sich zwischen den Gästen durchgeschlängelt, um leere Gläser abzuräumen? Wie viele Male war sie mit einem Grinsen im Gesicht auf mich zugekommen und hatte ihre Arme um mich geschlungen, nur weil wir uns einen halben Tag nicht gesehen hatten?
Amanda hatte zum Club gehört. Zu mir. Und nun war sie weg. Ich seufzte tief. Fuck, wie sollte ich auch nur ans Feiern denken? Mir war nicht danach zu tanzen, mit den Gästen zu sprechen oder zu lächeln. Zum Glück waren alle so mit sich selbst oder ihren Spielpartnern beschäftigt, dass sie gar nicht mitbekamen, dass ich ...
»Bitte, Schwarz!« Erneut ertönte die Stimme. Sie klang gequält und verängstigt. Ich runzelte die Stirn. Bildete ich sie mir wirklich nur ein? Ich wusste es nicht. Konzentriert lauschte ich erneut, doch das letzte Lied war gerade verstummt und inzwischen hallte das nächste aus den Lautsprechern. Nur dazwischen hatte ich die flehenden Worte vernehmen können. Ein ungutes Gefühl beschlich mich. Schwarz. Es gab nur einen Grund, dieses Wort in diesem Club zu schreien. Und ich hoffte wirklich, dass ich nur paranoid war und Gespenster sah, wo keine waren, denn sollte sich meine Vermutung bestätigen, würden in Kürze Köpfe rollen.
Nicht meiner, sondern von demjenigen, der offensichtlich ein Nein nicht von einem Ja unterscheiden konnte. Wie das Arschloch, das Amanda vergewaltigt hatte. Immer wieder. Er hatte sie erpresst, sie genötigt und sie in die Knie gezwungen. Aus dem strahlenden, fröhlichen Mädchen war eine bittere, verängstigte Frau geworden, bis sie sich selbst nicht mehr ertragen hatte. So was sollte niemandem passieren. Nie wieder. Nicht in meinem Club.
Ich stellte mein Glas ab, sah mich noch einmal nach Eileen um, die jedoch nicht zu sehen war und marschierte einfach aus dem Barbereich. Die Kasse war ohnehin abgeschlossen, und wenn sich irgendwer am Alkohol bediente, während ich weg war, konnte ich es nicht ändern. Doch ich musste mich versichern, dass alles in Ordnung war. Egal, wer geschrien hatte, sie brauchte Hilfe. Unterstützung, die Amanda nicht bekommen hatte.
Mit schnellen Schritten drängte ich durch die Menge und stieß dabei mehr als einmal mit jemandem zusammen. Einer der Männer, die ich anrempelte, öffnete den Mund und wollte mich anschreien, doch er verstummte, als er erkannte, wer ich war. Danach machte er mir einfach Platz, sodass ich meinen Weg fortsetzen konnte. Zielstrebig ging ich auf das Ende des Hauptsaals zu, wo ein Durchgang zu den Zimmern führte. Früher war es nur ein Raum gewesen. Inzwischen waren es mehrere. Ich hatte sie erst einmal gesehen und fühlte mich unwohl, genau in das Zimmer zu gehen, in dem Amanda schlussendlich gestorben war, doch der Schrei war aus dieser Richtung gekommen. Ich überwand mein Unbehagen und schritt durch den Durchgang.
Inzwischen war es wieder ruhig geworden bis auf die leise Hintergrundmusik, die sich mit dem Klatschen von Schlägen mischte. Kein ungewöhnlicher Ton in diesem Club. Hatte ich vielleicht nur ein Paar gehört, das miteinander spielte und ich machte mehr daraus, als es eigentlich war? Reagierte ich über?
Fuck, ich wusste es nicht. Mir war nur klar, dass ich keine Frau mehr im Stich lassen wollte. Nicht schon wieder. Doch dabei verlor ich wohl langsam den Verstand.
Ja, Amandas Schicksal war schlimm gewesen. Tragisch. Aber einmalig. Jeder Mensch entschied anders. Jede Person hatte ihren eigenen Willen. Amanda hatte eine Wahl getroffen. Ihre Strategie war es gewesen, sich zu töten, um von ihrer Realität zu fliehen. Meine war es gewesen zu trinken, bis ich auf der Schwelle zwischen Tod oder Leben stand.
Sie konnte ihre Entscheidung nicht mehr ändern. Ich meine allerdings schon. Ja, meine Wahl war auf den Alkohol gefallen und nun hatte ich entschieden, keinen mehr zu konsumieren. Es klang einfach, auch wenn es das natürlich nicht war. Noch immer kämpfte ich mit dem Verlangen nach der Taubheit, die nur der Alkohol mir schenken konnte und nun bildete ich mir anscheinend auch noch Stimmen ein, die nicht da waren. Aber das war in Ordnung. Ich musste nur einen Tag schaffen. Einen und noch einen, bis es eine Woche war. Dann ein Monat. Und ein Jahr.
Kurzzeitig glaubte ich wirklich, mich geirrt zu haben. Ich wollte schon umdrehen und zurück zur Bar gehen, um mir den Anschiss meines Lebens von Eileen abzuholen, weil ich die Theke einfach allein gelassen hatte. Doch ein Wimmern ließ mich innehalten.
Ich schluckte schwer. Noch immer fühlte sich mein Mund trocken an, obwohl ich gerade erst etwas getrunken hatte. Es war nur nicht das Richtige gewesen. Wasser konnte die Art von Durst nicht stillen, die ich empfand.
»Was ist hier los?«, brüllte ich und riss die Augen auf, als ich in das Zimmer starrte. Sofort war der Gedanke an Eileen wie weggefegt. Sie könnte mich danach gern lynchen, wenn sie wollte, aber für nichts auf dieser Welt hätte ich mich umgedreht und wäre wieder zurück an die Bar gegangen. Nicht mit dem Schrecken, der sich direkt vor meinen Augen abspielt.
Im ersten Moment sah es harmlos aus. Wie eine einfache Szenerie, die man in einem BDSM-Club erwarten würde. Doch ich wusste es besser. Im roten Raum waren mehrere Männer versammelt. Ohne sie bewusst zu zählen, erkannte ich, dass es fünf sein mussten. Vier davon saßen auf den Sitzmöglichkeiten verteilt, während einer hinter einer Frau stand. Ihr Körper war verkrampft. Sie kniete auf dem Boden, obwohl ihre Arme nach oben gefesselt waren. Das Seil war für diese Position viel zu kurz gehalten. Der Druck auf ihre Handgelenke musste enorm sein. Schmerzhaft. Außerdem hatte niemand ein Kissen unter ihre Beine gelegt, um ihre Kniescheiben zu schützen.
Sie trug nur noch einen BH. Der Rest ihrer Kleidung lag um sie herum verstreut. Was mich jedoch am meisten beunruhigte, war der schuldbewusste Blick des Mannes, der hier stand und zu mir sah.
Alles andere wäre erklärbar gewesen, aber der Ausdruck in seinen Augen ... Er blickte mich an, als wäre ich ein Henker und er auf dem Weg zum Schafott. Er hatte etwas Falsches gemacht. Das wusste ich mit jeder Faser meines Seins, sobald ich ihn gesehen hatte. Doch er blieb still. So wie alle anderen. Die Männer starrten mich einfach nur an. Manche mit glasigem Blick, andere verengten die Augen zu Schlitzen und musterten mich. Leere Gläser und Alkoholflaschen türmten sich auf dem einzigen Tisch im Zimmer.
Irgendwer musste eine der Flaschen umgeworfen haben, denn der Gestank nach Bier lag in der Luft und auf der Tischplatte waren nasse Flecken zu erahnen. Der Duft nach Alkohol war überwältigend. Es war klar gewesen, dass ich es schwerer haben würde, trocken zu bleiben, wenn ich im Club war, aber fuck! Ich war nicht darauf vorbereitet gewesen, wie sehr ich mich nach einem Tropfen sehnen würde. Die Trockenheit in meinem Mund nahm zu, und ein Ziehen breitete sich in meinem Magen aus, als wollte mich mein Körper dazu überreden, endlich Alkohol in meinen Hals zu schütten.
»Ich habe euch eine Frage gestellt.« Meine Stimme donnerte durch den Raum, während ich tief ein- und ausatmete und versuchte, dem Drang nach Alkohol zu widerstehen.
»Wir feiern nur ein bisschen«, krächzte der Mann hinter der Frau und hatte den Anstand, seine Finger von ihrem Hintern zu nehmen. Er trat einen Schritt von ihr weg und hob entwaffnend die Hände.
Die unteren Verletzungen am Körper der Frau, die von der Peitsche und dem Rohrstock rühren musste, die neben ihr auf dem Boden lagen, wirkten schon älter und deutlich heller, während die Wunden zur Mitte hin immer dunkler wurden. Frischer. Scharf sog ich die Luft ein, als ich auch Spuren oberhalb ihrer Hüfte entdeckte. An ihrem Steißbein. In der Höhe ihrer Nieren.
Verdammt! Was jemand zu Hause tat, kümmerte mich einen Scheißdreck, aber die oberste Regel des P&Ps war Safe, Sane, Consensual. Nichts daran war sicher, in die Nähe von wichtigen Organen zu schlagen, und vernünftig war es auch auf gar keinen Fall. Damit hatten sie schon einmal zwei von drei Teilen des Konzepts nicht eingehalten. Fehlte noch ein letzter Part. Die Einvernehmlichkeit, und bei der war ich mir ebenfalls nicht sicher, ob sie gewährleistet war.
»Ach ja, und was? Eine Vergewaltigung?« Mein Ton war scharf. Unfreundlich. Vorverurteilend. Vielleicht stand die rothaarige Frau jedoch genau darauf. Beobachtet zu werden, während sie wehrlos in Seilen hing und nichts tun konnte als die Prozedur über sich ergehen zu lassen. Ich glaubte es aber nicht. Ihre Haltung war dafür zu steif, zu schmerzerfüllt. Ihr Kopf lag erschöpft auf ihren Oberarmen.
Selbst wenn sie es wollte, müsste ihr Dom ihr eine Pause verordnen. Sie brauchte dringend eine Auszeit. Das konnte jeder Blinde erkennen.
»Dieses Zimmer ist nur mit vorheriger Reservierung für Gäste exklusiv zugänglich.« Die Worte kamen emotionslos über meine Lippen, während ich meine Blicke nicht vom Antlitz der Frau lösen konnte. Sie war dünn. Zu dünn. Krankhaft dünn. Unter ihrer Haut konnte ich hervorstehende Knochen erkennen, die auch die zahlreichen Tattoos auf ihrem Körper nicht verstecken konnten.
Dennoch war sie wunderschön. Ihre Haltung war perfekt trotz der Blessuren, dem Zittern und der falschen Fesselung. Ihr Rücken war durchgestreckt, ihre Knie bildeten eine Linie mit ihren Brüsten, die ein wenig über ihren BH quollen. Auf dem Ansatz ihrer linken Brust war der Anfang eines Tattoos zu erkennen, das unter dem schwarzen Stoff verschwand und danach wieder an ihrem Bauch auftauchte.
Ich konnte nicht ganz sagen, was es darstellen sollte, doch die violetten und blauen Farben passten zu ihrem strahlend roten Haar, das wirr über ihren Kopf verteilt war.
»Wir haben den Raum für eine Geburtstagsparty gebucht.« Verteidigend verschränkte das Arschloch hinter der Frau die Arme vor der Brust. Er spannte die Muskeln sichtlich an, doch sie waren kaum zu erkennen. Entweder trainierte der Typ nicht viel oder gar nicht.
Es war nicht zwingend notwendig, als Dom ins Fitnessstudio zu gehen. Viele unterschätzten allerdings, wie kräftezehrend es sein konnte, einen anderen Menschen zu schlagen. Es war körperliche Arbeit – überhaupt dann, wenn es richtig gemacht wurde.
Man durfte nicht einfach nur zuschlagen und das Beste hoffen. Nein, jeder Schlag war genau kalkuliert. Zum Glück hatte Eileen das Fortbildungsprogramm während der Expansion auch aufgestockt. Wir hatten nun doppelt so viele Mitglieder, also war das dringend notwendig. Ich wusste, dass sich auch der Bewerbungsprozess geringfügig geändert hatte. Es gab immer noch die Möglichkeit, sich auf normalem Wege zu melden, ein Einzelgespräch mit einem von uns Inhabern zu führen und sich damit als Mitglied zu qualifizieren. Doch die Alternative war nun, mit einem Mitglied in den Club zu kommen, das für einen bürgte.
Kein schlechtes Konzept, aber auch nicht das Beste, wie man an diesen Karikaturen an Männern sah, die anscheinend keine Ahnung hatten, was genau sie hier eigentlich taten. Wer sie wohl angeschleppt hatte? Derjenige würde seine Mitgliedschaft verlieren. So viel stand fest.
»Wer hat Geburtstag?«, fragte ich und trat noch einen Schritt weiter auf die Frau zu. Das Beben ihres Körpers ließ langsam nach. Ihre Schienbeine rutschten ein Stück auseinander. Sie keuchte vor Schmerz.
»Sie.« Er deutete auf die Frau vor sich. Ihr rotes gelocktes Haar verdeckte weiterhin die Sicht auf ihr Gesicht.
»Wie ist ihr Name?«, fragte ich und machte einen Schritt auf die Frau zu. Das Arschloch plusterte sich jedoch auf und versperrte mir den Weg.
»Das geht dich gar nichts an«, blaffte der Mann und hob das Kinn an. Eine Ader trat an seiner Stirn hervor. Eine ungesunde Röte zog sich über seine Wangen. Er schnaufte. Seine Nasenflügel blähten sich auf. Wütend trat er weiter auf mich zu, bis er vor mir stand.
Dass ich einen halben Kopf größer war als er, schien ihn nicht zu kümmern. Auch dass ich ein Marshall war, schreckte ihn wohl nicht ab. Oder wusste er es vielleicht gar nicht?
Ich trug kein Namensschild. Wofür auch? Jeder in diesem Club kannte mich. Früher zumindest. Vielleicht sollte ich eines tragen, doch die kleine Metallnadel würde mich die ganze Zeit daran erinnern, was geschehen war.
Wie ich Amanda das letzte Mal gesehen hatte, ehe ihre Leiche in Schnüren von der Decke baumelte. Wie ich betrunken durch den Club torkelte, bis ich mich übergab. Überall und nirgendwo, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wo oder wer ich überhaupt war. Wie Elijah mich anschrie, dass ich Hilfe brauchte und ich gleichzeitig wusste, wie recht er damit hatte. Die Erinnerungen überschwemmten mich. Gleichzeitig stieg Ärger in mir hoch, weil dieses Arschloch die Flut an Emotionen in mir ausgelöst hatte, die mich nun heimsuchte.
»Mich geht an, dass ihre Fesseln falsch geschnürt sind. Das Seil einfach statt doppelt zu nehmen ist ein hohes Risiko. Dadurch sperrt man die Blutzufuhr ab. Ihre Finger sind bestimmt kalt. Sie verfärben sich langsam. Der Knoten gehört gelöst.«
Selbstgefällig lachte der Mann auf, auch wenn für den Bruchteil einer Sekunde Unsicherheit in seinen Augen aufleuchtete, als wäre er sich nicht darüber im Klaren, ob ich recht hatte oder nicht.
»Ich brauche keine Ratschläge von einem Nobody. Wir spielen schon seit Jahren und es ist nie etwas passiert.«





























