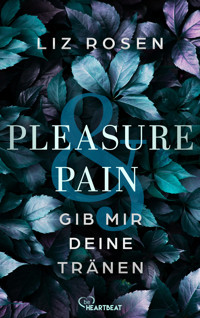4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich will sie glücklich machen, sie besitzen, an ihre Grenzen bringen. Dann gehört sie mir.
Ein Mord im angesagten BDSM-Club Pleasure and Pain ruft Detective Eliana Wright auf den Plan. Sie ist fest entschlossen, den Mord aufzuklären - immerhin ist das Opfer ihre beste Freundin. Dabei braucht sie jedoch die Hilfe des attraktiven Clubbesitzers Aiden Marshall. Aber es fällt ihr schwer, professionell zu bleiben, fühlt sie doch diese schier unwiderstehliche Anziehung zu dem dominanten Mann. Und Aiden hat ganz eigene Pläne: Ihm ist es wichtiger, Eliana seine Welt zu zeigen, als den Mord aufzuklären ...
Der zweite Band der heißen und düsteren Dark-Romance-Reihe um einen exklusiven Club, in dem die geheimsten Fantasien wahr werden.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Triggerwarnung
Playlist
Prolog
Kapitel 1: Eliana
Kapitel 2: Eliana
Kapitel 3: Aiden
Kapitel 4: Eliana
Kapitel 5: Aiden
Kapitel 6: Eliana
Kapitel 7: Aiden
Kapitel 8: Eliana
Kapitel 9: Eliana
Kapitel 10: Aiden
Kapitel 11: Eliana
Kapitel 12: Eliana
Kapitel 13: Aiden
Kapitel 14: Eliana
Epilog: Aiden
Triggerwarnung 2
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Ich will sie glücklich machen, sie besitzen, an ihre Grenzen bringen. Dann gehört sie mir.
Ein Mord im angesagten BDSM-Club Pleasure and Pain ruft Detective Eliana Wright auf den Plan. Sie ist fest entschlossen, den Mord aufzuklären – immerhin ist das Opfer ihre beste Freundin. Dabei braucht sie jedoch die Hilfe des attraktiven Clubbesitzers Aiden Marshall. Aber es fällt ihr schwer, professionell zu bleiben, fühlt sie doch diese schier unwiderstehliche Anziehung zu dem dominanten Mann. Und Aiden hat ganz eigene Pläne: Ihm ist es wichtiger, Eliana seine Welt zu zeigen, als den Mord aufzuklären ...
Der zweite Band der heißen und düsteren Dark-Romance-Reihe um einen exklusiven Club, in dem die geheimsten Fantasien wahr werden.
Liz Rosen
Zeig mir deine Finsternis
Es heißt, das Gehirn würde noch 7 Minuten weiterleben, nachdem wir bereits gestorben sind. 420 Sekunden, in denen unser Verstand uns eine Kurzfassung unseres Lebens zeigt. Bilder von unseren Familien, von Freunden, von Erlebnissen. Frage dich deshalb zukünftig in jedem Augenblick, ob jeder Moment, jeder Streit, jeder Mensch es wert ist, einen Bruchteil dieser 7 Minuten zu sein und dafür auf eine andere Erinnerung zu verzichten. Denn am Ende bleibt uns allen nur diese Zeit. Diese 420 Sekunden.
Triggerwarnung
Willkommen zurück im Pleasure and Pain! Bitte versichere dich vor dem Lesen des Buches, dass potenzielle Trigger der Geschichte für dich ungefährlich sind. Sieh dafür bitte auf der letzten Seite bei den Triggerwarnungen vorbei, ehe du weiterliest.
Playlist
Enemy Fire – Bea Miller
Still Counting – Volbeat
To My Knees – Two Feet
Just Pretend – Bad Omens
Tattoed in Reverse – Marilyn Manson
Champion – Bishop Briggs
HUSH – Ari Abdul
Somewhere I belong – Linkin Park
When The Party’s Over – Billie Eilish
Love Is Embarrassing – Olivia Rodrigo
The Nameless One – Volbeat
No Limits – Royal Deluxe
Let Me Put My Love Into You – AC/DC
The Loneliest – Måneskin
Toxic – 2Wei
We Are Chaos – Marylin Manson
HIGHER – Bishop Briggs
How Did You Love – Shinedown
The Grudge – Olivia Rodrigo
Prolog
Du willst nicht auf mich hören, richtig, kleine Brat? Du bist es nicht gewohnt, die Kontrolle abzugeben, dich dem Willen von jemandem zu beugen und dich in schützende Arme fallen zu lassen. Nein, du hast dein ganzes Leben durchgeplant, warst immer vorsichtig und hast dich sogar vor den Schatten in Acht genommen, die in der Dunkelheit deiner eigenen Seele lauern. Du hast tapfer gekämpft, dich gewehrt, und das darfst du auch gern weiterhin, doch irgendwann musst du die Wahrheit anerkennen. Du kannst dich nicht weiter vor dir selbst verstecken. Oder vor mir. Jetzt bist du nämlich in meinem Reich. Im Pleasure and Pain, und hier herrsche ich. Alles läuft nach meinen Regeln. Du kannst ihnen entweder gehorchen ... oder gehen.
Aber das willst du gar nicht, kleine Brat. Ich kann es an jeder deiner Reaktionen sehen. An dem Glitzern in deinen Augen, wenn meine Hand über den Flogger streicht, ich das Leder anhebe und über deine Haut streichen lasse. An dem Öffnen deiner Lippen und dem Hauchen, das aus deinem Mund kommt, sobald ich das Seil um deine Fußgelenke wickle. Fest und fester, bis du dich nicht mehr bewegen kannst und deine Gegenwehr erstirbt. An dem Zucken deiner Schenkel, wenn meine Zunge auf deren Innenseite trifft, und dem feuchten Glanz deiner Schamlippen.
Gib es zu, Brat! Du wirst nicht gehen. Dafür genießt du es zu sehr, dass ich Macht über dich habe. Und ich werde sie nutzen. Gegen dich, wenn du nicht aufpasst. Also renn, solange du noch kannst. Ansonsten werde ich dich als das bei mir behalten, was du warst, nachdem du einen Schritt in meinen Club gesetzt hast: Mein.
Kapitel 1: Eliana
Es ist unhöflich, Menschen über einen längeren Zeitraum einfach nur anzusehen, ohne etwas zu sagen – das hatte mir irgendwann jemand beigebracht. Ich konnte mich nicht erinnern wer, aber ich hatte es mir gemerkt und mein ganzes Leben lang beherzigt.
Bis jetzt. Denn nun konnte ich nicht anders, als auf Amandas Handgelenk zu starren, das freigelegt worden war, nachdem sie zu ihrem Messer gegriffen hatte. Der dünne Pullover war verrutscht und hatte die Wunden offengelegt, die darunter prangten wie ein gottverdammtes Mahnmal. Die Haut war gerötet, eine Kerbe verlief um ihren Unterarm, die aussah, als hätte jemand sie viel zu lange mit zu engen Handschellen gefesselt. Um die Fesselabdrücke waren Hämatome verteilt, die sich in verschiedenen Stadien der Heilung befinden mussten. Einige waren bereits gelb, andere hatten noch einen dunkelblauen Ton, der im Schein des künstlichen Lichts beinahe lila aussah.
Ich schluckte bei dem Anblick. Er erinnerte mich an früher. An meine Kindheit. Vielleicht musste ich deshalb wieder und wieder daran denken, wie unhöflich ich mich gerade verhielt. Die letzte Frau mit diesen Malen hatte ich auch angesehen.
Stundenlang, während ihr Tränen übers Gesicht geflossen waren und ein unerträglich lautes Klatschen durch die kleine Wohnung hallte – gepaart mit ihren schmerzerfüllten Klagelauten. Das Schreien hatte sich mir ins Gedächtnis gebrannt.
Mittlerweile hätte ich unmöglich sagen können, wieso genau sie geweint hatte, doch ich erinnerte mich noch an die Geräusche und den leeren Blick, der mich aus viel zu tiefen Augenhöhlen getroffen hatte. Und an die vielen Farben auf ihrem Gesicht. Rot, Blau, Grün, Gelb, Lila, Schwarz. So viel Schwarz.
»Hör auf zu starren, Eli.« Amanda lachte und holte mich damit aus der Erinnerung, ehe sie mich in die Tiefe der Dunkelheit ziehen konnte, die ich seit Jahren aus Angst mied, weil ich nicht wusste, was geschehen würde, wenn ich in der Finsternis ankam. Ob ich es jemals herausschaffen würde oder für immer darin gefangen bleiben würde.
»Entschuldige bitte, ich ...« Meine Stimme brach. Die Worte kamen nicht über meine trockenen Lippen und meine Zunge klebte unangenehm an meinem Gaumen.
Schnell räusperte ich mich und schob auch noch die letzten Geister der Vergangenheit zur Seite, bis ich wieder Amanda glasklar vor mir sehen konnte. Und ihr geschundenes Handgelenk.
»Es sieht aus, als hätte es wehgetan.« Das Räuspern hatte nicht geholfen. Noch immer klang meine Stimme seltsam belegt, aber diesmal schaffte ich es wenigstens, meinen Satz zu beenden, ehe ich mein Glas nahm und daran nippte. Das kühle Wasser fühlte sich erfrischend auf meinen Lippen an und verdrängte das trockene Gefühl in meinem Mund, doch dem Kloß in meinem Hals hatte es nichts entgegenzusetzen.
»Das hat es.« Wieder lachte Amanda, doch diesmal legte sie ihr Messer zur Seite und griff stattdessen mit den Fingern nach dem Stoff ihres Pullovers, um die Verletzungen vor meinen Blicken zu schützen. Der Ton, in dem sie sprach, klang aufrichtig. Belustigt. Doch der ernste Ausdruck in ihren Augen wollte nicht zu dem heiteren Klang passen. Nur den Bruchteil einer Sekunde später verstummte ihr Gelächter und sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her, als würde sie am liebsten aufstehen und gehen. »Wir haben darüber gesprochen, erinnerst du dich?«
Schuldgefühle stiegen in mir hoch. Sie sollte sich nicht unwohl fühlen. Schon gar nicht meinetwegen. Das war das Letzte, was ich mit diesem Treffen bewirken wollte. Ich hatte Amanda schließlich eine Ewigkeit nicht mehr gesehen.
»Ja.« Das hatten wir. Mehrmals. Bereits als mir die Spuren auf ihrem Körper das erste Mal aufgefallen waren. Es war Zufall gewesen, dass wir uns beim Einkaufen getroffen hatten, aber ich hatte die Anzeichen sofort erkannt. Ihre steife Haltung, das Ausweichen und Zurückzucken vor anderen Menschen aus Angst, jemand könnte die Wunden unbeabsichtigt berühren, und der gehetzte Blick in Zusammenspiel mit der Scham.
Ich hätte erwartet, dass Amanda es abstreiten würde, behaupten, dass es nicht so war, wie es aussah sondern sie auf der Treppe ausgerutscht oder unbeabsichtigt gegen den Türrahmen gelaufen wäre.
Aber das hatte sie nicht. Sie hatte mich in ein stilles Eck gezogen und mir gesagt, dass ich recht hatte. Dass sie geschlagen wurde. Und dass sie es liebte. Jeden Hieb, jeden schmerzhaften Stich, weil nur das bittersüße Gefühl dazu führte, dass sie sich gänzlich fallen ließ und sich keine Gedanken mehr darüber machte, was die Gesellschaft von ihr erwartete, andere über sie dachten oder welche Aufgaben auf sie warteten, sobald Jeremy sie wieder aus dem Schlafzimmer ließ.
»Was ist dann das Problem?« Amanda lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und zog meine Aufmerksamkeit damit wieder auf sich. Ja, was war das Problem? Sie hatte mir erklärt, dass Jeremy ihr nie wirklich Schmerzen zufügte und für ihre Sicherheit sorgte. Laut ihr war sie nie wirklich während der gemeinsamen Spielchen in Gefahr durch das Safeword, das sie vereinbart hatten. Jeremy würde bei der Benutzung sofort aufhören – zumindest glaubte Amanda das.
Und genau das bereitete mir Magenschmerzen. Was, wenn er es nicht tat? Wenn er über Amandas Grenzen hinausging, obwohl sie ihm vertraute? Und was, wenn er nicht einmal selbst daran schuld war, weil Amanda einfach nichts sagte? Sie liebte ihn. Jeder Blinde konnte das sehen. Wer versicherte mir also, dass sie wirklich ihr Safeword benutzte, wenn sie nicht mehr konnte oder wollte? Was, wenn sie einfach weitermachte, nur um Jeremy zu gefallen oder ihn nicht zu verärgern?
»Er tut dir weh.« Ob sie es nun wollte oder nicht, machte für mich keinen Unterschied. Nicht wirklich. Was sie taten, war gefährlich. Auch wenn Amanda sich dessen offensichtlich bewusst war und unmöglich die vielen Blessuren auf ihrem Körper übersehen konnte, hörte sie nicht damit auf. Etwas, das ich nicht verstehen konnte. Wieso machte sie das? Es musste doch einen Grund geben, oder nicht?
Amanda verdrehte die Augen und nahm die Arme vom Tisch, um sie vor ihrer Brust zu verschränken. Der ernste Ausdruck in ihrem Gesicht verdunkelte sich weiter und ihre braunen Augen wurden daraufhin fast schwarz, sodass ihre Iriden mit den Pupillen verschmolzen. »Er ist nicht wie Mica. Ich habe meine Zustimmung zu allem gegeben, was Jeremy mit mir macht.«
Ich schluckte. Der Kloß in meinem Hals wurde größer. Er wuchs an, drückte gegen meine Luftröhre und nahm mir für einen Moment die Fähigkeit zu atmen. Schnell nippte ich erneut an meinem Glas, ehe ich es zurückstellte. Doch auch diesmal vertrieb das Wasser nicht das einengende Gefühl, das sich von meinem Hals bis in meine Brust ausbreitete.
»Halt Mica da raus!« Auf keinen Fall wollte ich jetzt über Mica sprechen. Wenigstens der heutige Abend sollte sich um etwas anderes drehen als unsere Zankereien, die nun schon seit Wochen anhielten. Ich brauchte eine Auszeit davon, und ein Mädelsabend war mir deshalb am Vernünftigsten erschienen.
Leider entwickelte sich das Gespräch in eine Richtung, die ich nicht erwartet hätte. Warum konnten wir uns nicht über Schuhe unterhalten? Oder die neueste Mode? Von mir aus auch über den Mordfall, den ich gerade untersuchte und bei dem ich endlich den Schuldigen festgenommen hatte? All das hätte Spaß gemacht.
Über unsere Männer zu reden, erzeugte in meinem Magen allerdings ein unangenehmes Ziehen und plötzlich sah der gebackene Fisch, der vor mir auf dem Teller lag, überhaupt nicht mehr appetitlich aus. Verflucht, mir war der Hunger vergangen. Schon wieder. Dabei aß ich schon wegen meiner stressigen Arbeitstage viel zu wenig.
»Wieso? Wenn du dich in mein Privatleben einmischst, dann sollte ich auch das Recht haben, über deines zu urteilen. Mica ist ein Arschloch und ich verstehe nicht, was du an ihm findest.« Amanda schnaubte. Sie hob eine perfekt gezupfte Augenbraue an und legte den Kopf leicht schief, wodurch sie allerdings mehr ihres Nackens und somit eine Bisswunde an ihrem Hals freilegte. Die Zahnspuren zeichneten sich als gerötete Male auf ihrer Haut ab und waren ebenfalls von blauen Flecken umgeben. Mir drehte es den Magen um.
Seufzend schob ich den Teller von mir weg. Ich würde ohnehin nichts mehr essen, und der Geruch des duftenden Fisches sorgte dafür, dass mein schmerzender Magen grummelte.
»Er liebt mich und ich ihn.« Selbst in meinen Ohren klangen meine Worte hohl. Als hätte ich sie vorgelesen oder eine halbe Ewigkeit einstudiert, damit sie flüssig über meine Lippen kamen.
Dabei war es die Wahrheit, oder nicht? Wir waren seit Jahren ein Paar, und früher hatten wir nie Streit gehabt. Wir waren ein Herz und eine Seele gewesen, und genau so würde es wieder werden, wenn sich alles eingespielt hatte. Es waren einfach nur viele Veränderungen in letzter Zeit gewesen.
Ja, genau, daran musste die Distanz liegen, die zwischen uns herrschte. Richtig? Verflucht, ich hatte keine Ahnung. Es hatte sich viel verändert. Am meisten ich selbst und genau das war das Problem. Ich war müde davon, ständig die Entscheidungen zu treffen und dann zu hören zu bekommen, dass es die falsche Wahl war. Und das musste Mica instinktiv spüren, denn je weniger ich tat, desto mehr beschwerte er sich darüber, was ich alles noch nicht erledigt hatte.
Amanda schüttelte den Kopf. Wieder huschte ein dunkler Schatten über ihr Gesicht, der ihre blasse Haut kränklich wirken ließ. »Wirklich? Das glaube ich nicht. Jeremy liest mir jeden Wunsch von den Lippen ab und versucht alles, um mir zu geben, was ich will – selbst wenn es ihn aus seiner eigenen Komfortzone holt. Wir reden über unsere Bedürfnisse, über unsere dunkelsten Geheimnisse. Kannst du das von Mica und dir auch behaupten?«
Fragend sah sie mich an, während ihr eine ihrer violetten Strähnen in die Stirn fiel – direkt vor ihr linkes Auge. Ich starrte auf die Locke, um Amanda nicht direkt anblicken zu müssen. Sie hatte recht. Na gut, zum Teil. Niemand sollte in einer Beziehung aus seiner eigenen Komfortzone geholt werden, immerhin sollte man sich in einer Partnerschaft vor allem geborgen, geschützt und sicher fühlen, doch ihre Argumentation war nicht schlecht, denn eine Beziehung sollte auch der Ort sein, an dem man alles sagen konnte, ohne Angst davor haben zu müssen, verurteilt zu werden.
Erneut schweiften meine Gedanken an diesem Tag in die Vergangenheit ab. Zu Mica und dem Gespräch über meinen Wunsch nach mehr Nähe. Es war keine große Sache gewesen. Nichts, was wir nicht hätten umsetzen können. Ich hatte nur gewollt, dass wir nach dem Sex liegen bleiben – ein einziges Mal – und nicht aufspringen, um uns den Schweiß vom Körper zu waschen. Ich hatte unsere Verbundenheit riechen und fühlen wollen.
Aber Mica hatte gelacht, als hätte ich einen Witz gemacht. Einen schlechten. Er war aufgestanden und hatte die Dusche aufgedreht, während ich noch einen Moment in den Laken gelegen hatte, nur um mich einen Moment später aus dem Bett zu rollen und die Matratze abzuziehen. Ich hatte die Szene noch genau in Erinnerung, doch ich hatte keine Ahnung mehr, wie ich mich in diesem Augenblick gefühlt hatte, als hätte ich überhaupt nichts gespürt. Vielleicht war es auch so.
»Nein, aber mein Verlobter drückt mich nicht auf den Boden, bespuckt mich und schlägt mit einem Holzbrett oder einer Peitsche auf mich ein.«
Er sagte mir nur immer wieder, dass ich nicht ausreichte. Ich war nicht fleißig, hübsch, stark oder gut genug. Dabei war ich eine der jüngsten Kriminalbeamtinnen und löste mehr Fälle als irgendein anderer Kollege. Das allein war jedoch nicht zufriedenstellend. Nicht für Mica.
Ich hatte keine Ahnung, was genau er von mir wollte, doch irgendwas passte nicht. Ich wusste es. Tief in meinem Inneren. Ich hatte jedoch keinen blassen Schimmer, was ich ändern sollte und das brachte mich langsam um. Immer weiter zerfraß mich die Situation und ich konnte ihr nicht entfliehen. Als würde ich jedes Mal gegen eine unsichtbare Mauer laufen, wenn ich endlich einen Ausweg gefunden hatte. Ich dachte, die Beförderung wäre die Rettung. Dass er dann sehen würde, was ich leistete, doch da ich nun mehr arbeiten musste, war eher das Gegenteil der Fall gewesen.
»Verlobter?« Amanda riss die Augen auf. Ihr Kiefer klappte nach unten. Sie blinzelte. Mehrfach. Unglaube trat in ihr Gesicht. Nein, das war falsch. Sie sah schon fast verstört aus, als könnte sie nicht glauben, wie ich Mica gerade genannt hatte. Aber es stimmte. Der Ring, der an meinem Finger prangte und an meiner Haut rieb, weil er ein wenig zu groß war, bewies es. Ich würde heiraten. Etwas, das ich immer gewollt hatte.
Irgendwie hatte es allerdings in der Theorie besser geklungen als in der Realität. Ich hatte erwartet, dass ich mich fühlen würde wie die Frauen in den Filmen, wenn der Bösewicht geschnappt war und sie ihr restliches Leben mit dem Helden verbringen durften.
Aber das tat ich nicht. Es war nicht alles perfekt und Probleme lösten sich nicht einfach in Luft auf, nur weil das Ende einer Geschichte nahte. Nein, es ging immer weiter und weiter und weiter, und sobald eine Lösung gefunden wurde, tat sich eine neue Herausforderung auf.
»Er hat mir einen Antrag gemacht und ich hab Ja gesagt.« Ich senkte den Blick und sah statt zu Amanda auf ihren Teller. Auch sie hatte kaum etwas gegessen. Ihre Gabel lag auf dem Porzellan und spießte einen Teil des Fisches auf, den Amanda sich nur noch hätte in den Mund schieben müssen, aber sie machte keine Anstalten das zu tun.
»Wieso?« Sie runzelte die Stirn. Tiefe Furchen bildeten sich in ihrer Haut und sie lehnte sich ein Stück nach vorn, um mich genauer ansehen zu können.
Ich drückte den Rücken durch, um zu verhindern, dass ich unter ihrer Musterung immer kleiner wurde. Es gab nichts, wofür ich mich schämen oder was mir unangenehm sein musste. In unserem Alter war es normal zu ehelichen. Meine Eltern waren zu ihrer Zeit bereits verheiratet gewesen.
Und dennoch hinterließ ihre Frage einen fahlen Beigeschmack in meinem Mund, den ich hinunterspülen wollte. Wieder griff ich nach meinem Glas. Diesmal leerte ich es vollständig, doch der Belag auf meiner Zunge hielt sich hartnäckig.
»Wieso nicht? Es ist der logische nächste Schritt. Wir haben endlich das Haus gekauft, das wir immer wollten, ich wurde gerade befördert und wir haben beschlossen, in den nächsten fünf Jahren unser erstes Kind zu bekommen, immerhin werde ich nicht jünger. Es wäre gut, wenn wir die Hochzeit vor der Schwangerschaft schon hinter uns hätten.«
»Hinter uns hätten?«, echote Amanda und ihre Pupillen wurden, wenn möglich noch größer, während sich ein weiteres Gefühl auf ihrer Miene ausbreitete. Trauer. Sie bemitleidete mich, obwohl sie diejenige mit den Verletzungen war. »Hörst du dir überhaupt zu? Du klingst als würdest du ein paar Geschäftstermine vereinbaren und nicht den schönsten Tag deines Lebens planen.«
»Es ist nur ein Tag von vielen. Die Annahme, dass der Hochzeitstag der schönste von allen im Leben ist, lässt mich am Eheleben zweifeln. Sollten nicht alle Tage großartig miteinander sein?«
Die Hochzeit war der Anfang von etwas und nicht der Höhepunkt, wie es immer dargestellt wurde. Außerdem hatten viele Menschen eine verzerrte Wahrnehmung von diesem Tag, weil er immer als romantisch und wunderschön beschrieben wurde.
Vergessen wurden dabei aber auf die zahlreichen Momente, die schiefgehen konnten, und der Stress, den das Brautpaar an diesem Tag hatte, nur um den anderen Gästen ein unglaubliches Spektakel zu bieten.
Ich hatte gerade erst mit den Planungen begonnen, und schon jetzt war ich nervös wegen all der Stolpersteine, die in einer Katastrophe münden konnten. Angefangen bei der Torte, die jemand umstoßen und somit auf den Boden befördern könnte, bis zu meinem Kleid, das mir eventuell am Tag der Trauung nicht mehr passte, weil ich zu viel abgenommen hatte. Alles keine schönen Aussichten.
Amanda schnalzte mit der Zunge. Der Ton schwankte zwischen Unglaube und Verzweiflung. Das Kopfschütteln wurde schneller.
»Doch, aber darum geht es nicht. Du solltest dich auf die Zeit freuen, es gar nicht erwarten können, endlich vor den Altar zu treten und die Liebe deines Lebens zu heiraten. Ihn in dem Wissen zu küssen, dass er für immer ein Teil von dir sein wird. Wann hast du das letzte Mal etwas Spontanes gemacht, von dem du wusstest, dass es vielleicht nicht das Richtige ist, aber genau das, was du gerade brauchst? Ohne vorher alles durchzuplanen?«
Zählte das Haarefärben in der fünften Klasse, als ich mir eingebildet hatte, mir würden rote Strähnen besser stehen als meine langen blonden Locken? Wahrscheinlich nicht, immerhin hatte ich mir so lange die Farbe ausgewaschen, bis sie kaum noch zu erkennen gewesen war, weil ich schon am nächsten Tag die Entscheidung bereut hatte.
Ich war einfach nicht spontan oder risikofreudig. Das war mir zu unsicher. Lieber plante ich jeden Schritt und hatte immer die Kontrolle über alles, als dass irgendetwas geschah, das mein Leben zerstörte. Verstand sie das nicht?
»Du meinst, wie die Ausbildung mittendrin abbrechen und dafür als Tänzerin in einem dubiosen Club anzufangen?«
Meine Mundwinkel verzogen sich wie von allein in Richtung meiner Ohren, bis ich schmunzelte. Es war Jahre her, doch noch immer erschien es mir wie ein Fiebertraum, dass meine beste Freundin – die Frau, die mich erst dazu gebracht hatte, mich bei der Polizeischule zu bewerben – einfach hingeschmissen hatte, um im Pleasure and Pain anzufangen. Nicht nur der Name des Schuppens war gewöhnungsbedürftig, sondern auch all das, wofür er stand. Dennoch liebte Amanda ihre Arbeit.
Wahrscheinlich mehr als ich meine. Sicher, sie brachte keine Verbrecher ins Gefängnis, aber dafür musste sie sich auch nicht mit Tod und Verderben auseinandersetzen. Tag für Tag für Tag. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es irgendwann einfacher werden würde, doch der Anblick einer Leiche war jedes Mal aufs Neue verstörend.
»Ja, ganz genau!« Amanda erwiderte mein Lächeln. Ihr Mund verzog sich fröhlich, aber der Schatten um ihre Augen blieb. Genauso wie die dicken Ringe, die sich darunter abzeichneten. Hatte sie in letzter Zeit schlecht geschlafen?
»Amanda, nicht alle Menschen sind wie du.« Ich war nie so gewesen, auch wenn ich sie an manchen Tagen dafür beneidet hatte. Sie schien sich nie Gedanken darüber zu machen, was andere Menschen über sie dachten. Sie lebte einfach und richtete sich danach, was sie wollte. Das war der Traum von vielen. Es klang nach Freiheit, aber die wenigsten konnten sich das leisten.
Ich konnte es nicht, solange ich die Schulden im Nacken hatte, die mir hinterlassen worden waren, noch ehe ich alt genug war, um arbeiten zu gehen.
Amanda schnappte sich ihre Gabel, schob sich den aufgespießten Fisch in den Mund und kaute aggressiver als notwendig. Wahrscheinlich hatte sie keinen Hunger, doch durch das Essen erkaufte sie sich einige Sekunden der Stille, ohne dass es zwischen uns unangenehm wurde.
In der Zeit rang sie mit sich. Sie versuchte, eine teilnahmslose Miene aufzusetzen, doch die Falten um ihre Augen verrieten sie. Irgendwas wollte sie sagen, traute sich allerdings nicht, bis sie schließlich ihren Mut zusammenkratzte. »Das erwarte ich auch nicht, und ich habe bestimmt einige falsche Entscheidungen getroffen, mit denen ich nun für immer Leben muss, Eli, aber wenn ich mir dein Leben ansehe, ist es vor allem eins: leer.«
Ihre Worte trafen mich mitten in die Brust. Wie ein Messer bohrten sie sich in mein Inneres, bis meine Lunge protestierte. Ich holte rasselnd Luft. Die Bewegung meines Brustkorbs schmerzte, obwohl keine wirkliche Klinge darin steckte. Nein, die Pein, die ich empfand, kam nicht von meinem Körper, sondern von meiner Seele.
Sie hatte recht. Irgendwas in mir wehrte sich gegen den Gedanken, aber im tiefsten Inneren wusste ich, dass sie die Wahrheit sagte.
»Hast du nicht zugehört? Ich habe ein Haus, einen Verlobten, einen gut bezahlten Job und ...« Erneut brach meine Stimme. Ja, all das hatte ich und nichts davon wollte ich. Das Haus war mir zu groß, die Verlobung zu früh, der Job emotional zu anstrengend, und mir fehlte etwas, das ich nicht einmal beschreiben konnte.
Amanda fand jedoch spielend leicht die richtigen Worte. »Und keine Liebe, kein Verlangen, keine Leidenschaft.«
Ja. Das traf es gut. Ich funktionierte, wie ein Roboter, den jemand fleißig über Nacht an eine Steckdose anschloss, damit er tagsüber alles tat, was von ihm verlangt wurde. Wie hatte es die Supervisorin genannt, die mir nach meinem letzten Mordopfer zugeteilt worden war? Hochfunktionale Depression.
Ich hatte die klassischen Symptome dafür. Die Reizbarkeit, das ständige Grübeln, die innere Leere, die Schlafprobleme, das geringe Selbstwertgefühl und die chronische Erschöpfung. Dazu kam noch das Einigeln. Es war nicht Amandas Schuld, dass wir uns vor Monaten das letzte Mal gesehen hatten. Ich machte einfach nichts anderes mehr als zu arbeiten. Meine Freizeitaktivitäten, mein Privatleben – all das war praktisch tot. Ich wusste das alles, aber ich wollte es verdammt noch mal nicht hören. Nicht heute. Eigentlich niemals.
»Es reicht jetzt, Amanda! Ich lasse mich vielleicht nicht von Mica die ganze Nacht verprügeln und empfinde dabei die größte Wonne, aber unser Sexleben ist befriedigend.«
Lüge! Wir hatten Sex. Manchmal. Nicht, dass ich mich über die Häufigkeit beschweren wollte. Schon jetzt musste ich mich jedes Mal motivieren, mich für Mica auszuziehen, und in den wenigsten Fällen endete unser Bettgeflüster damit, dass ich einen Orgasmus hatte. Aber das ging vielen Frauen so. Es war nichts Besonderes und bedeutete nicht automatisch, dass unsere Beziehung schlecht war. Sie war nur alltäglich geworden, das Feuer war erloschen, wenn es denn überhaupt jemals da gewesen war, doch dafür war eine Glut der Liebe füreinander übrig geblieben.
»In Leidenschaft steckt nicht umsonst das Wort leiden, Eli. Du solltest es wenigstens versuchen, dann würdest mich nicht mehr mit Blicken verurteilen.« Amanda ließ ihre Gabel auf den Teller zurückfallen. Es klirrte. Ich zuckte zusammen, als der Ton sich in mein Gehör bohrte.
»Das habe ich nicht getan! Ich mache mir nur Sorgen um dich. Ist das so verwerflich? Die ganze Zeit starrst du ins Leere und die ganzen blauen Flecken und Striemen helfen nicht gerade dabei, mich zu beruhigen.«
Ruhig atmete ich aus und unterdrückte den Drang, Amanda zu fragen, ob sie einen Arzt brauchte oder sie sich über irgendwas Gedanken machte. Für mich sah es jedenfalls so aus. Wenn die Spiele mit Jeremy ihr die Lebensfreude nahmen, konnten sie nicht gut für sie sein.
Bei unserem letzten Treffen war sie fröhlicher gewesen. Entspannter. Nun zitterte jeder ihrer Muskeln, und ihre Augen wurden immer wieder glasig, als würde sie sich an etwas erinnern. Etwas Schlechtes.
Versöhnlicher lächelte ich sie an und drängte meine eigenen Probleme in den Hintergrund. Es ging nicht um mich, sondern um sie. Amanda sprach es nicht aus, aber ihre Haltung, ihre Gesten und ihre Blicke schrien nach Hilfe. Ich wusste nur nicht, wobei sie Unterstützung benötigte. War irgendwas passiert?
»Nein, du hast recht.« Amanda atmete lautstark aus. »Tut mir leid, Eli. Ich dachte, das Treffen mit dir könnte mich auf andere Gedanken bringen, aber ...« Sie erhob sich abrupt. Ihr Stuhl knarrte über den hölzernen Boden. So laut, dass ich mir sicher war, dass die Stuhlbeine Kerben in dem Parkett hinterlassen mussten. »Ich muss ein paar Sachen regeln.«
»Warte, Am! Lass uns zu Ende essen.« Auch ich sprang auf, beugte mich über den Tisch, bis eine meiner blonden Locken in die Soße fiel, doch es interessierte mich nicht. Gezielt griff ich mit der Hand nach Amandas Unterarm, um sie am Gehen zu hindern.
»Nein, ich ... ich muss etwas erledigen. Es tut mir wirklich leid.« Amanda zog den Arm zurück. Sie versuchte es zumindest, doch ich ließ sie nicht los. Meine Finger gruben sich in ihre Haut und ich suchte in ihrem Blick nach dem Auslöser für ihr Verhalten. Darin fand ich allerdings nur panische Angst.
»Am! Du kannst mir erzählen, was los ist. Ich bin immer für dich da. Das weißt du doch.« Die Schuldgefühle in mir wurden stärker.
Nein, ich war in den vergangenen Monaten eben nicht für sie da gewesen. Ich hatte mich manchmal wochenlang nicht bei ihr gemeldet. Die Verlobung, der Streit mit Mica, die Arbeit – all das war wichtiger gewesen als die einzige Freundin, die ich noch hatte. Ich musste Mica fast dankbar dafür sein, dass er mich zu diesem Treffen genötigt hatte, weil er endlich wissen wollte, wer meine Trauzeugin würde. Verdammt, das hatte ich Amanda nicht einmal gefragt.
»Ich weiß, ich hab nur ...« Amanda schüttelte erneut den Kopf. Unsere Blicke begegneten sich. Stille senkte sich für einen Augenblick zwischen uns, sodass ich beinahe ausblenden konnte, dass wir nicht die einzigen in dem kleinen Restaurant waren.
»Eli, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir vor Gericht geglaubt wird, wenn jemand gegen meinen Willen BDSM-Praktiken an mir vollzieht, obwohl ich in meinem Sexualleben solche ... Dinge ... gern mag?« Amanda stolperte über ihre eigenen Worte. Die Selbstsicherheit, mit der sie sonst über ihr Sexleben sprach, fehlte gänzlich in ihren Sätzen.
Sie hatte ihre Vorlieben nie verheimlicht, nicht vor mir. Sie war immer stolz darauf gewesen, dass sie die Liebe liebte und sie auch körperlich auslebte. Nun wirkte sie jedoch wie eine verschreckte Jungfrau, die Fragen zu ihrem ersten Mal hatte.
»Warum willst du das wissen, Amanda?« Eine dunkle Vorahnung beschlich mich, doch noch konnte ich mir einreden, dass ich wegen meines Berufs immer gleich das Schlimmste vermutete. Wahrscheinlich war das nur natürlich, wenn man sich das ganze Arbeitsleben lang mit den Verbrechen anderer Menschen beschäftigte.
Amanda zögerte. Ihr Mund öffnete und schloss sich gleich darauf wieder. Sie wollte etwas sagen, doch sie tat es nicht. »Ich ... vergiss es!«
»Was soll ich vergessen?«, fragte ich, während sich mein Magen verkrampfte. Meine Eingeweide zogen sich zusammen, bis kein Platz mehr für die Magensäure war und sie nach oben schoss. Sie brannte in meiner Speiseröhre und sammelte sich in meinem Mund. Ich unterdrückte ein Würgen und atmete durch die Nase, um nicht zu ersticken.
Amanda wimmerte. Ein Laut, den ich nie zuvor von ihr gehört hatte. Tränen schossen ihr in die Augen. Das dunkle Braun verschwamm. Sie blinzelte, doch die einzelne Wassertropfen blieben an ihren Wimpern hängen und verrieten den Schmerz hinter ihren Worten. »Es ist einfach schade, dass BDSM immer noch einen so schlechten Ruf hat. Ich bin nicht schuld an meinen Vorlieben, aber der Typ, der sie ausnutzt und gegen mich verwendet, schon, und ich habe keine Chance auf Hilfe, weil mich alle für eine Perverse halten, der es Spaß macht, vergewaltigt zu werden.«
Vergewaltigt. Ich schluckte. Was? Wovon sprach sie? Hatte Jeremy sie etwa ...? Nein, oder? Warum sollte sie ihn dann vor mir verteidigen? Gut, viele Frauen deckten ihre Partner aus Liebe, dabei war die Vergewaltigung auch in einer Beziehung eine Straftat, und das war verdammt gut so.
Eine Vergewaltigung hatte nichts mit Liebe zu tun, oder mit Sex. Es war eine sexuelle Handlung, sexuelle Gewalt und damit genauso Gewalt wie ein Messerangriff. Der einzige Unterschied in der heutigen Gesellschaft war, dass die Opfer einer Messerattacke sich nicht dafür schämten, dass jemand ihnen eine Klinge in den Bauchraum gerammt hatte, während Tausende Frauen den Kopf einzogen, als wäre es ihre Schuld, dass irgendjemand einen Teil von sich gewaltsam in sie getrieben hatte. Bei einem Messerangriff fragte niemand nach der Kleidung des Opfers. Bei einer Vergewaltigung schon.
Blitzschnell griff ich auch noch mit der zweiten Hand nach ihrem Unterarm, ehe sie sich weiter von mir entfernen konnte. Ich wollte sie nicht so gehen lassen. Hilflos. Das passte nicht zu ihr.
»Amanda, das stimmt nicht, wenn dir jemand Gewalt antut, dann ...« Ich verstummte ohne meinen Satz zu beenden, weil ich selbst wusste, dass es keine richtige oder falsche Antwort gab. Nicht in diesem Fall. Das Gesetz war eindeutig. Kein Mensch durfte einem anderen Schaden zufügen, aber nach dieser Regel müssten alle dominanten BDSM-Partner und Partnerinnen verurteilt werden.
Durch den Konsens der Submassiven bewegten diese Menschen sich in einer Grauzone, aber wie sollte man einem Richter oder Geschworenen erklären, dass man die Schläge eines Mannes mochte und die des anderen nicht? Niemand würde Verständnis dafür haben und sie würden Amanda die Schuld in die Schuhe schieben, ihr andichten, dass sie aus Eifersucht oder einem anderen trivialen Grund dem anderen Mann schaden wollte.
Amanda nickte langsam. Verstehend. Ein Schluchzen entrang sich ihrer Kehle. »Ich sagte doch, du sollst es vergessen, Eliana. Zurzeit ist mir einfach alles zu viel.« Eine einzelne Träne quoll über ihr Lid und floss ihre Wange entlang, während sie sich aus meiner Umklammerung losriss, sich ihren Mantel von der Lehne ihres Stuhls schnappte und ihn um ihre Schultern warf, ohne in die Ärmel zu schlüpfen.
»Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Ich will nur, dass du glücklich bist. Bist du glücklich?« Bittend sah Amanda mich an. Ein Hoffnungsschimmer glitzerte in ihren Augen, als wünschte sie sich von ganzem Herzen für mich, dass es mir an nichts fehlte. Genau das war der Grund, wieso wir trotz unserer Unterschiede Freundinnen waren. Jede von uns wollte nur das Beste für die andere. Sie für mich und ich für sie. Vielleicht konnte ich ihr deshalb nicht die Wahrheit sagen und sie damit enttäuschen.
»Ja.« Wieder eine Lüge. Ich war nicht glücklich. Nicht in diesem Moment und auch sonst nicht, aber das Treffen mit Amanda sorgte zumindest dafür, dass die Leere in meinem Inneren gefüllt wurde. Ab diesem Abend herrschte in mir vorrangig ein Gefühl. Sorge. Irgendwas stimmte nicht mit Amanda und mein Bauchgefühl sollte mich nicht im Stich lassen.
»Gut«, sagte Amanda, lächelte ein letztes Mal unter Tränen und wandte sich ohne ein weiteres Wort ab. Ich wollte ihr nacheilen, doch irgendwer musste die Rechnung für das Essen begleichen, das wir kaum angerührt hatten. Amanda verschwand eilig durch die Restauranttür, als würde sie vor etwas fliehen. Vor der Unterhaltung, mir oder den Dämonen, die sie schon den ganzen Abend beschäftigt hatten. Ich würde es niemals erfahren, denn die einzige Person, die es mir hätte sagen können, war nur zwei Wochen später tot, und ich wünschte mir nichts mehr, als dass ich Geld auf den Tisch geworfen hätte und ihr doch nach draußen gefolgt wäre.
Kapitel 2: Eliana
Zwei Wochen später
Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte, als ich einen Fuß in das dunkle Untergrundlokal setzte. Ich rechnete mit allem. Nackten Körpern, die sich aneinanderdrückten, Frauen, die mit gespreizten Schenkeln auf der Theke saßen und sich von fremden Männern befriedigen ließen, oder Männer mit Peitschen in der Hand, die auf die zarte Haut eines Rückens niederprasselten.
Aber nicht mit der Realität, die auf mich einstürmte, während ich die Treppe nach unten wanderte, die ins Pleasure and Pain und in den Hauptsaal führte. An den Wänden hingen Bilder, die verrieten, um welche Art von Club es sich hier handelte. Auf einem der schwarz-weißen Fotos war der Hintern einer Frau zu sehen, der gerade mit mehreren Rohrstöcken bearbeitet wurde. Auf einem anderen standen zwei Männer an je ein Andreaskreuz geschnallt. Sie waren beide nackt und streckten sich unzähligen Händen entgegen, von denen sie berührt wurden.
Abgesehen von den Bildern wirkte das Innere des Clubs auf den ersten Blick schrecklich alltäglich. Mehrere Gruppen hatten sich um die Bar platziert und hielten während ihrer Unterhaltung verschiedene Getränke in der Hand. Im Hintergrund spielte leise rhythmische Musik, zu der zwei Frauen in einer Ecke tanzten, und hinter der Theke stand ein attraktiv aussehender Mann, der sich bemühte allen Bestellungen gerecht zu werden. Selbst die Kleidung der meisten wäre angemessen für jeden anderen Club. Ich sah Kleider, schwarze eng anliegende Hosen, Hotpants, Röcke, Hemden, sogar Sakkos. Hier und da blitzte einmal eine nackte Gestalt durch den Raum oder eine der Frauen trug nichts außer ihrer Unterwäsche, aber alles in allem war es züchtiger als in meiner Vorstellung. Eine Nonne hätte dennoch drei Kreuze gemacht und wäre schreiend davongelaufen.
Zum Glück war ich jedoch keine, sodass ich das knutschende Paar im Eck einfach ignorierte und mir einen Weg durch die Menschenmengen bahnte. Mit meinem langen hellbraunen Mantel war ich trotz der lockeren Kleiderordnung overdressed. Es musste beinahe grotesk aussehen, als ich neben einem Mann in Jogginghose kurz zum Stehen kam, weil sich um die tanzenden Damen eine Traube gebildet hatte.
»Ich bin Detective Eliana Wright. Lassen Sie mich durch!«, rief ich lauthals und bemühte mich, weiter nach vorn zu kommen. An der Bar vorbei und durch den Hauptsaal zu einem Durchgang, der in einen weiteren Raum führte. Den roten Raum, wie Wilson ihn genannt hatte, was auch immer das zu bedeuten hatte.
Leider kam ich nur unendlich langsam voran. Wann immer jemand vor mir sich zur Seite bewegte, wurde die Lücke von jemand anderem gefüllt. Es war zermürbend. Dabei war ich schon zu spät dran. Ich war losgefahren, sobald ich die Nachricht einer Leiche im Pleasure and Pain gehört hatte, und ich hatte auf der Fahrt mehrfach versucht, Amanda zu erreichen, aber sie hatte sich nicht gemeldet. Wilson schon, der ihren Ausweis gefunden hatte, sodass ich vor dem Club geparkt und es nicht geschafft hatte, sofort auszusteigen. Keine Ahnung, wie lange ich einfach in meinem Wagen gesessen hatte, aber die Zeit hatte nicht gereicht, um zu realisieren, was geschehen war.
Amanda war tot. Sie war ermordet worden. In dem Club, den sie so sehr geliebt hatte. Wahrscheinlich von dem Mann, dem sie am allermeisten vertraut hatte.
In Minischritten kam ich vorwärts. Vorbei an diversen hölzernen Kübeln, in denen zur freien Entnahme verschiedene Schlaginstrumente steckten, und an spartanisch aussehenden Stehtischen, auf denen weitere Peitschen und Werkzeuge lagen, die ich nicht einmal benennen konnte. Gegen die kühlen Temperaturen draußen war es unangenehm heiß und stickig in dem Kellergewölbe, in dem ich noch kein einziges Fenster gesehen hatte. Das Atmen fiel mir schwer, doch irgendwie schaffte ich es schlussendlich zum Durchgang, ohne dabei zu ersticken.
In diesem Teil des Lokals waren weniger Menschen, aber für meinen Geschmack immer noch zu viele. Schaulustige hatten sich vor dem roten Raum versammelt und starrten auf den Tatort, als wäre er ein Gemälde, das es zu ergründen gab. Nur war der Erschaffer kein Künstler, der sich lange überlegt hatte, mit welchen Farben er eine Komposition schuf. Nein, der Verantwortliche dafür war ein gewissenloser Mörder, der das Leben meiner Freundin geraubt hatte. Aus welchem Grund auch immer.
»Ich bitte Sie, den Raum zu leeren und die Einsatzkräfte durchzulassen«, verlangte ich, quetschte mich durch die Menge und blendete dabei den Geruch nach Alkohol und Schweiß aus, der mir tief in die Nase kroch. Das war allerdings besser als der beißende Gestank des Todes, der sonst an vielen Tatorten zu vernehmen war.
Amanda konnte noch nicht sehr lange tot sein. Noch lag keine Spur von Verwesung in der Luft. Nur viel zu teures Parfüm und der Duft nach aufgestauten Hormonen.
Ich ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen und sofort wurde mir klar, wieso dieser Bereich als der rote Raum bezeichnet wurde. Alles war in einem hellen Rot gehalten. Von der ledernen Couch bis zum künstlichen Licht, das auf den Körper hinunterschien, der bewegungslos in roten Seilen hing.
Ich schluckte schwer und riss die Augen auf. Mein Sichtfeld wurde größer, gleichzeitig wünschte ich, ich würde erblinden. Zwar hatte Wilson mir zusammengefasst, in welchem Zustand Amanda aufgefunden worden war, aber es zu sehen ... Ich hatte es mir leichter vorgestellt. Viel leichter. Als wäre es nur eine Leiche von vielen, die ich im Zuge meiner Arbeit gesehen hatte.
Schmerzhaft fest biss ich mir auf die Zunge, während sich der ganze Schrecken vor mir ausbreitete. Amandas violette Haare hingen ihr ins Gesicht. Sie sahen strähnig aus, als wären sie seit Tagen nicht gewaschen worden, und sie verdeckten zum Teil ihre geöffneten Augen, die mir leer entgegensahen. Farblos. Das Braun darin war verschwunden und einem milchigen Weiß gewichen, das nahezu perfekt zu ihrem leichenblassen Teint passte.
Ihr schwarzes Kleid war am Saum zerrissen und hing an ihrem Körper hinab. Es war gerade lang genug, um den Ansatz ihrer Schenkel zu verhüllen. Der Stoff war ihr allerdings von der Schulter gerutscht und gab ihre linke Brust frei. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, das Kleid zurechtzuzupfen.
Nein, das war falsch. Niemand von uns durfte das tun. Es würde Beweise vernichten. Und doch drängte irgendwas in mir, zu Amanda zu eilen und sie vor den Blicken zu beschützen, die pausenlos auf sie gerichtet waren, als erwarteten die Umstehenden, sie würde gleich zu lachen beginnen und aufstehen, als wäre sie nicht tot.
Eine Blutspur verlief über ihren rechten Unterschenkel. Sie war bereits angetrocknet, aber die Pfütze unter Amanda verriet, dass es zuvor auf den Boden getropft war. Ihre Arme waren ausgestreckt. Seile waren um ihre Handgelenke gewickelt und durch zwei Ösen an der Decke befestigt worden. Sie hatte sich also nicht bewegen können, als sie starb. Als ihr Mörder ihr ein weiteres Seil um den Körper gelegt hatte. Um den Hals. Das harte Material fraß sich an dieser Stelle in ihre Haut. Hämatome hatten sich um die strangulierte Stelle gebildet.
Es sah schmerzhaft aus, auch wenn der rational denkende Teil meines Gehirns wusste, dass Tote keine Schmerzen mehr hatten, zog sich mein Magen zusammen. Denn Amanda hatte bestimmt die Hölle durchlebt, während sie hilflos in den Seilen hing und wegen des Knebels in ihrem Mund nicht schreien konnte.
»Eliana? Sollen wir sie losbinden?« Wilson tauchte neben mir auf. Er hatte den Rest des Absperrbandes in der Hand und sicherte so gut wie möglich den Bereich. Dennoch würde es unmöglich werden, den Täter anhand von Fingerabdrücken oder DNA-Spuren zu finden. Der Club desinfizierte bestimmt gewissenhaft alle Stellen alle paar Stunden, wie es laut Vorschriften für solche Etablissements üblich war, doch hier waren so viele Menschen, die alles anfassten, dass auch nach den wenigen Stunden alles kontaminiert war und jeder von ihnen ein Verdächtiger wäre. Aber vielleicht hatten wir Glück und wir würden an Amanda selbst Spuren ihres Mörders finden.
»Eli, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir vor Gericht geglaubt wird, wenn jemand gegen meinen Willen BDSM-Praktiken an mir vollzieht, obwohl ich in meinem Sexualleben solche ... Dinge ... gern mag?« Amandas Worte kamen mir wieder in den Sinn. War sie in Gefahr gewesen? Hatte sie gewusst, dass jemand hinter ihr her war? Ihren Tod wollte? Vielleicht. Aber ich hatte es nicht ernst genommen, genau wie es die Geschworenen vor Gericht getan hätten.
Jetzt war sie allerdings tot und jeder würde ihr glauben, dass sie das nicht gewollt hatte. Niemand wollte sterben. Nicht zum Vergnügen.
Ich schloss gepeinigt die Augen. Ich hätte ihr besser zuhören, eine bessere Freundin sein müssen. Doch das war ich nicht gewesen. Hätte ich sie retten können? Wenn ich sie bestärkt hätte und mit ihr zur Polizei gegangen wäre? Ich wollte es nicht wissen. Bereits jetzt befürchtete ich, mein Gesicht nie wieder im Spiegel ansehen zu können, ohne Amanda vor Augen zu haben. Das konnte ich nicht mehr ändern, aber ich konnte dafür sorgen, dass sie zumindest Gerechtigkeit erfuhr.
»Macht zuerst Bilder von ihrer Position und wartet darauf, dass Skylar entscheidet, wann wir sie herunterholen können, Wilson. Vorher will ich nicht, dass sie bewegt wird. Sobald wir den Mörder finden, möchte ich eine klare Verurteilung und nicht vor Gericht streiten müssen, weil irgendwo während der Untersuchung ein Formfehler geschehen ist.«
Ich wollte, dass Amandas Mörder für immer im Gefängnis saß und sich daran erinnern musste, was er getan hatte, während er graue Zellenwände anstarrte. Das wäre immer noch zu wenig Bestrafung, doch es würde reichen müssen. Es war alles, was ich noch für meine Freundin tun konnte.
»Verstanden.« Wilson nickte stoisch. Dabei entging mir nicht, dass er es vermied, in Amandas Richtung zu sehen. Er war schon seit Jahren bei der Polizei und es war nicht unser erster gemeinsamer Fall. Bisher hatte ihm kein Mord etwas ausgemacht, doch Amandas Anblick schien sogar an ihm nicht spurlos vorbeizugehen.
Der Mord war nicht besonders brutal oder sehr blutig, doch sie war eines der jüngsten Opfer meiner Karriere, und die Geschichte hinter ihrem Tod war grotesker als alles, was mir je untergekommen war. Sie hatte genau das geliebt. Sich fallen zu lassen und die Kontrolle abzugeben, jemandem vertrauen zu können. War das Schicksal tatsächlich so grausam, das Beste in ihrem Leben in das Schlimmste zu verwandeln? Offensichtlich.
Im Hintergrund ertönte ein Schluchzen, und ich war im ersten Moment nur erleichtert, dass es nicht von mir kam, ehe die Verärgerung einsetzte, weil es sich immer noch ein paar Gäste im Durchgang bequem gemacht hatten und uns bei der Arbeit zusahen. Hatten diese Menschen irgendwo auch nur einen Funken Respekt in ihrem Körper?
»Ich sagte, Sie sollen den Raum leeren, meine Damen und Herren«, wiederholte ich und war stolz, dass ich streng und professionell klang, obwohl eine unangenehme Enge in meinem Brustkorb herrschte und Tränen sich ihren Weg an die Oberfläche bahnten. Ich hatte gedacht, sie im Auto mit Erfolg zurückgedrängt zu haben, doch ich hatte mich wohl geirrt. Sie stiegen mir in die Augen und ich blinzelte sie tapfer weg.
»Sie können nicht den gesamten Bereich sperren«, rief eine herrische Stimme und ließ mich zusammenzucken, weil ich nicht mit Gegenwehr gerechnet hatte. Die Marke an meinem Gürtel reichte für gewöhnlich, dass man meinen Worten Folge leistete. Überall, nur nicht im Pleasure and Pain.
Die Masse teilte sich und machte so einer hochgewachsenen Frau mit dunklen Haaren Platz, die mit erhobenem Kopf auf mich zu stolzierte. Ihre schwarzen Strähnen umrahmten ihr aristokratisches Gesicht, das farblich Amandas Leiche Konkurrenz machte und einen starken Kontrast zu dem pechschwarzen Lippenstift bildete, der ihren Mund zierte.
»Wir versuchen, hier zu ermitteln.« Nervös verlagerte ich mein Gewicht von einem Bein auf das andere und besah die Schönheit genauer. Sie trug ein dunkles Kleid, das genauso lang war wie Amandas, als hätten sie sich abgesprochen. Der Stoff klebte an ihr wie eine zweite Haut und bewegte sich fließend bei jedem Schritt mit.
»Und ich versuche, ein Etablissement zu leiten«, antwortete sie kühl und hielt wenige Meter von mir entfernt an. Ein seltsames Glitzern lag in ihren grünen Augen, doch ihre Stimme klang ausdruckslos. Monoton. Viel zu abgeklärt für eine Zivilperson, die im gleichen Raum mit einer Leiche war.
Entweder hatte sie kein Herz, war eine Psychopathin oder sie hatte im Leben schon so Schlimmes erlebt, dass eine tote Frau kein Schock mehr für sie war. Vielleicht auch alles davon oder jegliche Kombinationsmöglichkeit.
»Ich habe Verständnis für ihre Verärgerung und die Unannehmlichkeiten, die ihnen durch diesen Mord bereitet werden. Seien Sie versichert, dass es auch für uns kein Vergnügen ist, Miss ...« Fragend hob ich eine Augenbraue und widerstand dem Drang, ihr ins Gesicht zu sagen, dass ich in Wirklichkeit absolut kein Verständnis hatte. Hier war jemand gestorben, verdammt! Wieso sollte es mich kümmern, dass der Club einen Abend lang keinen Umsatz machte? Am liebsten würde ich alle Menschen nach Hause schicken, doch davor mussten sie befragt werden – jeder einzelne von ihnen. Denn eines war klar: Einer von ihnen hatte Amanda umgebracht.
»Marshall. Eileen Marshall. Ich bin Teilhaberin des Pleasure and Pains.« Eileen stemmte die Hände in die Hüften und trat einen Schritt auf mich zu. Ihre schwarzen, hochhakigen Stiefel, die bis über ihre Knie reichten, quietschten dabei leicht auf dem glatten Untergrund. Das Schuhwerk konnte unter keinen Umständen bequem sein, dennoch trug Eileen es, als wären die Schuhe einfach ein Teil ihres Körpers. Es sah auch so aus, als wären sie genau das. Eileens Outfit war ungewöhnlich, doch es kleidete sie perfekt und ließ sie wie eine verfluchte Göttin in Schwarz aussehen.
Ich seufzte. Natürlich. Die Familie Marshall bestand aus drei Brüdern – Miles, Elijah und Aiden – und einer Schwester. Der Vater lebte noch, hatte allerdings keinen Kontakt zu den Kindern, die sich ganz allein ein Imperium in der BDSM-Szene aufgebaut hatten. Der jüngste der Brüder hatte allerdings immer wieder Probleme mit den Behörden und wurde schon mehrfach wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Irgendwo in meinem Wagen lag eine Akte mit weiteren Informationen über die Familie, doch ich hatte mir nicht die Zeit genommen, sie ausführlich zu studieren.
Ein Fehler, wie mir jetzt klar wurde. Ich hatte gedacht, alle würden ein Interesse daran haben, uns bei der Lösung des Falles behilflich zu sein. Ich hatte einfach angenommen, dass allen etwas an Amanda gelegen hatte, immerhin war sie seit Jahren hier angestellt. Doch ich hatte mich anscheinend geirrt. Eileen wollte mich nicht hier haben, auch wenn ich noch nicht sagen konnte, wieso. Hatte sie etwas mit dem Tod von Amanda zu tun? Vielleicht. Ich würde es herausfinden, doch zuvor wollte ich endlich Amandas Leiche hier wegschaffen.
»Es wäre vorteilhaft, wenn Sie mit uns kooperieren würden.« Ich formulierte es als Tatsache, aber die unausgesprochene Frage nach ihrer Hilfe schwang in meinen Worten mit. Ob sie nun in den Fall verstrickt war oder nicht, ohne ihre Unterstützung würde es schwer werden, an Informationen zu kommen. Wenn die Leitungsebene die Aussage verweigerte, würden das Personal und auch die Gäste aus Loyalität diesem Beispiel folgen.
Ob es mir gefiel oder nicht, Eileen kannte die Menschen in diesem Club und ich nicht. Sollte sie sich jedoch weigern, könnte ich ihr Verhalten immer noch als Behinderung der Justiz auslegen und ihr unterstellen, die Hauptverdächtige zu sein – was sie allerdings nicht war. Nein, ich hatte eine Ahnung, wer Amanda das angetan hatte, und bisher hatte ich ihn noch nicht gesehen. Seine Freundin war gestorben. Jeremy sollte hier sein und um sie trauern, aber von ihm fehlte jede Spur.
Eileen räusperte sich. Sie lehnte sich ein Stück nach vorn, als hätte sie Schwierigkeiten, mich zu sehen, und runzelte die Stirn, während ihr Blick über mich glitt. Sie starrte mich an. Irgendwas an meiner Erscheinung schien sie zu stören, doch sie sagte nichts dazu. Nicht, dass ihre nächsten Worte deshalb wesentlich besser waren. »Das tun wir bereits. Wir haben Sie gerufen, statt die Leiche abzunehmen und einfach auf den Bürgersteig vor den Club zu legen. Damit sind wir Ihnen schon entgegengekommen.«
Entgegengekommen? War das ihr Ernst? Sie sprach gerade von einer Straftat! Einen Tatort zu verunreinigen war gesetzlich verboten. War ihr das klar? Vermutlich. Es war ihr nur egal. Genauso wie die Tatsache, dass sie mit einer Kriminalbeamtin sprach. Ihre stolze Haltung, das erhobene Kinn und ihr abschätziger Blick verrieten, dass sie keinen Respekt vor mir oder meiner Arbeit hatte.
Je länger ich im Pleasure and Pain
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: